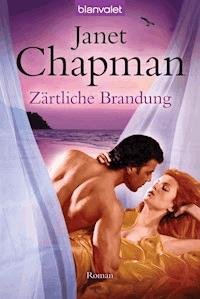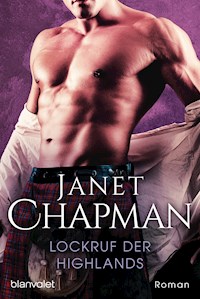5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Highlander-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe, die die Grenzen von Zeit und Raum sprengt – von Schottland bis nach Maine!
Die attraktive Ärztin Libby Hart stürzt mit ihrem Auto in einen Weiher. Gerettet wird sie von Michael MacBain, einem schönen, starken Highlander – der aus dem Mittelalter in die heutige Zeit katapultiert wurde. Zutiefst verletzt, hat Michael den Frauen abgeschworen. Aber Libby entfacht eine Sehnsucht in ihm, der er nicht widerstehen kann. Und auch sie fühlt sich von dem stolzen Krieger magisch angezogen …
Die »Highlander«-Reihe:
Band 1: Das Herz des Highlanders
Band 2: Mit der Liebe eines Highlanders
Band 3: Der Ring des Highlanders
Band 4: Der Traum des Highlanders
Band 5: Küss niemals einen Highlander
Band 6: In den Armen des Schotten
Band 7: Lockruf der Highlands
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Die attraktive Ärztin Libby Hart stürzt mit ihrem Auto in einen Weiher. Gerettet wird sie von Michael MacBain, einem schönen, starken Highlander – der aus dem Mittelalter in die heutige Zeit katapultiert wurde. Zutiefst verletzt, hat Michael den Frauen abgeschworen. Aber Libby entfacht eine Sehnsucht in ihm, der er nicht widerstehen kann. Und auch sie fühlt sich von dem stolzen Krieger magisch angezogen …
Autorin
Janet Chapman ist das jüngste von fünf Kindern. Schon immer hat sie sich Geschichten ausgedacht, aber erst mit ihrem ersten Roman »Das Herz des Highlanders« begann die Gewinnerin mehrerer Preise, professionell zu schreiben. Janet Chapman lebt mit ihrem Mann, ihren zwei Söhnen, drei Katzen und einem jungen Elchbullen, der sie regelmäßig besucht, in Maine.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.instagram.com/blanvalet.verlag
Janet Chapman
Der Ring des Highlanders
Roman
Deutsch von Anke Koerten
blanvalet
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Wedding the Highlander« bei Pocket Books, a divison of Simon & Schuster, Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright dieser Ausgabe © 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Copyright der Originalausgabe © 2003 by Janet Chapman Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2008 by Blanvalet Verlag,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Book Cover Photos; Rudy Bagozzi) LH · Herstellung: sam Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-12206-5 V003
www.blanvalet.de
1
Pine Creek, Maine, 22. Oktober
Sein eigener Schrei weckte ihn, als es ihn durch die schaurige Leere schleuderte, und unter Verrenkungen schlug er wild um sich, um etwas Festes zu finden, das ihm Halt bieten konnte. Doch um ihn war nur blendend weißes Licht und die entsetzliche Erkenntnis, dass er keine Gewalt über sein Schicksal hatte.
Michael McBain schlug die Augen auf, rührte sich nicht und lauschte der Stille, die nur durch seine eigenen erregten Atemzüge unterbrochen wurde. Langsam setzt er sich auf, wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht, ehe er seine Beine vom Laken befreite, die Decke zurückschlug und aufstand. Er ging zum Fenster, öffnete es, sog die frische Oktoberluft langsam und in kontrollierten Zügen ein und ließ sie beim Ausatmen über seine bebenden Muskeln streichen.
Ganze zwei Minuten mussten vergehen, bis sein Herz sich schließlich beruhigte und seine Gedanken sich klärten. Michael seufzte in die Nacht hinein. Die Welt war in Ordnung, entschied er, in die Dunkelheit starrend; die in Mondlicht getauchten Berge warfen noch immer ihre Schatten auf seine Farm, die Sterne schienen vom Firmament, sein Haus strahlte Frieden aus. Sein Sohn Robbie lag sicher in seinem Bett, und unten im Erdgeschoss schlief John.
Noch einmal rieb Michael sich erschöpft über sein Gesicht. Die Träume wurden immer detaillierter. Und kamen häufiger.
Sie setzten mit Maura ein – mit ihrer Beerdigung. Im Traum sah Michael sich immer an der Hügelflanke kauern, vor den MacKeages verborgen. Er beobachtete sie, wie sie seine Frau jenseits des Zaunes begruben, der die Sünder von den Gerechten schied.
Ian MacKeage bestattete seine Tochter in ungeweihtem Boden. Und als man Maura mit unheiliger Erde bedeckte und der Traum seinen Fortgang nahm, erlebte Michael wieder die Wut und das Gefühl völliger Hilflosigkeit, die er an jenem Tag verspürt hatte.
Sie hatte sich nicht selbst das Leben genommen – sie hatte sich im Schneesturm auf das brüchige Eis des loc verirrt. Sie war auf dem Weg zu ihm, war von ihrem Clan davongelaufen, um zu heiraten, damit ihr Kind mit dem Segen der Kirche zur Welt kommen konnte.
Und von da an änderte sich der Traum, und er durchlebte die Konfrontation mit Ian MacKeage an jenem Schicksalstag vor achthundert Jahren. Ians heftige Vorwürfe hatten Michaels Kummer noch vertieft. Er war fortgegangen, unfähig, sich vor Mauras Vater zu rechtfertigen.
Ja, damals hatte er sich entschieden, in den Krieg zu ziehen.
An diesem Punkt wechselte der Traum immer rasch zu einem gleann unweit der Burg der MacKeages. Greylen, Ian, Morgan und Callum MacKeage befanden sich auf dem Rückweg von Verhandlungen mit den MacDonalds, befriedigt, weil sie es geschafft hatten, sich der Hilfe des anderen Clans gegen die MacBains zu versichern.
So war es gekommen, dass Michael und seine fünf Krieger einen Angriff gewagt hatten – und hier verwandelte sich sein Traum in einen so fürchterlichen Albtraum, dass einem Krieger das Blut in den Adern stockte.
Das Unwetter hatte sie ohne Vorwarnung überfallen. Die Kampfgeräusche wurden zu einem irren Getöse schreiender Männer, verängstigt wiehernder Pferde und ohrenbetäubender Donnerschläge. Als Erstes erhob sich ein peitschender Wind, der vom Himmel herabfuhr, Bäume entwurzelte und Staub aufwirbeln ließ, der ihre Kehlen verstopfte. Blitze zuckten, Regen setzte ein und prasselte erbarmungslos auf sie nieder. Das Letzte, was Michael in Erinnerung blieb, war ein kleiner alter Mann auf der Felsklippe über ihnen, der dies alles voller Entsetzen mitansah.
Wenn er Glück hatte, erwachte er in diesem Moment, von seinen eigenen Schreckensschreien aus dem Albtraum gerissen. Er erwachte in seinem Bett, im einundzwanzigsten Jahrhundert und in Sicherheit, doch noch immer nicht imstande zu begreifen, wie zehn Männer und ihre Schlachtrösser achthundert Jahre vorwärts durch die Zeit katapultiert werden konnten.
Manchmal aber erwachte er nicht, und der Albtraum setzte sich fort und flachte zu einem weniger grausamen, wiewohl ebenso beunruhigenden Traum ab, in dem er am Tag der Sommersonnenwende vor acht Jahren auf dem Gipfel des TarStone Mountain stand.
In diesem Traum vertraute Michael die Asche von Mary Sutter, Robbies Mutter, einer sanften Brise an und sah zu, wie sie fortgeweht wurde. Er hielt ihren kleinen Sohn in den Armen, umgeben von den MacKeage-Kriegern, die sein Schicksal teilten, sowie von Marys Schwester Grace und Marys sechs Halbbrüdern. Auch Daar, der Priester war da – derselbe Mann, den er in dem Unwetter vor achthundert Jahren auf dem Felsvorsprung erblickt hatte.
Michael rieb sich die Brust und blickte zum TarStone Mountain. Daar war in Wirklichkeit ein Druide namens Pendaär, der jetzt auf halber Höhe des TarStone lebte, getarnt mit einem Priestergewand und einem harmlosen, nachbarschaftlichen Lächeln.
Auch die vier MacKeage-Krieger waren seine Nachbarn. Ihr uralter Zwist trat in Anbetracht der Notwendigkeit, in dieser modernen Zeit zu überleben, in den Hintergrund. Zudem knüpften die Blutsbande zu dem Achtjährigen, der nebenan schlief, sie inzwischen aneinander. Greylens Frau, Grace Sutter MacKeage, war Robbies Tante. Und für die Männer, den alten Druiden eingeschlossen, stand Robbies Glück an erster Stelle.
Michael starrte noch immer aus dem Fenster, doch galt seine Aufmerksamkeit jetzt den leisen Schritten, die den Raum betraten. Er wartete, bis Robbie sich auf ihn stürzen wollte, ehe er reagierte.
»Man sollte gut bewaffnet sein, mein Sohn«, sagte er leise und ohne sich umzudrehen. »Und auf die Folgen gefasst.«
Die Schritte hielten inne.
Michael blickte über seine Schulter und lächelte dem Jungen zu, der drei Schritte entfernt stand, die Hände auf den nackten Hüften, eine finstere Miene im Kindergesicht.
»Ein edler Krieger tritt einem Unbewaffneten nicht mit einer Waffe gegenüber«, konterte Robbie, offensichtlich beleidigt. Seine finstere Miene wich einem diabolischen Lächeln, als er die Hände hob und seine Finger spielen ließ. »Ich plante eine Kitzelattacke.«
Michael schloss das Fenster, hob seine Hose auf und schlüpfte hinein. Als er sein Hemd überzog, drehte er sich zu seinem Sohn um. »Was hältst du davon, wenn du dich stattdessen ebenfalls anziehst und wir den Gipfel erklimmen?«
»Jetzt?«, gab Robbie von sich, stützte die Hände wieder in die Hüften und sah auf die Uhr neben Michaels Bett. »Es ist doch erst zwei Uhr morgens.«
Auf der Suche nach Socken griff Michael in das oberste Schubfach seiner Kommode. »Wir schaffen es vielleicht bis zum Sonnenaufgang«, lockte er.
Robbie, der keinen Vorwand für ein Abenteuer brauchte, klatschte in die Hände. »Nehmen wir die Schwerter mit?«
Michael setzte sich auf die Bettkante und streifte die Socken über. »Ja, aber zieh dich warm an und bring die Rucksäcke mit, wenn du hinuntergehst. Ich mache indessen Proviant zurecht und hinterlasse für John eine Nachricht.«
Robbie war schon draußen und lief den Gang entlang, ehe Michael mit seinen Anweisungen fertig war. Michael stand auf und warf die Decke über die Matratze. Sie war noch feucht von seinem Schweiß.
Sein Aufschrei musste Robbie geweckt haben. Der für sein Alter viel zu kluge Junge wusste, dass sein Vater wieder von Träumen geplagt worden war, und hatte versuchen wollen, ihn mit einer Kitzelattacke abzulenken.
Michael starrte das zerwühlte Bett an. Es war das dritte Mal in den letzten sechs Wochen, dass ihn dieser Traum heimsuchte.
Nicht der Traum selbst war es, der ihn verstörte, vielmehr die zunehmende Häufigkeit. Michael ging zurück ans Fenster, stützte die Arme auf den oberen Teil des Schiebefensters und starrte zum TarStone. Waren die Träume Vorzeichen künftigen Geschehens? Der Albtraum erzählte seine Vergangenheit, nicht seine Zukunft.
Würde es eine Fortsetzung seines Traumes geben?
Wichtiger noch, besaß er diesmal Macht über den Ausgang der Ereignisse? Er hatte sich mittlerweile ein neues Leben geschaffen, und er hatte die Aufgabe, seinen Sohn ins Mannesalter zu geleiten. Nichts durfte sich zwischen ihn und Robbie drängen, kein Zauber und kein Zauberer.
»Komm jetzt, Papa. Ich bin schon angezogen, und du hast noch nichts eingepackt«, rief Robbie von der Tür her. »Ich möchte bei Sonnenaufgang auf dem Gipfel sein.«
Michael nahm seine Strickweste von der Stuhllehne und ging hinaus auf den Gang, seinen Sohn sacht vor sich herschubsend. »Laufen oder reiten wir?«, fragte er.
»Wir laufen«, gab Robbie zurück und sprang die Treppe hinunter, dass die leeren Rucksäcke gegen das Geländer schlugen. »Stomper ist schon zu alt, um in aller Herrgottsfrühe geweckt zu werden, und Feather ist zu faul.« Robbie blieb am Fuß der Treppe stehen, blickte zu Michael hoch und sagte leise, um John nicht zu wecken: »Ich habe keine Lust, mich mit diesem sturen Pony abzumühen. Außerdem mag es mein Schwert nicht. Es pikst wohl beim Reiten.«
»Wie wär’s mit dem Quad?«, fragte Michael ebenso leise.
Robbie schüttelte den Kopf. »Das macht zu viel Krach. Man würde keine Nachttiere sehen.«
Michael versetzte seinem Sohn einen Schubs in Richtung Küche. »Du schreibst die Nachricht für John und packst die Rucksäcke. Ich hole unsere Schwerter.«
»Darf ich Roberts Schwert nehmen?«, fragte Robbie.
Michael zog eine Braue in die Höhe. »Deine Kräfte reichen nicht aus, um dich mit Feather abzukämpfen, und doch traust du dir zu, den Gipfel des TarStone zu erreichen und Roberts Schwert mitzuschleppen?«
Der Junge überlegte angestrengt, um dann bedächtig den Kopf zu schütteln. »Stimmt. Es ist zu schwer.« Plötzlich hellte sich seine Miene auf. »Du könntest ja beide tragen.«
Nach einem weiteren Schubs, um ihn in Bewegung zu setzen, drehte Michael sich um und ging zur Bibliothek. »Nein, mein Sohn. Ein Krieger trägt seine Waffe selbst«, sagte er über die Schulter.
Michael betrat die Bibliothek und blieb vor dem Kamin stehen, um die drei über der Feuerstelle hängenden Schwerter zu betrachten. Zwei davon waren so lang wie der Kamin breit. Sie flankierten ein kleineres, für eine viel jüngere Hand geschaffenes Schwert. Er streckte die Hand aus und nahm Robbies Waffe von der Wand. Als er mit einem Finger die glatte Länge der Klinge entlangstrich, spürte er, wie fein ausbalanciert sie war.
Er hatte das Schwert eigens für Robbie anfertigen lassen, als Geschenk zu seinem vierten Geburtstag. Robbies Tante Grace hatte mit Entsetzten reagiert, die MacKeage-Männer aber waren gebührend beeindruckt gewesen. Bis auf Greylen. Laird MacKeages Miene hatte einen sehnsüchtigen, fast schmerzlichen Ausdruck angenommen, als er mit der kleinen Waffe in der Hand seine drei kleinen Töchter ins Auge fasste.
Robbie hatte sein Schwert sofort Donnerer genannt, eine ungefähre Übersetzung des Namens, den Michael seiner eigenen Waffe gegeben hatte, und war hinausgelaufen, um mit der Klinge auf das Buschwerk einzuhauen. Seither hatte Michael Robbie stolz in kriegerischen Fertigkeiten unterwiesen.
Das Schwert zu handhaben, war nur ein kleiner Teil der Lektionen, für Robbie aber der schönste. Der begabte Junge bewies, dass er nicht nur seinen Verstand, sondern auch seine rasch wachsende Muskelkraft beherrschte. Sein jugendliches Selbstvertrauen und seine Intelligenz trugen dazu bei, dass Robbie auf dem besten Weg war, zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit heranzuwachsen.
Dennoch war Michael nicht völlig sorglos, was seinen Sohn anging. Auch traute er seinem neuen Leben und der neuen Umgebung nicht, auch nicht nach zwölf Jahren, da er aus Erfahrung wusste, wie rasch sich alles ändern konnte. Aus diesem Grund übte Michael sich, was seine Person betraf, in strikter Zurückhaltung. Er blieb meist für sich und bewirtschaftete seine Christbaumfarm mit starker und umsichtiger Hand. Zu den Leuten in Pine Creek hielt er freundlich und wachsam Distanz, kümmerte sich jedoch rührend um den alten John Bigelow, den Vorbesitzer der Farm, dem er half, über den Verlust seiner Frau nach siebenundfünfzig Ehejahren hinwegzukommen.
Die verstorbene Ellen fehlte ihnen allen, ganz besonders Robbie, für den sie eine Art Ersatzgroßmutter gewesen war. Seit Ellens Tod vor zwei Monaten kamen die drei nur schwer mit ihrem Junggesellenleben zurecht. Michael würde wohl oder übel eine Haushälterin einstellen müssen, wenn sie sich die Mägen nicht weiterhin mit angebrannten Mahlzeiten verderben wollten.
Michael griff nach Tàirneanaiche, umfasste mit der Faust den Schwertgriff und nahm die Waffe von der Wand. Er schloss die Augen und spürte das vertraute Gewicht der Waffe. Die letzten zwölf Jahre hatte er sich ohne sein Schwert auf dem Rücken nackt gefühlt, und inzwischen brachte er seine Zeit damit zu, die Klinge vom Staub statt vom Blut seiner Feinde zu säubern.
Er blickte erneut zu der Wand über dem Kamin auf, an der Robert MacBains Schwert hing. Der alte Kämpfer hatte sich nicht an das einundzwanzigste Jahrhundert gewöhnen können und war in der Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat hinter Gewittern hergejagt.
Bei der Erinnerung an den Tod seines alten Freundes im Norden des Hochlands von Neuschottland vor zehn Jahren umfasste Michael Tàirneanaiche fester. Nur sie beide waren von der ursprünglich aus sechs Mann bestehenden Rotte übrig geblieben. Robert war auf der Stelle tot gewesen, als der Blitz in sein Schwert und in seinen Körper fuhr. Er hatte es nicht bis nach Hause geschafft, und Michael konnte nur hoffen, dass der alte Krieger endlich seinen Frieden gefunden hatte.
»Papa, du bist heute in merkwürdiger Stimmung«, sagte Robbie von der Tür her. »Tante Grace sagt, ich soll darüber reden, wenn mir etwas Sorgen macht. Reden macht alles leichter.« Er trat ein, seinen prall gepackten Rucksack auf dem Rücken, und sah mit besorgten grauen Augen zu Michael auf. »Du könntest mir von deinem Traum erzählen, das hilft vielleicht.«
Michael legte sein Schwert auf den Polstersessel und steckte Robbies Schwert in die an seinen Rucksack angenähte Scheide, wobei er darauf achtete, dass der Griff ihn beim Gehen nicht behindern konnte. Er strich Robbie übers Haar und hob lächelnd das Kinn des Jungen an.
»Ich träumte, ich stünde auf dem TarStone und hielte dich in den Armen, während wir vor acht Jahren deiner Mutter Lebewohl sagten«, erklärte er. Die halbe Wahrheit war seiner Meinung nach immer noch besser als eine Lüge. »Sicher war die geplante Bergwanderung der Grund dafür, dass ich von Mary geträumt habe.«
Robbie schlang die Arme um Michaels Mitte und drückte ihn fest an sich. »Wir müssen ja nicht gehen, Papa.«
»Doch, wir gehen«, sagte Michael leise und erwiderte die Umarmung. »Wir beide sollten Marys Lieblingsplatz aufsuchen.«
»Nein, Papa.« Robbie trat zurück und blickte zu Michael auf. »Mamas Lieblingsplatz war in deinen Armen.«
Michael, der das Gefühl hatte, ein Vorschlaghammer wäre auf seiner Brust gelandet, drückte Robbie an sich, damit der Junge nicht sehen konnte, wie sehr ihn dessen Worte getroffen hatten.
»Kannst du ein Geheimnis für dich behalten, Papa?«, fragte Robbie in sein Hemd hinein.
»Ja.«
»Ich habe ein neues Lieblingstier.«
»Was für eins?«
»Eine Schneeeule.«
Michael sah seinen Sohn an und zog eine Braue hoch. »Und seit wann hast du dieses gefährliche Tier schon?«
»Sie kam im Januar, an meinem Geburtstag zu mir.«
»Sie?«
Robbie, dem Michaels Besorgnis entging, nickte. »Ich nenne sie Mary«, flüsterte er.
Wieder traf ihn der Vorschlaghammer, diesmal so heftig, dass es ihn fast umwarf. »Mary? Du hast ein Tier nach deiner Mutter benannt?«
»Ja.« Robbie nickte. »Ich wünschte mir zum Geburtstag ganz fest meine Mutter und bekam stattdessen die Eule. Deshalb habe ich sie Mary getauft.«
Michael trat beiseite und griff nach seinem Schwert. Langsam versuchte er diese Neuigkeit zu verdauen und sich in die Fantasie eines Achtjährigen einzufühlen.
»Warum habe ich diese Eule nie gesehen?«, fragte er und sah Robbie wieder an. »Wo triffst du dich mit deiner Freundin?«
Robbie zeigte aus dem Ostfenster der Bibliothek. »Dort. Auf dem TarStone. Wenn ich auf meinem Pony reite, fliegt sie mir gern nach.« Jetzt war sein Geheimnis gelüftet, und Robbie überschlug sich beinahe, um die ganze Geschichte loszuwerden. »Sie gleitet mit leisen Flügelschlägen wie der Wind durch den Wald, Papa. Und sie ist eine gute Jägerin. Die Hasen, die sie schlägt, teilt sie mit mir.« Robbie verzog sein Gesicht. »Aber Mary frisst die Hasen nicht, auch wenn ich sie brate.«
Michael wich einen Schritt zurück, mehr beeindruckt als besorgt. Seit Grace ihm vor achteinhalb Jahren seinen Sohn in die Arme gelegt hatte, hatten er und Robbie diese Wälder durchstreift, hatten gecampt, geangelt, gejagt und ihre Mahlzeiten über offenem Feuer zubereitet. Er hatte nicht gewusst, dass sein Sohn seit geraumer Zeit die Gewohnheit hatte, sich sein Essen selbst zu machen, und ebenso wenig, dass er sich eine Schneeeule als Haustier zugelegt hatte.
Michael schob Robbie zur Küche. »Hast du dein Messer dabei?«, fragte er. Auf das Thema Schneeeule wollte er sich erst ausführlicher einlassen, wenn sie unterwegs zum Gipfel waren.
Sein Sohn griff in die Tasche und zog ein Klappmesser heraus, das er Michael entgegenhielt. »Wann kann ich ein großes haben wie du?«, fragte er.
»Wenn ich der Meinung bin, dass du es haben solltest.«
»Ich könnte eines mit gerader Klinge haben und es in meinen Stiefel stecken, so wie du.«
»Nein, das kannst du nicht. Ein Klappmesser ist sicherer«, belehrte Michael ihn, griff in seine Tasche und zog sein eigenes Messer heraus. »Das in meinem Stiefel ist eine Waffe. Messer, die man in der Tasche trägt, sind Werkzeuge.«
»Und ein Krieger braucht nicht mal ein Messer, um in der Wildnis zu überleben«, leierte Robbie herunter und steckte sein Messer zurück in die Tasche, als sie durch die Küche hinaus auf die Veranda traten. »Papa, wirst du sterben?«
Michael schloss die Tür hinter ihnen leise und mit zitternder Hand, darauf bedacht, nicht zu zeigen, wie sehr Robbies unschuldige Fragen ihn beunruhigten. Er nahm seinen Rucksack auf den Rücken, rückte sein Schwert so zurecht, dass der Griff genau hinter der rechten Schulter lag, und ging die Stufen hinunter. Die Frage erstaunte ihn nicht. Seit Ellens Ableben hatte der Junge unablässig Fragen über den Tod gestellt, und Michael war allzu oft um eine Antwort verlegen gewesen.
»Ich werde sterben«, sagte er schließlich in gleichmütigem Ton. »Aber nicht heute. Und nicht morgen. Ich bin ein Krieger, Robbie, und es ist meine Pflicht, so lange zu leben, bis ich dich ins Mannesalter geleitet habe.«
»Werde ich ein Krieger sein, wenn ich erwachsen bin?«
Michael strebte forschen Schrittes voran. »Ja und nein«, gab er aufrichtig zurück. »Du wirst das Wissen und die Geschicklichkeit eines Kriegers und das Herz eines Highlanders haben, doch wirst du hier leben und mir helfen, die Christbaumfarm zu führen, wenn ich zu alt sein werde, um es allein zu schaffen.«
»Grampys Söhne sind aber nicht geblieben, um ihm zu helfen«, erwiderte Robbie und fiel neben ihm in Gleichschritt. »Aber ich werde dich nicht verlassen«, versprach er und fasste nach Michaels Hand, als er mit aufrichtigen grauen Augen zu ihm aufschaute. »Und ich werde nicht vor dir sterben.«
Michael nickte. »Richtig. Du wirst nicht vor mir sterben«, pflichtete er ihm mit belegter Stimme bei.
»Vielleicht … vielleicht solltest du dir noch ein paar Söhne anschaffen«, flüsterte Robbie. Er ließ Michaels Hand los und verschob die Tragriemen seines Rucksacks. Dann blickte er wieder auf. »Nur für den Fall, dass ich sterben sollte.«
»Das wird nicht geschehen«, sagte Michael unwirsch, blieb stehen und drehte Robbie so, dass er ihm gegenüberstand. »Und kleine Kinder holt man sich nicht aus der Luft. Ich bräuchte eine Frau, um diese Söhne zu bekommen.«
»Du hast mich ohne Frau bekommen.«
Michael runzelte die Stirn. Wie nur war ihr Gespräch von Tod auf Sex umgeschwenkt? »Ich wollte deine Mutter heiraten«, erklärte er. »Und wenn sie am Leben geblieben wäre, hätten wir vermutlich mehr Kinder gehabt. Aber manchmal stellt sich das Leben unseren Plänen entgegen.«
»Warum suchst du dir nicht eine andere Frau zum Heiraten?«
Michael setzte sich wieder in Bewegung und bahnte sich seinen Weg durch die Reihen von Christbäumen, bis sie den Wald erreichten. »Man entschließt sich nicht zur Heirat und nimmt dann die erstbeste Frau. Ein Mann und eine Frau müssen sich lieben.«
»Wie Tante Grace und Onkel Gray.«
»Ja«, sagte Michael leise. »Wie Grace und Gray. Und Callum und Charlotte und Morgan und Sadie. Es muss erst eine Bindung da sein, aus der sich Liebe entwickelt.«
»Aber du kannst keine Bindung zu einer Frau haben, wenn du es nie versuchst.« Robbie blickte auf, und aus seinen Augen blitzte im Mondschein der Schalk eines Jungen, der glaubt, eine Mission zu haben. »Und weil Gram Ellen nicht mehr lebt, ist es meine Pflicht, für sie zu sprechen. Und sie sagt, dass du dich verabreden und ausgehen solltest.«
»Und meine Antwort ist die, die ich Ellen acht Jahre lang gab. Ich möchte keine Frau.«
»Weil du an gebrochenem Herzen leidest, Papa. Aber Gram Ellen sagte immer, dass die richtige Frau dich davon heilen könnte.« Robbie trat über einen Baumstamm, der den Weg versperrte, drehte sich um und ging rückwärts, als er fortfuhr: »Und ich kann dir dabei helfen.«
»Wie?«, fragte Michael mit schwindender Geduld. Er ging an seinem Sohn vorüber und übernahm die Führung. Es sah aus, als hätte diese immer wieder aufflammende Diskussion mit Ellen Bigelows Tod nicht ihr Ende gefunden, da sein Sohn offenbar entschlossen war, für sie in die Bresche zu springen.
Gemeinsam mit Grace MacKeage. Wieso war es für Frauen unerträglich, wenn ein Mann allein blieb?
»Ich habe schon angefangen, Papa.«
»Wie bitte?«, fragte Michael. »Hat das etwas damit zu tun, dass du vergangenen Monat so viel in Gu Bráth bei Grace warst?«
»Ja. Tante Grace hat mir geholfen, eine Anzeige ins Internet zu stellen.«
Michael blieb stehen. »Was für eine Anzeige?«, fragte er, den Blick unverwandt auf den vom Mond beschienenen Wald vor ihnen richtend, wobei er sich fragte, ob die Anzeige auf einer der für einsame Singles gedachten Websites gelandet war.
»Ein Mietangebot«, erläuterte Robbie. »Ich möchte mein Haus vermieten.«
Michael wusste nicht, ob er erleichtert lachen oder vor Überraschung aufstöhnen sollte. »Du möchtest das Haus deiner Mutter vermieten?«, fragte er leise und wandte seinem Sohn sein Gesicht zu. »Warum?«
»Weil es nicht leer stehen soll. Ein Haus sollte bewohnt werden.«
Michael vermeinte Graces Worte aus Robbies Mund zu hören. »Es wird bewohnt sein«, stieß er hervor. »Wenn du erwachsen bist und heiraten wirst.«
»Aber das dauert zu lange. Das Haus muss jetzt leben. Wenn ich dort hingehe, ist es schrecklich still, Papa. Und einsam. Das Haus muss fühlen, dass es gebraucht wird.«
Michael drehte sich um und ging weiter, mit so großen Schritten, dass Robbie laufen musste, um mithalten zu können. »Es ist ein Haus, mein Sohn, erbaut aus Holz, Glas und Stein. Es hat keine Gefühle.«
Robbie zupfte an Michaels Rucksack, um ihn zum langsameren Gehen zu veranlassen. »Es hat Gefühle, Papa. Wenn ich dort hingehe, spüre ich seine Einsamkeit.«
Michael sah mit zusammengekniffenen Augen den vor ihm liegenden Pfad entlang. »Erkläre mir, was die Vermietung des Hauses deiner Mutter damit zu tun hat, dass ich eine Frau suchen soll.«
»Weil ich es an eine ganz besondere Frau vermieten werde. Sie wird dein gebrochenes Herz heilen, ihr werdet heiraten, und ich werde eine neue Mutter und kleine Brüder bekommen.«
Michael blieb erneut stehen. Er nahm den Jungen bei den Schultern und ging in die Hocke, um mit ihm auf Augenhöhe zu sein.
»Man besorgt sich keine Frau im Internet«, sagte er leise. »Und auch keine Mutter. Wenn wir heute Abend zurückkommen, gehen wir zu Grace, damit sie die Anzeige löscht. Du wirst doch nicht wollen, dass Fremde das Haus deiner Mutter bewohnen.«
»Nein, Papa! Zu spät. Ich habe die Auswahl schon auf drei Frauen eingeengt.«
Michael schrie nicht, er brüllte. Er richtete sich auf, drehte sich um und machte sich auf den Rückweg. Verdammt! Tante oder nicht, Grace MacKeage hatte ihre Grenzen einmal mehr überschritten.
Robbie lief ihm nach und prallte auf seinen Vater, als Michael sich plötzlich duckte, um einem weißen Federwirbel auszuweichen. Die lautlose Annäherung der Eule ging in ein zorniges Pfeifen über, als der Vogel mit erhobenen Schwingen erneut auf sie losging.
Michael, der Robbie packte und sich mit ihm zu Boden warf, rollte weiter und zog seinen Sohn unter sich. Als die Eule auf einem drei Fuß entfernten Baumstamm landete, starrte Michael in die goldgelben Augen eines Raubvogels.
Eine Faust stieß ihn in die Rippen. Robbie kämpfte sich unter ihm hervor. »Mary!«, rief Robbie und kam zwischen der Eule und Michael auf die Knie. »Keine Angst, Papa. Mary tut uns nichts.«
Michael hatte die Frau seines Herzens vor fast neun Jahren verloren, und wenn er ihren Namen hörte, spürte er noch immer einen Stich im Herzen. Er setzte sich auf, zog Robbie auf seinen Schoß und starrte die schneeweiße Eule an.
Die Eule erwiderte das Starren mit riesigen Augen, die im Mondschein unverwandt auf ihn gerichtet waren. Aus ihrem leicht geöffneten Schnabel kamen hohe, rasselnde Laute, die sich wie Geplapper anhörten. Lange Fänge klammerten sich an den moosbedeckten Baumstamm. Als der zwei Fuß große Vogel beiseitetrat, um seine Schwingen zu einer eindrucksvollen Spannweite von nahezu fünf Fuß zu öffnen, schien es, als wollte er auf sich aufmerksam machen.
Ein gefährlicher, todbringender Raubvogel.
Und das Lieblingstier Robbies, das er nach seiner Mutter benannt hatte.
»Mary, lass das«, schalt Robbie die Eule. »Das ist mein Papa.«
Die Schneeeule ließ die Schwingen sinken und zog den Kopf ein. Ihr Geschnatter ging in ein leises Plaudern über.
»Ist sie nicht das hübscheste Ding, das man sich vorstellen kann, Papa?«
»Ja«, musste Michael ihm leise recht geben. Das war sie wirklich. Das glatte weiße Gefieder der Eule lief in festen schwarzen Enden aus, die wie ein zartes Spitzenmuster den ganzen Körper bedeckten. Ihr Gesicht war herzförmig und aus glattem Weiß, mit großen, kalten und gelben Augen, die von schwarzen, wie mit einem dicken Stift gezogenen Linien umgeben waren. Kräftige, mit weißen Daunen bedeckte Beine liefen in breite und scharfe Krallen aus.
Ein prächtiger Raubvogel.
»Schon gut, Papa. Mary hat dein Geschrei gehört und glaubte, ich wäre in Gefahr. Siehst du, jetzt ist sie ruhig«, sagte Robbie und streckte die Hand nach dem Vogel aus.
Michael fasste nach Robbies ausgestreckter Hand und drückte sie an den Körper des Jungen. »Hast du sie angefasst, Robbie? Wenn ihr zusammen seid, kommst du dann nahe … an Mary heran?«
»Ja, Papa. Sie setzt sich gern auf meine Schulter, wenn ich auf meinem Pony reite. Wenn ich pfeife, kommt sie zu mir.«
»Und sie hat dich nie mit ihren Klauen attackiert?«
»Nein, sie ist sehr vorsichtig.« Robbie stand auf und nahm seinen Rucksack auf den Rücken. »Komm, Papa. Mary möchte mit zum Gipfel. Sie kann uns bei der Entscheidung helfen.«
»Bei welcher Entscheidung?«
»An welche Frau ich das Haus vermieten soll.«
Michael strich sich übers Gesicht. Schon wieder das Thema Frauensuche. Als Kind seiner Mutter, die er nie gekannt hatte, konnte Robbie es wie sie mit einem Maulesel an Sturheit aufnehmen.
Michael stand auf und ging los, wieder auf den Gipfel des TarStone Mountain zu. »Dann gehen wir eben weiter«, zeigte er sich einverstanden. »Und bringen den Tag damit zu, darüber zu diskutieren, ob es nötig ist, dein Haus an eine Fremde zu vermieten.«
Die Schneeeule erhob sich in die Luft und glitt lautlos vor ihnen durch den Wald, als wüsste sie, welchem Ziel sie zustrebten. Michael atmete den Geruch des nächtlichen Waldes ein, während das Laub unter ihren Füßen raschelte. Es ging auf Ende Oktober zu, das Land bereitete sich auf den nächsten Winter vor – so wie er es auch bald tun musste. Ellen Bigelows Tod, der sie plötzlich, aber friedlich im Schlaf hatte sterben lassen, würde das bevorstehende Weihnachtsfest sicher schwierig gestalten.
Ellen war die treibende Kraft hinter der Christbaumfarm gewesen. Auch letztes Jahr noch hatte die dreiundachtzigjährige Frau die Männer mit ihrer Energie beschämt. Ellen hatte dreimal täglich unglaubliche Mahlzeiten aufgetischt, sie hatte Kränze gebunden, an die Kunden Sägen ausgegeben, damit diese sich ihre Bäume selbst fällen konnten, hatte Dekorationen verkauft, Apfelwein ausgeschenkt und allmorgendlich frisch gebackene Donuts verkauft. Und daneben war ihr noch Zeit geblieben, sich über den Kleinstadtklatsch auf dem Laufenden zu halten.
Michael, der vor zehn Jahren nach Pine Creek gekommen war und die Bigelow-Farm gekauft hatte, hatte die Frau zutiefst bewundert.
»Papa, stört es dich, dass mein Tier Mary heißt?«
»Nein, mein Sohn. Mary ist ein guter Name für ein so schönes Tier.«
»Aber es stört dich, dass ich mein Haus vermieten möchte.«
»Nicht so sehr dein Wunsch, das Haus bewohnt zu sehen«, erläuterte Michael. »Es ist vielmehr die Tatsache, dass du deine Hoffnungen darauf setzt, diese besondere Frau zu finden, die es mieten soll. Was ist, wenn sie sich als Enttäuschung entpuppt?«
»Das wird sie nicht«, erklärte Robbie mit aller Zuversicht eines Achtjährigen. »Ich werde bei der Auswahl sehr kritisch sein. Tante Grace hilft mir bei den E-Mails, die ich ihnen schicke.«
Michael schnaubte und gab damit seinem Sohn zu verstehen, was er von Graces Beitrag zu diesem verrückten Plan hielt. »Und wer wird der Hausherr deiner Mieterin sein? Was ist, wenn der Heißwasserkessel oder die Heizung den Geist aufgibt? Wirst du das alles reparieren?«
»Nein, Papa, das machst du.«
»Ich verstehe. Jede Wette, dass auch dies eine Idee deiner Tante ist.«
»Nein, meine.«
»Tja … dann solltest du zur Kenntnis nehmen, dass ich dich aufwecken und mitnehmen werde, wenn man mich um zwei Uhr morgens ins Haus ruft. Wenn du Hausherr sein willst, junger Mann, musst du die Verantwortung übernehmen.«
»Heißt das jetzt, dass ich Mamas Haus vermieten darf?«
»Solltest du nicht lieber eine Familie suchen, die es bewohnt? Und auf diese Weise neue Spielkameraden finden?«
»Ich brauche Spielkameraden längst nicht so dringend wie du eine Frau, Papa.« Robbie blieb stehen und blickte in Michaels Augen. »Sie wird dich zum Lächeln bringen.«
Michael zerzauste das Haar seines Sohnes und schob ihn dann weiter den Weg entlang. »Erzähl mir von den drei Frauen, die du gefunden hast.«
»Später, beim Frühstück. Aber von einer verrate ich dir schon mal etwas: Carla ist Witwe und hat drei Kinder.« Robbie drehte sich um und wackelte mit den Augenbrauen. »Sie muss nett sein, wenn ein Mann sie so liebte, dass er sie heiratete. Und von Carla hätten wir beide etwas. Du kriegst eine Frau und ich neue Freunde.«
»Und woher kommt Carla?«
»Aus Florida.«
Michael schnaubte wieder. »Und du hast keine Angst, dass sie unsere Winter nicht aushält?«
»Doch, habe ich.« Robbie verstummte minutenlang und ging weiter. »Vielleicht sollte ich Carla von der Liste streichen«, sagte er, ohne sich umzudrehen.
»Bleiben nur noch zwei. Was ist mit ihnen?«
»Es könnten inzwischen mehr sein«, konterte Robbie. »Ich konnte zwei Tage lang meine E-Mails nicht einsehen.«
E-Mails. Interneteinträge. Eine Mieterin auszusuchen, ehe man sie kennen gelernt hatte. In was für einer veränderten Welt wuchs sein Sohn heran, verglichen mit Michaels eigener Kindheit vor achthundert Jahren.
»Möchtest du morgen mit mir nach Gu Bràth gehen und meine E-Mails lesen?«, fragte Robbie, als er sich unter einem geneigten Ahornschössling duckte.
»Nein, Robbie. Diese Verrücktheiten überlasse ich dir und Grace. Ich muss mit Weihnachtsvorbereitungen anfangen und mich auf den Schnee einstellen, der bald kommen wird. Und ich muss John beschäftigen, um ihm über seinen Verlust hinwegzuhelfen.«
»Grampy wird doch nicht nach Hawaii zu seinem Sohn ziehen, oder?«, fragte Robbie.
2
Los Angeles, Kalifornien, 22. Oktober
Elizabeth Hart durchschritt den Eingang ihres Stadthauses und ließ ihren Aktenkoffer ohne Rücksicht auf den Inhalt aus der Hand gleiten. Mit der Hüfte schob sie die Tür zu, schleuderte die Schuhe von sich und ließ ihren Regenmantel auf den Boden fallen, als sie den Flur entlang zur Küche lief.
Wohin hatte sie nur die Flasche mit dem Scotch gestellt?
Elizabeth durchsuchte etliche Schränke und entdeckte die ungeöffnete Flasche schließlich im hintersten Winkel der Speisekammer. Sie nahm ein Glas aus der Spüle, öffnete den Kühlschrank und füllte das Glas mit Eis. Mit unsicherer Hand goss Elizabeth die goldene Flüssigkeit fast bis zum Rand. Sie nahm einen Schluck, hustete, als ihr die Luft wegblieb, und trug sodann Glas und Flasche ins Wohnzimmer.
Nur vom Schein der durch die Fenster einfallenden Straßenbeleuchtung geleitet, ging Elizabeth zur Couch und setzte sich. Sie stellte die Scotch-Flasche auf den Kaffeetisch und griff nach der Fernbedienung.
Zurückgelehnt nippte sie wieder am Glas, drückte auf die Fernbedienung und sah zu, wie die Flammen zwischen den perfekt angeordneten keramischen Holzscheiten aufloderten. Künstliche Glut glomm auf, und Elizabeth spitzte die Ohren … um nichts zu hören.
Bis auf ein leises Zischen der Zündung war das Feuer lautlos, geruchlos und sehr, sehr sauber.
Als sie das Stadthaus vor fünf Jahren gekauft hatte, war ihre Wahl nicht darauf gefallen, weil es so günstig zu ihrer Arbeitsstelle lag oder weil ihr die Architektur gefiel oder gar wegen der exklusiven Gegend. Sie hatte es gekauft, weil es einen Kamin besaß.
Nur war damals der Kamin mit Holz zu befeuern gewesen.
Dann hatten alle sie bearbeitet – ihre Mutter, ihr Vater und der Bursche, mit dem sie sich traf. Ob es Paul oder Greg gewesen war, daran konnte sie sich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Holzfeuer wären schmutzig, machten Arbeit und schlechte Luft, wurde ihr eingehämmert. Eine Gasheizung würde viel besser zu ihrem Lebensstil passen.
Grammy Bea war ihre einzige Verbündete gegen alle anderen gewesen. Da sie aber eine Autostunde weit entfernt in den Bergen lebte, hatte ihre Unterstützung gegen den Druck ihrer Eltern und ihres Freundes nichts ausrichten können. Der Gaskamin war vor Elizabeths Einzug installiert worden.
Ein Holzfeuer hingegen hatte etwas Urtümliches an sich. Während ihrer College-Zeit und ihres Medizinstudiums hatte Elizabeth sich in den Winterferien wochenlang bei Grammy Bea in den Bergen vergraben. Zündholz an Papier zu halten, das Knistern des Feuers zu hören, die Asche hinauszutragen, waren tägliche Rituale, wie sie Elizabeth liebte. Ein Holzfeuer bedeutete Wärme, sowohl physisch als auch psychisch, es erforderte Geduld beim Entfachen und Hüten der Flammen und schuf damit einen der menschlichen Natur angepassten Tagesrhythmus.
Elizabeth drückte auf die Fernbedienung, und die Flamme in ihrem Kamin erlosch. Sie klickte wieder, und das Feuer erwachte zischend zum Leben.
Sie gönnte sich noch einen tiefen Schluck Scotch und kostete das Brennen in der Kehle aus. Ihr Magen wärmte sich. Ihre Muskeln prickelten, als ihre Anspannung nachließ.
Der Zug war zehn Meilen nördlich der Stadt entgleist. Dreiundvierzig Fahrgäste hatten Verletzungen erlitten, bei sechs Personen war der Zustand kritisch.
Elizabeth hatte sich mit drei der am schwersten verletzten Unfallopfer befasst.
Zwei von ihnen waren fast Routinefälle gewesen, wenn man das von so schweren Fällen sagen konnte, und Elizabeth hatte ihr ganzes Wissen und ihre Erfahrung eingesetzt. Der junge Mann mit dem Milzriss und ein anderer mit Rippenbrüchen und Lungenverletzungen würden überleben und das Leben wieder aufnehmen, das vom Schicksal so jäh unterbrochen worden war.
Den Scotch brauchte sie wegen Patientin Nummer drei.
Elizabeth würde Esther Brown und deren Mann Caleb ihr Leben lang nicht vergessen. Das ältere Ehepaar war nach Seattle gefahren, um Tochter und Enkel zu besuchen.
Caleb hatte Glück gehabt und war bei dem Zugunglück mit Schnittwunden, ein paar Rippenprellungen und einem geschwollenen Knie davongekommen, Esther aber hatte Verletzungen erlitten, die für eine Achtundsiebzigjährige lebensgefährlich werden konnten: ein zerschmettertes Bein, einen Bruch des Handgelenks und innere Blutungen.
Bevor Elizabeth Esther in den OP-Raum schieben lassen konnte, hatte Caleb darauf bestanden, mit seiner Frau zu beten, und er hatte zudem darauf bestanden, dass Elizabeth mit ihnen betete.
Für die im Schatten Grammy Beas aufgewachsene Elizabeth waren Gebete etwas Vertrautes. Sie wusste um deren Kraft, und wenn sie mit Esther und Caleb betete, bedeutete dies nicht, dass sie emotional beteiligt war. Es bedeutete nur, dass sie als Ärztin gewillt war, alle möglichen Mittel auszuschöpfen, um ihrer Patientin über das Trauma einer Operation hinwegzuhelfen.
Elizabeth hatte also neben Caleb stehend die Hand auf Esthers Arm gelegt und sich ganz fest gewünscht, die Frau möge überleben.
Doch in diesem Moment war etwas eingetreten.
Etwas Unerklärliches.
Elizabeths Körper hatte sich erwärmt. Ihre Haut hatte sich gestrafft. Ihr Herzschlag hatte sich verlangsamt, der Raum, in dem sie sich befand, war ihrer Sicht entschwunden, bis nur mehr Licht um sie war.
Eine Anordnung reinster Farben hatte sie umgeben. Ein Regenbogen laserscharfer, strahlender Farben war durch ihren Kopf gewirbelt. Und Esther Brown war bei ihr gewesen.
Nur hatte Elizabeth Esther nicht gesehen, sie war Esther geworden. Sie hatte gespürt, wie das Blut durch Esthers Adern strömte, hatte Esthers Herzschlag gespürt, sie hatte jeden Atemzug zusammen mit der Frau gemacht. Und sie hatte Esthers Lebenswillen gespürt.
Elizabeth hob ihre zitternde Hand und untersuchte deren Silhouette im Licht des Kamins. Sie prickelte noch von der verbliebenen Wärme.
Elizabeth wusste, dass Grammy Bea sich oben im Himmel vor Lachen ausschüttete.
Elizabeth hatte ihre Großmutter nicht nur geliebt, sie hatte sie angebetet. Während ihre Eltern irgendwo Urlaub machten oder an nicht enden wollenden Konferenzen teilnahmen, hatte es Elizabeth genügt, sich in der Aufmerksamkeit ihrer Großmutter zu sonnen.
Ein einziges Mal war Bea sich mit Elizabeths Eltern einig gewesen, damals nämlich, als Katherine und Barnaby Hart verkündet hatten, ihre Tochter solle einmal Ärztin werden, eine Prophezeiung, die nach Elizabeths Geburt getroffen worden war, und alle, auch Bea – und später Elizabeth selbst – hatten einunddreißig Jahre darauf hingearbeitet, dieses Vorhaben zu verwirklichen.
Der einzige Misston war die Ankündigung ihres Vaters gewesen, dass Elizabeth eine Ausbildung zur Chirurgin machen würde. Da hatte Bea widersprochen, sehr lautstark, und hatte behauptet, jawohl, ihre Enkeltochter sei für den Heilberuf bestimmt, doch solle sie lieber Allgemeinmedizin wählen.
Chirurgie sei ein zu eingeschränktes Gebiet, hatte Bea eingewendet. Zu stark auf einzelne Körperteile fokussiert und nicht auf den gesamten Patienten. Bea erklärte, Elizabeth sei die Gabe des Heilens angeboren, die mütterlicherseits in der Familie weitervererbt wurde. Elizabeths Bestimmung wäre die Allgemeinmedizin.
Eine Heilerin? Etwa ganzheitlich, mit diesem ganzen Hokuspokus an Zauberkunst?
Bea hatte behauptet, die auffallende weiße Strähne in Elizabeths Haar sei ein Zeichen dieser Gabe. Elizabeth hingegen hielt sie für eine genetische Anomalie, die gar nicht so selten anzutreffen war.
Sie war keine außergewöhnliche Heilerin.
Dieser Meinung war Elizabeth jedenfalls bis jetzt gewesen.
Aber als man Esther Brown in den OP geschafft hatte und Elizabeth sich für die Operation vorbereitete, war die Veränderung eingetreten.
Zunächst hatte sich Elizabeth so stark auf die vorgeschriebene Prozedur konzentriert, dass ihr das Geflüster entging. OP-Teams hatten immer etwas zu tuscheln, wenn die Patienten vorbereitet wurden, und Elizabeth hatte gelernt, das banale Gerede auszublenden.
Erst als sie ihr Skalpell an Esther Brown ansetzen wollte, gebot eine der Schwestern ihr Einhalt. Als Elizabeth aufblickte, hatte sie sich schreckgeweiteten Augen gegenübergesehen, die sie über die OP-Masken hinweg anstarrten.
Und dann fingen alle auf einmal zu sprechen an. Die organischen Funktionen der Patientin seien normal. Keine Spur mehr von einem zerquetschten Bein und von einem Bruch des Handgelenks. Ihr eben noch aufgetriebener Leib sei flach.
Elizabeth hatte einer wild dreinschauenden Assistentin das Krankenblatt entrissen und das gesamte Unfallchirurgie-Team verwünscht, weil es die falsche Patientin anästhesiert hatte.
Verdammt. Beinahe hätte sie eine kerngesunde Frau aufgeschnitten.
Über eine halbe Stunde lang überprüften sie alle Monitore und machten noch etliche Röntgenbilder. Die Ambulanzaufnahme wurde angerufen, Esthers Armband wurde mehrfach überprüft und elektronisch gescannt. Elizabeth hatte schließlich Esthers OP-Haube und Sauerstoffmaske abgenommen und das Gesicht der Frau überprüft.
Sie war es. Ihr Haar war etwas weißer und ihre Züge nicht mehr vor Schmerz verzerrt, doch die Frau auf ihrem Operationstisch war dieselbe, mit der sie vor weniger als einer Stunde gebetet hatte.
Elizabeth war nur imstande, ihr schweigendes Team anzustarren. Irgendetwas war ganz schrecklich schiefgegangen.
Oder für Esther Brown wundervoll gelaufen.
Ja, ja. Grammy Bea lachte sich jetzt sicher ins Fäustchen und erzählte allen Himmelsbewohnern von dem Wunder. Und Elizabeth sah ihre chirurgische Laufbahn wie ein Kartenhaus im Wind einstürzen.
Wortlos war sie aus dem OP-Raum gegangen. Sie hatte das Krankenhaus verlassen wollen, doch hatte sie etwas bewogen, im Lift den ›Aufwärts‹-Knopf zu drücken, statt hinunter in die Lobby zu fahren. Die Lifttür hatte sich auf Höhe der Kinderabteilung geöffnet, und Elizabeth ertappte sich dabei, dass sie zum Zimmer des kleinen Jamie Garcia ging.
Am Morgen war Jamie mit einer Kopfverletzung eingeliefert worden, die er sich zugezogen hatte, als er mit seinem Fahrrad gegen ein Auto fuhr. Er lag im Koma, die Aussichten waren nicht gerade günstig.
Elizabeth hatte sich neben Jamie gesetzt, hatte seine kleine Hand in ihre genommen und hatte ihn wortlos, allein kraft ihres Willens beschworen, zu sich zu kommen. Und wieder hatte sie ein Wärmegefühl verspürt, ihre Haut hatte sich gespannt, ihr Puls verlangsamt. Der Regenbogen strahlender Farben war wiedergekehrt.
Und Jamie Garcia hatte die Augen aufgeschlagen und ihr zugelächelt.
Diesmal war Elizabeth nicht einfach gegangen. Sie war geflüchtet.
Nun goss sie sich Scotch nach, nahm den Drink mit ans Fenster und starrte hinaus auf die Skyline, auf das Cedars-Sinai Medical Center und die chirurgische Abteilung, die gut zu erkennen war. Dort hatte sie sich immer sehr wohl gefühlt, sehr kompetent, immer Herrin der Lage – ihrer selbst und jeder Situation sicher, der sie sich gegenübersah.
Bis zum heutigen Tag.
In einem einzigen blendenden Augenblick, als sie ihrem OP-Team über dem anästhesierten Körper Esther Browns in die Augen sah, hatte Elizabeth erkennen müssen, dass sie die Lage ganz und gar nicht beherrschte.
Nach ihrer Flucht aus Jamies Zimmer und während der Fahrt hinunter in die Lobby hatte sie gegen den Drang angekämpft, durch das Krankenhaus zu laufen und bei allen Patienten zu beten. Das Verlangen zu heilen war so überwältigend, dass Elizabeth das Gefühl hatte, sie müsse bersten. Die Welt, die sie seit einunddreißig Jahren kannte, löste sich in wirbelnden Farben auf, die an ihr zerrten, bis sie sich vom Chaos übermannt fühlte.
Ja, ihr war die Kontrolle völlig entglitten.
Sie musste herausfinden, was vorgegangen war. Ihr Leben lang hatte Grammy Bea Elizabeth von den Frauen in ihrer Familie erzählt, die angeblich diese Gabe besessen hatten. Die letzte war ihre vor fast zwanzig Jahren verstorbene Großtante Sylvia gewesen. Alle diese Frauen hatten etwas Absonderliches oder eine körperliche Anomalie besessen. Elizabeths Ururgroßmutter hatte angeblich Augen verschiedener Farbe gehabt. Großtante Sylvia war mit taillenlangem Haar zu Welt gekommen, das ihr Leben lag erstaunlich rasch nachgewachsen war. Elizabeth konnte sich erinnern, dass sie mit elf oder zwölf bei Sylvias Beerdigung gesehen hatte, dass das geflochtene Haar ihrer Großtante den Sarg beinahe ausgefüllt hatte.
Elizabeth zupfte an ihrer weißen Strähne, zog sie nach vorne und hob den Blick, ehe sie die Haare mit einem Seufzer wieder zurückblies. Als Kind hatte sie über Grammy Beas Geschichten gelacht und sie abgetan als Geschichten, die ein wenig Aufregung in das Leben eines einsamen Mädchens bringen sollten.
Nun, jetzt lachte sie nicht mehr.
Zurück ins Krankenhaus konnte sie nicht. Nicht, wenn die vielen kranken und verletzten Menschen an ihr zerrten. Nicht, wenn sie ihren Verstand behalten wollte.
Das Schrillen des Telefons durchbrach die Stille des Stadthauses. Elizabeth zuckte erschrocken zusammen, verschüttete einen Teil ihres Drinks und starrte das Telefon auf dem Tisch neben der Couch an.
Sie wollte mit niemandem sprechen.
Es läutete fünfmal, ehe sich der Anrufbeantworter einschaltete. Elizabeth lauschte ihrer eigenen Stimme, die den Anrufer aufforderte, eine Nachricht zu hinterlassen. Ihr Atem stockte, als James Kesslers Stimme plötzlich in ihrem Wohnzimmer ertönte.
»Elizabeth! Bist du da? Nimm den Hörer ab, Elizabeth. Ich möchte mit dir reden.«
Zehn Sekunden Stille.
»Elizabeth! Heb endlich ab und sag mir, was mit Jamie Garcia passierte. Ich weiß, dass du heute Nachmittag bei ihm warst. Seine Monitore gingen aus, und als Sally Pritchard hineinlief, um nach ihm zu sehen, sah sie, wie du gingst.«
Wieder zehn Sekunden Stille, dann: »Elizabeth, du sollst abheben!«
Sie tat einen Schritt vorwärts und hielt inne. James Kessler war Neurologe und Freund der Familie, und Jamie Garcia war sein Patient. Er wollte von ihr eine Erklärung, doch was konnte sie ihm sagen? Dass sie den Jungen durch Handauflegen wundersam geheilt hatte?
»Verdammt, Elizabeth. Ruf mich sofort an, wenn du nach Hause kommst.«
Der Anrufbeantworter piepste, und das rote Licht leuchtete in dem Moment auf, als James auflegte. Elizabeth trank noch einen Schluck Scotch.
Sie musste hier raus. Zum Teufel, sie musste weg aus Kalifornien. Es war unmöglich, James oder ihren anderen Kollegen oder sogar Esther Brown gegenüberzutreten. Wie sollte sie ihnen etwas erklären, das sie sich selbst nicht erklären konnte?
Sie brauchte Zeit zum Überlegen – und etwas Abstand konnte nicht schaden. Ehe sie nicht eine Erklärung gefunden hatte, die sie nicht ins Irrenhaus brachte, musste sie allen aus dem Weg gehen.
Aber betraf das auch ihre Mutter? Katherine kannte die Familiengeschichte, und wie Elizabeth glaubte auch sie lieber daran, dass ihre weiblichen Vorfahren eher exzentrisch als mit übernatürlichen Kräften ausgestattet waren. Ungewöhnlich langes Haar, verschiedenfarbige Augen oder eine weiße Strähne war nichts, was einen zur Hexe verdammte, es war, nun ja, es war der Stoff, aus dem Familienlegenden sind.
Natürlich hatte Elizabeth in ihrer Kindheit häufig mit ihrer Mutter über Grammy Beas Geschichten gesprochen, die Katherine immer rasch als Wunschdenken abgetan hatte. Bea wäre immer neidisch gewesen, weil Tante Sylvia behauptete, sie sei diejenige, die diese Gabe geerbt hätte. Bea selbst hatte Kräuter angepflanzt, geerntet und verarbeitet und auf ihrer kleinen Farm in den Bergen verkauft. Und da Bea nur eine Tochter hatte und Katherine kein ›Zeichen‹, das sie als etwas Besonderes hervorgehoben hätte, projizierte Bea die Gabe auf ihre Enkelin.
Elizabeth fand diese Erklärung vernünftig.
Damals zumindest.
Doch das erklärte nicht, was heute passiert war. Jetzt noch spürte sie ein Nachbeben der ungewöhnlichen Energie. Ihr Kopf fühlte sich an, als wäre er mit Watte ausgestopft. Ihr dunkles Wohnzimmer schien wie von einem unnatürlichen Licht sanft durchflutet, das sie auf ganz besondere Weise wahrnahm.
Elizabeth setzte sich wieder auf die Couch und starrte ins Feuer. All die Jahre hatte Grammy Bea sich so sehr bemüht, ihr einen Blick auf Bereiche jenseits der Schulmedizin zu eröffnen. Bis zu ihrem Tod vor zwei Monaten hatte sie es als ihre Aufgabe angesehen, Elizabeth die natürliche – oder besser gesagt die unnatürliche – Welt vertraut zu machen.
Dies hatte Barnaby Hart bis zu dem Tag verrückt gemacht, als er selbst vor vier Jahren das Zeitliche segnete. Ihr Vater hatte immer geklagt, dass er zwei Wochen benötige, um Elizabeth nach einem Besuch auf der Farm ihrer Großmutter wieder zurechtzubiegen. Meist war sie mit einem Koffer voller Heilkräuter, Tinkturen und Salben nach Hause gekommen und hatte das Zeug verstecken müssen, ehe ihr Vater es wegwerfen konnte.
Sie versteckte die Sachen unter den kosmetischen Utensilien ihrer Mutter, da sie bald entdeckt hatte, dass es am besten war, wenn man etwas so versteckte, dass es sichtbar blieb. Außerdem kannte Katherine den Wert der Kräuter und wendete sie an, wenn sich eine Erkältung meldete oder eine Falte es wagte, sich auf ihrem schönen Gesicht zu zeigen.
Das Telefon läutete und erschreckte Elizabeth zum zweiten Mal. Mit angehaltenem Atem hörte sie das fünfmalige Schrillen, hörte ihre Stimme, die den Anrufer bat, eine Nachricht zu hinterlassen, und vernahm anschließend nur Stille.
»Elizabeth«, sagte ihre Mutter schließlich. »Bitte, melde dich, wenn du zu Hause bist. James rief eben an, er sucht dich. Im Krankenhaus gehen sonderbare Dinge vor. Es handelt sich um Patienten – die auf unerklärliche Weise geheilt wurden. Melde dich, Elizabeth«, sagte Katherine mit fordernd erhobener Stimme.
Ruhig griff Elizabeth zum Hörer und hielt ihn sich ans Ohr. »Ich muss verrückt sein, Mutter, weil es stimmt. Ich habe zwei Menschen geheilt, nur indem ich sie berührt habe.«
Eine gute halbe Minute herrschte Stille.
»Mom?«
»Hat dich jemand dabei gesehen?«, fragte Katherine leise.
Elizabeth stellte den Drink auf den Tisch und umfasste den Hörer mit beiden Händen. »Ich glaube nicht«, flüsterte sie. »Mein OP-Team machte sich bereit, als ich mit der Frau betete. Ihr – ihr Mann war dabei, aber es geschah nichts Ungewöhnliches. Das Chaos spielte sich nur in meinem Kopf ab. Danach verließ ich den Raum, um mich für die Operation zu waschen. Mom, ich wusste gar nicht, was geschehen war, bis die Patientin in den OP-Raum geschoben wurde. Alle dachten, es handle sich um eine Verwechslung, da nach der Eisenbahnkatastrophe so viele Verletzte eingeliefert wurden.«
Wieder einige Sekunden des Schweigens, und dann: »Was ist mit James?«, fragte Katherine. »Er sagte, du wärest zu seinem Patienten gegangen, und der Junge sei plötzlich aus dem Koma erwacht. Und das war nicht zu erwarten. Man hatte ihn für gehirntot erklären wollen.«
Deswegen hatte James versucht, sie zu erreichen. Sie kannten einander schon ewig, seit ihre Väter gemeinsam eine Praxis geführt hatten. Und da er durch Elizabeth mit Grammy Beas Geschichten groß geworden war, regte sich nun Argwohn bei James.
»Ich … ich habe ihn geheilt, Mom«, flüsterte Elizabeth und schloss die Augen, in denen Tränen brannten, als die laut ausgesprochenen Worte bedeutungsvoll durch das stille Wohnzimmer hallten.
»Das hast du nicht getan, Elizabeth. Das kannst du nicht.«
»Ich habe es gespürt. Mom, ich habe Esther Brown und Jamie Garcia gespürt. Ich wurde eins mit ihnen und – und heilte sie.«
Wieder herrschte völlige Stille am anderen Ende der Leitung.
»Was soll ich tun?«, flüsterte nun Elizabeth und wischte sich eine Träne ab, die über ihre Wange floss. »Was passiert jetzt?«
»Du lügst«, sagte Katherine entschieden. »Lass das nicht zu, Elizabeth. Dein Leben wird ruiniert, deinen Beruf kannst du aufgeben, und die Medien werden einen Riesenzirkus veranstalten.«
»Ich muss weg«, setzte Elizabeth hinzu. »Hier kann ich nicht bleiben. Ich …« Sie atmete bebend ein. »Ich kann nicht zurück ins Krankenhaus, Mom. Ich dachte, ich würde verrückt … ich glaubte zu spüren, wie die Menschen an mir zerren und mich um Heilung anflehen.«
»Ach, Baby.« Katherine fing leise zu weinen an. »Es tut mir ja so leid. Du hast recht. Du musst fort – aber nur für eine Weile, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Da er nichts Konkretes in der Hand hat, wird James den Fall auf sich beruhen lassen müssen.«
Elizabeth umfasste den Hörer fester. »Nein, das wird er nicht. Solange wir beide uns um das Forschungsstipendium bemühen, wird er nicht lockerlassen. Er wird die Sache gegen mich verwenden.« Elizabeth seufzte in den Hörer. »Jetzt macht es mir nichts mehr aus, Mom. Ich werde auf das Geld verzichten. Auch wenn es uns gelänge, die Sache geheim zu halten, kann ich nicht mehr im Krankenhaus arbeiten.«
Nun ertönte ein Stöhnen am anderen Ende der Leitung. »Elizabeth Hart, du bist Ärztin«, sagte ihre Mutter leise. »Du kannst nicht einfach davonlaufen.«
»Aber ich kann nicht zurück. Begreifst du denn nicht, Mom? Es hat mich überwältigt.«
»Das ist mir klar, Liebes. Ich meine … ich verstehe das alles nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist. Im Moment kannst du keinen klaren Gedanken fassen, Elizabeth. Du kannst noch nicht mit Sicherheit wissen, ob es mit deinem Beruf vorbei ist. Lass dir Zeit. Du hast ja recht, wahrscheinlich solltest du fortgehen, aber unternimm nichts, was du bereuen könntest.«
»Warum ist das passiert, Mom? Warum jetzt, so ganz ohne Vorwarnung?«
»Das weiß ich nicht, Liebes. Ich bin ebenso erschüttert wie du.«
»Wie ist das nur möglich?«
»Ist es nicht«, versicherte Katherine ihr mit Bestimmtheit. »Du kannst keinen Menschen allein durch Willenskraft heilen, egal, was Bea dir einreden wollte. Lass dich von ihren Geschichten nicht so beeinflussen, Elizabeth. Für das Geschehene muss es eine Erklärung geben. Wenn du Distanz zum Krankenhaus gewonnen hast, wirst du sicher eine vernünftige Erklärung finden.«
»Und wohin soll ich verschwinden?«
Zögern am anderen Ende der Leitung, ein tiefer Seufzer, und schließlich sagte Katherine: »Auf die Farm kannst du dich nicht zurückziehen, da James sie kennt und es der erste Ort wäre, an dem er dich sucht.«
»Ich schreibe heute noch einen Brief an meinen Chef und lasse ihm diesen morgen zustellen«, sagte Elizabeth, entschlossen, sich später den Kopf über ihren Zufluchtsort zu zerbrechen. »Ich werde ihm mitteilen, dass ich wegen eines familiären Notfalls Urlaub nehmen muss – väterlicherseits, wie ich andeuten werde, damit es nicht sonderbar aussieht, wenn du hierbleibst.«
»Ich könnte ja mitkommen.«
Elizabeth zögerte. »Nein, Mom«, sagte sie sanft. »Ich muss allein sein und nachdenken. Sobald ich weiß, wo ich bleibe, rufe ich dich an.«
»Elizabeth? Wirst du klarkommen?«, fragte Katherine leise. »Ich mache mir Sorgen, wenn du ganz allein und plan- und ziellos auf und davon gehst.«
»Ich bin erwachsen, Mom«, sagte Elizabeth munter und bemühte sich, zuversichtlicher zu klingen, als sie sich fühlte. »Ich verspreche dir, dass ich anrufen werde, sobald ich weiß, wo ich bleibe.«
»Mir gefällt das nicht«, gab Katherine sich seufzend geschlagen. »Trotzdem halte ich es in Anbetracht der Alternativen für das Beste. Du kannst jetzt einfach nicht hierbleiben. Erst muss Gras über die Sache wachsen, und du musst eine vernünftige Erklärung finden.«
Wie auch immer diese ausfallen mochte, dachte Elizabeth.
»Ich muss jetzt Schluss machen, Mom. Ich möchte packen und losfahren, ehe James auf die Idee kommt, mich hier zu suchen. Für ihn steht zu viel Geld und Prestige auf dem Spiel, als dass er lockerlässt.«
»Ich hab dich lieb, Elizabeth.«
»Ich weiß, Mom. Ich liebe dich auch. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich kann sehr gut auf mich aufpassen.«
»Ruf mich trotzdem an, wenn du dich eingerichtet hast. Unterdessen kümmere ich mich hier um James. Ich habe immer noch ein paar Kontakte zum Krankenhaus.«
Elizabeth lächelte in den Hörer. »Dann nutze sie, Mom. Ich muss fort. Wir bleiben in Kontakt, und du berichtest mir, was sich hier tut.«
»Ich … hab dich lieb«, wiederholte Katherine.
»Ich dich auch. Adieu.«
Elizabeth legte behutsam den Hörer auf und starrte ins Feuer. Sie musste einen Ort finden, an den sie sich zurückziehen konnte, am besten sofort. Von einem Gefühl der Eile getrieben, ging sie ins Schlafzimmer.
Sie ging zum Schrank, zog ihren Koffer heraus und warf ihn geöffnet aufs Bett. Auf dem Weg zwischen Kommode und Koffer blieb Elizabeth, den Arm voller Wäsche, vor dem Computer stehen und schaltete ihn ein. Sie fuhr fort zu packen, während er hochfuhr, plötzlich aber hatte sie eine Idee. Sie warf die Wäsche in den Koffer und lief geradezu in die Küche.
Sie ging zur Sprechanlage und drückte den Knopf für die Lobby.
»Dr. Hart?«, drang Stanleys Stimme aus dem Lautsprecher. »Was kann ich für Sie tun?«
»Stanley, falls jemand kommt und nach mir fragt … könnten Sie wohl sagen, dass ich nicht da bin? Ich möchte für den Rest der Nacht nicht gestört werden.«
»Kein Problem, Dr. Hart«, versprach Stanley. »Dafür bekomme ich doch das viele Geld … damit ich dafür sorge, dass niemand gestört wird, wenn es ihm nicht passt.«
»Danke, Stan. Ich verreise für eine Weile. Mom wird meine Pflanzen gießen und so. Geben Sie gut Acht auf sie, ja?«
»Wird gemacht, Dr. Hart. Gute Reise.«
»Sie wird gut, Stan. Danke.«
Elizabeth ging zurück ins Schlafzimmer. Vor ihrem Computer blieb sie stehen und loggte sich ins Internet ein.
Während das Modem wählte, ging sie an den Schrank und begutachtete ihre Garderobe. Was sollte sie mitnehmen? Verdammt, sie brauchte ein Ziel. Dank Stanley hatte sie etwas Zeit gewonnen, falls James sie suchen sollte. Nicht einmal die Nationalgarde würde es schaffen, am Portier vorbeizukommen, da er nun wusste, dass sie nicht gestört werden wollte.
Elizabeth surfte im Internet nach Mietangeboten für Häuser. Sie entschied sich spontan für die Ostküste, da ihr diese weit genug entfernt schien.
New England klang gut: anheimelnd, gemächlich und bodenständig. Ein sicheres Fleckchen in den Bergen.