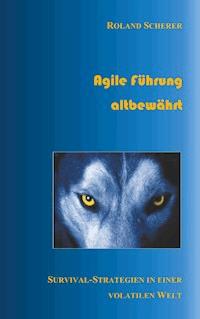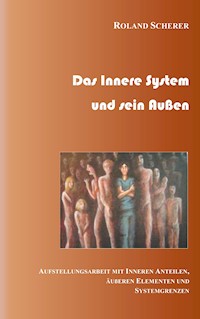
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Um ein solch komplexes System wie die menschliche Psyche zu verstehen, müsste man entweder noch komplexer denken - was unmöglich ist - oder man reduziert die Komplexität durch geeignete Modelle." Als systemischer Begleiter hat Roland Scherer erfahren, wie komplex die menschliche Psyche ist. Sie ist für den menschlichen Geist nicht umfassend zu begreifen. Deshalb sind Modelle notwendig, die diese Komplexität auf ein beherrschbares, aber dennoch brauchbares Maß reduzieren. Einige Modelle postulieren, dass die Psyche des Menschen aus mehreren Persönlichkeitsanteilen besteht. Es gibt diese Modelle zum Teil schon recht lange und sie haben sich bewährt. Auch bei Aufstellungen der Psyche werden solche Modelle gern verwendet. Roland Scherer entwickelt mit dem Aufstellungsformat des Inneren Systems ein modifiziertes Modell, das auf dem Ego-State-Modell und seinen Verwandten basiert. Er geht dabei davon aus, dass es keine falschen oder richtigen Modelle gibt, sondern dass diese in der jeweiligen Situation mehr oder weniger zielführend sind. Basierend auf seinen Erfahrungen schafft er mit dem Inneren System eine Möglichkeit für den Klienten und Begleiter, innere Antriebe zu verstehen und mit ihnen zu arbeiten. Mit dem Außen werden die Einflüsse aus der Umgebung des Klienten abgebildet. Dabei wird zwischen dem Innen und dem Außen eine deutliche, aber permeable Grenze gezogen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Anstelle eines Vorworts
1 Modelle der Psychologie
1.1 Die Wirklichkeit als Konstrukt
1.2 Modelldenken in der Begleitung
2 Modelle der Persönlichkeitsanteile
2.1 Die Gemeinsamkeiten der Modelle
2.2 Das Voice-Dialogue-Modell
2.3 Das Ego-State-Modell
2.4 Das Modell der Inneren Familie
2.5 Das Modell des Inneren Teams
2.6 Das Ressourcen-Modell
2.7 Ein neues Modell: Das Innere System und sein Außen.....
3 Der systemische Ansatz
3.1 Was ist ein System?
3.2 Das Wesen des Systemischen Denkens
3.3 Das semiotische Dreieck und der Systemiker
3.4 Das Menschenbild in der systemischen Sicht
3.5 Die Haltungen eines konventionellen Beraters
3.6 Haltungen eines systemischen Begleiters
3.7 Komplementärbegleitung
3.8 Systemgesetze
4 Aufstellungen
4.1 Frühe Formen
4.2 Familienaufstellung nach Hellinger
4.3 Der Ablauf einer Gruppen-Aufstellung
4.4 Systemische Aufstellungen
4.5 Systemische Strukturaufstellungen
4.6 Einzelaufstellungen
4.7 Sonstige Aufstellungsformen
5 Das Modell des Inneren Systems und seines Außen
5.1 Der Mensch als System
5.2 Die Inneren Elemente
5.3 Das Außen
5.4 Die Grenze zwischen Innen und Außen
5.5 Störungen aus der Sicht des Inneren Systems
5.6 Die Grenzen der Gültigkeit des Modells
6 Die Aufstellung des Inneren Systems und seines Außen
6.1 Klärung des Anliegens
6.2 Klärung von Modell und Methode
6.3 Anteile erkennen und finden
6.4 Fragen an die Anteile
6.5 Welche Elemente sind zu stellen?
6.6 Die Einzelaufstellung des Gesamtsystems
6.7 Was noch zu beachten ist
6.8 Warum funktionieren manche Aufstellungen nicht?
6.9 Zum guten Schluss
7 Anhang
7.1 Ein herzliches Dankeschön!
7.2 Begriffserklärungen
7.3 Stichwortverzeichnis
7.4 Literaturverzeichnis
Anstelle eines Vorworts
Kaum jemand liest Einleitungen, dessen bin ich mir bewusst. Ich bitte Sie trotzdem, mindestens einen Blick in das Kapitel 0.1 "Verwendete Begriffe" zu werfen, Missverständnisse werden dadurch vermieden. Auch das Kapitel 0.2 "Ein kurzer Überblick" kann zum Verständnis des Buches beitragen.
Dieses Buch hat ein neu entwickeltes Aufstellungsformat des Systemischen Stellens zum Thema. Es wurde für Begleiter (Psychotherapeuten, Psychologische Berater und Coachs) und interessierte Laien geschrieben, die an einem weiterentwickelten Modell der Persönlichkeitsanteile als Persönlichkeitstheorie und an dessen Einsatz in der Begleitung als Format einer systemischen Aufstellung interessiert sind. Was systemisch bedeutet, ist in Kapitel 2 erklärt, aber was ist in diesem Zusammenhang ein Format?
Den Begriff „Format“ für eine bestimmte Form der Aufstellung haben die Begründer der Systemischen Strukturaufstellung, Insa Sparrer und Mathias Varga von Kibéd, entwickelt. Sie betrachten Aufstellungen als eine transverbale Sprache, die systemische Strukturen beschreiben kann. Transverbal bedeutet in diesem Zusammenhang eine Form der Verständigung, eine Transaktion, die über das gesprochene Wort hinausgeht. Wie bei verschiedenen Sprachen können die Strukturen in unterschiedlichen Formen ausgedrückt werden. Die Kunst ist es nun, das richtige Form - hier Format genannt - für die vorliegende Fragestellung auszuwählen.
Strukturen innerhalb einer Aufstellung können wechseln, ein Element aus einem anderen System kann ohne Vorankündigung auftauchen. Die Aufstellung eines Teams kann zum Beispiel durch einen induzierten (absichtlich herbeigeführten) oder spontanen Strukturebenenwechsel plötzlich die Natur einer Familienaufstellung annehmen, denn beide haben die gleichen Strukturen. Die Repräsentanten ändern dann möglicherweise die ihnen ursprünglich zugewiesenen Bedeutungen und Rollen. In ähnlicher Form können Personen in abstrakte Bedeutungen und umgekehrt wechseln. Und schließlich kann sich auch die Fragestellung unvermittelt ändern.
Auch ambigues Arbeiten ist möglich, indem zum Beispiel Lösungssätze mehrdeutig formuliert werden, sodass sie auf mehrere Struktur-ebenen passen. Wenn der Klient zum Beispiel sagt: „Du vor mir, ich nach Dir“, passt das sowohl zu seinem Verhältnis zum Vater als auch auf das zu seinem Chef. Gerade aus dieser Mehrdeutigkeit ergeben sich oft erstaunliche Lösungen.
Wer jetzt allerdings ein Werk erwartet, das alles über die Modelle der Inneren Persönlichkeitsanteile, Systemisches Stellen und Lösungsfokussierung beinhaltet, könnte enttäuscht werden. Ich spreche diese Punkte kurz an, eine umfassende Schilderung würde eine ganze Bibliothek ergeben. Ich hoffe darauf, dass der Leser entweder über diese Punkte schon Vorwissen besitzt, oder bereit ist, sich bei entsprechendem Interesse selbstständig einzuarbeiten. Das Literaturverzeichnis ist dafür hoffentlich eine erste Hilfe.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Roland Scherer
Über das neue Aufstellungs-Format
Bei den Systemischen Aufstellungen gibt es Dutzende Aufstellungsformate, warum also noch ein weiteres? Und ist das hier vorgestellte nicht anderen zum Verwechseln ähnlich?
Ich denke nicht. Wie jeder, der ein neues Format entwickelt hat, habe ich mich von anderen inspirieren lassen, und ich bilde mir nicht ein, dass es mir ohne diese Anregungen möglich gewesen wäre, dieses Aufstellungsformat zu entwickeln. Wir stehen immer auf den Schultern von Riesen, wenn es uns gelingt, einen anderen Blickwinkel einzunehmen.
Das hier vorgestellte Format passt zur Betrachtung des Inneren Sys tems eines Menschen. Dieses Denkmodell ermöglicht es, den Blick auf Menschen trotz ihrer für andere undurchschaubaren Komplexität so weit zu vereinfachen, dass es zu sinnvollen Aussagen über sie kommen kann. Dabei darf nicht soweit vereinfacht werden, dass die Komplexität ganz verloren geht, das Modell muss so simpel wie möglich und dennoch so komplex wie nötig sein.
Wenn ich das alles bedenke, komme ich zu der Auffassung, dass es sich lohnt, ein eigenes Format zu entwickeln oder ein bestehendes zu modifizieren, wenn die bereits vorhandenen nicht mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmen. Ob das hier vorgestellte Format besser oder schlechter als schon bestehende ist, ob es also hilfreicher ist oder nicht, wage ich nicht zu entscheiden. Alles was ich sagen kann ist, dass es besser zu meinen Vorstellungen passt und mein Modell vom Menschen und seinem Verhaltens für mich besser abbildet. So kann ich mit diesem Format leichter arbeiten, da ich während der Begleitung eines Klienten meine Vorstellungen nicht anpassen muss. Jeder Therapeut oder Coach muss immer für sich selbst entscheiden, welche Formate zu seiner Arbeit passen.
Verwendete Begriffe
In diesem Buch nenne ich denjenigen, der eine psychische Erkrankung, eine Störung oder ein Problem hat, das er lösen oder heilen möchte, den „Klienten“. Ich bezeichne das, worunter er leidet, übergreifend als "Störung".
Derjenige, der aufgrund dessen konsultiert wird, also der Arzt, Therapeuten, Heiler, Coach oder Berater nenne ich „Begleiter“.
Der Zeitraum, in dem der Begleiter die Klienten unterstützt, nenne ich die „(Phase der) Begleitung“, die Zeit, in der die beiden tatsächlich miteinander kommunizieren, eine „Sitzung“.
Eine verbale oder nonverbale Äußerung zu einem anderen Menschen oder Persönlichkeitsanteil nenne ich Eric Berne folgend eine „Transaktion“. Ein Gespräch besteht aus mehreren meist wechselseitigen Transaktionen, die durchaus auch wortlos sein können.
Bei Aufstellungen verwende ich auch gerne für den Begleiter den Begriff „Gastgeber“ (an dieser Stelle Dank an SySt® für die Begrifflichkeit), der Klient ist dann auch der „Aufsteller“. Diese Bezeichnungen wähle ich , um klarzustellen, dass die handelnde Person der Klient ist, während der Begleiter, wie jeder gute Gastgeber, „nur“ den Prozess führt, ohne in die Aufstellung inhaltlich einzugreifen. Die Personen, die als Stellvertreter einer Person, einer Sache oder eines Zusammenhangs aufgestellt werden, nenne ich "Stellvertreter" oder "Repräsentanten". Sie werden aus den Gästen einer Aufstellung meist vom Aufsteller ausgewählt. Nicht ausgewählte Gäste betrachten das Geschehen von außen, ohne einzugreifen oder sich zu äußern. Das, wofür die Repräsentanten stehen, belege ich mit dem Sammelbegriff "Element". Die Namen dieser Elemente werden durch spitze Klammern als solche gekennzeichnet. Beispiele für Persönlichkeitsanteile sind <Verschreckte Junge> oder <Sorgende Mutter>, Beispiele für personelle Elemente sind <Vater> oder <Chef>, für nicht personelle <Ziel> oder <Hindernis>.
Wird auch der Stellvertreter des Aufstellers aufgestellt, heißt dieser in der Systemischen Struktur-Aufstellung „Fokus", da nicht die Person selbst, sondern nur der Teil von ihm gestellt wird, der mit dem Anliegen zu tun hat, wegen dem die Aufstellung stattfindet. Mit dem Anliegen einer Aufstellung bezeichne ich das Thema bzw. die Fragestellung, um die es dem Klienten bei der Aufstellung geht.
Wegen der leichteren Lesbarkeit und der semantischen Sperrigkeit anderer Lösungen verwende ich jeweils die grammatikalisch männliche Form der Handelnden. Diese betrachte ich als die gendermäßig allgemeinere, sie umfasst für mich alle Geschlechter. Ich bitte die weiblichen oder anders-geschlechtlichen Leser, mir diese Vereinfachung zu verzeihen und das Buch so, wie von mir gedacht, zu lesen.
Ein kurzer Überblick
Um die Welt zu erkennen, braucht es den ersten Blick und den zweiten Gedanken. 1
In diesem Buch wird das Innere System als Persönlichkeitsmodell, so wie ich es entwickelt habe, vorgestellt. Darüber hinaus wird die Begleitung von Klienten durch Aufstellungen anhand dieses Modells vorgeschlagen. Mir ist bewusst, dass das Innere System, wie jedes Modell, unvollständig sein muss. Es ist weiterhin selbstverständlich, dass man auch andere Methoden der Begleitung anwenden kann, wenn man dieses Modell einsetzt.
Es würde den Rahmen des Buches sprengen, die komplexen Sichtweisen der verwendeten therapeutischen Ansätze umfassend zu schildern. Ich beschränke mich deshalb auf eine kurze Darlegung der Grundannahmen und gehe davon aus, dass der Leser entweder entsprechende Kenntnisse besitzt oder bereit ist, sich einzuarbeiten. Als Anregung mag das Literaturverzeichnis dienen. Ohne entsprechende Vorkenntnisse kann das hier beschriebene Format nicht gewinnbringend angewendet werden.
Ich habe im ersten Kapitel den Modellbegriff, wie er in der Psychologie verwendet wird, kurz dargestellt und im zweiten die verschiedenen bereits existierenden Modelle, die auf Persönlichkeitsanteilen basieren, als Basis des Inneren Systems erläutert. Da das Innere System auf systemischen Vorstellungen beruht, habe ich die Grundlagen des systemischen Denkens und Handeln im dritten Kapitel dargestellt. Das vierte Kapitel bringt einen Überblick über verschiedene Aufstellungsmethoden. Diese ersten vier Kapitel können nur eine kurze Zusammenfassung sein, die auf keinen Fall ein tiefes Verständnis für die behandelten Vorstellungen und Verfahren bringen kann. Für eine
ausführliche Darstellung verweise ich auf die Literatur im Anhang. Wenn Sie Kenntnisse über die behandelten Themen haben, können Sie diese Kapitel überschlagen, die folgenden sind meiner Meinung nach bei entsprechendem Vorwissen auch dann noch verständlich.
Das fünfte Kapitel stellt das Innere System vor. Ich habe mich bei dessen Entwicklung auf die im dritten Kapitel vorgestellten Modelle gestützt. Das sechste Kapitel schließlich zeigt auf, wie ich auf Basis des Inneren Systems Aufstellungen durchführe. Am Ende jedes Kapitels finden Sie eine kurze Zusammenfassung. Im Anhang finden Sie neben dem Literaturverzeichnis eine Begriffserklärung und ein Stichwortverzeichnis.
Ich hoffe, Ihnen mit diesem Buch eine knappe, verständliche und ziel-führende Darstellung meiner Vorstellungen und meiner Methoden der darauf fußenden Begleitung geben zu können.
Persönlichkeitsanteile sind handlungsleitende, Reaktionen steuernde und Orientierung bietende Muster. (Geralt Hüther)
1 Nach Terry Pretchett („Scheibenwelten“) schaut der erste Blick, wie etwas wirklich ist, ohne es zu interpretieren. Der zweite Gedanke ist der, der nicht automatisch kommt, sondern am ersten Gedanken nagt, bis der merkt, dass etwas an ihm falsch ist.
1 Modelle der Psychologie
Wir vereinfachen oft die Komplexität von Zusammenhängen und Systemen, um sie leichter greifbar und begreifbar zu machen. So sagen wir zum Beispiel: „Die Sonne geht im Osten auf“, wohl wissend, dass nicht die Sonne aufgeht, sondern dass sich die Erde so dreht, dass für uns der Eindruck entsteht, die an sich stillstehende Sonne würde im Osten aufsteigen. Wie einfach und leicht fassbar ist da das Denkmodell einer Sonne, die sich um eine stillstehende Erde dreht, vor allem, weil wir die Bewegung der Erde nicht wahrnehmen. Für den Alltag ist dieses vereinfachte Modell ja auch durchaus ausreichend.
Nun sind Menschen als soziale Wesen besonders an Menschen interessiert, also an Systemen hoher Komplexität, die somit nichttrivial sind. Um sie zu verstehen, sollten wir lernen, Rückkopplungen zu beachten, indem wir zirkulär denken. Wir es gewohnt sind, immer nach möglichst einfachen Kausalitäten zu suchen. Diese Betrachtung mag für triviale Alltagsprobleme hinreichend sein und hat sich dort auch bewährt, für komplexe Fragestellungen ist sie nicht geeignet.
Der Mathematiker Gödel hat nachgewiesen [Hofstadter, 1985], dass ein System nur dann von einem anderen System vollständig erfasst werden kann, wenn das zweite in hinreichendem Maße komplexer ist als das erste. Da Menschen im Wesentlichen gleich komplex sind, kann ein Mensch nur dann einem anderen begreifen, wenn er sich von diesem ein vereinfachendes Modell macht. Der Grad der Vereinfachung ist dabei von der Fragestellung abhängig. Interessiert nur das Verhalten eines Durchschnittsmenschen, kann grober vereinfacht werden, als wenn es sich um das Verhalten eines konkreten Menschen dreht. Die Gefahr ist dabei, dass wir anfangen in Stereotypen zu denken, wodurch wir einen anderen schnell einordnen können, auch auf die Gefahr hin, Fehler zu machen („Alle Deutschen sind pünktlich“, was ganz sicher für den öffentlichen Verkehr nur eingeschränkt gilt).
Besonders in der Psychotherapie und im Coaching geht es aber um einen einzelnen konkreten Menschen, und so haben Psychotherapeuten lange und mit unterschiedlichen Ergebnissen um vereinfachende Modelle gerungen. Die Ergebnisse waren deshalb unterschiedlich, weil auch die Fragestellungen unterschiedlich waren. Das zur Frage stellung passende Modell zu finden, ist keineswegs trivial. Wie Steve de Shazer sagt: „Einfach zu sein, ist harte Arbeit.“
Auch in anderen Wissenschaften wird mit Modellen gearbeitet, und auch dort kämpfen Wissenschaftler mit ähnlichen Problemen. Gerade in der Physik, sei es in der theoretischen Teilchenphysik oder in den mehr anwendungsorientierten Ingenieurswissenschaften, ist die Bildung eines passenden Modells der Königsweg zur Lösung. Wann vereinfache ich so stark, dass die Ergebnisse unbrauchbar werden? Was muss ich noch beschreiben? Was gehört zum System und wie sind die Randbedingungen? Muss ich das betrachtete System umfangreicher machen, weil ich ansonsten keine Aussagen über die Randbedingungen machen kann? Und wann ist das Modell so komplex, dass es nicht mehr beherrscht bzw. berechnet werden kann?
Das Verhalten eines einzelnen, konkreten Menschen nun kann grundsätzlich nicht berechnet werden, denn es ist chaotisch. Vorhersagen sind also unmöglich, man kann nur statistische Aussagen machen. Wenn ich also einen Menschen dabei begleiten möchte, wenig hilfreiches Denken und Verhalten abzulegen, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich mit ihm auf ein Modell zu einigen, das ihn für die vorliegende Fragestellung „gut genug“ beschreibt. Nur so können wir mit möglichst wenigen Missverständnissen kommunizieren.
Dabei darf niemand das Modell mit der Wirklichkeit verwechseln. Wie eine Landkarte die Wirklichkeit immer vereinfacht darstellt – das ist ihr Sinn, denn ein 1:1-Modell einer Landschaft wäre wenig hilfreich, ja sogar nutzlos – stellt auch ein Modell nur einzelne Aspekte der Wirklichkeit dar, verzerrt andere oder lässt sie ganz aus. Wenn ich auf Deutschlands Autobahnen fahren möchte, werde ich zu einer Übersichtskarte greifen, die die Autobahnen darstellt. Diese sind aber viel zu dick gezeichnet, denn wenn ich Deutschland so verkleinere, das es auf eine A4-Seite passt, wären sie zu dünn, als dass ich sie noch erkennen könnte.
Der Streit, der zwischen psychologischen Schulen immer wieder auftritt, ist ein Streit um das „richtige Modell“ des Menschen. Er ist weitgehend sinnlos, denn jedes Modell lässt gewisse richtige Schlüsse zu. Wird es aber überdehnt, also zu Aussagen missbraucht, zu denen es nicht geeignet ist, führt das zu falschen Schlüssen. Bei der Entwicklung eines jeden Modells muss man also darauf achten, nicht nur das Modell zu beschreiben, sondern auch seine Grenzen und Randbedingungen, innerhalb derer es gültig ist. Naturwissenschaftler beachten diese Regeln seit langem, Geisteswissenschaftler tun sich etwas schwerer damit.
1.1 Die Wirklichkeit als Konstrukt
Das Bild, das sich Menschen von der Welt machen, kann durchaus radikal unterschiedlich sein. Wir unterscheiden hier grundsätzlich zwischen Positivismus und Konstruktivismus, wobei das keine rein akademische Frage ist. Je nach dem Bild, das ich mir von der Welt mache, beurteile ich auch Menschen und ihre Fähigkeit, die Welt wahrzunehmen und zu beeinflussen, unterschiedlich.
Wirklichkeit ist erst einmal alles, was wirkt. Insofern sind auch unsere Empfindungen und Vorstellungen wirklich, denn sie haben Auswirkungen auf unser Denken und Handeln. Wir können also die Wirklichkeit für uns ändern, indem wir unsere Interpretation des Erfahrenen oder unserer Erinnerungen ändern. Das kann zu einer bedeutungsverändernden Neubewertung und der Einführung von Ressourcen führen, die zum Erlebenszeitpunkt (noch) nicht vorhanden waren. Deshalb kann der Satz: "Damals konntest Du Dich nicht wehren, heute bist Du erwachsen!" durchaus zu einer Änderung der subjektiv wahrgenommenen Vergangenheit führen.
Die Erkenntnistheorie beschäftigt sich mit der Tätigkeit des Beobachtung der Umgebung und inwieweit der Beobachter daraus Erkenntnisse über die Wirklichkeit gewinnen kann. Menschen gehen davon aus, dass die Wirklichkeit bestimmte Eigenschaften hat:
Zugänglichkeit
Die Möglichkeit, die Wirklichkeit zu erfahren und wahrzunehmen.
Intersubjektivität
Die Überzeugung, dass das, was ein Beobachter mit seinen Sinnen aufnimmt, auch von anderen genau so wahrgenommen wird.
Verlässlichkeit
Die Sicherheit, dass sich nichts ohne Ursache ändert und dass heute noch gilt, was gestern gegolten hat.
Erst wenn diese drei Grundsätze gelten, nehmen wir das, was wir wahrnehmen, auch als Wirklichkeit an. Dabei gibt es durchaus erkenntnistheoretische Schulen, die anderen Überzeugungen folgen. Drei gegensätzliche möchte ich hier nennen.
1.1.1 Konstruktivismus
Bei diesem Modell wird davon ausgegangen, dass der Beobachter die Wirklichkeit nicht erkennen kann, weil er die Sinneseindrücke erst in seinem Kopf zu seinem Bild der Wirklichkeit formt. Dabei wird das Wahrgenommene durch den Filter der Erfahrungen so modifiziert, dass es für den Beobachter verständlich wird.
Ein scheinbar triviales Beispiel ist das, was wir sehen. Bestimmte elektromagnetische Wellen unterschiedlicher Wellenlänge werden als verschiedene Farben wahrgenommen, andere als Wärme und wieder andere, zum Beispiel Ultrakurzwellen, können wir überhaupt nicht wahrnehmen. Hier nehmen wir technische Mittel, zum Beispiel einen Funkempfänger, zu Hilfe, um sie überhaupt nachweisen zu können. Ein Gemisch elektromagnetischer Wellen eines bestimmten Wellenlängenbereichs - des sichtbaren Lichts - wird im ersten Schritt als ein impressionistisches Bild verschiedener Farben und Helligkeiten wahrgenommen. Dieses Bild wird dann aufgrund der Erfahrung interpretiert. Das Gehirn konstruiert also aus den wahrgenommenen Farbflecken die Gegenstände, die der Beobachter schon kennt.
Der radikale Konstruktivismus geht sogar davon aus, dass möglicherweise keine Realität existiert, sondern dass wir alles, was wir wahrnehmen, in unserem Intellekt konstruieren. Wir träumen also, ähnlich wie im Film „Matrix“, die Realität. Diese Vorstellung macht jedoch jedes aktive Bemühen, die Umstände zu verbessern, überflüssig, denn nichts findet wirklich statt. Von daher ist sie für die Bewältigung unser Leben nicht zielführend.
Allerdings können wir beobachten, dass ein Ereignis von verschiedenen Personen unterschiedlich erlebt wird. Das, was wir erleben, ist also nur zum Teil die Wirklichkeit, zum anderen unsere Interpretation. So ist auch der Satz von Milton Ericson zu verstehen, dass es nie zu spät ist, eine glückliche Kindheit zu haben. Verändern wir die Bewertung des Erlebten, ändert sich damit auch unsere Erinnerung, und es scheint uns, als wäre unsere Vergangenheit eine andere geworden.
1.1.2 Realismus
Der Grundgedanke des Realismus ist, dass eine erkennbare Wirklichkeit existiert. Im Gegensatz zum radikalen Konstruktivismus geht der Realismus also davon aus, dass das, was wir erleben, auch wirklich existiert und keine Konstruktion eines wie auch immer gearteten Intellekts ist.
Die Vorstellung, dass das Erlebte sich trotzdem aus den Ereignissen und unserer Bewertung des Erfahrenen zusammensetzt, ist mit dem Realismus, genau wie mit dem „milden“ Konstruktivismus durchaus vereinbar.
1.1.3 Positivismus
Der Positivismus postuliert, dass die Wirklichkeit genau so ist, wie wir sie wahrnehmen. Das widerspricht aber jeder psychologischen Erfahrung. Jemand kann ein Ereignis als traumatisch erleben, obwohl ein andrer es als „nicht so schlimm“ wahrnimmt. Die Intersubjektivität ist also in der Regel keineswegs gegeben, obwohl wir im Alltag immer an sie glauben. Polizisten wissen das – sie glauben Augenzeugen eines Unfalls nur bedingt.
Ein Positivist kann einige systemische Grundsätze nicht gutheißen, zum Beispiel den, dass wir, wie Steve de Shazer [2009] sagt, nur dann wissen, was wir gefragt haben, wenn wir die Antwort hören. Auch der therapeutische Grundsatz der Allparteilichkeit ist nicht mehr gegeben. Wenn zwei Menschen das gleiche Ereignis unterschiedlich schildern, muss nach Überzeugung eines Positivisten einer von ihnen entweder lügen oder sich irren. Ein kluger Begleiter geht hingegen davon aus, dass die Wirklichkeit für jeden eine andre sein kann, weil sie jeder aus seiner Erfahrung heraus unterschiedlich bewertet. Für jeden ist also das, was er erlebt hat, wahr, obwohl es tatsächlich durch Erfahrungen und Prägungen gefärbt ist. Niemand glaubt an die eigene Subjektivität, deshalb ist der „Bias“, also die Fehleinschätzung, allgegenwärtig. Ein Begleiter ist allerdings, anders als ein Naturwissenschaftler, an Objektivität nicht interessiert. Für ihn ist das Erlebte des Klienten wichtig, als das durch den Klienten Gefärbte und Bewertete. Um einen Klienten begleiten zu können, braucht man dessen Wirklichkeit und nicht die scheinbar objektive.
1.1.4 Erinnerungen
An Erlebtes erinnern wir uns unvollständig. Damit unser Gehirn sozusagen Speicherplatz spart, merkt es sich nur Stichworte. Unsere Vorstellung ergänzt dann diese Stichworte zu einer vollständigen Geschichte, die uns logisch erscheint und wir dann auch erzählen kön nen. Wir glauben allerdings fest daran, dass wir uns nicht nur an die Stichworte erinnern, sondern auch an die "dazu-gedichteten" Vorstellungen. Obwohl sie variabel sind, halten wir auch sie für einen Teil der Erinnerung. Sie können sich also durchaus zu einem späteren Zeitpunkt anders darstellen.
Erinnern ist also ein adaptiv-konstruktiver Prozess. Wenn wir uns erinnern, werden die Stichworte unserer Erinnerung neu kombiniert, ihr Gefüge kann sich ändern. Das episodische Gedächtnis, das uns mit autobiographischen Erinnerungen versorgt, ist also keineswegs unveränderlich. Diese Veränderlichkeit nutzt verschiedener Therapieansätze zur Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung, um mit seiner Methode des Imaginery Rescripting quälende Erinnerungen ertragbar zu machen.
Unser Gehirn geht sogar so weit, dass es ganze Ereignisse "erfinden" und uns als Erinnerung präsentiert. Wenn die Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis fehlt, kann diese ganz aus unseren Vorstellungen als Erinnerung rekonstruiert werden, wenn wir davon überzeugt werden, dass dieses Ereignis stattgefunden hat und wir es miterlebt haben. So werden falsche Erinnerungen durch suggestive Befragungen, aber auch und besonders leicht durch manipulative Aufstellungen erzeugt. Ein Gastgeber einer Aufstellung muss sich also besonders davor hüten, das Aufstellungsgeschehen interpretieren zu wollen. Als Gastgeber aus einer Aufstellung zum Beispiel auf das scheinbar objektiv wahre Verhältnis zweier Menschen zueinander zu schließen, ist manipulativ. Selbst wenn sich die Stellvertreter entsprechend äußern, muss der Gastgeber davon ausgehen, dass diese Aussagen durch persönliche Erfahrungen der Stellvertreter und durch die Auffassung des Aufstellers gefärbt sind. Übernimmt sie der Gastgeber und stellt sie als objektiv dar, wird die Aufstellung in eine Richtung gedrängt, die möglicherweise nicht zur Lösung führt. Denn dem Gastgeber wird eine hohe Autorität zuerkannt, er hat allein aufgrund seiner Stellung die Deutungshoheit über die Aufstellung, auch wenn er das nicht möchte. Diese Autorität darf er auf keinen Fall, auch nicht unabsichtlich missbrauchen.
1.2 Modelldenken in der Begleitung
Um es noch einmal zu wiederholen: Modelle helfen den Begleitern und auch den Klienten, die Natur des Menschen zu begreifen, obwohl diese so komplex ist, dass ein vollständiges Durchdringen nicht möglich ist. Deshalb müssen wir die Modelle der Fragestellung anpassen: Was möchten wir betrachten? Welche Vereinfachungen sind also zulässig, ohne zu falschen Ergebnissen zu kommen? Was sind die Randbedingungen des Modells und wie weit reicht es?
Wir sollten uns immer wieder daran erinnern, dass ein Modell ein unvollständiges Abbild der Wirklichkeit ist und dass Vereinfachungen nicht nur zulässig, sondern sogar gewollt sind. Wir dürfen nie die Landkarte mit der Landschaft verwechseln. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Wirklichkeit abzubilden, keine ist vollkommen, jede hinkt an irgendeiner Stelle. Deshalb gibt es auch kein richtiges oder falsches Modell, wohl aber die Gefahr, das Modell falsch anzuwenden, indem wir seinen Gültigkeitsbereich überdehnen.
Als Beispiele stelle ich hier einige Modelle dar und insbesondere einige Ausprägungen der Modelle der Persönlichkeitsanteile, die auf meine Vorstellung des Inneren Systems entscheidenden Einfluss haben.
1.2.1 Das schamanische Modell
Schamanen waren wohl die ersten Begleiter der Menschen. Sie waren Ärzte, Therapeuten, Coachs und Berater, alles in einer Person. Ich möchte hier nicht auf das Weltbild der Schamanen eingehen, wer sich dafür interessiert, möge die entsprechende Literatur lesen [Harner, 1999 / Eliade, 1974]. Außerdem gibt es wohl so viele schamanische Weltbilder und Behandlungsweisen, wie es Kulturen gibt und gab, und selbst innerhalb des gleichen Kulturkreises sind von Schamane zu Schamane durchaus Unterschiede zu finden.
Interessant ist allerdings, wie Schamanen – und zwar in fast allen Traditionen, von denen man weiß – die Heilung seelischer Traumata bewerkstelligt haben. Ein Trauma hat in der schamanischen Vorstellung immer der Verlust eines Seelenanteils zufolge. Dieser hat den Schmerz und die Verletzung mit sich in die Anderswelt genommen, um den Klienten zu schützen und ihm ein normales Weiterleben zu ermöglichen. Die Seele des Klienten wird aber dadurch unvollständig, was zu Problemen führen kann. Es ist laut schamanischer Vorstellung auch möglich, dass dieses „Loch“ in der Seele durch eine fremde Wesenheit ausgefüllt wird, in bester Absicht, um die Seele wieder vollständig zu machen. Da diese Wesenheit aber fremd ist, passt sie nicht zur Seele des Klienten und führt auf die Dauer auch zu Problemen.
Die Aufgabe des Schamanen ist es nun, das Trauma zu heilen, indem er den verloren gegangenen Seelenanteil in der Anderswelt findet und ihn davon zu überzeugen, dass die verletzenden Umstände, wegen denen der Anteil gegangen ist, nicht mehr existieren. Hat sich eine fremde Wesenheit mit der Seele des Klienten verbunden, kann dieser für ihre Dienste gedankt werden und ihr versichert werden, dass ihre Dienste jetzt nicht mehr gebraucht werden. Dann kann der Schamane den verlorenen Seelenanteil zum Klienten zurückbringen und ihn mit ihm wiedervereinigen [Ingermann, 2007].
Dieses Modell hat sich bei schamanistischen Gesellschaften erstaunlich gut bewährt. Das Bestreben, die Seele eines Klienten wieder "rund" und vollständig zu machen, ist also durchaus nichts Neues. Allerdings muss der Begleiter, wenn er schamanische Methoden anwenden will, dem Klienten genau erklären, worum es bei ihnen geht und ihn in der Regel sogar zur schamanischen Arbeit ausbilden. Bei schamanisch geprägten Gesellschaften ist das nicht notwendig, hier wissen die Klienten um die entsprechenden Vorstellungen und Methoden.
Das Modell und das daraus resultierende Vorgehen ist erstaunlich modern und könnte sogar von heutigen Begleitern als sinnvoll angesehen werden. Denn auch moderne Psychotherapeuten betonen, dass Traumata dissoziiert, also aus dem Bewußtsein verdrängt, werden. Was moderne Begleiter allerdings ablehnen werden, ist die Vorstellung einer Anderswelt, obwohl die Landschaften des „Katathymen Bilderlebens“ inklusive des „Sicheren Ortes“ der schamanischen Anderswelt zumindest teilweise entsprechen. Ein wesentlicher Unterschied ist allerdings, dass erstere nur in der Vorstellung des Klienten existieren, während die Anderswelt als real und außerhalb des Klienten existierend angesehen wird.
1.2.2 Das Modell der Archetypen
Archetypen können Rollen und Funktionen eines Menschen charakterisieren. Anstelle komplizierter Beschreibungen und Aufzählungen benutzt man eingängige Bilder, über deren Funktion weitestgehende Einigkeit herrscht, da sie eine urtümliche Struktur von Handlungsmustern beschreiben und idealtypisch eine Idee beschreiben. Die Quellen solcher Archetypen sind Mythen, Märchen und Sagen. Um Menschen beziehungsweise deren Verhalten zu charakterisieren, benutzt man gerne gesellschaftliche Archetypen wie König, Magier, Narr oder Krieger. Andere Archetypen werden zur Beschreibung von Zuständen genutzt wie Licht und Schatten, Farben, aber auch Landschaften wie der Wald, das Gebirge, der See oder das Meer. C.G. Jung hat den Begriff des Archetyps in der Psychologie eingeführt.
Die Benutzung von Archetypen kann die Verständigung sehr vereinfachen, in bestimmten Fällen ist sie allerdings nicht angebracht. So hat eine Person aus einem anderen Kulturkreis möglicherweise völlig andere Mythen und Märchen verinnerlicht und kennt die bei uns geläufigen Archetypen entweder gar nicht oder mit einer anderen Funktion. Man hüte sich also vor "falschen Freunden", denn diese gibt es nicht nur in anderen Sprachen, sondern auch in anderen Kulturkreisen. So hat zum Beispiel im Deutschen der Wald völlig andere Nebenbedeutungen wie in anderen Kulturen, selbst wenn sie europäisch sind.
Ein ernsthaftes Problem ist, dass inzwischen viele junge Menschen die traditionellen Sagen und Märchen nicht mehr kennen, dass ihnen also auch die davon abgeleiteten Archetypen unbekannt sind. Eine Be zeichnung, die für uns ein Archetyp ist, kann für junge Menschen entweder gar keine oder eine völlig andere Bedeutung haben.
Deshalb verständige ich mich mit Klienten nur insoweit via Archetypen, als ich sicher bin, dass wir ein zumindest weitgehend deckungsgleiches Verständnis einer solchen Figur haben. Wenn für einen Klienten zum Beispiel ein König nur ein Typ auf einem Thron mit einer Krone auf dem Kopf ist, ihm aber die weitergehende Bedeutung dieses Archetyps als die das Land heilende und nährende Kraft, als Garant für Gerechtigkeit und Sicherheit, als Quelle der Weisheit und Hüter der Tradition fehlt, brauchen wir uns über Missverständnisse nicht zu wundern. Dann müssen wir die Aschearbeit machen und genau und wortreich definieren, was wir meinen. Für uns selbst können wir natürlich die Archetypen weiterhin nutzen, da sie ausgezeichnete Eselsbrücken sind.
1.2.3 Das psychoanalytische Modell
Der Psychoanalyse legte Sigmund Freud um 1890 ein Modell des menschlichen Denkens zugrunde, das in der damaligen Zeit total neu und spektakulär war. Heute sind seine Vorstellungen fast in den Alltag übernommen worden, man darf aber nicht vergessen, dass es zu Beginn seiner Tätigkeit noch nicht lange her war, dass man psychische Erkrankungen mit der Charakterkunde auf Basis der Vier-Säfte-Lehre von Galens behandelte.
Freud teilt in seinem Modell die Psyche des Menschen in drei Bereiche:
Das Ich
Mit diesem Anteil ist der kritische Verstand gemeint, die eigentliche bewusste Persönlichkeit, die handelt und dabei Triebverzicht oder –aufschub übt. Sie ist geprägt vom Realitätsprimat und der Kontrolle über ihre Handlungen.
Das Es / Unbewusste
Dieser Bereich wird von Reizen getriggert und will ihre Bedürfnisse und ihre Libido ausleben. Dieser Teil arbeitet allein nach dem Lustprinzip und ist vom Ich nur bedingt zu steuern. Für die damaligen Menschen war es schwer vorstellbar, ja sogar schwer erträglich, dass es Bereiche der menschlichen Psyche geben sollte, die vom Intellekt nicht erreichbar sind.
Das Über-Ich
Dieser Bereich versucht die Ver- und Gebote durchzusetzen. Er wird geprägt durch Moralische Instanzen und Forderungen. Er setzt Werte und Normvorstellungen durch, die den Menschen nach den Regeln steuern, mit denen er sozialisiert wurde, die er also von Eltern und Gesellschaft von frühester Kindheit an übernommen hat.
Das Selbst
Das Selbst ist die Vereinigung der drei Ich-Anteile, also die gesamte Psyche des Menschen.
Freud wird heute in vielen Punkten abgelehnt, und er hat sich sicherlich auch in vielen Punkten geirrt, was der Zeit geschuldet ist, in der er gewirkt hat. Seine bürgerliche Herkunft hat ihn verschiedene Dinge einseitig sehen lassen. Man muss ihm aber zugutehalten, dass er das Modelldenken wieder in die Psychologie eingebracht hat. Seine Lehren aber haben sich in den Methoden der Tiefenpsychologie weiterentwickelt.
1.2.4 Das Modell der Transaktionsanalyse
Eric Berne hat Mitte des 20. Jahrhunderts [Dehner, 2013] mit der von ihm entwickelten Transaktionsanalyse das Freudsche Menschenmodell erheblich erweitert und modifiziert. Während für Freud das Bestimmende im Verhalten der Menschen ihre Triebe waren, legte Berne mehr Wert auf die Transaktion, also die Kommunikation unter den Menschen. Dabei war ihm – anders als Freud – weniger die Bedeu tungsebene der Kommunikation wichtig, also das, was man aufschreiben kann, als die nonverbale Beziehungsebene. Heute ist man sich darüber im Klaren, dass bei einem persönlichen Gespräch der weit größere Anteil (circa 80%) der Inhalte nonverbal übermittelt werden.
Das funktionale Modell der Psyche eines Menschen sieht auch die Transaktionsanalyse dreigeteilt, wobei die drei Teile noch weiter spezifiziert werden:
Das Eltern-Ich
Das Eltern-Ich hat Ähnlichkeiten mit dem Freudschen Über-Ich, wobei seine Entstehung bei Berne stärker auf die Eltern personalisiert ist.
Er unterscheidet zwischen dem fürsorglichen Eltern-Ich, das das Gegenüber liebevoll pflegt und beschützt, und dem steuernden Eltern-Ich, das Regeln und Anweisungen gibt. Kinder lernen durch Erziehungspersonen idealerweise beide Eltern-Ich-Anteile kennen und verinnerlichen sie, sodass sie ihnen in ihrem Erwachsenen-Leben beide zur Verfügung stehen.
Das Erwachsenen-Ich
Das Erwachsenen-Ich denkt logisch, nimmt Informationen auf und gibt sie weiter, wobei es sich völlig sachlich verhält. Es kennt keine Leidenschaften und Gefühle und trifft rein vernunftgesteuerte Entscheidungen und wird nicht weiter unterteilt.
Das Kind-Ich