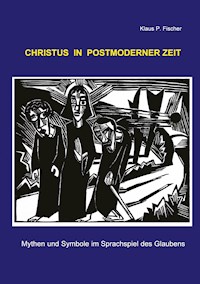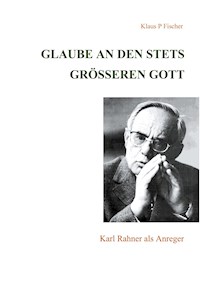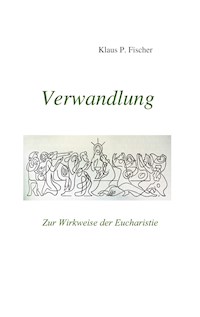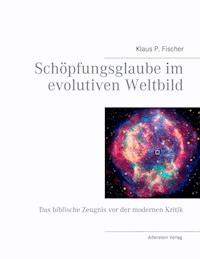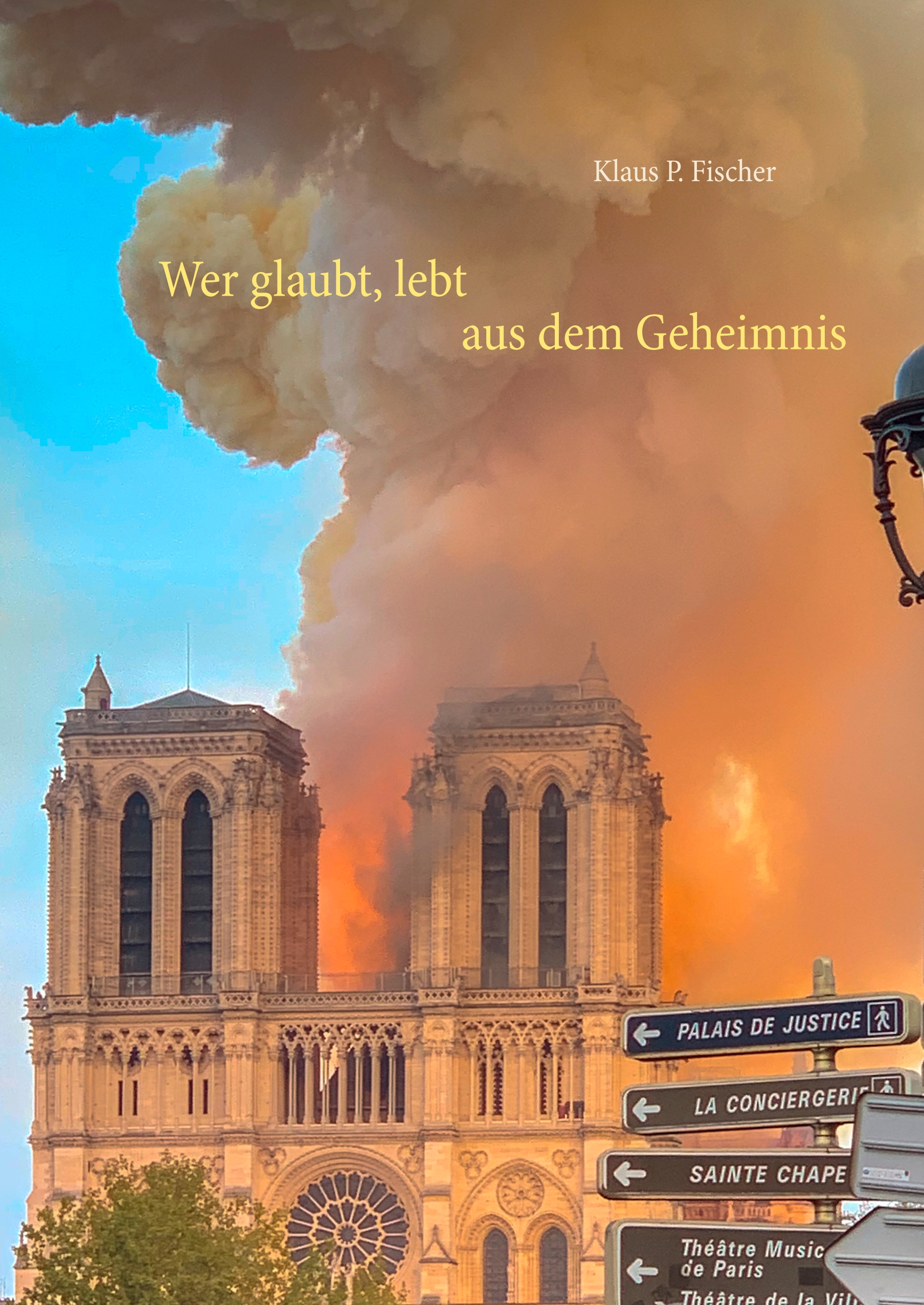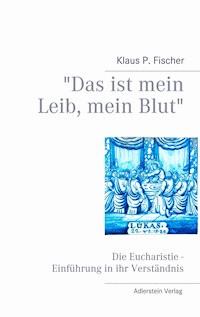
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Büchlein will durch die Erläuterung der zentralen biblischen Texte Erkenntnisse fördern, die ein grundlegendes Verständnis der Eucharistiefeier von ihren frühesten Anfängen an ermöglichen. Dabei kann es zu neuen und überraschenden Einsichten kommen. Wer seinen Glauben verstehen und zu einem soliden, selbständigen Urteil finden will, sollte sich in dieses Büchlein vertiefen. Herausgeber: Hans-Jürgen Sträter, Adlerstein Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wir hören dich fragen:
Was wollt ihr hier
beim Mahle?
Was sollen
wir wollen?
Dich, Herr.
Wir fragen: Wo wohnst du?
Dich fasst doch kein Kelch,
keine Schale.
Du sagst: Kommt, esset, dann seht
ihr und wisst,
dass euer Glaube, wo immer ihr geht
und leidet und liebt,
meine Wohnung ist.
Darin bleibt ihr
in mir.
(Silja Walter, zu Joh 1,38-39)
VORWORT
Eine alte, pastorale Grundregel offizieller Kreise in der katholischen Kirche besagt, es gelte alles zu vermeiden, ja zu verhindern, was die Gläubigen verwirren könne.
Dieser bewährten Regel zuwider werden die Katholiken seit einiger Zeit von verwirrenden Nachrichten heimgesucht. Fast fünfzig Jahre nach der Liturgie-Reform des II. Vatikanischen Konzils wird die „alte Messe“, d.h. die vorkonziliare Messform – in den Augen von Traditionalisten „die Messe aller Zeiten“ – , gegen den Widerstand auch vieler Bischöfe wieder zugelassen, mit der Maßgabe, diese „alte Messe“ neben der „neuen Messe“ hochzuhalten und im Bewusstsein der Gläubigen als gleichwertige, obschon bloß „außerordentliche“, Feierform zu verankern.
Das mit diesem Toleranz-Edikt` einhergehende Problem liegt (wie der grimmige Widerstand von Traditionalisten zeigt) darin, dass bedeutsame Einsichten der Theologen und Liturgiker, durch biblisch-urkirchliche und ökumenische Studien befördert, zu der vom Konzil beschlossenen, liturgischen Erneuerung geführt haben.
Die Liturgie-Reform verdankt sich also einem vertieften Glaubensverständnis. Für pastoral Erfahrene liegt es auf der Hand, dass mit der Zulassung der vorkonziliaren Form auch die damals zugunsten besserer Einsicht zurückgestellten, älteren Vorstellungen und Auffassungen über Inhalt und Zweck der hl. Messe wieder hochkommen und sich ausbreiten werden. In eine aus gutem Grund verlassene Form kann man nicht zurückkehren (wie in ein Kostüm), ohne den historisch ihr zugehörigen Inhalt wieder mit aufzunehmen und weiter zu transportieren.
Verwirrung und Streit unter Gläubigen sind in diesem Rahmen leicht absehbar. Dies umso mehr, als das Echo von katholischen und auch evangelischen Teilnehmern an Vortrags- und Fortbildungsveranstaltungen des Verfassers über das Thema Eucharistie in den letzten Jahren gezeigt hat, dass die Unsicherheit der Christen in Bezug auf das Verständnis der Eucharistie beträchtlich und ihr erklärtes Bedürfnis nach tieferem Verständnis dessen, was man glaubt und glauben soll, überraschend hoch ist (jedoch von nicht wenigen Verantwortlichen immer wieder unterschätzt wird).
Der Verfasser möchte auf den folgenden Seiten zusammenfassen und weiteren Kreisen zugänglich machen, was in den oben genannten Vorträgen und Tagungen von den Teilnehmern als wesentlicher Erkenntnisgewinn auf dankbares Echo gestoßen ist. Eine Veröffentlichung in Buchform muss zwar bemüht sein, die wichtigste Fachliteratur zum Thema einzubeziehen. Der Haupttext ist jedoch allgemeinverständlich gehalten, verlangt freilich Geduld und Konzentration. Interessierte Leser, die keine Fachleute sind, brauchen über die erhebliche Anzahl der Anmerkungen nicht zu erschrecken. Sie sind sämtlich fachlich gehalten und können ohne Abstriche am Verständnis des Haupttextes übergangen werden.
Das gilt auch für die wenigen, ausgewiesenen Anmerkungen, die wegen ihrer Länge – aber in kleinerem Druckbild – in den Haupttext eingefügt sind.
Das II. Vatikanische Konzil nennt die Eucharistie „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“. Vielleicht wird dieser Kernsatz durch die Lektüre der nachfolgenden Darstellung deutlicher und durchsichtiger. Diese würde dann zu einer Hilfe dafür, sich in der erwähnten verwirrenden Situation zurechtzufinden.
Dem Verfasser liegt daran, die Leser darauf hinzuweisen, dass sich in der Eucharistie das zentrale „Geheimnis des Glaubens“ sowohl auftut wie verhüllt. Dieses wird nur von den „Augen des Glaubens“ geschaut und – wie Pascal mit älteren Vorgängern betont – vom liebenden Herzen berührt.
Die Eucharistie lässt sich in der Tiefe nur verstehen, wenn sie nicht bloß in Kirchenräumen begangen, sondern auch in Form und Inhalt der Lebensgestaltung von Christen übersetzt wird.
Hinweis: Bibelzitate sind, wo nicht anders angegeben, vom Verfasser übersetzt.
Heidelberg, am Fest des hl. Philipp Neri 2011
Der Verfasser
INHALT
Einführung
1. Die Struktur
2. Art und Bedeutung des Opfers
2.1 Dankendes Gedenken
2.2 Das Mahl als Sinnbild
2.3 „Mein Leib“
2.4 „Mein Blut“
2.5 Die Sendung Jesu unter dem Blickwinkel des Opfers
2.6 ´Messopfer` als Sühne?
2.7 Erinnerung oder Gedächtnis?
3. Vom Sinn der „Wandlung“
Literaturnachweis
Einführung
Dem abendländischen Kulturkreis ist es eigentümlich, dass man sich mit gleichnishaft-symbolischer Sprache und Rede schwer tut. Typisch sind Redewendungen wie „Ich glaube nur, was ich sehe, was ich riechen, tasten, greifen kann“. Als real gilt die mit den Sinnen (Augen, Ohren ...) und ihnen entsprechenden Messinstrumenten zugängliche Welt. Dass es sich mit einer Sache anders verhalten kann, als Anschauung und Sinne sie bieten, geht den Menschen schwer ein. An manches Umdenken hat man sich oberflächlich gewöhnt, ohne es ganz zu glauben. Man denke an manche Erscheinungen der Natur, wie „Sonnen-Aufgang“ und „Sonnen-Untergang“.
Wir halten uns nach wie vor an den Sprachgebrauch (zB im Kalender, in Wetterprognosen), obwohl die Physik lehrt, die Sonne bewege sich nur scheinbar, es sei die – für uns nicht unmittelbar wahrnehmbare – Rotation unseres Planeten, welche den Eindruck von Sonnen-Aufgang und Untergang erzeuge (daher verweigerte sich der gesunde Menschenverstand` früher schon dem Domherrn Kopernikus).
Und wenn die Astro-Fotografie etwa eine Farbaufnahme unserer Nachbar-Galaxie – des Andromeda-Nebels – bietet, wir aber dabei hören, wir sähen diese Galaxie nicht im heutigen Zustand, sondern in ihrem Zustand vor mehr als zwei Millionen Jahren (so lange sei ihr Licht zu uns unterwegs), so sträubt sich der Normalverbraucher` gegen diese Behauptung, mutet sie ihm doch zu, zu glauben, etwas, das man jetzt fotografieren könne, sei gar nicht jetzt, im Moment der Aufnahme, wirklich, ja es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Objekt heute, da wir das Foto betrachten, ganz anders aussehe, möglicherweise gar nicht mehr existiere.
Ähnliche Auffassungsschwierigkeiten haben die meisten Leute auch bei religiösen Themen, etwa mit der sogenannten „Wandlung“ in der hl. Messe – nämlich zu erfassen, wie jene Worte, die als „Wandlungs-Worte“ deklariert werden, zu verstehen seien.(1)
Seit dem frühen Mittelalter zeigten sich Theologen und Philosophen bemüht, zu ergründen, was sich ereigne, wenn der Priester (damals auf Latein) im Namen Jesu Christi über das Brot die Worte spricht „Das ist mein Leib“, über den Kelch „Das ist mein Blut“; wie dieser Wechsel der Subjekte und Bezeichnungen – Brot / Leib Christi; Kelch (Wein) / Blut – zu verstehen sei. Ist das eine „nur symbolische“, bildliche Redeweise – oder ist das Brot dann, d.h. nach dem Aussprechen der Worte, „real“ der Leib Christi, ist der Wein dann „real“ das Blut Christi? Wegen des „ist“ (lat. „est“) rang man sich, gegen alle Versuche einer symbolischen Auffassung, durch zu einer „realistischen“ Deutung. Auch wenn das Brot für die Sinne Brot bleibe und der Wein Wein, sei zu glauben, es handle sich „jetzt“ um Leib und Blut Christi „in Wirklichkeit“ – freilich unsichtbar, da ja für die Sinne nicht wahrnehmbar.
Deshalb betonte im 13. Jahrhundert Thomas von Aquin im berühmten Lied „Pange, lingua“ (Preise, Zunge): durch das Wort („verbo“) werden wirkliches Brot zu Christi Fleisch, Wein zu seinem reinen Blut, auch wenn die Sinne hier versagen („si sensus deficit“/ „sensuum defectui“); der reine Glaube genüge („sola fides sufficit“), und der Glaube möge das für die Sinne ungreifbare Hinzukommende – Leib und Blut Christi – gewähren („praestet fides supplementum“).
Europäischer Verstand sagt also: dass die Brothostie zu Jesu wirklichem Leib usw. „verwandelt“ werde, lässt sich nicht beweisen, man kann es nur – oder muss es eben – glauben. Daraus nährt sich die verbreitete Vorstellung, glauben heiße, Unbeweisbares für wahr halten. Sagt nicht der Hebräerbrief etwas Ähnliches, wenn es heißt, Glaube (pístis) sei „Beweis“ oder „Rechenschaft“ (élenchos) über Dinge, die man nicht sieht (Hebr 11,1)?
Allerdings war für das Glaubens-Verständnis damit nicht allzuviel erreicht. Denn wie sollte man sich das Geschehen vorstellen? Da Brot und Wein in ihrer materiellen Beschaffenheit ja erhalten bleiben, sollte man vielleicht annehmen, dass Leib und Blut Christi unsichtbar unter` Brot und Wein oder neben` ihnen zu stehen kommen (so dachten Luther und viele andere)? Das aber hieße, vier Dinge (oder Substanzen) nebeneinander, in Parallele, anzunehmen: zwei sichtbare, zwei unsichtbare.
Das Problem lag darin, dass man Brot und Leib Christi sowie Wein und Blut Christi nebeneinander stellte und sich fragte, wie es möglich sei, dass das jeweils Zweite (Leib/Blut Christi) aus dem Ersten werde, das Sichtbare (Brot, Wein) in das Unsichtbare (Leib, Blut Christi) übergehe oder sich wandle. Thomas von Aquin schlug vor, die „Wandlung“ meta-physisch zu deuten: Leib und Blut Christi wären wirklich hinter oder jenseits der physischen Dinge, und zwar (nach Art der aristotelischen Philosophie gedacht) als das übernatürliche „Wesen“ (griechisch: hypokeímenon, lateinisch: substantia) von Brot und Wein.
Durch die „Wandlung“ würden Leib und Blut Christi zum neuen „Wesen“, zu der nur dem Glauben fassbaren, übernatürlichen „Substanz“ (= Christus) von Brot und Wein. Die physischen Substanzen Brot und Wein würden durch die „Wandlung“ gleichsam degradiert zu bloßen „Akzidentien“, das heißt, zu bloß physischen, äußerlichen, nebensächlichen Eigenschaften der „wahren Substanz“ Leib und Blut Christi. So kam es zu einem neuen theologischen Begriff, nämlich „Transsubstantiation“: durch die „Wandlung“, veranlasst durch die Worte „Das ist mein Leib, mein Blut“, würden die physischen Substanzen Brot und Wein überwunden und zu bloß natürlichen Eigenschaften heruntergestuft, an die Stelle der Substanzen Brot und Wein träten nun die Substanzen Leib Christi und Blut Christi.
Weil man auf katholischer Seite den Eindruck hatte, die Theologen der Reformation würden die Realität der „Wandlung“ in Frage stellen und damit den Heilswert der Messfeier aushöhlen, formulierte das Trienter Konzil, der Vorgang der „Wandlung“ werde „sehr treffend“ (aptissime) „Transsubstantiation“ genannt, denn es gehe um die „wunderbare und einzigartige Wandlung (conversio) der ganzen Brotsubstanz und der ganzen Weinsubstanz in Leib (corpus) und Blut [Christi], wobei selbstverständlich der Augenschein (species) von Brot und Wein erhalten bleibt“ (Sess. XIII, can. 2).
Der Glaube suchte sich also an das Unvorstellbare zu gewöhnen, dass die Elemente Brot und Wein nach wie vor anwesend sind, dass sie jedoch von der „Wandlung“ an unsichtbar, im tiefsten Inneren, nicht weniger real Leib und Blut Christi seien. Zwangsläufig aber wird mit dieser Deutung das Glaubensverständnis bei nicht wenigen Gläubigen ein Stück weit verdinglicht.
Kindlicher Glaube wollte sich vorstellen, wie Christi (unsichtbarer) Leib in der kleinen Hostie Platz finde. Kindern wurde häufig erklärt, nach dem Kommunionempfang bleibe Christus einige Minuten in der Seele, bis eben die Verdauung der Hostienscheibe abgeschlossen sei (s. Katechismus der Kath. Kirche Nr. 1377).
Fromme Phantasie und Erwartung, von der metaphysischen Erklärung eingeengt, forderten mehr, wollten den unsichtbaren Christus wenigstens gelegentlich schauen und harrten darauf, dass er – durch ein neues Wunder (so wie vor den Oster-Zeugen) – sich den Menschenaugen für einen Augenblick sichtbar mache (so machten da und dort Nachrichten von Hostien- und Blutwundern die Runde). Vielen Menschen fällt abstraktes, metaphysisches Denken schwer, sie begreifen nicht, dass mit der „Wandlung“ Christus den „Akzidentien“, d.h. den Kategorien von Raum und Zeit, entzogen ist, während das Sicht- und Greifbare eben Brot und Wein bilden (Thomas von Aquin(2):
Christus ist im Sakrament keineswegs [nullo modo] örtlich [localiter] gegenwärtig).
Doch hat sich ein weiterer Nachteil dieser Deutung („Transsubstantiation“) eingestellt. Im Laufe der Jahrhunderte ist auch eine Wandlung des Begriffes „Substanz“ geschehen. Die Naturwissenschaft hat sich des ursprünglich metaphysischen Begriffes Substanz bemächtigt, und so versteht heute der Sprachgebrauch unter Substanz ein Stück Materie, einen nicht näher bestimmten Stoff, ein chemisches Präparat.
Um die Mitte des 20. Jahrhunderts stellten zumal holländische Theologen unter Hinweis auf die begrenzte Verwendbarkeit von Kategorien altgriechischer Philosophie in der Theologie neben den Begriff „Transsubstantiation“ ergänzend die Begriffe „Transfinalisation“ und „Transsignifikation“. Damit war die neue, zuvor nicht dagewesene („trans“) Zielsetzung und Bedeutungssetzung für Brot und Wein angesprochen, die mit der „Wandlung“ erreicht werde.
Der Blick richtete sich nicht mehr nur auf das gewandelte Ding`, sondern auf Sinn und Zweck des Vorgangs bzw der Handlung des Zelebranten für die gläubig feiernde Gemeinde.
Die neuen Termini zielten auf die Bedeutung, welche das als „Wandlung“ deklarierte Geschehen für die christliche Existenz gewinnt.(3)
Mit den oben genannten, neuen Begriffen versuchte die dogmatische Theologie einen Schritt, um neue Erkenntnisse der biblischen und historischen Theologie aufzunehmen. Denn die Wiederentdeckung der alttestamentlich-jüdischen, überhaupt der biblischen Welt, des realsymbolischen Denkens, des urkirchlichen Verständnisses der Eucharistie, im Verein mit betont personalem Denken, hat zu einer tiefgehenden Erneuerung des Verständnisses der Eucharistie geführt, die hilfreich ist, weil sie die Feier durchsichtig macht und gleichzeitig das christliche Lebenskonzept zwanglos aus ihrem Gehalt entspringen lässt. Freilich wird von manchen beklagt, die moderne Liturgiewissenschaft anerkenne nur das Alte als ursprungsgemäß-maßgeblich, nicht aber das im Mittelalter und vom Trienter Konzil Entwickelte. Es komme zu fragwürdigen Rekonstruktionen des Alten, welche „die lebendig gewachsene Liturgie auflösen“ würden.
In den Jahrzehnten nach dem 2. Vatikanischen Konzil (Liturgie-Reform) ist es verschiedentlich zu Missbräuchen bei liturgischen Handlungen, zumal bei der Messfeier, gekommen – Missbräuche von Seiten liturgisch unkundiger und strukturblinder Zelebranten, angesteckt von einem revoluzzerhaften` Geist.
Doch kommt man nicht umhin, die Erkenntnisse der Liturgiewissenschaft ernst zu nehmen und aufzugreifen, statt die Dinge beim vorkonziliaren Status quo zu belassen, als wäre dieser nicht mehr entwicklungsfähig. Man wird sehen, dass das Wunder – wie es der Glaube nennt – dadurch nicht kleiner, sondern größer wird.