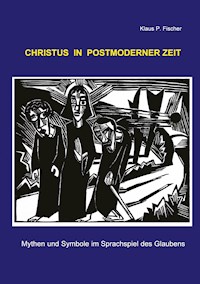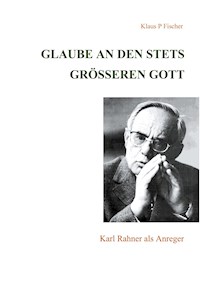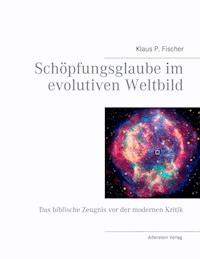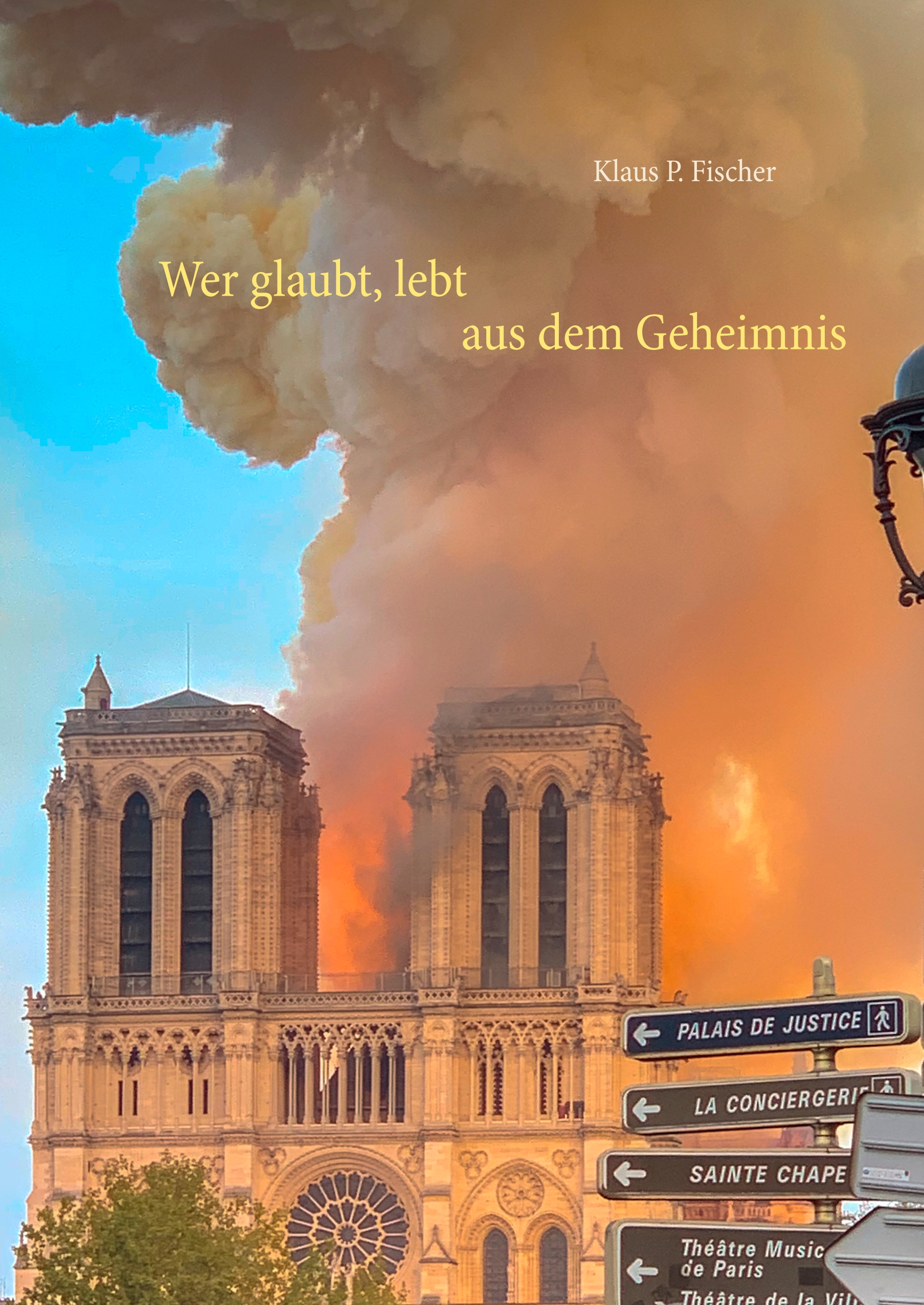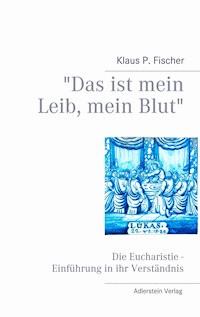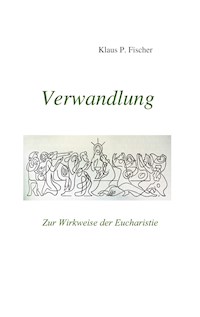
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Mit Ihrem kraftvollen Buch zu Abendmahl/Eucharistie haben Sie mir eine große Freude bereitet! Unsere inhaltlich-theologische und ökumenische Verbundenheit sehe ich als großes Geschenk an. Prof. em. Dr. Dr. Dres. h.c. Michael Welker (Universität Heidelberg,Theol. Fakultät) an den Verfasser. Verwandlung ist ein wichtiger Begriff der Bibel: Gott wendet ein Geschick oder verwandelt Klage in Tanz; Jesus verwandelt Wasser in Wein; Christen sollen sich wandeln lassen zu neuem Denken (Paulus). Katholische Christen kennen den Begriff (Ver-)Wandlung vor allem als Zentralbegriff der Eucharistiefeier. Erfahrungsgemäß tun sich aber viele schwer mit metaphysischen Vokabeln (Wesen, Substanz), die für die Erklärung herangezogen werden. Vielleicht lässt sich das, was die kirchliche Lehre meint, auch in einer mehr biblischen Denk- und Sprachform darstellen. Herausgeber: Hans-Jürgen Sträter, Adlerstein Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Einleitung
„Brot bleibt Brot“?
Die Welt der Symbole
Verlust der Symbole durch Abstraktion
Kindlicher oder erwachsener Glaube?
Transsignifikation und die biblische Sicht
Zur Struktur der Eucharistie
Das Mahl als Sinnbild
„Mein Leib“, „mein Blut“
Opfer
„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“
Zum Verständnis der „Verwandlung“
Das Sühne-Motiv in der „Wandlung“
Zusammenfassung
Literaturhinweise
Zum Autor
EINLEITUNG
Die Kirche mit ihrer 2000 Jahre umspannenden Geschichte der Glaubensüberlieferung, die sie mit großer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit betreibt, gibt ungern dem Gedanken Raum, das „Geheimnis des Glaubens“, das sie den Menschen nahebringt, lasse vielleicht noch andere Annäherungen zu als jene, die gewohnt und bewährt erscheinen, ja für viele als „offiziell“ gelten.
Allerdings gehört zur Tradition auch das IV. Laterankonzil (von 1215), das, indem es den unfassbaren Abstand zwischen Schöpfer und Geschöpf betont, die Warnung ausspricht, Aussagen, die für die Menschenwelt gelten, seien nicht in gleichem Sinne auf Gott übertragbar, weil jede Ähnlichkeit zwischen Gott und Mensch von einer noch größeren Unähnlichkeit zwischen ihnen überholt werde.
Verhält es sich aber so, können kirchliche Glaubensaussagen und Definitionen nicht derart verbindlich sein, dass keine andere, ihrem Sinn entsprechende, vielleicht sogar treffendere sie ergänzen, womöglich ersetzen könnte.
Der Traditionalismus, der dies bestreitet, ist dadurch gekennzeichnet, dass er historisch einmal gefundene, ja erkämpfte Definitionen für unüberholbar, nicht ersetzbar ansieht. Für ihn ist die ´Sache Gottes` in offiziell gewordenen sogenannten Traditionsformeln erschöpfend ausgesagt, sicher verpackt und nur so zugänglich.
Wird zum Beispiel in der Eucharistie-Feier der Begriff „Wandlung“ auf die Mitte des Hochgebets (Kanon) bezogen und (mit Thomas von Aquin) als „Transsubstantiation“ gedeutet, so erschließt sich diese Deutung mit allen Konsequenzen allerdings nur jemandem, der die aristotelisch-thomistische Metaphysik mit der Unterscheidung von Substanz und Akzidenz genau verstanden und verinnerlicht hat. Deutet man den nach der „Wandlung“ vergegenwärtigten „Leib Christi“ als übernatürliche „Substanz“, bleibt aber undeutlich, was es mit deren (übernatürlichen) Akzidenzien für eine Bewandtnis haben soll. Dass der durch die „Wandlung“ realisierte „Leib Christi“ örtlich zugegen oder fassbar sei, wird ja von Thomas selbst verneint.
Allerdings bestand die katholische Kirche, reformatorische Alternativ-Deutungen im Blick, auf dem Trienter Konzil darauf, das Interpretament „Transsubstantiation“ gebe den kirchlichen Glauben „sehr treffend“ wieder.
Die Frage ist nur, ob das, worauf sich der eucharistische Glaube bezieht, in seiner Fülle, in seinem Reichtum in jenen metaphysischen Begriffen schon zum Ausdruck kommt – kommen kann oder ob es Übersetzungen und Sichtweisen gibt, die das Schema „Transsubstantiation“ ergänzen und bereichern.
Nun gab und gibt es in allen Rängen stets Gläubige, die mit inniger Besorgnis an einmal erlernten und gewohnten Begriffen und Vorstellungen hängen. Diese sind für sie wie eine Wohnung, in der man sich zuhause fühlt. Weil man sich auf die einmal definierte und akzeptierte kirchliche Glaubenslehre verlässt, kann man sich anderen Lebensbereichen zuwenden.
Manchmal ist das Haften an traditionellen Formeln auch bequem:
Nachdenken kann Zweifel vermehren. So erscheint es gesünder und einfacher, als Gottes Offenbarung nur jene Definitionen anzuerkennen, mit denen sich das kirchliche Lehramt einmal identifizierte.
Ein Problem dieser Denkweise, die vom IV. Laterankonzil implizit abgewiesen wird, zeigt sich darin, dass sie solchen Christen keine Verständnis-Hilfe anbieten kann, die unter einem anderen geistes- und kulturgeschichtlichen Horizont leben und denken, denen daher frühere, unter einem anderen Geisteshorizont gewonnene Denkformen (zB metaphysischer Art) wenig zugänglich, womöglich verschlossen sind. Die Herausforderung des Glaubens reduziert sich dann auf Annahme oder Ablehnung der ´Verpackung`, das heißt, bestimmter tradierter Formulierungen und Vorstellungen, die mit der „Glaubenswahrheit“ selbst praktisch gleichgesetzt werden. Die Unverständlichkeit einer bestimmten Tradition wird dann zum „Geheimnis des Glaubens“ gezählt, der Glaube selbst gerät zum Gegenstand eines religiösen Positivismus.
Den Positivismus aber haben etwa die Naturwissenschaften schon hinter sich gelassen. Ihre Experten haben erkannt: Wollen sie die Ordnungs-Strukturen der Natur sprachlich fassen, müssen sie sich „mit Bildern und Gleichnissen begnügen, fast wie in der religiösen Sprache“ (W. Heisenberg).
Denn Wissenschaftler „sehen nur gewisse Fußabdrücke von etwas uns Verborgenem und Unbegreiflichem“ (H.P. Dürr), die noch dazu in hohem Grade ihre eigenen Fußspuren sind (A. Eddington), nämlich „innere Scheinbilder oder Symbole der äußeren Gegenstände“ (H. Hertz).
Was für die Erkenntnis der Natur gilt, gilt umso mehr von der Berührung mit Gott. Nicht bloß, weil er schlichte Zuhörer hatte, sondern weil Gott Gott ist, redete Jesus in Bildern und Gleichnissen, statt Definitionen einzuüben. Selbstverständlich benötigt die Theologie, wie andere Wissenschaften auch, Definitionen, um darin Erkenntnisse festzuhalten, die einen Klärungsprozess durchlaufen haben. Definitionen sind aber, wie der Name sagt, Abgrenzungen, das heißt aber, Ausgrenzungen aus dem unumfassbaren Ganzen der Wirklichkeit Gottes oder auch der Schöpfung. Damit begrenzen Definitionen im Grund ihre eigene Gültigkeit.
Das 2. Vatikanische Konzil wurde, um den programmatischen „Sprung nach vorn“ zu schaffen, durch die Eröffnungsansprache des Papstes an die Notwendigkeit erinnert, die „Substanz“ des kirchlichen Glaubensvermächtnisses wohl zu unterscheiden von der sie „einkleidenden Formel“. Von dieser Unterscheidung geleitet, stellte es mit überwältigender Mehrheit fest, dass Gottes Geist auch in den von Rom getrennten Kirchen wirkt und dort „die Reichtümer Christi“ aufschließt. Daher sei es „heilsam“, mit diesen Kirchen – und so auch mit Gottes Geist – in engen Kontakt zu treten, damit sich die eigene Kirche fortwährend erneuern könne. Das betreffe auch „die Art der Lehrverkündigung“, „die von dem Glaubensschatz selbst genau unterschieden werden“ und daher „zu gegebener Zeit sachgerecht und pflichtgemäß erneuert werden“ müsse (Ökumenismus-Dekret Nr. 4-6).
Das kann nur bedeuten, dass auch theologische Formeln und Aussagen fortgesetzter Erneuerung bedürfen, da sie nicht wie selbstverständlich und restlos mit „dem Glaubensschatz selbst“ identisch sind, der ja das Geschenk des stets größeren Gottes (Deus semper maior) ist.
So wie das Konzil den Reichtum der Glaubenserkenntnis in den von Rom getrennten Kirchen rühmt, ist dieser Reichtum auch in der in Jahrtausenden gesammelten Gotteserkenntnis Israels zu finden. Dieses reiche „gemeinsame geistliche Erbe“ von Juden und Christen hält das Konzil in einer eigenen Erklärung ausdrücklich fest (Erklärung über die Nichtchristlichen Religionen Nr.4). Bestätigend reagierten darauf unlängst rund fünfzig orthodoxe Rabbiner in einer Erklärung zum Verhältnis Judentum-Christentum, worin sie die alte Abwertung des Christentums als „fremder Kult“ zurücknahmen und es stattdessen als „gottgewollt und Geschenk an die Völker“ anerkannten.
Ferner ist zu bedenken, dass die Glaubens-Überlieferung von jeder Generation neu übernommen, verstanden, ratifiziert werden muss, damit die Kirche selbst weiter lebt; zudem ist auf die Umbrüche der Geschichte zu achten, die Übersetzung der Überlieferung in alle möglichen Sprachen und Kulturen. Das macht verständlich, dass sich die Theologie auch immer wieder neu Rechenschaft geben muss, was „Wandlung“, ein zentraler Begriff der Eucharistiefeier, besagen kann und will.
Nicht zuletzt ist die „Wandlung“ auch Thema in den Konflikten um die sogenannte „Neue Messe“ (gemeint ist die vom letzten Konzil erneuerte Messfeier). „In der Alten Messe“ – argumentieren besorgte Gläubige – vollziehe sich nämlich „im Moment der hl. Wandlung“, bei der Trennung der Gestalten von Brot und Wein, „das Opfer von Kalvaria neu“.
Ein etwas anderes Bild zeichnet eine Stimme aus der Orthodoxie: „Damit die Worte Christi, die der Priester kommemoriert, die göttliche Wirkung empfangen, ruft der Priester in der Epiklese den Heiligen Geist an.
Aus den Worten der Anamnese ´er nahm Brot …und reichte es seinen Jüngern... und sagte … Das ist mein Leib` macht der Heilige Geist die epiphaniale Anamnese, er bringt die Intervention Christi selbst zum Ausdruck, der die vom Priester gesprochenen Worte mit seinen eigenen Worten identifiziert, der die gefeierte Eucharistie mit seinem Heiligen Abendmahl identifiziert, und das ist das Wunder der metabolé (Wandlung) der Gaben“. Der hl. Johannes Chrysostomos kleide diese Sicht in den Appell: „Glaube, dass sich heute dasselbe Festmahl ereignet wie das, wo Christus zu Tische lag“. Darin aber werde die Antwort – das Ja – des menschenfreundlichen Gottes greifbar.1
So wird die Weite der christlichen Ökumene sichtbar, zugleich die Not innerchristlicher Verständigung.
Hier zeigen sich heute nicht selten Anzeichen von Müdigkeit, die in den Wunsch mündet, man solle es doch bei den Unterschieden der Konfessionen belassen, sie tolerieren, ja als „Kulturerbe“ erkennen. In Zeiten einer fundamentalistischen Großwetterlage kommen wieder Ängste hoch vor „zu viel“ Nähe zu „den anderen“; vor ´Überfremdung`. Der Blick nach rückwärts gebe Sicherheit, der Blick nach vorn lasse alles ´verschwimmen`.
Unbestritten gehört der Glaube an die Verwandlung, die Brot und Wein auf dem Altar erfasst, zum Herzstück christlich-kirchlichen Glaubens von Anbeginn – so wesentlich, dass sich hier leicht die Geister scheiden.
Die liebe Not und Unruhe, die sich bei diesem Thema unversehens entzünden, spiegelt unübertroffen bis heute das bekannte Aperçu des Frankfurter Pfarrers Lothar Zenetti:
Frag hundert Katholiken,
was das Wichtigste ist in der Kirche.
Sie werden antworten: Die Messe.
Frag hundert Katholiken,
was das Wichtigste ist in der Messe.
Sie werden antworten: Die Wandlung.
Sag hundert Katholiken,
dass das Wichtigste
in der Kirche die Wandlung ist.
Sie werden empört sein:
Nein, alles soll so bleiben wie es ist!
Soll es also auch exklusiv beim Trienter Deute-Modell bleiben?
Der Inhalt der folgenden Seiten, mehrmals vorgetragen und zur Diskussion gestellt, fand ein positives Echo.
Dabei stellte sich heraus, dass weit mehr Christen, als der Autor dachte, Fragen zu diesem Thema mit sich tragen und Antworten suchen.
Selbstverständlich können die nachfolgenden Überlegungen nicht mehr sein als ein gedankliches Experiment des Autors. Wer sie nur irritierend findet, möge sie beiseite legen und vergessen. Vielleicht kann er aber dem Autor zugutehalten, dass auch er, auf seine Weise, das „Mysterium fidei“ ehren möchte.
Ein Teil der auf diesen Seiten entwickelten Gedanken findet sich in erster Fassung in meiner Studie „Das ist mein Leib, mein Blut“ (Wiesmoor 2011), wurde hier jedoch überarbeitet und erweitert.
Die Lektüre verlangt keine Fachkenntnisse, wohl aber konzentriertes Bemühen in einer ruhigen Stunde. Die Anmerkungen – z.T. fachlich gehalten – können ohne Nachteil überschlagen werden. Bibelzitate sind, wo nicht anders angegeben, vom Verfasser übersetzt.
Der Mensch des abendländischen Kulturkreises tut sich schwer mit religiöser Sprache und Rede. Typische Redewendungen sind „Ich glaube nur, was ich sehe, was ich riechen, tasten, greifen kann“.
Als real gilt die mit den Sinnen (Augen, Ohren ...) und entsprechenden Messinstrumenten zugängliche Welt.
Dass es sich mit einer Sache anders verhalten kann, als die Anschauung sie bietet, geht den Menschen schwer ein.
1 Vgl. Evdokimov, L`Esprit Saint, 101-104; ergänzend zB Kallis, Orthodoxie, 71-75.