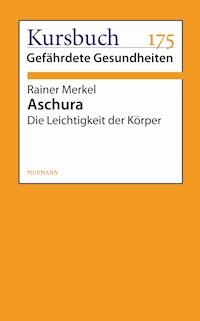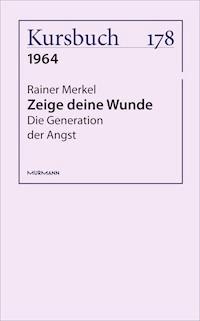8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die undurchsichtigen Anforderungen des Berufslebens: Christian versucht sich in einer jungen, aufstrebenden Agentur. Er verzagt, er hofft, er beschließt, glücklich zu werden, und erlebt so den Traum der schönen neuen Arbeitswelt. Die Suche nach dem Glück in Zeiten der New Economy: Christian soll sich in einer Multimedia-Agentur Werbung für eine Bausparkasse einfallen lassen. Auf die Agentur ist er stolz, die Sparkasse ist ihm peinlich. Es ist sein erstes Projekt und er hat zwölf Monate Zeit. Er verzagt, er hofft und er beschließt, glücklich zu werden. Es wird ein Jahr der Wunder. Christian schlittert überfordert und doch nicht ungeschickt durch die undurchsichtigen Anforderungen des Berufslebens. Die junge, aufstrebende Agentur, in der er arbeitet, scheint kaum Hierarchien zu kennen, stattdessen dominiert eine allgemeine Begeisterung und der Glaube, Teil einer medialen Revolution zu sein. Die neue Form des Opportunismus heißt hier Opposition, die neue Form des Mitläufertums heißt Kreativität. Gudula heißt die Kollegin, die ihm zeigt, wie Teamarbeit wirklich funktioniert. Titus ist Christians Freund, er ist schnell, phantasievoll und schlagfertig, eigentlich ist er ein Künstler, sagt er, und benimmt sich auch so. Grassi ist Christians Chef und will wissen, ob ihn die Arbeit glücklich macht. Wosch ist auch sein Chef, will aber eigentlich ein Kinderbuch schreiben. Christian schlägt sich durch und versucht verzweifelt das Unmögliche: glücklich und zugleich erfolgreich zu sein. Er fühlt sich als Mitglied der Agentur bestätigt und sieht seine Zukunft in strahlendem Licht. Aber Das Jahr der Wunder geht zu Ende. Rainer Merkels witziger und bissiger Roman zeichnet ein Bild vom Perpetuum mobile der Dienstleistungsgesellschaft, vom Traum der schönen neuen Arbeitswelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Ähnliche
Rainer Merkel
Das Jahr der Wunder
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Am Meer
1
Das ist es, was vom Sommer übrig geblieben ist. Ein überhitztes, pulverisiertes Leuchten in der Luft, die Ausläufer einer Staubfontäne, die vom Innenhof allmählich ins Treppenhaus hineingewandert sind. Eine großzügig ausgebreitete Schleppe, die jederzeit zum Leben erwachen kann, wenn man nur hustet oder niest. Ich schaue aus den schmalen, schießschartenartigen Fenstern nach unten in den Hof. Ich weiß nicht, ob Titus sich noch an alle Einzelheiten erinnert, ob er noch die Details im Kopf hat. Als wir damals nach Wien gefahren sind, um One thousand aeroplanes on the roof zu sehen, hat er alles organisiert, ich musste mich um nichts kümmern. Titus hat ein schlafwandlerisches Orientierungsvermögen. Jetzt weiß ich noch nicht einmal, ob ich überhaupt angemeldet bin. Ich gehe Stufe für Stufe, auf einen langsamen Rhythmus bedacht, über den feinen, auf dem Sichtbeton wie Puder verteilten Staub, den ich, wenn ich oben angekommen bin, unbedingt wieder loswerden muss. Es kann sein, dass sie noch nicht einmal einen Fußabtreter haben. Ein Fußabtreter passt nicht zu GFPD. In Wien hatte ich zum ersten Mal das Hemd an, das Titus mir aus Bali mitgebracht hatte. Das changierende Rostbraun ist über die Jahre schon etwas verblichen, aber es ist noch immer das schönste und vornehmste Hemd, das ich besitze. Ich habe es bis oben hin zugeknöpft und noch nicht einmal die Hemdsärmel hochgekrempelt, obwohl das vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Wenn ich oft genug stehen bleibe, lässt die Hitze vielleicht nach und man sieht mir die Aufregung nicht mehr an. Ich schaue aus dem Fenster. Der Innenhof ist in eine Licht- und Schattenzone unterteilt, und obwohl es früher Nachmittag ist, sieht man dort unten niemanden. Der Innenhof ist ganz leer, und ich schaue eine Weile nach unten, wie das Licht auf die Steinplatten fällt und eine Atmosphäre der Ruhe ausstrahlt. Titus wartet auf mich. Zwei Stockwerke höher, im Foyer oder schon an seinem Platz, zu dem er zurückgekehrt ist, um die Zeit zu nutzen, in seiner typischen, in sich gekehrten Haltung, mit seinem nervös wippenden Knie, und ich muss mich beeilen, ich muss rechtzeitig da sein. Sein Knie, das den Takt vorgibt, den Rhythmus, mit dem er in seine Selbstvergessenheit versinkt. Steinzeitmenschen, Jäger und Sammler müssen so gewesen sein, immer auf dem Sprung und trotzdem so mit ihrem Ziel verbunden, als befänden sie sich in einem luftleeren Raum. »Du kommst einfach mal vorbei und schaust es dir an«, hat Titus gesagt. Er hätte sagen können: »Du schaust dir GFPD an, und GFPD schaut dich an.« Ich spüre den Schweiß in den Achselhöhlen, wie er langsam hervorkriecht, und dann geht draußen die Sonne weg, und alles wird auf einmal ganz grau. Das Gefühl der Hitze und Enge nimmt zu. Ich versuche den obersten Hemdknopf zu öffnen. Jemand ist im Treppenhaus, jemand, der es sehr eilig hat. Die Schritte sind deutlich zu hören, und ich versuche etwas schneller zu gehen. Der oberste Hemdknopf lässt sich nur schwer öffnen. Ich könnte die Ärmel hochkrempeln, aber das würde unpassend aussehen. Titus hat es schon ein paar Mal zu erklären versucht. Was GFPD genau ist, wie GFPD funktioniert, dass es keine Agentur ist, bei der man sich einfach bewirbt. Schon beim Betreten des Treppenhauses ist es mir so vorgekommen, als würde ich in einen Turm hochsteigen, als wären alle diese Stahltüren Sackgassen und Scheineingänge, lediglich Erinnerungen an Türen, die zu Räumen führen, die gar nicht mehr existieren. Und man kann sich überhaupt nicht bewerben. Titus hat ein paar Kommilitonen aus der Hochschule der Künste eingeschleust. »Willst du mir etwa sagen, du wärst nicht kreativ?«, hat er triumphierend gefragt, nachdem er meine Notizbuchgeschichten gelesen hatte, die ich beim Taxifahren probeweise verfasst habe und die er dann gleich Molberger, dem Geschäftsführer, gezeigt hat. Ich gehe etwas schneller, vielleicht bin ich die ganze Zeit zu langsam gegangen. Der Verfolger atmet in einem irritierenden Rhythmus, und obwohl ich jetzt zwei Stufen auf einmal nehme, kommt er immer näher, ohne dass ich ihn sehen kann. Vielleicht bewirbt er sich gar nicht, sondern ist im Gegenteil jemand, der etwas bringt, ein Bote, jemand aus einer anderen Welt, für den GFPD etwas ganz Natürliches ist, ein Dienstleistungsunternehmen wie jedes andere auch. In diesem Moment kommt die Sonne wieder heraus. Das Nachmittagslicht steigt wie ein nach oben schnellender Wasserpegel in den Fenstern hoch, und jetzt, wo ich schon fast angekommen bin und nicht mehr umkehren kann, im zweiten oder dritten Stock, werde ich auf einmal nervös und spüre, wie mein Herz klopft und alle Geräusche um mich herum verdrängt. Ich sehe das Plastikschild mit der Aufschrift GFPD, und ich sage mir noch, das ist wirklich nichts Besonderes. Das Schild sieht geradezu billig aus. Das Treppenhaus ist staubig. Die Wände sind nicht verputzt, und die Fugen zwischen den Verschalungsbrettern treten in wulstigen Kanten wie bei Operationsnähten hervor. Das Stöhnen hinter mir ist sehr laut, doppelt so laut wie zuvor und fast ein bisschen hemmungslos. Ich drehe mich nicht um. Ich mache den obersten Hemdknopf wieder zu und öffne die Tür.
2
Eine große Stille breitet sich aus, als ich den Eingangsbereich verlasse und das Foyer betrete. Im ersten Moment denke ich noch, das Foyer ist viel zu groß, und ich bin gar nicht bei GFPD. Wie der Raum vor meinen Augen nach oben steigt, mich mit seinem Volumen empfängt. Bläuliche Milchglasscheiben wachsen in die Höhe, das Licht kommt in einer großen ausholenden Bewegung auf mich zu. Das ist der erste Eindruck. Der Eindruck des Schwebens, wie das Licht auf mich zukommt und sich mit mir vermischt, wie es mich durchdringt. Wir bilden ein schwebendes, diffuses Gewebe, und ich mache einen Schritt nach vorne, tastend und vorsichtig. Die Frau am Empfangstresen lächelt mir zu. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, für einen kurzen Moment, einen Augenblick der Verwirrung. Im Nachhinein versuche ich mich immer wieder daran zu erinnern, was ich in diesem Moment gedacht habe oder ob ich am Ende vielleicht gar nichts gedacht habe. Ich laufe auf Wosch und Steinfeld zu, die beiden Mitarbeiter von GFPD, die als dunkle, leicht verschwommene Silhouetten nach einer Weile im Foyer auftauchen, um mich abzuholen. Wosch kneift die Augen zusammen und zwinkert mir zu. Sie gehen vor mir her, nebeneinander, in einer mechanischen Eleganz, wie zwei Portalfiguren, die sich auf einmal in Bewegung gesetzt haben. Ich versuche den obersten Hemdknopf zu öffnen, aber es gelingt nicht, er ist wie angewachsen. Für einen Moment verliere ich beinahe die Nerven, im Spiegel auf der Mitarbeitertoilette konnte ich mich nicht durchringen, ihn zu öffnen, tupfte mir nur ein bisschen Wasser auf die Stirn und zog Grimassen, mit denen ich mir Mut zu machen versuchte. Wosch dreht sich ein paar Mal um und grinst mir zu. Der Konferenzraum befindet sich in der hintersten Ecke der Agentur. Es stehen sogar Blumen auf dem Tisch, ein Strauß mit gelben Hyazinthen, und ich muss mich gegen die Vorstellung wehren, sie seien eigens zu meiner Begrüßung aufgestellt. Das ist es, was ich nicht vergessen darf. Dass ich überhaupt noch gar nicht da bin. Ich bin unterwegs, ich befinde mich in einem Zustand des Übergangs. Titus kommt später noch dazu, sagt Wosch, aber ich habe das Gefühl, dass er mich lieber alleine lassen und sich nicht einmischen will. Meine Hände halte ich unter dem Tisch und lege sie nur ganz selten, und wenn, dann einzeln und mit zärtlicher Aufmerksamkeit, auf die Tischplatte, vorsichtig, um keine Spuren zu hinterlassen. Ich habe mir vorgenommen, bei allem, was Wosch und Steinfeld sagen, den Eindruck zu erwecken, es sei mir schon bekannt, ich hätte schon davon gehört. »Es ist mir schon seit langem bekannt.« Oder: »Davon habe ich erst neulich gehört. Das ist ja eine alte Geschichte.« Manchmal blinzele ich mit den Augen, als sei mir alles ein bisschen zu viel, als sei meine Zeit nur begrenzt und mein Bedürfnis, sofort weiterzuarbeiten und keine Zeit zu verlieren, sehr groß. Manchmal wiederhole ich einfach das, was Wosch oder Steinfeld gesagt haben. Ich zitiere sie oder gebe das, was sie sagen, in Zusammenfassungen wieder oder versuche, mit geschickten Wiederholungen dem Gesagten eine neue Wendung zu geben. Als Steinfeld von der geplanten CD-ROM spricht und auf einmal den Ausdruck »Terminal« benutzt, die Formulierung, »die Terminals werden auch von ungeschulten Benutzern bedient«, wiederhole ich es einfach und sage: »Die Terminals werden also von ungeschulten Benutzern bedient? Das ist natürlich ein Problem.« Wosch lehnt sich zurück. Er grinst, wie er überhaupt nach jedem Satz grinst, während Steinfeld keine Miene verzieht. Wosch ist lässig, jungenhaft, entspannt. Er erinnert mich an eine Figur aus einem Enid-Blyton-Roman, den ich als Kind gelesen habe, einen Jungen, der sich mit seinen Freunden in einer Höhle versteckt, während die Verbrecher in den Tiefen des Berges herumirren, um einen Schatz zu finden, der ihnen nicht gehört. Vorsichtig nähere ich mich dem obersten Hemdknopf, Knopf für Knopf, ich fange in Bauchhöhe an, überprüfe jeden einzelnen und taste mich dann langsam nach oben. Steinfeld faltet die Hände. Im Nachhinein denke ich, dass es eine besondere Ehre ist, dass sie mit mir sprechen und dass sie es vielleicht nur tun, weil ich mit Titus befreundet bin. Titus hat gesagt, dass es um eine Bausparkasse geht, was sich im ersten Moment etwas exotisch anhört. Ich versuche mir ein paar Formulierungen zu merken. »Materialdefinition«, »Grobkonzept«, »Touch-Screen«. Manchmal kann ich der Versuchung nicht widerstehen, mich nach Titus umzudrehen, ob er vielleicht mit im Raum ist oder gerade hereinkommt oder am Ende sogar die ganze Zeit, ein Gedanke, den ich mir aber sofort verbiete, unter dem Tisch sitzt und mir die Daumen drückt.
»Das ist es ja gerade. Dass alles offen bleiben soll«, sagt Steinfeld. Er hat einen leichten Glanz auf der Stirn, so als würde er auf eine dezente und eingeübte Art schwitzen. »Du sollst dich überhaupt nicht festlegen. Es ist so, als hättest du von alledem hier«, er macht eine weit ausholende Bewegung, »keine Ahnung. Du stellst es dir einfach vor.« Für einen Moment weiß ich nicht, was ich antworten soll. Ich denke daran, wie mir Titus ein paar Mal erklärt hat, was er bei GFPD überhaupt macht und was er unter »Interaktion« versteht. Dass man sich etwas besser merken kann, wenn man es gleichzeitig liest, hört und sieht. Es ist so, als wäre man am Meer. So wie sich der Horizont weitet und man das Gefühl hat, man würde auseinander gezogen zu einer weiten, gleichförmigen Fläche. Man weiß nie, wo man zuerst hinschauen und ob man nicht besser für immer stehen bleiben soll. Als wir damals in Wien waren, haben wir noch überlegt, ob wir nicht ans Meer fahren sollen, und ich denke manchmal daran, wie das gewesen wäre, dass es bestimmt großartig gewesen wäre. Aber wir konnten uns nicht dazu entschließen. Wir waren Zivildienstleistende, und das schlechte Gewissen, in einem Leihwagen unterwegs zu sein, begleitete uns die ganze Fahrt. Ich sehe noch immer das Bild eines mit offenen Türen am Meer stehenden Leihwagens vor mir und Titus und mich, wie wir langsam auf den Strand zulaufen. Titus sagt: »Du musst es als Raum sehen. Als Möglichkeit.« Wosch zieht die linke Augenbraue hoch. Er versucht mir ein bisschen Mut zu machen. Er ist eindeutig sympathischer als Steinfeld. Vielleicht ist er eine Art Animateur, verschwindet in dem Moment, in dem ich aufgenommen worden bin, und sagt leise »Goodbye«.
»Natürlich muss der Weltraumbezug vorhanden sein«, sagt Steinfeld. Er fixiert einen Punkt des Konferenztisches, spreizt die Finger und macht eine schnelle Aufwärtsbewegung mit der linken Hand.
»Wir haben diesen losen Bezug zu Per Anhalter durch die Galaxis, womit wir natürlich einen gewissen Humor mit hineinbringen.« Wosch grinst.
»Per Anhalter durch die Galaxis«, sage ich, »das ist ja eine alte Geschichte.«
Steinfeld und Wosch sehen mich gleichzeitig an.
»In diesem Punkt sind uns leider die Hände gebunden«, sagt Wosch. Er legt die Hände übereinander, so dass sich die Gelenke an den Pulsadern berühren, und grinst. Seine lässige Art ist geradezu berauschend, und ich muss aufpassen, dass ich nicht unvorsichtig werde. Sie fragen mit keinem Wort nach meiner Qualifikation, wer ich bin, was ich gemacht habe, ob ich mich mit den Medien, die zum Einsatz kommen sollen, überhaupt auskenne. In den Gesprächen mit Titus übernehme ich immer den Part des Zweiflers, des Häretikers, den Part des Alles-Durchdenkers. Vielleicht finden Wosch und Steinfeld Gefallen daran. Zum Beispiel: Er macht sich über alles Gedanken. Oder: Er gibt sich nicht mit einfachen Lösungen zufrieden.
»Der Weltraum darf natürlich keine Phantasmagorie sein«, sage ich.
Steinfeld sieht mich etwas irritiert an.
»Das ist ja genau der Punkt«, sagt er, »da stimmen wir wunderbar überein.«
»Bildlich gesehen kann er ja bei einigen Motiven schwarz sein.«
»Er ist unsichtbar«, sage ich und mache ein nachdenkliches Gesicht.
»Imaginär«, sagt Wosch.
»Dann wäre also in diesem Punkt die Gefahr gebannt«, sagt Steinfeld. Ich nicke nachdenklich, ein bisschen in mich versunken.
»Und was das Finanzielle angeht …«
Ich unterbreche Steinfeld, und zwar in höchster Eile. Es ist eine intuitive Reaktion, weil es mir auf einmal so vorkommt, als sei ich in dem einen oder anderen Punkt zu weit gegangen und hätte zu wenig Bereitschaft gezeigt, mich hier mit meiner ganzen Persönlichkeit einzubringen. Titus hat ein halbes Jahr ohne Bezahlung gearbeitet und nachts sogar unter seinem Schreibtisch geschlafen, bis er dann einen Vorstoß gewagt hat, der ihn allerdings gleich in eine, wie er sagt, höhere Sphäre befördert hat. Ich darf diesen Schritt nicht gleich am Anfang machen. Ich unterbreche Steinfeld. Ich lege Zeigefinger und Mittelfinger zwischen die beiden obersten Hemdknöpfe und senke den Kopf.
»Und was das Finanzielle angeht«, sage ich, »werden wir uns bestimmt einig. Da sehe ich keine Probleme.«
Steinfeld dreht sich zu Wosch, und für einen Moment klingt etwas Disharmonisches an, bleibt etwas fraglich und sonderbar. Ich denke an die Cola, die Beatrice, die Frau am Empfangstresen, mir angeboten hat und die vielleicht noch immer unangetastet im Foyer steht. Ich habe mich nicht getraut, einen Schluck zu trinken.
»Das ist jetzt wirklich deine Sache«, sagt Steinfeld. »Ich habe mit der Projektleitung doch gar nichts zu tun.« Sein Gesicht ist auf einmal ganz verzerrt. Ich frage mich, ob das ein Streitpunkt ist, unter dem hier alle mehr oder weniger leiden, mit dem alle klarkommen müssen, dass es in finanziellen Fragen Probleme gibt. Vielleicht nur kleine, unbedeutende Probleme, kleine atmosphärische Störungen, im Sinne von schwankenden Kursen und Währungen. Minimale Empfindlichkeiten, die ums Geld kreisen, sich aber dann, wenn sie nicht so schnell geklärt werden können, einfach von selbst lösen.
»Das können wir früher oder später immer noch klären«, sage ich, »ist überhaupt gar kein Problem.«
»Wir klären es«, sagt Steinfeld und lächelt, und es ist überhaupt das erste Mal, dass er es tut, während Wosch beinahe etwas trotzig aussieht.
»Man muss nur einen Modus finden, der alle Beteiligten zufrieden stellt.«
»Absolut«, sagt Wosch und strahlt mich an, als würden wir in diesem Moment aus einem dunklen Tunnel treten, und die »Insel der Abenteuer«, die Geschichte der fünf Freunde, fängt an. In Geldfragen sind wir uns jedenfalls einig.
3
Wosch läuft voraus, gleitet durch die unübersichtlichen, ineinander verschachtelten Räume. Eilig, wie von etwas fortgezogen, und gar nicht mehr so gemütlich wie zu Beginn. Ich habe Schwierigkeiten, ihm zu folgen. Die Räume werden von geschwungenen Milchglasscheiben unterteilt, die sich wellenförmig durch den ganzen Saal ziehen und die einzelnen Abteilungen voneinander abgrenzen, die sich zur Mitte hin öffnen und ein großes, leeres Oval bilden, von dem man jederzeit in alle Abteilungen hineinschauen kann. Auch Molberger kann man sehen, wie er an seinem Schreibtisch sitzt und etwas in einen kleinen, schwarzen Computer eingibt. Ich bin froh, dass der Moment der Verabschiedung so einfach ist. Einen Augenblick denke ich noch, dass alles schief geht. Ich bin in Woschs Abteilung, Steinfeld ist schon gegangen, und ich weiß auf einmal nicht mehr, was ich tun soll. Ständig muss ich irgendwelchen Mitarbeitern ausweichen, die wichtige Dinge zu erledigen haben. Beatrice hat mir, als ich warten musste, noch einen Sitzplatz und eine Cola angeboten, aber hier, im Inneren der Agentur, stehe ich die ganze Zeit im Weg, und jedes Mal, wenn jemand vorbeikommt, weiche ich zurück, entferne mich von Wosch, der ununterbrochen telefoniert. Ich stehe in einer nicht definierten Zone, in einer Art Zwischenraum, durch den man normalerweise einfach so hindurchgeht. Ich spüre einen kühlen Luftzug, als würden die mich umgebenden Maschinen und Geräte atmen, und während ich noch überlege, ob Wosch mich vielleicht vergessen hat, merke ich auf einmal, dass der oberste Hemdknopf verschwunden ist. Der oberste Hemdknopf des balinesischen Hemdes. Es muss im Konferenzraum passiert sein, und ich versuche mir noch einzureden, dass es nicht so schlimm ist, aber dann fällt mir ein, dass er handgefertigt und so gesehen vielleicht doch wertvoll ist. Das Hemd verliert etwas von seiner Ausstrahlung und sieht ganz anders aus, tatsächlich einfach und vielleicht sogar ein bisschen banal. Es kostet einige Energie, mich nach allen Seiten umzudrehen, die mich umgebenden Tische und Mitarbeiter in aller Ruhe anzusehen, um zu erkennen, dass niemand etwas gemerkt hat, auch Titus nicht, der gar nicht, wie ich auf einmal gedacht habe, unmittelbar hinter mir sitzt, sondern an diesem Tag überhaupt nicht in der Agentur ist. Überall stehen Schreibtische, an denen GFPD-Mitarbeiter sitzen, die Gesichter, fein geschnitten, von Kreativität wie einbalsamiert. Wosch beugt sich vor und rollt ein paar Meter auf mich zu. Es ist von einer aufreizenden Lässigkeit, wie er in seinem Bürostuhl sitzt und wie er dieses Auf-einem-Bürostuhl-Sitzen ironisiert, und ich denke noch, das ist also die höchste Form, wenn man so etwas kann. Während wir jetzt in Richtung Ausgang gehen, empfinde ich das Fehlen des obersten Hemdknopfes beinahe als Erleichterung. Im ersten Moment denke ich noch, ich müsste nach ihm suchen, ich müsste tatsächlich durch alle Räume gehen und meine Bewegungen noch einmal nachvollziehen, sie im Nachhinein erforschen. So ein Knopf kann sich hier unmöglich halten. Er geht hier sofort verloren. Es ist ein lustvoller und beängstigender Gedanke, wie ich mir vorstelle, ich würde ihn suchen und auf allen vieren durch die Agentur kriechen, in jeden Winkel und in jede Ecke hinein. Ich krieche durch die Agentur. Ein paar Mal kehrt dieser Gedanken jetzt wieder wie eine große, mich einholende Woge, der man nicht ausweichen kann.
Wosch lächelt mir zu, und wir gleiten, scheinbar willenlos, in einem Zustand der Verflüssigung durch die sich öffnenden, bläulichen Glaswände hindurch, die sich immer wieder unterteilen, Eingänge, Korridore und Seitenarme bilden, bis wir schließlich das Foyer erreichen, und auf einmal scheint mir alles geklärt, scheint alles von einer großen Transparenz und Durchsichtigkeit. Wosch macht eine elegante Drehung nach rechts, stellt sich vor mir auf und streckt mir die Hand entgegen. Wir haben Beatrice und den Empfangstresen noch gar nicht erreicht, aber offensichtlich ist genau diese von Wosch ausgewählte Stelle der richtige Ort für die Verabschiedung. Sein Lächeln erscheint mir gar nicht mehr jungenhaft und unbekümmert, sondern geradezu verschwörerisch. Er zwinkert mir zu. Er sagt nichts weiter Wichtiges, aber es ist beeindruckend, wie nachlässig und unbeschwert er ist. »Vielleicht sollten wir uns mal ein paar Vorhänge besorgen, was?«, sagt er. »Den ganzen Tag scheint hier die Sonne herein.« Er dreht sich nach Beatrice um. Und während ich noch überlege, was ich sagen könnte, lächelt Beatrice mir über eine Entfernung von fast zehn Metern zu. Später kommt es mir so vor, als hätten Wosch und Beatrice in diesem Moment etwas ausgetauscht, ein geheimes Zeichen oder ein Signal. Das Foyer wirkt jetzt fast noch größer als zuvor, hell, weitläufig, in jeder Hinsicht verschwenderisch. Beatrice hat einen ganz falschen Eindruck von mir, und während Wosch sich entfernt, auf nicht nachvollziehbare Weise leicht hin- und herschwankend, nehme ich mir vor, von nun an entschlossen und zielstrebig zu sein. Wie ich zum Beispiel zur Mitarbeitertoilette gegangen bin, als ich dachte, mein Hemd sähe langweilig aus. Die Innenseite der Toilettentür war mit Kommentaren und Bemerkungen übersät, und ich wunderte mich, dass sie gar nicht obszön, sondern tatsächlich geradezu wissenschaftlich und durchdacht waren. Zwei Mitarbeiter diskutierten darüber, wie viel Energie eine Leuchtstoffröhre verbraucht und ob das Einschalten mehr Energie kostet als deren dauerhafter Betrieb. Die Diskussion erstreckte sich über die gesamte Türfläche, und es war schon fast der gekachelte Fußboden erreicht, da hatte man den Eindruck, als würden sich die Mitarbeiter jetzt schon gegenseitig an ihren Handschriften erkennen, »mein lieber arne«, stand in Kleinschreibung am unteren Türrand, »doppelt so viel? … das ist doch ein moderner mythos«. Beatrice lächelt mir zu, und ich gehe langsam und mit starrem, auf den grauen Industrieteppichboden gerichtetem Blick auf sie zu. Ich sehe sie jetzt nochmal, so wie ich sie schon am Anfang gesehen haben. Sie steht hinter dem halbmondförmigen Empfangstresen, etwas erhöht, ihr bleiches und zartes Gesicht dem Besucher zugewandt, der eilig an ihr vorübergeht, mit einem kurzen Gruß oder einem Seitenblick, wie ich es am Anfang auch hätte tun sollen, an ihrem schlanken, fast zwei Meter großen Körper vorbei, der dort wie am Ufer der Bewegungen zart vornübergebeugt das Murmeln und Plätschern der Gespräche aufnimmt, die hier täglich und ununterbrochen hereingetragen werden. Ich gehe an ihr vorbei und mache sogar für einen Moment die Augen zu, so als wäre ich in Gedanken schon beim nächsten Termin, und dann lächelt sie mir zu. Sie lächelt mir zu, obwohl ich schon fast vorbei bin. »Trinken Sie Ihre Cola doch ruhig aus«, sagt sie und hält die Sprechmuschel des Telefonhörers zu. Ich bin für einen Moment irritiert, dass sie mich siezt, nachdem Wosch und Steinfeld mich die ganze Zeit geduzt haben. Ich wiege den Kopf hin und her, zögere noch einen Moment, und dann nehme ich das Glas und trinke es wie eine Medizin in einem Schluck aus.
4
Der Parkplatz ist größer, als ich gedacht habe, und jetzt, wo ein Teil der Mitarbeiter schon nach Hause gefahren ist, eine große, sich immer mehr ausbreitende Schattenlandschaft zurücklassend, fallen die einzelnen Wagen viel mehr auf. Ich gehe absichtlich etwas langsamer. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass Wosch und Steinfeld oben am Fenster stehen und sehen, wie ich in das Taxi steige, mit dem ich gekommen bin. Eine Weile bleibe ich unschlüssig vor dem elfenbeinfarbenen, im Schatten wie erbleicht aussehenden Wagen stehen. Ich könnte auf der Beifahrerseite einsteigen, und es sähe dann vielleicht so aus, als sei nicht ich der Fahrer, sondern der Fahrgast, der auf seinen Fahrer wartet. Das durchgesessene Polster ist warm, so als sei wirklich jemand mitgekommen und habe hier eine Weile auf mich gewartet. Ich kurbele das Seitenfenster herunter und lasse das Sonnendach zurückfahren. Ich versuche diese belastenden, überflüssigen Schamgefühle loszuwerden. Ich setze die Sonnenbrille auf und fahre los, aber die Schamgefühle folgen mir, eines nach dem anderen, vom Parkplatz zum Wärterhäuschen, wo die Schranke schon offen steht, bis ans Ufer, wo ich abbiege und mit einer fast wütenden Beschleunigung alle Gefühle zu vertreiben versuche. Noch nicht einmal einen halben Kilometer entfernt, steht ein älterer Mann am Straßenrand mit einem zusammengerollten Teppich und winkt, und ich fahre einfach an ihm vorbei, ich ignoriere ihn. Ich kann nicht anhalten und ihn mitnehmen. Es erscheint mir auf einmal unmöglich. Ich fahre weiter, ängstlich bemüht, nicht anzuhalten. Alles beschränkt sich darauf, dass ich denke: Ich kann keine Kunden irgendwo hinbringen. Die Kunden kommen von nun an zu mir. Mit einer akrobatischen Verrenkung kurbele ich das Beifahrerfenster hoch, während ich mit der anderen Hand lenke. Die Fahrbahn blitzt für einen Moment silbern auf und verschwindet dann unter einer vorbeiziehenden Wolke. Ich konzentriere mich auf Gegenstände, Bordsteinkanten, Fassadenteile, entfernte Häuser. Ich denke an die Agenturräume, wie sie sich in meiner Erinnerung immer wieder umgruppieren, sich verändern, als trainierten sie sich selbst, als studierten sie etwas ein. Als ich über die Putlitzbrücke fahre, sind die Schamgefühle verschwunden. Vielleicht habe ich sie abgestreift, oder sie haben sich im Fahrtwind verflüchtigt, sind davongeweht. Ich könnte über die Seestraße fahren, mit einem kleinen Umweg am Landwehrkanal entlang, und im gleichmäßigen Strom des Nachmittagsverkehrs schließlich nach Hause gelangen. Die Seestraße ist sehr lang, und ich könnte noch eine Weile weiterfahren, wie bei einer Überlandfahrt, von der man nicht weiß, wo sie hinführt. Das Wichtigste ist das Sonnendach, dass der Wagen ein Sonnendach hat. Als wir damals nach Wien gefahren sind, hatten wir es die ganze Fahrt über geöffnet, und einmal, in einem besonders übermütigen Moment, habe ich sogar einen Fuß aus dem Dach gehalten. Ich stelle mir vor, ich würde es jetzt noch einmal versuchen, und lasse für einen Moment das Steuer los. Ich versuche es natürlich nicht wirklich, es ist nur ein Gedankenspiel, und vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass mich der Fußgänger, der in diesem Moment auf die Straße läuft, rechtzeitig sieht. Ich müsste schon umkehren, um mich bei ihm zu entschuldigen, aber das scheint mir dann doch übertrieben. Die meisten Leute sind so etwas gewöhnt. Den rabiaten, rücksichtslosen Fahrstil der Berufskraftfahrer, von denen sie aber, wenn sie eingestiegen sind, nur noch Feinfühligkeit und Einfühlungsvermögen verlangen. Sie erzählen ihr ganzes Leben, ihre ganze Geschichte von Anfang bis Ende, auch wenn die Dauer der Fahrt dafür gar nicht reicht. Einmal sagte ein Fahrgast zu mir, den ich vom Glockenbachweg zur Deutschen Oper fuhr: »Sie sehen ja so traurig aus. Sind sie nicht glücklich in ihrem Beruf?« Und dann stieg er an der Deutschen Oper ohne zu bezahlen einfach aus. Ich stelle den Wagen in der Togostraße ab, ein paar Meter von meiner Wohnung entfernt, damit mich beim Aussteigen niemand beobachten kann. Vielleicht ist es das letzte Mal. Als ich das Sonnendach zufahren lasse, kommt es mir so vor, als würde der Wagen alles in sich aufnehmen, sich alles merken, auch die Beschimpfungen des Fußgängers und meine endlosen Selbstgespräche. Er merkt sich alles, nimmt alles auf, denke ich, während ich noch einen Moment sitzen bleibe, und dann fällt mir ein, dass ich mir noch ein Notizbuch kaufen muss.
5
Wenn man den Flur mitrechnet, ist meine Wohnung sehr groß. Er ist dunkel und verwinkelt, und manchmal kommt es mir so vor, als bestünde die ganze Wohnung nur aus diesem einen riesigen Flur, und beim Hereinkommen hat man das Gefühl, er würde sich noch bis in alle Räume hinein fortsetzen. Er eignet sich gut, um Bilder aufzuhängen. Als Titus ein paar Tage später abends vorbeikommt, bleiben wir die ganze Zeit im Flur stehen und schauen uns die Fotos aus unserer Zivildienstzeit an. Titus kommt direkt vom Flughafen, und während ich auf ihn warte, überlege ich noch, ob es überhaupt der richtige Zeitpunkt ist. Ich muss ihn fragen, wie viel Geld ich verlangen soll. Ich hänge die alten Fotos wieder auf, damit der Flur nicht so düster erscheint. Ich kann ihn nicht einfach so fragen, nicht einfach so und ohne Vorbereitung. Ins Notizbuch schreibe ich: »Es ist ein Experiment, und im Notfall fange ich eben ohne Geld an.« Früher hingen die Fotos auf dunkelgrünen Filzplatten, versehen mit den schreibmaschinengeschriebenen Titeln, die ich mir ausgedacht hatte. Irgendwann haben sie mir nicht mehr gefallen, und ich habe sie abgehängt, und dann stand manchmal unter einer leeren Filzplatte, die einfach so auf der Tapete hing, »Kind, das seinen Hund sucht« oder »Kind, das beim Spielen überrascht wird«. Es ist ein Ritual zwischen uns, dass er einfach so hereinkommt, grußlos und ohne Kommentar. Wir begrüßen uns nicht an der Tür, sondern in der Wohnung. Die Begrüßung ist eine Selbstverständlichkeit und als solche im Grunde überflüssig, Ausdruck spielerischer Eleganz, wie wir sie hinauszögern, wie ein in die Länge gezogener Filmvorspann. Ich mache einen Schritt vor, damit er an mir vorbei ins Wohnzimmer gehen kann. Er ist gut gelaunt, als habe ihm der Flug, der Aufenthalt in der Luft neue Kraft gegeben. Er schaut sich die Fotos an, läuft an ihnen vorbei wie durch eine Ausstellung, aber nicht so, als seien es seine eigenen Bilder, die hier ausgestellt sind, sondern als seien es die Bilder irgendeines ihm gar nicht bekannten Künstlers, der ihn aber jetzt brennend interessiert.
»Warum machst du denn kein Licht an?«, fragt er, während er am Ende des Flures stehen bleibt. Er bückt sich etwas.
»Und das hier?«, fragt er und zeigt auf das Foto, auf dem der körperlich und geistig behinderte Marius ein weißes Plastikboot hinter sich herzieht und die Schnur dabei so hoch hält, als sei das Schiff ein Pferd.
Ich gehe einen Schritt auf ihn zu. »Du hast es an der Isar gemacht«, sage ich, wie ein Kunsthändler, der seinen Preis nennt, »als wir mit Michaelas Kindern in den Tierpark gefahren sind, und der Tierpark war zu.«
»Schönes Bild«, sagt er. »Der Junge sieht auf diesem Bild fast normal aus.«
Er macht keine Anstalten, sich hinzusetzen. Er geht ein bisschen im Flur auf und ab, schaut sich die Fotos an. Marius ist auf vielen Bildern zu sehen, und vielleicht liegt es daran, dass er aufgrund seiner Behinderung nur schwer zu fotografieren war und Titus sich diese Herausforderung nicht entgehen lassen wollte.
»Hier ist ja noch alles wie immer«, sagt er, während er kurz ins Wohnzimmer schaut. Es ist ein Satz, den er immer sagt. Selbst, wenn ich wirklich etwas verändern und zum Beispiel überall Goldstaub verteilen würde, bin ich mir sicher, dass er den Satz »hier ist ja noch alles wie immer«, allein schon aus Gewohnheit wieder sagen würde, und ich würde mich darüber ärgern, dass meine Wohnung keine Gestalt annehmen kann, die Titus überzeugt. Ich drücke auf die Fingerkuppe meines Zeigefingers, die noch immer ein bisschen blutet, nachdem beim Aufhängen der Fotos eine der Stecknadeln abgebrochen ist. Ich sauge an dem Finger, der stark schmerzt, als sei er bis auf den Knochen durchbohrt.
»Bald geht’s los«, sagt Titus und bleibt direkt vor mir stehen. Er reibt sich die Hände, als ginge es für ihn auch bald los.
»Wie soll ich das mit dem Geld machen?«, frage ich. Ich habe noch immer den Finger im Mund und merke jetzt, wie unpassend das ist. Titus macht einen Schritt zur Seite und schaut auf das Foto mit Marius, als könne er dort eine Antwort finden. Wir haben es in der Nähe des Englischen Gartens gemacht, und ich habe Marius festhalten müssen, damit er nicht weglief. Tagelang wusste niemand so genau, ob wir die Kinder nicht am besten den ganzen Tag in der Tagesstätte einsperren sollten. Es gab Warnungen, dass Säuglinge nicht bei offenem Fenster schlafen und Kinder nach dem Spielen im Freien gewaschen werden sollten. Die Kinder lagen wie vom Himmel gefallene Engel auf einer Wiese neben dem chinesischen Teehaus. Es gelang mir nicht, Marius festzuhalten, der vielleicht den Giftwolken aus Tschernobyl entgegenlaufen wollte, aber Titus war schnell genug. Das ist überhaupt eines seiner großen Talente, seine Reaktionsschnelligkeit.
»Soll ich 8000 verlangen?«, frage ich. Ich nehme den Finger aus dem Mund, er brennt wie Feuer.
»8000«, wiederholt Titus leise, auf das Bild schauend, als sei das jetzt tatsächlich der von mir als Galerist für das Bild veranschlagte Preis. Er reißt sich vom Anblick des Fotos los, dreht sich zu mir.
»Das mit dem Geld ist gar nicht so wichtig«, sagt er und streicht mit den Fingern über die grüne, abgenutzte Filzplatte an der Wand, »mir selbst ist es ganz gleich, was ich verdiene. Wir sind keine Idealisten, aber du darfst nicht denken, dass das eine Rolle spielt.«
Er legt die Hände aneinander. Er sieht mich so an, als wolle er mir Zeit geben, über das, was er gesagt hat, nachzudenken.
»Also erst mal«, sagt er, sprungbereit, um nach unten zu laufen, »gehen wir morgen schön essen. Vielleicht mexikanisch?«
Er steht schon im Treppenhaus, während ich noch halb im Flur stehe. Er ist fast einen Kopf größer als ich, und während wir uns umarmen, denke ich, dass unsere Umarmung wie immer etwas komisch aussieht. Wie eine Umarmung aus Spaß, eine Umarmung im Zirkus oder im Varieté, und ich frage mich manchmal, wer von uns beiden dabei wohl das größere Gelächter auslöst.
»Also morgen. In alter Frische«, sagt er. Und ich sage: »Also morgen, in alter Frische.« Er hat sich schon verabschiedet, als ich auf einmal denke, dass ich doch besser absage. Es ist auf einmal so eine Idee, dass ich mit meiner Inspiration vorsichtig umgehen und mich schonen muss, dass ich überhaupt nur eine begrenzte Anzahl von Einfällen zur Verfügung habe und dass man nicht so einfach drauflos schreiben kann. »Nicht so einfach drauflos schreiben«, schreibe ich ins Notizbuch, und es ist schon ein oder zwei Uhr. Er winkt mir noch einmal zu, während er die Treppe hinunterläuft. Ich mache die Tür zu, gehe in die Küche, setze Wasser auf und stelle im Wohnzimmer den Fernseher an. Im Wohnzimmer ist es plötzlich sehr kalt, und ich schalte den elektrischen Heizlüfter an, als es mit einem Schlag still und vollkommen dunkel wird. Die Sicherung ist herausgesprungen. Ich stehe im Dunkeln und denke: Das ist es also. 8000 Mark. Es erscheint mir wie ein körperlich spürbarer, körperlich verifizierbarer Prozess, ein Beweis, dass ich es hier mit etwas Besonderem zu tun habe und in etwas hineingeraten bin, wo man sich also mit seinem ganzen Körper einsetzen und einbringen muss. Und ich muss mir eine andere Summe ausdenken, eine niedrigere, eine, die mich nicht so belastet, eine, die Titus nicht zur Verzweiflung treibt.
6
Nachts träume ich von Molberger, dem Geschäftsführer der Agentur, der Titus während eines Inlandfluges von Frankfurt nach Berlin nach meinem Vorleben befragt. Hat er wirklich Medizin studiert? Ist er religiös? Molberger und Titus diskutieren, während sie Farmersalat essen, in dem irritierenderweise ein Stein ist, mein Badeenten-Konzept. Ich habe ein paar Ideen zu Papier gebracht, bei denen es um eine Badeente geht, die in alle möglichen Schwierigkeiten gerät. Alle Ideen müssen in der Badewanne spielen. Auch mein abgebrochenes Studium kommt vor, und zwar in Form eines nicht zu Ende geführten Rohbaus, der im Laufe der Zeit, der Flug dauert ungefähr eine halbe Stunde, zu einer Ruine wird. Molberger findet mein Konzept beachtlich. Sie diskutieren es während des Fluges. Es ist nur ein kurzes, beiläufiges Gespräch, unterbrochen von entspannten Blicken auf deutsche Landschaften, auf flurbereinigte Felder, frisch gestrichene Dörfer, geschwungene Autobahnkreuze. Dann schläft Molberger ein, und Titus liest ein Buch über Philosophie. Der Traum endet mit dem überlauten Geräusch einer von einem Stein zertrümmerten Krone. Das Knirschen und Splittern weckt mich aber nicht auf, sondern lässt den Traum einfach genau an dieser Stelle enden, sodass der mit weichen Polstern, Teppichen und eleganten Plastikverkleidungen gestaltete Innenraum des Flugzeuges allmählich verschwimmt, ein blaugrauweißes Farbengewaber. Einzelne Rauchsäulen steigen auf. Ich konzentriere mich auf das Tageslicht, auf die morgendliche Helligkeit, wie sie über die Oberlichter und Fensterfronten in den Lesesaal der Bibliothek hineinströmt. Es ist eine Kunst für sich, mit so einem Traum umzugehen. Ich bin sehr früh aufgewacht und gleich in die Bibliothek gefahren. Ich fahre jetzt jeden Tag in die Bibliothek. Ich denke, es ist am besten, wenn ich zu meinen alten Gewohnheiten zurückkehre. Es könnte sein, dass jemand von der Agentur, vielleicht Beatrice mit ihrer sanften, eindringlichen Stimme, bei mir anruft, um mir zu sagen, dass es Wosch und Steinfeld furchtbar Leid täte, dass aber alles ein »schrecklicher Irrtum« sei. Ich fahre in die Bibliothek, wo ich für niemanden erreichbar bin. Im Sommer, als es so heiß war und ich mit Sonja für das Physikum gelernt habe, waren wir fast jeden Tag da. Wir haben Wochen und Monate gelernt, wochenlang Karteikarten zur Physiologie der Nervenzelle und zur Arbeitsweise des Gehirns, der Ganglien und Synapsen beschriftet und auswendig gelernt. Ich bin schon so oft hier gewesen, dass ich denke, dass jeder weiß, was mit mir los ist, und jeder hier irgendeine Idee von mir hat, am Ende hat selbst das Gebäude, haben selbst die Bücher, die Wände und Lampen irgendetwas in Erinnerung behalten, und jedes Mal, wenn ich hier bin, fällt es ihnen wieder ein. Auf der Hinfahrt habe ich mir Per Anhalter durch die Galaxis gekauft, das ich unter den Lehrbüchern, die ich mitgenommen habe, verstecke. Ich bin auf einmal begeistert von meiner neuen Rolle, dass ich etwas tue, und tatsächlich nicht irgendetwas, sondern etwas, das unter günstigen Umständen mit 8000 Mark entlohnt wird, und dass ich, und zwar als einziger hier, sozusagen mit Erlaubnis, Kapitalist bin. Ich laufe durch den Lesesaal. Der grünlich schimmernde Teppich dämpft die Geräusche, aber verführt auch dazu, unvorsichtig zu sein. Für einen Moment kommt mir alles lächerlich vor, unsinnig und albern, und ich möchte sofort mit Wosch telefonieren, der mir mit seiner frischen, einnehmenden Art Mut machen könnte. Wosch sagt: »Zwei Wochen, oder? Zwei Wochen, dann sehen wir, wie weit du bist.« Sie sehen, wie weit ich bin. Am besten ist es, denke ich, dass ich so viel habe, so viele Ideen, dass sie sie gar nicht alle auf einmal sehen können. Ich könnte mit Tobias Rosenberg sprechen, einem ehemaligen Freund von Sonja, und ihn fragen, wie viel Geld ich verlangen soll. »8000«, würde ich sagen, »ist natürlich ein bisschen viel. Aber wenn man es als Verhandlungsbasis nimmt.« Rosenberg hat bei GFPD gearbeitet, Sonja hat es mir mal erzählt, und ich könnte sie fragen, ob sie mir seine Nummer gibt, Tobias Rosenbergs Telefonnummer, der vielleicht über ein geheimes, noch unerschlossenes Wissen verfügt. Es gibt in der Bibliothek viele Verstecke und Schlupfwinkel. Gerade die Medizinstudenten verfügen über ein ausgeklügeltes System, sich über die gesamte Bibliothek so zu verteilen, dass sie gleichzeitig nirgendwo und überall sind. Sonja findet man zum Beispiel nie, auch wenn man sie noch so lange sucht. Manchmal versteckt sie sich im Handschriftenlesesaal oder in irgendeinem Zwischengeschoss. Sie hat eine ganz besondere Fähigkeit, sich zu verstecken. Als wir noch zusammen waren, versteckte sie sich manchmal so gut, dass ich sie tagelang nicht fand. Manchmal versteckte sie sich auf eine symbolische Art und Weise, wenn sie zum Beispiel schwieg und nichts sagte, so wie sie es tat, als wir kurz vor der Prüfung bei Titus zum Essen eingeladen waren. »Arbeitet er wirklich in einer Agentur?«, fragte sie, als wir zusammen nach Hause gingen. »Und so jemand kennst du?« Es war ein Essen im kleinen Kreis, und Titus war ganz begeistert von der Idee, dass wir beim Zubereiten der Mahlzeit ein Team bildeten. Wir hielten die selbst gemachten Nudeln, die zuerst aus einem Stück bestanden, ein langer zusammenhängender, fast vier Meter langer Faden, der aus der im Flur aufgestellten Nudelmaschine quoll, mit Hilfe einer Menschenkette über eine Entfernung von fast vier Metern hoch bis zur Küche, wo Titus den Faden, Nabelschnur einer riesigen Kreatur, mit einer Schere in kleine Stücke zerschnitt und sie in einen gusseisernen Topf mit kochendem Wasser hineingleiten ließ. Sonja bekam einen Lachanfall, und beinahe wäre alles schief gegangen, schon im Flur, im Vorfeld, aber Titus war reaktionsschnell genug und hielt den plötzlich herunterhängenden Faden fest. Auf dem Heimweg fing Sonja dann auf einmal von Tobias Rosenberg an, dass er aber viel sympathischer sei als Titus. Sie kann es nicht ertragen, wenn jemand von einer Sache begeistert ist, und ich versuchte ihr zu erklären, dass sich Titus manchmal sogar über seine Arbeit lustig macht. Titus würde nie auf die Idee kommen, dass Sonja ihn nicht mag oder nicht ernst nimmt. Sie sagte: »Und so jemand kennst du? So jemand?« Ich laufe eine Weile durch den Lesesaal, über den grünen Teppich, der so weich und nachgiebig aussieht, und suche nach einem Platz, wo ich mit dem Konzept anfangen kann. Das Konzept darf keinen überflüssigen Gedanken enthalten, wie es überhaupt, wie ich glaube, keinen Gedanken, sondern nur Ideen enthalten darf. Allein eine Idee, ein Detail kann für den Gesamteindruck von großer Wichtigkeit sein. Wie Titus uns zum Beispiel, obwohl ich es etwas übertrieben fand, vor dem Essen die Hände wusch. Er ging mit einer Emailleschüssel um den Tisch herum, und man musste die Hände in die Schüssel eintauchen, und Titus wusch sie und trocknete sie dann mit einem dünnen Leinenhandtuch ab. Jeder musste das über sich ergehen lassen, und man war beeindruckt und gleichzeitig etwas peinlich berührt. Es liegt vielleicht an seinem Bedürfnis nach Harmonie, dass er so etwas tut, dass er sich so viel Mühe gibt und dass er gerade das Flüchtige, Vergängliche bewahren will. Ich überlege, ob es eine Idee gibt, die zwingend ist, während ich in eines der oberen Stockwerke gehe, um mir einen Platz zu suchen, wo man mich nicht so gut sehen kann. Ich stecke mir Schaumstoffstöpsel ins Ohr. Ich suche nach einer Idee. Sie muss einfach und trotzdem schön sein. Eine Schönheit, die alles zusammenführt und miteinander verbindet. Ich sehe sie in Gedanken schon vor mir, für einen kurzen, verschwommenen Moment, und dann beuge ich mich über mein Notizbuch und fange an.