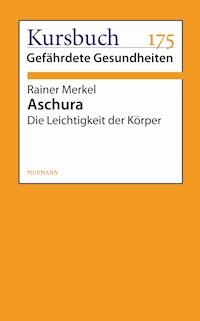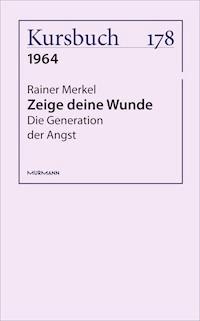8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Die Liebe: Begehren, Verhängnis, Erinnerung Rainer Merkel erzählt Szenen einer erlöschenden Liebe: Ein Mann muss zum Flughafen. Er hat es eilig, kommt aber nicht voran, seine Erinnerungen halten ihn auf. Die Stadt leuchtet für ihn noch einmal im grellen Licht der Erotik. Die Suche nach der Wahrheit wird zu einem sexuellen Geständnis, einem Geständnis ohne Zuhörer, einem Monolog ohne Publikum. ›Lichtjahre entfernt‹ ist eine Tour de Force durch die Abwege der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Ähnliche
Rainer Merkel
Lichtjahre entfernt
Roman
Fischer e-books
Der Autor dankt der Jürgen-Ponto-Stiftung und dem Herrenhaus Edenkoben.
Für meinen Vater
»Bis dahin hatte ich nur darauf gewartet, aber jetzt hatte ich endlich begriffen, daß ich keine Minute länger warten durfte, daß ich, wenn ich glücklich sein wollte, es augenblicklich sein mußte.«
Emmanuel Bove
Teil Eins
1
Die Hitze ist so stark, lastet so schwer auf einem, dass man sie immerfort beiseiteschieben und wegdrängen will. Ich lasse das Wasser im Bad laufen, während ich im Wohnzimmer vor der orangenen Couch stehe, auf der Judith vor fünf Tagen geschlafen hat. Die Hitze schiebt sich wie ein großes mehrdimensionales Gebilde in die Wohnung, als drängte der gesamte Atem der Stadt, die Ausdünstungen von ganz Brooklyn in das Zimmer hinein. Ich schaue auf die Couch. Das leuchtende Orange ist eine eigentümliche Radikalisierung, eine fast comichafte Wiederholung ihrer Haut. Die Couch, plötzlich erhellt, unwirklich geworden, überbelichtet, wie ausgebleicht. Sie hat nicht einmal ein Laken benutzt, es sich aber gefallen lassen, dass der Ventilator nur auf der untersten Stufe läuft. Ich habe noch eine Stunde, höchstens anderthalb. Immer wieder halte ich inne. Gehe die Stationen im Einzelnen durch. Das heißeste New York seit Jahren. Schon am Sonntag auf dem Dampfer auf dem Hudson River, bei meinem Ausflug mit Mads Christiansen, kam mir der Verdacht, es wäre vielleicht besser gewesen, doch nach Washington zu fahren. Aber wieso soll ich nach Washington fahren, wenn sie genauso gut nach New York kommen kann und wir sogar eine Wohnung für uns ganz allein haben? Aber ich lasse mich auf einen Machtkampf mit ihr ein. Noch dazu in einer Wohnung, die keine Klimaanlage hat. Nicht im Geringsten habe ich an sie gedacht, als ich den Ventilator gekauft habe. Trotzdem würde ich alle verfügbaren Ventilatoren, die in diesem Sommer in New York zu bekommen sind, für sie kaufen. Ich hätte die Wohnung von Michael und Janette mit Ventilatoren bestückt, mit Dutzenden, mit Hunderten von ihnen. Allein in dem kleinen Billigladen an der Ecke Grand Street/Leonard Street hätte ich alle verfügbaren Ventilatoren gekauft, auch den mannshohen, der mich, wie er im Geschäft zu Demonstrationszwecken auf einem Karton aufgestellt ist, sogar leicht überragt. Die Hitze macht ihr nichts aus. Sie ist immun dagegen. Sie schwitzt noch nicht mal. Sie sagt, die Wohnung sei schön, aber sie sagt es erst, nachdem wir sie schon wieder verlassen haben. »Möchtest du wirklich nur eine Nacht bleiben?«, frage ich, als wir in dem koreanischen Restaurant in der Grand Street sind. Ich habe den großen Ventilator nicht gekauft, weil er mir zu klobig erschien. Auf höchste Stufe gestellt, erreicht auch der neue nur dann einen Kühlungseffekt, wenn man sich direkt vor ihn stellt. Er läuft ununterbrochen, nur nachts stelle ich ihn aus. Ein wie wahnsinnig rotierendes Plastikgebilde, bei dessen Anblick man immerzu fürchtet, es würde sich selbständig machen, sich in Bewegung setzen und die Wohnung, selbst auf der Suche nach Kühlung, verlassen, mit unbeholfenen ruckenden Schritten durch die Grand Street bis an die Kreuzung Grand Street/Leonard Street, um dort voller Verzweiflung vor den Schaufenstern des geschlossenen Geschäfts, aus dem es stammt, stehen zu bleiben und immerfort mit seinen Plastikrotorblättern wedelnd auf Erlösung zu warten. Das orangerote Velours der Couch. Die Schweißtropfen, die nicht verdunsten und Flecken hinterlassen. Und wie Judith sich auf einmal einfach auf die Couch legt und ich auf das Doppelbett. Ein misslungenes Wochenende, ein außer Kontrolle geratener Machtkampf. Oder einfach ein Zeichen von Erschöpfung?
Jetzt, eine Stunde vor meinem Abflug, habe ich den Ventilator ausgeschaltet. Vielleicht weil ich mich mit der Hitze bestrafen will oder weil ich mich mit einer kindlichen Begeisterung auf die kalte Dusche freue, auf die jetzt alles zusteuert, der letzte Akt, bevor ich New York verlasse. Wir verbringen nur eine Nacht zusammen. In getrennten Betten, die so weit voneinander entfernt sind, dass wir uns noch nicht mal die Hand geben können. Vielleicht ist es nur eine Episode in einer langjährigen Beziehung, über die man später lachen kann. Ich packe das grüne Plastikkreuz ein, das ich ihr bei der Verabschiedung zu geben vergessen habe. Die dunkelbraune Papiertüte mit dem leuchtend grünen Kreuz, billiger, zerbrechlicher Designerschmuck, mit dem ich ein Lächeln auf ihr Gesicht, wie ich nicht anders sagen kann, zaubern wollte. Wir verlassen das Restaurant und laufen die Grand Street entlang. Etwas von ihrer anfänglichen Begeisterung kehrt wieder zurück, als ich ihr das Geschäft zeige, in dem ich den Ventilator gekauft habe, und den Supermarkt, in dem man sich immer so fühlt, als sei man in Südamerika. Für einen Moment bleibt sie vor dem verbarrikadierten stockdunklen Laden stehen, während ich erzähle, wie die Kinder der Besitzer einem die Einkäufe immer in Plastiktüten packen und dann sogar noch bis zur Straße tragen. Tagsüber reiht sich hier ein Geschäft an das andere, und in der Nacht taucht dann auf einmal zwischen all den heruntergelassenen Rolltoren eine kleine Bar auf, die Blue Mountain heißt. Unter normalen Umständen würde sie ihr gefallen, aber sie will noch nicht mal ihren Cocktail austrinken und versinkt in dem großen Sessel neben der Fransen-Stehlampe, die direkt am Fenster steht. »Und wo ist jetzt deine Wohnung?«, fragt sie. Sie versucht mit aller Kraft den Eindruck zu erwecken, als würde sie den Abend genießen. Wir laufen durch New York. Wir laufen durch die Hitze. Den ganzen nächsten Tag, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Und ich denke in diesem Moment, dass Judith doch ein ganz anderer Mensch ist als Gabriela und dass man sie kaum miteinander vergleichen kann und es auch keinen Sinn macht, es immer wieder zu tun. Wenn Gabriela etwas nicht gefällt, wird sie sofort wütend, während Judith immer ganz ruhig bleibt. »Da oben«, sage ich und zeige auf den dritten Stock. Es ist ein Witz. Wir verbringen nur eine Nacht zusammen. Judith trinkt den Cocktail aus, aber nur weil ich sie darum bitte. Sie leert das Glas in einem Zug, und das wiederum ist etwas, das Gabriela nie tun würde.
Plötzlich ergraut und verhärtet sich alles. Die zerrissenen Fliegengitter vor den Fenstern. Die wackeligen Regale, die mit Industrielack angestrichen sind. Das enge klaustrophobische Bad, dessen Eingang direkt neben dem Elektroherd liegt. New York ist an diesem Tag diesig und schwermütig. Alles hält die Luft an, bevor die Hitze ihren Höhepunkt erreicht. Mein Flug geht in drei Stunden, aber ich habe die Wohnung noch immer nicht aufgeräumt. Direkt neben dem Bett vor dem zubetonierten Kamin auf einem großen Stapel mit Ausgaben der Zeitschrift n+1 steht der Wecker. Der Alarm ist auf sieben Uhr gestellt. Als wäre das eine Formel, eine Zustandsbeschreibung. n+1. Als könnte das Glück bringen. Aber ich bin schon eine Stunde früher aufgestanden. Ich sage zu ihr: »Wollen wir nicht spazieren gehen? Wollen wir uns nicht New York anschauen?« Wenn sie in München am Wochenende tanzen gehen will, ist ihre Vorfreude immer so groß, dass ich schon allein deswegen mitkomme, um zu erleben, wie glücklich sie ist. Sie schaut auf die Speisekarte. Es fängt alles ganz normal an. »Wie sieht sie denn aus?«, fragt sie, als würde sie eine ganze Woche bleiben. Sie sagt: Deine Wohnung. Sie gehört Michael und Janette. Es ist allenfalls »unsere« Wohnung, zumindest an diesem Wochenende. Es ist ihre Spezialität, ihr intuitives Verständnis von Zeiträumen, in denen sich unser Schicksal verengt und sich meine Unfähigkeit, schnell zu reagieren, so zuspitzt, dass ich am nächsten Tag vier Meter vor der elektrischen Schiebetür des Port Authority Bus Terminals, kurz bevor sie nach Washington zurückfährt, auf einmal alle Kommunikationsfähigkeit verliere und minutenlang gar nichts mehr sage. Dabei fahre ich nicht mit, dabei steige ich gar nicht in den Bus ein. Eine Frage drängt sich mir in diesem Moment auf, während ich in der Küche vor dem Regal stehe und überlege, ob der Staub, der sich wie ein Schleier über das arabisch aussehende Tongefäß gelegt hat, von mir stammt und wie er sich während meiner Anwesenheit dort so schnell gesammelt hat. Nämlich die Frage: Hat ihr die Stadt etwa nicht gefallen? Ist sie von New York enttäuscht? Ihre Augen bekommen einen merkwürdigen Glanz, als wir vor dem kleinen Haus mit der Wellblechfassade stehen, in dem Michael und Janette wohnen. Während wir noch auf dem Weg zur Wohnung die ganze Zeit über das Buch, das Kyra ihr geliehen hat, sprechen und ich das Gefühl habe, sie würde mich mit einem ihrer Akademiker-Freunde verwechseln, ist sie jetzt auf einmal ganz übermütig und verspielt. Es ist etwas, das ich schon einmal einem Klienten erklärt habe, als es darum geht, eine traumatische Erfahrung zu bearbeiten, und ich ihm sage, dass man solche Erinnerungsräume sehr wohl noch einmal betreten könne und dass man dabei selbst entscheiden kann, wie lange man in ihnen verweilt, und dass man auch das Recht hat, diesen Raum für sich anders zu gestalten und zu verändern, sofern es dem eigenen psychischen Gleichgewicht dient. Als es bei meiner letzten Stunde mit Lambert zu einer Auseinandersetzung kommt, sage ich ihm, dass es mir leidtäte, dass es ausgerechnet jetzt passiert sei, es würde auch mich belasten und er könne versichert sein, dass wir genau an der Stelle bei meiner Rückkehr wieder anknüpfen und genau dort weitermachen würden. Ich sage zu ihm: »Wir fangen genau an der gleichen Stelle wieder an.« Und um ihn zu beruhigen, mache ich mir in meinem Kalender sofort einen Vermerk. »Jetzt guck dir das an«, sagt Judith. Sie hat sich die Handtasche über die Schulter gehängt und schaut nach oben.
In meiner Erinnerung konzentriert sich diese Nacht auf genau diesen Moment. »Jetzt guck dir das an«, sagt sie und kneift die Augen zusammen. »Was meinst du denn?«, frage ich, während sie zu den Fenstern der Wohnung von Michael und Janette schaut. »Es ist niemand da.« »Wieso?« »Die Leute sind weggegangen.« »Welche Leute?« »Na die, die da wohnen.« Ich schaue auf die Fenster. Sie möchte nicht zugeben, dass sie müde ist und sich am liebsten sofort hinlegen will. Als wir das koreanische Restaurant verlassen, sagt sie noch: »Das ist total aufregend! Jetzt schauen wir uns Williamsburg an.« Dabei sind wir schon mittendrin. Sie hakt sich bei mir ein. Wir sind ein Paar, das sich gerade erst kennengelernt hat. Tatsächlich fühlt es sich so an, als würden wir ausgehen. »Vielleicht schlafen sie ja schon«, sage ich. »Und was ist, wenn sie nicht aufmachen?« »Dann klingeln wir sie raus«, sage ich. »Das lassen wir uns doch nicht bieten.« Sie lächelt. Wie hat ihr Gesicht vorher ausgesehen? In den fünf Jahren davor und in den zwei Tagen, während derer wir uns in New York gesehen haben. Der Duschvorhang in der Wohnung von Michael und Janette ist so verschimmelt, dass ich ihn direkt nach meiner Ankunft mit einer Schnur zusammengebunden habe, um Judith den Anblick zu ersparen. Die Dusche sieht ohne Vorhang nicht besonders vertrauenerweckend aus. Sie besteht aus einem gemauerten Winkel im Badezimmer, zu dem man nur gelangt, wenn man sich zwischen Waschbecken und Toilette hindurchzwängt, um dann auf einmal wie unter einem Felsvorsprung zu stehen, unter dem das Wasser leise tröpfelt und dann unverhältnismäßig laut auf den Steinboden schlägt. Ich höre das Tröpfeln, als sie morgens unter der Dusche steht. Die Wassertropfen, die auf den Stein prallen. Das Wasser, das zu warm und zu unergiebig ist. Es sind diese Geräusche, die mich daran hindern, die Wohnung und auch New York zu verlassen. Der Duschvorhang, milchig weiß und mit seinen in Plastik eingeschlossenen Luftblasen, seinem grauen Schleier aus Schimmelflecken, wie er in aller Unschuld in der Ecke hängt. Die durchlöcherten Fliegengitter vor den Fenstern, die verstaubten Regale, die Ritzen und Spalten auf den Fußböden. »Wo sind diese Leute denn hingegangen?«, frage ich sie. »Die spazieren hier irgendwo rum«, sagt sie, sich an mich lehnend. »Vielleicht gehen die jetzt irgendwo noch was trinken.« »Jetzt?« Sie schaut auf die andere Straßenseite. Auf einmal hat sie das Interesse an der Unterhaltung verloren. Am nächsten Tag, als wir spazieren gehen, bleibt sie alle paar Meter stehen und muss sich ausruhen. Sie kriegt keine Luft mehr. Mads Christiansen hat mir einmal erklärt, dass Asthma eine »königliche Krankheit« sei, eine »auratische Krankheit«. Und dass er es nachvollziehbar fände, wenn Judith mit mir morgens nicht joggen gehen will, und dass sie keine Luft mehr bekommt, wenn ich nachts so schnell einschlafe. Ausgerechnet in New York. Das Königliche des Asthmas. Wie jede Bewegung hinterfragt und überprüft wird, wie man darauf achtet, dass man sich nicht verausgabt und sich immer im Gleichgewicht hält. Die Fortbewegung von A nach B und das Laufen an sich bekommt auf einmal etwas Unwürdiges. »Ja, die spazieren hier irgendwo rum«, sagt sie. »Die gehen noch aus.« Ich überlege, ob ich mich noch einen Moment hinlegen soll. Die Couch steht direkt am Fenster, und dort ist es vielleicht etwas kühler. Auf der Couch liegen die alten Ausgaben der New York Times. Zeitungen von einer ganzen Woche. Im Luftzug der Ventilatoren heben und senken sich die vordersten Seiten, und die Zeitungen scheinen sich mit Luft aufzupumpen und noch ein letztes Mal auf sich aufmerksam machen zu wollen. Irgendwo darunter muss das Buch von Kyra sein, das Judith vergessen hat. The Mask of Anarchy. Es muss irgendwo unter den Zeitungen liegen. »Wir fangen genau an der gleichen Stelle wieder an«, sage ich zu Lambert, in der letzten Stunde vor meiner Abreise aus München. Ich habe seine Stunde vorverlegt, und er ist jetzt der erste Klient, den ich nach meiner Rückkehr treffen werde. »Ich lasse Sie nicht hängen«, sage ich zu ihm. »Aber ich traue Ihnen schon zu, dass Sie zwei Wochen ohne Therapie auskommen.« Lambert schaut mich an. Ich bin mir nicht sicher, ob er die Therapie nicht einfach abbricht, so gekränkt wie er ist, und ich frage mich, während ich die Zeitung zusammenpacke und ins Badezimmer hinübergehe, ob das ohnehin nicht das Beste für ihn wäre. »Komm«, sage ich zu Judith. Ich versuche das Spielerische des Augenblicks noch aufrechtzuhalten. »Wir gucken mal.« Sie schaut zur anderen Straßenseite. Man hört Schritte, die langsam näher kommen. »Was?«, murmelt sie abwesend. Die Tasche rutscht ihr von der Schulter. »Was gucken wir?«, fragt sie. »Wir schauen mal, ob sie da sind.« Ich nähere mich vorsichtig der Haustüre und schaue auf das Klingelschild, auf dem gar nicht Michael und Janettes Namen stehen, sondern nur die Nummern der verschiedenen Wohnungen. »Die werden sich wundern«, sage ich. Es ist fünf Tage her, eine halbe Ewigkeit. Ich lege den Arm um sie, aber ich glaube, dass sie das gar nicht merkt, so abwesend wie sie auf einmal wirkt. »Die werden ihr blaues Wunder erleben«, sage ich und drücke auf die Klingel.
2
Es ist gar nicht die Nacht, die so ungünstig verlaufen ist. Es ist der Spaziergang. Der Sonntag, an dem wir durch New York laufen. Im Grunde laufen wir die ganze Zeit, ohne aber genau zu wissen wohin. Wir gehen aus dem Haus, frühstücken, und dann laufen wir. Ich mache dies vielleicht in dem Glauben, wir würden irgendein Ziel erreichen, irgendeinen Ort finden. Die Terrasse des Cafés in der Bedford Avenue, die Parkbank im Fulton Park, die Aussichtspromenade in Brooklyn Heights, die zwei dunkelblauen, viel zu engen, Beklemmungen auslösenden Sessel im obersten Stock des Cafés in der Montague Street und dann, so als hätten alle anderen Möglichkeiten keine Bedeutung, das Port Authority Bus Terminal. Die Warteschlange der Passagiere, die nach Washington fahren. Vier oder fünf, die noch vor uns sind. Drei Minuten, die uns noch bleiben, die wir mit Belanglosigkeiten füllen, obwohl es mir in diesem Moment wie ein Aufschrei durch den Kopf schießt: Noch drei Minuten und ich sehe sie die nächsten vier Monate nicht wieder. Am Abend im Restaurant habe ich noch gedacht, ich hätte einen ganzen Tag Zeit, sie zu überreden, noch länger zu bleiben, aber dann ist es auf einmal zu spät. Ich habe den richtigen Moment verpasst. Ich höre ein lautes Dröhnen, als ein Lastwagen in die Straße hineinfährt. »Vielleicht fängst du mal langsam mit dem Aufräumen an«, sagt eine innere Stimme. Eine Stimme, die erstaunlich rücksichtslos und brutal ist und die ich bei meiner Arbeit mit meinen Klienten zügeln muss. Eine Stimme, die aber auch von großem Nutzen sein kann und mich davor bewahrt, die Kontrolle zu verlieren. »Das klare Licht bricht in der Dunkelheit hervor«, heißt es in dem Haiku, der auf der Serviette abgedruckt ist, in dem kleinen koreanischen Restaurant, in dem wir essen. Es könnte der erste Haiku gewesen sein. Den zweiten habe ich direkt danebengeschrieben, sodass ich die beiden jetzt kaum noch auseinanderhalten kann. »Ja, ja, schrie ich, doch das Klopfen hörte nicht auf am verschneiten Tor.« Aus irgendeinem Grund habe ich sie ohne Zeilenumbruch abgeschrieben, und jetzt weiß ich nicht, wie sie zu unterteilen sind. Judith mag keine Haikus. Schon gar nicht in einem koreanischen Restaurant. Ihre Abneigung ist jedoch so unterschwellig, als versuche sie, die japanische Diskretion noch zu überbieten. Einmal sagt sie: »Ich mag ihn.« Und ich frage sie: »Magst du ihn wirklich? Den oder den anderen?« »Beide«, sagt sie. Aber es ist nicht die Wahrheit. Ich kann nicht sagen, dass ich glaube, sie lügt. Wie soll ich ihr das sagen? »Haben sie denn in Korea keine Haikus?«, frage ich. »Bestimmt nicht«, sagt sie. Wieso schreibe ich die Haikus ab, ohne den Zeilenumbruch zu beachten? »Das klare Licht« oder »das klare Licht bricht«? Ich könnte es rekonstruieren, man könnte das hinbekommen. Sie presst sich die Serviette gegen die Lippen. Es ist die größtmögliche Aggression, zu der sie fähig ist. »Das Klopfen am verschneiten Tor.« Ich muss es auswendig lernen, mir alles merken, solange die Erinnerung noch frisch ist. Ich habe noch immer das Bad nicht geputzt, und ich muss auch die Küche noch aufräumen. Stattdessen schaue ich aus dem Fenster. Einige weißgekleidete Arbeiter tragen die in Folie verschweißten Fleischstücke von der Ladefläche des LKW zu dem benachbarten Lagerhaus. Ich höre das Warnsignal eines zurücksetzenden Lastwagens und reiße die Seite mit den Haikus aus meinem Notizbuch heraus. Ich muss das Flugzeug bekommen. Ja, ja, schrie ich. Das Wohnzimmer habe ich schon geputzt oder zumindest das, was einem sofort ins Auge springt. Ich schalte den Ventilator wieder ein. »Jetzt wollen wir doch mal sehen«, sagt sie, während sie das gewellte Papier der Speisekarte vor sich ausrollt. In der Wohnung ist es so heiß, dass sich mein ganzes Leben auf einmal in einen einzigen Wassertropfen verwandelt, der in der Luft hängt. Er fällt nicht, er kommt nicht an, er verdunstet noch in der Luft. Das klare Licht. Noch immer stehe ich in Gedanken in der Wohnung, noch immer schaue ich auf die Schweißränder auf der Couch. Oder: Das klare Licht bricht. Ich muss unbedingt diese Haikus auswendig lernen, denke ich die ganze Zeit. Das ist das Wichtigste. Schon wieder fällt ein Schweißtropfen herunter. Immerhin lebe ich noch.
Er ist wie eine Schicht, die schützt und gleichzeitig an einem zehrt. Eine unsichtbare parasitäre Hülle, die aus einem herauswächst, um sich schon im nächsten Moment in Luft aufzulösen. Wie Kleidung, der man nicht traut, oder Kleidung, die sich selbst nicht traut. Eine Schicht, die zurückweicht. Etwas, das aus dem Körper flüchtet und nicht weit kommt. Etwas, das einen Blick nach draußen riskiert. Im Spiegel des winzigen Badezimmerschränkchens von Michael und Janette sieht es so aus wie eine ölige silberne Rüstung, die schwer auf den Schultern liegt. An manchen Tagen schwitze ich einfach so, ohne dass ich es merke, und es scheint keine Rolle zu spielen. Aber schon im nächsten Moment schwimmt der ganze Körper davon, und man verliert allen Halt. Ich klappe das Notizbuch wieder zu und gehe in die Küche. Ich lasse das Wasser im Bad laufen, während ich vor dem Ventilator auf dem Fußboden knie und das arabisch aussehende Tongefäß zusammenklebe. Als ich den Staub rund um das Tongefäß mit einem kleinen Schwämmchen zu beseitigen versuche, bricht das Regal in sich zusammen. Es ist eines der vielen unvorhergesehenen Ereignisse, die sich der Hitze und der nervlichen Anspannung verdanken. Ich habe Michael und Janette noch nie in meinem Leben gesehen, ich habe sie noch nicht persönlich kennengelernt, aber ihr arabisch aussehendes Tongefäß habe ich schon kaputt gemacht. Den Büchern in den Regalen zufolge beschäftigen sie sich mit Literaturwissenschaften und Philosophie. Janette macht Video-Installationen, jedenfalls hat mir das Mads Christiansen erzählt. Die Wohnung ist so schlicht, dass Judith sie gar nicht zur Kenntnis nimmt. »Wie findest du sie«, frage ich sie. »Sie ist ganz schön, oder?«, sagt sie. Etwas Schlimmeres ist aus ihrem Mund kaum vorstellbar. Ganz schön? Die Dielen haben langgezogene Risse, in denen sich Staub und Dreck sammeln, die Möbel sind alt und verschlissen, aber die Wohnung gefällt mir. In der Nachbarschaft gibt es viele kleine Betriebe und Lagerhallen. Flache Gebäude mit Rolltoren und Backsteinwänden, die mit Graffiti bemalt sind. Direkt nebenan ist das Kühlhaus einer Fleischverarbeitungsfirma, aber sonst gibt es nicht viel zu sehen. Der interessantere Teil von Williamsburg ist einige Straßenzüge entfernt, und Michael und Janette sind die Ersten aus der Kunstszene, die dieses Gebiet erschlossen haben. Lohnt es sich, das Gefäß wieder zu reparieren? Es sind mehr als ein Dutzend Teile. Ich drehe mich nach dem kleinen Plastikwecker um, den ich für einen Dollar gekauft habe. Der Plan, am Flughafen einen Kaffee zu trinken und in Ruhe Notizen zu machen, erscheint mir auf einmal unrealistisch. Judith sagt: »In Washington ist es genauso heiß, aber es macht mir nichts aus.« Sie ist vom ersten Moment an müde und erschöpft. Vielleicht, weil die Busfahrt so anstrengend gewesen ist und die langwierige Auseinandersetzung, die ihrem Besuch vorausgegangen ist, ihr die Laune verdorben hat. Sie trägt keinen Lippenstift. Sie hat noch nicht mal ihren Make-up-Koffer dabei, als ich sie am Busbahnhof abhole. »So ein Mist«, sagt sie. »Ich habe meinen Inhalator vergessen.« Für einen Moment bricht sie aus dem symphonischen Kosmos ihrer Harmonie aus und ist tatsächlich wütend. »Mist«, sagt sie. »Wirklich. Scheiße.« Sie beißt sich auf die Unterlippe. Für einen Moment scheint es denkbar, sie könne sofort nach Washington zurückfahren. Warum ich eigentlich nicht kommen will, hat sie einmal gefragt, bei einem unserer nächtlichen Telefonate, in der ersten Woche, als ich draußen in der lauen Abendluft vor dem an einer Hauswand angebrachten Telefon in der Grand Street stehe, den Verkehr im Rücken, ihre Stimme im Ohr, und ununterbrochen Geldstücke in den blauumrandeten Metallschlitz stecke. »Warum kommst du nicht zu mir?« Geldstück um Geldstück, als wäre es eine Vergnügungsmaschine, eine Stimmen-Peepshow, während sie in ihrer kleinen Wohnung in Washington sitzt, im zwölften Stock eines ehemaligen Hotels, und ihre fellartigen grünen Riesenhausschuhe trägt, nach denen ich am Ende fast noch mehr Sehnsucht habe als nach ihr selbst. Sogar Baltimore oder die Fahrt nach Paris steht jetzt in der Rangfolge unserer Reisen besser da, wenn man es mit dem Wochenende in New York vergleicht. Ich schaue auf die Couch. Das orangerote Velours der Couch. Die Schweißtropfen, die nicht trocknen und Flecken hinterlassen. Und wie Judith sich sofort hinlegt, kaum dass wir die Wohnung betreten haben. Es ist nur eine Nacht. Noch dazu auf zwei verschiedenen Betten. Wir laufen durch die Hitze. Aber wir schauen uns nichts an. Wir sind blind für die Sehenswürdigkeiten von New York. Eine Stadt, die sich aus unserer Umklammerung nicht befreien kann und ununterbrochen transpirieren und schwitzen muss. Und ich denke in diesem Moment, dass Judith beim Sex immer so aussieht, als würde die Welt untergehen, während Gabriela mich immer so ansieht, als hätte sie Grund, wütend auf mich zu sein, als sei sie verärgert, obwohl das ihre Art ist, Lust auszudrücken. Sie ist einen Kopf kleiner als Judith. Ihr im Vergleich zu Judith fast winziger und sich beim Sex geradezu verschluckender Körper. Ihr zimtfarbener, anbetungswürdiger, verschwenderischer Körper. Gabriela, deren Körper strahlt, leuchtet, in meiner Erinnerung in Flammen steht.
Vielleicht liegt es an der Klimaanlagenluft. Als wir den Busbahnhof betreten, hat sie auf einmal wieder gute Laune. Ich vergesse das Geschenk, das kleine grüne SchmuckKreuz, das ich auf dem Hinweg bei der Zwischenlandung in Chicago für sie gekauft habe. Ich trage es die ganze Zeit mit mir herum, und am Busbahnhof, am Port Authority Bus Terminal, vergesse ich es auf einmal. Nur wenige Meter von dem Mitarbeiter der Busgesellschaft entfernt, der die Tickets kontrolliert. Sie hält den Kopf wieder so hoch. Das ist der Museumsblick. Ein Blick, den ich von den vielen gemeinsamen Ausstellungsbesuchen schon kenne. Ihr Blick ist eine Mischung aus Erhabenheit und Leere. Ihre Handtasche geschultert und die Haare hochgebunden. So steht sie im Museum vor den Bildern. So als wollte sie sich ihnen zur Verfügung stellen. Als hoffte sie, etwas von der Aura der Bilder würde sich auf sie übertragen. Ich erinnere mich, wie sie bei der Lucien-Freud-Ausstellung, von der ich nicht mehr weiß, wo wir sie gesehen haben, schon den ersten Bildern mit dieser aufrechten, den Kopf gleichsam rahmenden Aura gegenübertritt. Als wollte sie sagen: Zeigt euch von eurer schönsten Seite, dann zeige ich mich auch von meiner schönsten Seite. Dabei sind die Gemälde von Lucien Freud gar nicht schön. Ich knie auf dem Boden und lege die Scherben des arabischen Tongefäßes zusammen. Was würde Judith jetzt sagen? Würde sie Mitleid mit mir haben? Und dann zeigt sich wieder ihre Präsidentengattinnenhaftigkeit, während wir vor einer dicken nackten Frau stehen und sie die Bemerkung macht: »Wusstest du eigentlich, dass er ein Enkel von Freud ist. Also dem Freud?« Und sie in ihrer typischen somnambulen Leere an mir vorbei auf ein anderes Bild schaut, um meine Reaktion einfach zu ignorieren. »Mir gefällt, wie die Frau aussieht«, sagt sie. »Die Haut sieht gar nicht so alt aus, wenn man die Augen zusammenkneift.« »Ja, wenn man die Augen zusammenkneift«, wiederhole ich, um nicht Gefahr zu laufen, belehrend zu wirken. Dabei kennt sie sich mit Kunst ohnehin viel besser aus als ich. Sie entdeckt ständig neue Künstler und neue Museen und erinnert mich daran, wenn wir uns mal wieder etwas anschauen müssen. Sie streicht sich mit ihrer rechten Hand über den Nacken, fährt mit der abgekauten Spitze ihres Zeigefingernagels über ihren entblößten Hals. Wie um Himmels willen schafft sie es, so gedankenlos und unvoreingenommen zu sein? Sie schaut auf die Bilder. Auf die wuchernde düstere Haut der Nackten von Lucien Freud. In der Ausstellung, die wir nicht in Deutschland, aber mit einiger Sicherheit auch nicht in London und schon gar nicht in Washington gesehen haben. Eine Ausstellung, die wir irgendwo gesehen haben, irgendwo auf unserer langen Wanderschaft, die unserem ständigen Bedürfnis geschuldet ist, die Schauplätze unserer Beziehung zu verlagern und möglichst jeden Monat auf einer anderen Bühne aufzutreten. Wie sie schon ins Museum hineingeht. Als begrüße sie ihre Gäste. Trotzdem kann ich nicht anders, als ihren zärtlichen Hochmut in diesem Moment zu bewundern. Sie selbst würde vor Scham erröten, wenn ich auch nur eine Andeutung machen würde. Wenn ich sagen würde, sie sei hochmütig oder, was noch schlimmer wäre, aggressiv. Ist sie aggressiv, wenn sie von der »Haut der alten Frau« spricht, die so aussieht »wie ein Feld«, das gerade eben »gepflügt« worden ist? Eine Frucht, die gerade »gepflückt« worden ist? In London? In Düsseldorf? Oder doch in München? Sie lächelt. Sie wirft den Kopf zurück. Weniger vielleicht, dass sie ihn zurückwirft, als dass sie ihn zurücklegt, etwas in die Rückenlage geht, um ihren Ausbruch von Lachen abzusichern und zu stabilisieren. Sie lacht, umgeben von diesen schmierigen traurigen Bildern des Enkels von Sigmund Freud. Sie lacht, wie man sagen könnte, rückwärts, nach hinten gewandt. In New York sind ihre Lippen blass und hell. Sie hat den Lippenstift nicht nachgezogen, während wir die langgezogene Bedford Avenue entlanglaufen, um dann doch mit der U-Bahn zum Fulton Park zu fahren. In dem kleinen Park hat man eine wunderbare Aussicht auf Manhatten. Man befindet sich direkt zwischen Brooklynund Manhattan-Bridge, aber wir haben kaum Zeit, uns auf eine der Bänke zu setzen und uns auszuruhen. Kurze Zeit später muss sie zum Busbahnhof zurück. Es ist ungeheuerlich. Sie schaut sich jedes Bild an. Es können noch so unbedeutende Skizzen sein, sie schaut sie sich an. Im Gegensatz zu ihr möchte ich die gesamte Ausstellung mit einem Blick erfassen, damit ich weiß, auf was ich mich einzustellen habe. Sie aber schenkt jedem noch so kleinen Kopf, jedem noch so fragmentarischen Porträt ihre ganze Aufmerksamkeit. »Haben nicht alle Lucien-Freud-Gesichter den gleichen Ausdruck?«, frage ich sie. Sie nickt, den Mund fest geschlossen, ein Ausdruck erotischer Verweigerung. Wenn sie doch nur ein einziges Mal den Kopf schief legen würde. Aber sie muss ihre Museums-Haltung wahren. »Ich finde das auch«, sagt sie in ihrer grenzenlosen Kompromissbereitschaft. »Sie sind geheimnisvoll. Ein bisschen mysteriös.« Sie gerät in Fahrt, zeigt einen Moment der Leidenschaft. »Ja«, sagt sie, »wir denken immer, wir kennen schon alles.« Sie sagt immer »wir«, wenn sie philosophisch wird. »Wir tun so, als verstünden wir alles. Aber manchmal verstehen wir uns selbst nicht. Und hier«, sie zeigt auf ein anderes Bild. »Findest du nicht, dass es brutal aussieht?« Ich verstehe nicht, was sie meint. »Oder gefällt es dir nicht, weil es nicht abstrakt ist?« Weil es nicht abstrakt ist? Sie spitzt die Lippen und legt den Kopf schief, um mich nachzumachen. Tatsächlich liebe ich sie dann am meisten, wenn sie mich nachahmt. Wie ist das zu beurteilen? Was heißt das? Ich liebe sie, wenn sie mich nachahmt. Wir gehen zu einem anderen Bild, in einer Ecke, wo ich noch nicht gewesen bin. Sie will mir etwas zeigen. Möchte sie mir ein Bild zeigen, in dem wir uns wiederfinden können? Ich kann mich an kein einziges Lucien-Freud-Bild erinnern. Ich sehe immer nur sie. Wie sie die Bilder anschaut und wie sie immer sagt: »Was wir denken. Was wir wissen … Als würden wir das alles verstehen.«
3
Zu diesem Zeitpunkt bleibt uns noch eine halbe Stunde. Das Geschenk ist in meiner MRI