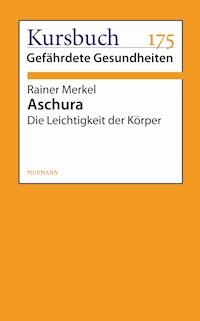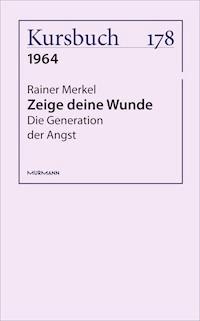9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Reisen in die Krise Oder Der Rausch des Helfens Rainer Merkel, der ein Jahr lang als Mitarbeiter bei der Hilfsorganisation Cap Anamur in einer Psychiatrie in Liberia gearbeitet hat, reist in drei vom Krieg verwüstete Länder. In seinen Reportagen fragt er, welche Anziehungskraft Traumata und Gewalt auf Menschen haben können. Friedensarbeiter, Traumatherapeut oder Bundeswehrsoldat: Sie alle suchen die Grenzerfahrung, die nicht intensiv genug sein kann. Als »Embedded Journalist« im Feldlager der Bundeswehr in Afghanistan wird Merkel plötzlich mit seiner eigenen Geschichte und seinen eigenen Traumata konfrontiert. Es zeigt sich, dass das Unglück der anderen unsere Trauer ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Ähnliche
Rainer Merkel
Das Unglück der anderen
Kosovo, Liberia, Afghanistan
FISCHER E-Books
Inhalt
»Der Wille zur andächtigen Hingabe ist eine veredelte Form der Maskierung.«
Aby Warburg
»Einem Kind wurde einst von dem Leiden eines andern erzählt. Darauf ging das Kind abseits und umarmte die Luft.«
Peter Handke
Kosovo
1
Am Anfang schien es noch so, als könnten wir ihm wirklich helfen, ein neues Leben anzufangen und alles zu vergessen, was er durchgemacht hatte. Ich frage mich, ob er auch so einen Blick gehabt hat. »Dieses betäubte Starren, die weit aufgerissenen, leeren Augen eines Mannes, dem alles egal ist.« Der Zweitausend-Jahre-Blick, von dem die Amerikanerin Judith Herman in ihrem Buch Die Narben der Gewalt erzählt. Ich denke daran, als ich auf dem Weg ins Café Gottlob bin, an einem warmen Frühlingstag in Berlin. Ich denke an den Jungen, der noch nie in seinem Leben Schuhe getragen hatte, den Carly so mochte und dessen Potential sie für so groß hielt, dass sie eine regelrechte Leidenschaft für ihn entwickelte. Sie war gar nicht damit einverstanden, als Freunde ihm später ein Paar nagelneue Lederschuhe besorgten. Sie wollte nicht, dass man es ihm zu einfach machte und ihm alle Hindernisse aus dem Weg räumte. »Es wäre das Beste gewesen, sie hätten ihm die Schuhe nie gekauft«, sagte Carly. »Das wäre wirklich das Beste gewesen.« Carly wollte den Jungen beschützen. Eine Weile versuchte sie sogar, eine Familie in Monrovia zu überreden, ihn zu adoptieren. Einen Jungen, der noch nie in seinem Leben Schuhe getragen hatte und den sie in seinem Dorf im Süden von Liberia am liebsten bei lebendigem Leib verbrannt hätten. Über die Schuhe war er sehr glücklich. Er trug sie ohne Socken, und er zog sie auch nachts nicht aus, so dass die harten Lederkanten ihm immer mehr in die Haut hineinschnitten.
Carly konnte seinem scheinbar unschuldigen Charme nicht widerstehen. Seinem Zweitausend-Jahre-Blick, der aber vielleicht gar nicht so leer und gleichgültig war, wie wir zuerst dachten. Carly wollte nicht glauben, dass er einen Monat nach seiner wundersamen Rettung durch einen UN-Mitarbeiter im Landesinneren noch nicht erkannt hatte, wie wichtig unsere Hilfe für ihn war und was für eine große Chance das für ihn bedeutete. Carly betrachtete das Gesicht des Jungen wie ein Gemälde, ein Bild, das sie gemalt hatte und über dessen fehlende Veränderungsbereitschaft sie dann aber ein bisschen enttäuscht war. Sie sagte, wir dürften keine Zeit verlieren und den richtigen Moment nicht verpassen. Die brasilianische Psychoanalytikerin Suely Rolnik, die in den 1970ern ein Opfer der Diktatur in ihrem Heimatland geworden war, hat darüber geschrieben, wie viel Zeit sie gebraucht habe, um die erlittenen Erfahrungen zu verarbeiten. Es war die traditionelle brasilianische Musik, die Rolnik schließlich ihre Stimme und ihre Lebensenergie zurückgab. Ein Prozess, der mit Umwegen vielleicht sogar noch länger gedauert hat als die neun Jahre, die zwischen der Erfahrung der brasilianischen Diktatur und der Wiederentdeckung ihrer Stimme bei einer Stunde Gesangsunterricht in Paris lagen. Für den Jungen, der noch nie in seinem Leben Schuhe getragen hatte, war ein Monat schon zu viel. Der Junge konnte nicht singen. Oder er wollte es nicht. Am Ende enttäuschte er uns alle. Es lag nicht daran, dass er ständig alle Angebote in den Wind schlug und nirgendwo länger als ein paar Wochen blieb. Es lag daran, dass es von Anfang an so bestimmt und so festgelegt war, dass er uns enttäuschen würde.
»Er soll wenigstens Socken tragen«, bat mich Carly ihm auszurichten. »Denkst du bitte daran?« Das Mitleid in ihrem Gesicht war echt, aber die Socken hat er trotzdem nie bekommen.
»Sag ihm, dass er Socken anziehen soll«, sagte Carly immer wieder.
»Ja«, sagte ich, »mache ich.« Aber dazu hätte er erst mal die Schuhe wieder ausziehen müssen.
War Carly am Ende deswegen so unglücklich und wollte deswegen am liebsten wieder in den Kosovo zurück? Wegen des Jungen, der sie und mich nicht mehr zur Ruhe kommen ließ? Der Junge, dessen Unbekümmertheit und grenzenlose Zuversicht stärker war als jedes Trauma. Ich laufe in einem Bogen am Café Gottlob vorbei. Ich versuche Zeit zu gewinnen. Ich bin mit Rron verabredet, den ich am Abend zuvor bei der Finissage seiner Ausstellung in einer kleinen Schöneberger Galerie getroffen habe. Es ist der erste Kontakt, der ohne Carly zustande gekommen ist. Der erste Versuch, diese Reise ohne ihre Hilfe zu organisieren. Im Licht des gnädigen, großzügig warmen Frühlings sieht Berlin jetzt ganz harmlos aus. Das Café Gottlob ist ein harmloser und gepflegter Ort, wo man auch draußen sitzen kann. Ich laufe die wenigen Meter über die Grunewaldstraße und genieße die Sonne (die mich aber gleichzeitig daran erinnert, dass ich die Stadt, die ich noch vor einer Woche, als ich den Flug gebucht habe, so sehnsüchtig verlassen wollte, jetzt auf einmal doch nicht mehr verlassen will). Ein Flug nach Priština, mit Umsteigen und einem kurzen Aufenthalt in Frankfurt. »Jetzt habe ich auch keine Lust mehr«, sagte Carly am Ende. Da hatte der Junge seine Schuhe schon längst verkauft und stand kurz davor, nach Maryland in sein Dorf zurückzukehren, in das Dorf seiner Eltern, die nicht mehr lebten und für deren Tod er verantwortlich gemacht worden war. Zurück nach Hause und in seinen sicheren Untergang, wie Carly glaubte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist ein Copyshop, genau an der Ecke, wo ich abbiegen muss, um zum Café zu gelangen. Ich stelle mir vor, dass der Künstler, mit dem ich verabredet bin, ohnehin zu spät kommt und dass es deswegen keinen Unterschied macht, wenn ich jetzt noch Carly anrufe. Carly ist schwer zu erreichen, doch in diesem so schmeichelhaft weichen Licht, unter dieser so sanften, nachgiebigen Sonne, die Berlin auf einmal so gut aussehen lässt, erreicht das Bedürfnis, Carly anzurufen, seinen Höhepunkt. Ich halte nach einem Internetcafé Ausschau, in dem man telefonieren kann, als ich auf einmal Rron entdecke. Drüben, auf der anderen Straßenseite, auf der er sich in fast identischer Geschwindigkeit, parallel zu mir, in Begleitung einer jungen Frau, Richtung Café Gottlob bewegt. Er ist auf dem Weg zu unserer Verabredung. Er geht im Schatten. Er bewegt sich ähnlich langsam und unschlüssig wie ich, aber es sind die Bewegungen eines Künstlers, der die Nacht durchgemacht hat und der sich in Anwesenheit seiner Begleiterin einen Habitus von Gleichmut und Gelassenheit geben will, den Ausdruck eleganter Dumpfheit, mit der er die Unwägbarkeiten des Lebens ignoriert. Er bleibt an der Straßenecke, an der sich der Copyshop befindet, stehen. Er scheint zu überlegen, in welche Richtung er gehen soll. Ich verstecke mich, zumindest versuche ich das, sofern es in der prallen Sonne mitten auf dem Bürgersteig, auf dem sich noch nicht einmal Bäume befinden, möglich ist. Rron wendet sich nach links, biegt in die Nebenstraße ein und nähert sich dem Café. Was würde er wohl dazu sagen, wenn er wüsste, dass ich an ihm als Künstler gar nicht interessiert bin? Dass mir das Interview mit ihm gar nichts bedeutet? Dass es um etwas ganz anderes geht?
2
Ich könnte Carly anrufen. Sie ist irgendwo in Australien mit ihrem Mobiltelefon unterwegs. Sie hat kein Festnetz, und die Verbindung, falls sie überhaupt zustande kommt, ist so fragil, dass es gut sein kann, dass das Gespräch mitten im Satz abbricht und dann trotz aller Anstrengungen nicht mehr fortgesetzt werden kann. (Warum will ich auf einmal doch nicht mehr aufbrechen, zu einer Reise, auf die ich mich doch so gut vorbereitet habe?) Es ist eine Reise, die ich vielleicht gar nicht gemacht hätte, wenn Carly und ich uns nicht getroffen hätten und Carly nicht ins Krankenhaus gekommen wäre, in dem ich arbeitete, um den Jungen, der noch nie in seinem Leben Schuhe getragen hatte, kennenzulernen. Im Krankenhaus, dem E. S. Grant Mental Health Hospital, hielt er es noch am längsten aus, vermutlich weil er dort mehr oder weniger ein Gefangener war, alle Mitarbeiter ihn ins Herz geschlossen hatten und sich rührend um ihn kümmerten. Vielleicht würde sich etwas von der Begeisterung auch auf mich übertragen, die Begeisterung, die Carly empfindet, wenn sie von ihrer Zeit im Kosovo spricht. Wenn sie davon spricht, dass sie unbedingt wieder dorthin will, zurück in das Land, in dem sie fünf Jahre gelebt hat. Mein Vater war geradezu süchtig danach, Reisen zu unternehmen und zu planen. Und noch vor dem Ende einer Reise dachte er schon wieder an die nächste, das nächste Ziel, die nächste Sehenswürdigkeit. Am Ende seines Lebens hatte diese Reiselust meines Vaters ein derartiges Ausmaß angenommen, dass ich mir wünschte, wenn ich auch nur davon hörte, er habe wieder eine seiner berüchtigten Busreisen geplant, irgendetwas würde ihn stoppen und seiner Reiselust, diesem ganzen Eskapismus endlich ein Ende bereiten. Rron dreht sich um. Ob er mich erkannt hat? Ob er sieht, dass ich ihm auf der Spur bin? Er ist Künstler, er umgibt sich mit der Aura der Unberechenbarkeit. Als ich ihn am Abend zuvor fragte, ob ich ihn interviewen dürfte, sagte er zwar sofort zu, weigerte sich aber dann, einen Termin zu vereinbaren, und überließ das lieber seiner Managerin. Ich habe den Verdacht, dass die Frau an seiner Seite dieselbe Frau ist, mit der ich gestern gesprochen und diesen Termin vereinbart habe, mit der zusammen er jetzt langsam aus meinem Blickfeld verschwindet, um das Café Gottlob zu betreten.
Es ist eine Halluzination, eine Phantasie. Rron Qena ist eine Schleuse, ein Tor oder ein Türöffner. Er entspricht dem Bild, das ich mir immer vom Kosovo gemacht habe. Eine Mischung aus süßlichen Klischees und wirklich existentieller Bedrohung, aus der er heraustritt mit einer gewissen Souveränität. Mit schlechten Zähnen, übernächtigt, zerfahren und mit einer Managerin, die merkwürdig zögerlich und unsicher ist. Er sitzt draußen vor dem idyllischen Café Gottlob, mitten in Berlin-Schöneberg, in einem ausgeblichenen T-Shirt, einen halben Meter von den Strahlen der wärmenden Frühlingssonne entfernt, und versucht, eine Portionspackung Kaffeesahne zu öffnen. Er untersucht die Packung, er dreht sie nach links und nach rechts. Da ist irgendwo die Lasche, die man nicht hochziehen, sondern abbrechen muss. In aller Gelassenheit kapituliert er, und die Frau an seiner Seite, die als Managerin doch noch etwas ungeübt wirkt, braucht einen Moment, bis sie bemerkt, dass sie ihm vielleicht helfen könnte. Wir sitzen im Schatten. Es ist eiskalt. Was hat Rron erlebt, dass er so kälteunempfindlich ist? Der Krieg im Kosovo ist seit über zehn Jahren vorbei. Tears of Europe. Der Gestus seiner Bilder ist fragmentarisch, unentschlossen, aber nicht ohne Wärme. Die Frauenfiguren in seinen wilden expressionistischen Landschaften sehen wie Gefangene einer Abstraktion aus, die etwas gewalttätig geraten ist.
»Wie war er, der Krieg?«, frage ich Rron, nachdem wir schon eine ganze Weile über seine Kunst gesprochen haben. Die Gesprächsatmosphäre hat sich entspannt. Längst hat sich herausgestellt, dass die Frau an seiner Seite nicht seine Managerin, sondern in Wirklichkeit seine Freundin ist.
»Ich meine, hat er deine Kunst beeinflusst?«
Rron hat noch immer das kleine Milchdöschen in der Hand. Vielleicht inspiriert es ihn. Im Kosovo, wie sich später herausstellen wird, findet man so etwas nicht. Im Kosovo ist der Kaffee selbst ein Kunstwerk.
»Ich lasse mich nicht durch die Politik beeinflussen«, sagt er.
»Natürlich nicht«, sage ich und überlege, wie ich das Thema trotzdem am Leben erhalten kann. »Aber das ist schon wichtig, oder? Im Hinblick auf den Kunstmarkt, zum Beispiel.« Ich denke an seine Bilder, und ich frage mich, ob er auch nach Europa eingeladen würde, wenn er aus Usbekistan oder Kasachstan stammte.
»Der Kunstmarkt?«, fragt er und stellt das Milchdöschen auf den Tisch. »Den ignoriere ich total. Mit dem möchte ich lieber nichts zu tun haben.« Seine Freundin, die nicht seine Managerin ist, lächelt. Aber es ist nicht klar, ob sie mit seiner Antwort zufrieden ist.
»Wenn man den Kunstmarkt als Künstler ernst nimmt«, erklärt er und schiebt das Milchdöschen beiseite, »dann ist man ruiniert. Dann ist man ganz unten.« Er beugt sich vor. Ich warte darauf, dass er noch etwas sagt. Etwas Ironisches oder etwas in der Richtung, dass er natürlich trotzdem irgendwie mitspielt. Er sagt aber nichts, starrt nur auf den Tisch und wartet auf die nächste Frage. So oft ist er vielleicht noch gar nicht interviewt worden, und vielleicht weiß er nicht, dass es am besten ist, wenn sich seine Ehrlichkeit in Grenzen hält.
Ich brauche jemanden wie Rron. Jemand, der sich im Kosovo auskennt. Ein Mensch, der in einer Parallelwelt lebt. Rron weiß selbst nicht ganz genau, ob es Kunst, Performance, Zivilcourage oder doch nur ein Gag gewesen ist, als er zusammen mit Freunden den UNMIK-Soldaten und den ihnen gegenüberstehenden nationalistischen Vetëvendosje!-Demonstranten Tee ausschenkte. Peacebuilding als Street-Performance. Ich denke an zerschossene Stadtlandschaften, KFOR-Soldaten, die sich betrinken, Internationale, die sich arrogant verhalten. Fragmentarische urbane Orte, in denen die Düsternis plötzlich aufreißt und den Blick auf eine andere, viel wildere und wahrere Welt freigibt. Das ist das Versprechen, das Rron mir gibt. Aber Rron ist müde. Er denkt schon an die nächste Ausstellung in New York, außerdem ist er noch mit seinem Galeristen zum Mittagessen verabredet.
»Ich nehme den Krieg nicht so ernst«, sagt er.
»Und warum nicht?«, frage ich.
»Das ist besser so.«
Seine Freundin räuspert sich, und ich denke, sie wird jetzt vielleicht doch noch eingreifen, um das Bild, das er von sich gibt, etwas zu korrigieren.
»Es hat keinen Sinn, Kunst zu studieren«, sagt er und starrt auf den Tisch. »Es macht gar keinen Sinn, überhaupt etwas zu studieren. Schon gar nicht im Kosovo.«
»Du willst es ja auch nicht«, sagt seine Freundin. Sie dreht sich kurz zu mir um. »Er könnte hier studieren, wenn er wollte, aber er will lieber in Priština bleiben«, setzt sie mit einem leicht vorwurfsvollen Unterton hinzu.
»Genau«, sagt Rron und nickt. »Ich könnte hier keine Kunst machen.« Er dreht sich um, sein Blick schweift über die bepflanzte Terrasse des Café Gottlob und die sanierten, in dezenten Farben gehaltenen Schöneberger Altbauten. Er schüttelt entschuldigend den Kopf. »Das würde nicht gehen.« Er rückt mit seinem Stuhl etwas zurück. Ich nicke und mache eine Notiz. Ich solidarisiere mich mit ihm. Ich wechsele das Thema und befrage ihn zu seiner Einschätzung der aktuellen politischen Lage. Wir sprechen über die internationale Gemeinschaft und darüber, wie die KFOR-Soldaten und UN-Mitarbeiter Priština verändert haben. Er erzählt mir von seinem Vater, der ein berühmter Karikaturist gewesen ist, und wie er, ohne dass es eigentlich geplant war, dessen Arbeit fortsetzt. Es sind die Cartoons, die ihn und seine Familie über Wasser halten, und nicht die Kunst. Unser Gespräch verwandelt sich. Längst führe ich kein Interview mehr, sondern unterhalte mich mit ihm über den Kosovo. Ich erzähle ihm nichts von Carly und meinen Kontakten, meinen Verbindungen zur NGO-Szene. Ich erzähle ihm nichts von dem Jungen, der seine Schuhe verkauft hat und für immer verschwunden ist, der Carly so viel Kraft gekostet und sie beinahe an den Rand der Verzweiflung getrieben hat. Rron hat sie gesehen, die UN-Leute und die KFOR-Soldaten, er hat erlebt, wie sie in den Bars und Clubs von Priština auftreten, als würde ihnen die ganze Stadt gehören.
»Vielleicht treffen wir uns mal in Priština«, schlage ich vor.
»Natürlich treffen wir uns in Priština«, sagt Rron und richtet sich auf. »Wo wirst du wohnen?«
Und dann erklärt er mit großer Geste, dass er schon etwas für mich finden werde und dass ich ihm das ruhig überlassen könne. Ich falte meine Notizen zusammen und stecke sie in die Tasche. Das Interview ist beendet. Ich übernehme die Rechnung und bezahle auch die Getränke seiner Freundin. Für einen Moment habe ich das Gefühl, dass die Beziehung zwischen ihnen am Scheidepunkt steht. Sie haben komplizierte Reisepläne, über die sie sich nicht einig sind. Er verschränkt seine Arme. Wir stehen noch einen Moment an der Straßenecke, wo der Copyshop ist und wo ich noch vor zwei Stunden nach einem Internetcafé Ausschau gehalten habe. Wir stehen in der Sonne, aber Rron, der auf der Terrasse die ganze Zeit im Schatten gesessen und nicht im Geringsten gefroren hat, scheint es jetzt auf einmal kalt zu sein. Wir verabschieden uns. Es ist eine herzliche Verabschiedung, als seien wir in kürzester Zeit Freunde geworden, und sie ist in gewisser Hinsicht Ausdruck meiner Hoffnung, der plötzlich aufkommenden Erwartung und des Gefühls der Vorfreude, dass ich jetzt also meine Reise beginnen und endlich aufbrechen kann. Vielleicht brauche ich Carly jetzt gar nicht mehr. Vielleicht funktioniert meine Reise auch ohne sie.
3
Das Licht ist grell bei der Ankunft, es scheint keinen Schatten zu geben. Der aus Deutschland stammende klapprige Audi des Taxifahrers scheint Licht und Dreck aufzusaugen wie ein Staubsauger, und selbst mein Laptop, in dem die Telefonnummer des Vermieters versteckt ist, weigert sich hochzufahren. Eine eigentümliche Mischung aus Baulücken, Glasfassaden und schnell hochgezogenen kastenförmigen Gebilden, die noch gar nicht fertig sind. Ein architektonisches Niemandsland, in dem es keine Anhaltspunkte, keine großen Gesten, keine Fixpunkte gibt. Eine Stadt, die so aussieht wie eine misslungene Parodie auf Los Angeles.
»Das ist der Bill-Clinton-Boulevard«, sagt der Taxifahrer. »Kennst du den?« Bill Clinton. Ein Geist, der sich über eine staubige Hauptstraße legt. Nachdem General Mladić, der jetzt in Den Haag sitzt, nach Srebrenica gekommen ist und der Westen den Horror des Balkankrieges nicht mehr länger ertragen konnte, fing das NATO-Bombardement an.
»Das ist seine Schuld«, sagt der Taxifahrer stolz, aber er meint es natürlich anders. Es sei allein den Amerikanern zu verdanken, dass es so weit gekommen ist und die NATO eingegriffen hat.
»Sind Sie sicher, dass es die Amerikaner waren?«, frage ich, während ich mir schon nicht mehr sicher bin, ob der Krieg wirklich notwendig gewesen ist.
»Sie ist nach ihm benannt. Es ist seine Straße«, sagt er und neigt den Kopf etwas nach hinten, da wir sie in diesem Moment überqueren. Den Bill-Clinton-Boulevard sehe ich nie mehr wieder. Lange Zeit zweifele ich daran, ob er überhaupt existiert. Meine eigene Straße habe ich noch nicht gefunden. Es dauert eine Weile, bis ich meinen Vermieter kennenlerne, der mich an einer Straßenecke in Empfang nimmt. Über meine eigene Straße, in der sich meine Unterkunft befindet, bin ich mir im Unklaren. Eine Woche brauche ich, um endlich zu verstehen, was sich hinter dem Straßennamen, der nirgendwo schwarz auf weiß zu sehen ist, verbirgt. UÇK Street. Die kosovo-albanische Befreiungsarmee, der auch der Präsident angehört hat, bewacht meinen Schlaf und breitet ihre schützenden Arme über mich aus. Die UÇK Street ist ganz schön weit vom Bill-Clinton-Boulevard entfernt. Nach meiner Ankunft gehe ich vorerst nicht mehr aus dem Haus. Ich telefoniere mit einer Psychologin, einer Kinderpsychiaterin und einer Philosophin, die mir Rron empfohlen hat. Ich will mich dem Trauma und den Horrorgeschichten, die mir bevorstehen, mit Vorsicht nähern. Ich möchte keinen falschen Schritt machen, die Bürgersteige in Priština sind mit Schlaglöchern und Stolperfallen übersät.
Ich hätte schon vor zwei Jahren hier sein müssen. Ich bin später dran als geplant. Ich kehre gewissermaßen an einen Ort zurück, an dem ich schon gewesen bin, wenn auch nur auf imaginären und ausgedachten Reisen. Reisen mit Entwurfscharakter. Reisen, die anfangen und in der Planungsphase enden, die mit den Geschichten über Ramush Haradinaj anfangen, mit den Geschichten über Srebrenica, Tuzla und dem fast 800-seitigen Bericht von General Reinhardt, der 1998 der erste KFOR-Kommandant war, weitergehen, und manchmal allein daran scheitern, dass eine Telefonverbindung nicht zustande kommt. Mit Carly, der australischen Freundin, telefoniere ich am Ende doch noch, aber die Verbindung bricht schon nach ein paar Minuten wieder ab. Sie weist mich darauf hin, dass ihre Kontakte in Priština hilfreich sein könnten, um eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist. In Krisengebieten zu übernachten kann sehr teuer werden. Sündhaft teuer. Carly ist die Verbindung. Die Brücke von Liberia zum Kosovo, von Australien zu der großzügigen, mit zwei Toiletten und zwei Schlafzimmern ausgestatteten Wohnung in der UÇK Street. Wofür brauche ich zwei Toiletten und zwei Schlafzimmer? Um mich aufzuteilen? Meine verschiedenen miteinander konkurrierenden Rollen zu proben oder gegeneinander auszuspielen? Carly weiß alles über den Kosovo, sie weiß alles über die UNMIK, und sie weiß, mit wem ich mich treffen muss, um etwas von dem Land zu erfahren und eine Idee davon zu bekommen, wie es funktioniert. Das Trauma, in seiner ganzen Gewalttätigkeit und Kraft. Die schmutzige Arbeit der Therapie. Die vernachlässigte und unterbewertete Kunst der Verdrängung. Carly hätte mir wertvolle Tipps geben können. Sie hätte mir erklären können, wie es sein kann, dass sie es fünf Jahre im Kosovo ausgehalten hat und die Zeit im Nachhinein als die schönste Zeit in ihrem Leben beschreibt, während sie über Liberia, wo wir uns kennengelernt haben, nichts Gutes zu sagen hat. Aber unser Gespräch wird gleich wieder unterbrochen. Die Telefonverbindungen zwischen Berlin und Australien erweisen sich als instabiler als gedacht. Ich bin kaum in Priština angekommen, als ich schon weiß, dass es keinen Sinn ergibt, Rron noch einmal zu treffen. Ich will nichts mit Künstlern, Schriftstellern und Kreativen zu tun haben. Ich fühle mich außerstande, die Wohnung, die ich dank Carlys guter Kontakte gefunden habe, zu verlassen. Unter mir wohnt eine ehemalige UNMIK-Mitarbeiterin, eine Juristin und Freundin von Carly, die eine Weile für die UN-Mission im Kosovo gearbeitet hat, ein Kind hat und jetzt darauf wartet, dass ihr Mann, der bei EULEX arbeitet, nach Hause kommt. Ich könnte runtergehen. Und wir könnten über Carly sprechen, Carly, die erste UN-Mitarbeiterin, die ich in Liberia kennengelernt habe und deren eigentümliche Mischung aus Sanftheit, Bescheidenheit und ihrem kapriziösen, unberechenbaren und manchmal auch wütenden Idealismus mich schon in Liberia verwirrt hat. Wir könnten darüber sprechen, ob Carly dieselbe Wanderung unternommen hat, ob sie derselben Karawane angehört, die von einem Einsatzort zum nächsten zieht. Und darüber, ob sie vielleicht erklären kann, warum Carly in Liberia am Ende so furchtbar unglücklich gewesen ist. Lag es wirklich daran, dass sie nicht akzeptieren konnte, wie Liberia funktionierte, dass der Junge, der noch nie in seinem Leben Schuhe getragen hatte, für immer untertauchte und verschwand? Aber ich bin noch nicht angekommen. Ich muss entscheiden, in welchem Schlafzimmer ich die Nacht verbringe. In dem etwas dunkleren, aber großzügigeren hinteren oder in dem kleineren helleren, gleich neben dem Badezimmer, mit der halb ausgetrockneten Bambuspflanze, die in einem leeren Plastikröhrchen zwischen den Heizungsrippen hängt und dringend gegossen werden müsste. Ich könnte die Wohnung so aufteilen, dass eine Hälfte unbewohnt bleibt. Die Hälfte, in der der Autor, Schriftsteller oder der Leser zu Hause ist. Der, der diese Reise geplant hat, jetzt aber nichts mehr damit zu tun haben will.
In Gedanken bin ich schon ein paarmal in Priština gewesen. Ich dachte, es sei gut für mich, ich dachte, es würde mir helfen, nach meiner einjährigen Auszeit wieder langsam Fuß zu fassen. Kosovo. Das hörte sich von Liberia aus wie ein Urlaubsort an. Eine Enklave des Friedens und der Ruhe, wenn auch etwas staubig und kalt. Das Konzept meiner Reise, die Ideen für meine Recherche wirkten brüchig und vage. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen«, sagte Carly, als wir noch in Liberia zusammensaßen und über den Kosovo phantasierten. »Es reicht, wenn du ein, zwei Leute kennst, dann geht alles andere ganz von allein.« Die Namen verdoppelten und verdreifachten sich schließlich. Die Telefonnummern vervielfältigten sich, noch bevor ich Priština überhaupt erreicht hatte. Die Rohfassung der Geschichte, die Essenz des Traumas, ist schwer zu fassen. Es ist eine Geschichte, die nicht chronologisch erzählt werden kann, die keinen stringenten Aufbau, keine richtige Abfolge hat und die nichts davon verrät, was der Betroffene im Augenblick der Katastrophe empfindet. Dieser Augenblick hat kein Empfinden, keine Gefühle, kein Gedächtnis. Dieser Moment ist ausgelöscht. Ich erinnere mich, wie Carly lächelte. Sanft und zufrieden über ihre eigene Vergangenheit, die sie schon ein wenig zu verklären begann. Ich konnte es nie ertragen, wenn Leute ins Krankenhaus kamen, um es sich anzuschauen, und dabei ganz diskret nach den Traumatisierten und den Kindersoldaten fragten.
»Also«, sagte einmal eine junge deutsche Ärztin aus dem Landesinneren, die zu Besuch in der Hauptstadt war, »ihr habt ja hier bestimmt viele … äh, Traumapatienten, oder? Also Traumatisierte … Und dann noch die, die sogar selbst Täter gewesen sind.« Sie schaute mich herausfordernd an, als traute sie mir jetzt alles zu.
»Wie meinst du denn das?« Ich stellte mich absichtlich dumm, so als hätte ich keine Ahnung, was sie von mir wollte. »Leute, die traumatisiert sind?«
»Ja, aber auch die, die wirklich gekämpft haben … oder die, die gezwungen worden sind zu kämpfen, obwohl sie das gar nicht wollten … Na eben, zum Beispiel die Kindersoldaten.« Sie schaute sich auf dem Krankenhausgelände um, als hätte ich sie irgendwo versteckt.
»Ach so«, sagte ich und machte eine lange Pause, sah ihr in die Augen und nickte, als hätte ich überprüfen müssen, ob sie auch vertrauenerweckend genug sei. »Ja, du meinst Traumapatienten und Kindersoldaten.«
»Ja«, sagte sie und nickte gewichtig.
»Davon haben wir nicht einen Einzigen«, sagte ich dann. »Niemand. So etwas haben wir hier nicht.«
Die Ärztin nahm die Nachricht nicht gut auf, wie es mir schien. Sie verlor etwas die Fassung. Sie hielt mich ganz offensichtlich für einen desillusionierten Zyniker, der Menschen wie sie, die sich wirklich für etwas engagierten, verachtete. Für einen Moment schien es, als wolle sie mich beiseitestoßen und sich selbst ein Bild verschaffen. Jetzt in Priština, in der luxuriösen Wohnung eines ehemaligen UN-Mitarbeiters, der von seiner Existenz nicht die geringste Spur hinterlassen hat (mit Ausnahme einer unbrauchbaren kosovo-albanischen SIM-Karte), denke ich, dass ich ihr gegenüber etwas unfair war, dass ich ihr das Leben unnötig schwergemacht und mich vor dem Eingang des Patiententraktes wie ein Schatzwächter aufgeführt habe, wie der Hüter eines Vermächtnisses. Leute, die auf der Suche nach dem Trauma waren, konnte ich nicht ertragen. Solche Leute waren mir suspekt. Die rotgesichtige, dezent schwitzende deutsche Ärztin aus dem Landesinneren stand stellvertretend für eine Anmaßung und Selbstgerechtigkeit, mit der ich nichts zu tun haben wollte.
»Ich kann dir gar nicht sagen, warum ich mich im Kosovo so wohl gefühlt habe«, sagte Carly. »Ich hätte nie weggehen sollen. Aber so ist das eben in unserem Beruf.« Sie war enttäuscht, dass der Junge die Schuhe verkauft und sich ihrer Fürsorge wieder entzogen hatte. Und es gab keine größere Niederlage für ihre Bemühungen als die Tatsache, dass er genau dorthin zurückkehrte, wo er hergekommen war. Zurück nach Maryland, dorthin, wo ihm die größte Gefahr drohte. Ich muss die Wohnung irgendwann wieder verlassen, die Wohnung in der UÇK Street, und ich muss rausgehen an die frische Luft. Vielleicht einen Abendspaziergang machen. Eine halbe Stunde später ist es mir immerhin gelungen, eine Verabredung für den nächsten Tag zu treffen. Es ist mir gelungen, mich aus meiner Erstarrung zu lösen, die mich für einen Moment befallen hat. Zwei Jahre hat es gedauert, bis ich endlich aufbreche. Zwei Jahre habe ich gebraucht, bis ich mich von Liberia erholt habe. Der Zettel von Carly ist zerknittert und beinahe unleserlich geworden.
»Ich könnte dir viel erzählen«, sagt Carly am Telefon, bevor die Verbindung unterbrochen wird.
»Ich wollte mir erst mal die Psychiatrie anschauen, die Mental-Health-Projekte, die die so haben«, sage ich noch. »Vielleicht ergeben sich dann noch andere Themen, irgendetwas, das mich …«
»Da kenne ich mich gar nicht aus«, unterbricht sie mich mit ihrer Tausende von Kilometern entfernten, etwas dumpfen Stimme.
»Ja, natürlich«, sage ich. »Ich wollte dich auch nur fragen, was ich mir sonst noch anschauen soll … Wen ich treffen soll. Kannst du mir jemanden empfehlen?«
»Hast du meine Liste, hast du den Zettel noch?«, fragt sie, aber dann bricht die Verbindung wieder ab, und als ich es das nächste Mal versuche, erreiche ich sie nicht mehr.
Nach meinem Abendspaziergang, der mit so etwas Beruhigendem wie Lebensmittel einkaufen beginnt und mit der Durchsicht meines E-Mail-Posteingangs in einem Internetcafé endet, entscheide ich mich für das hintere Schlafzimmer, den dunkleren, aber großzügigeren Raum mit einem monumentalen, schwarz glänzenden Kleiderschrank samt Glasschiebetüren. Das andere Schlafzimmer bleibt frei. Der Schriftsteller, der mit in den Kosovo gekommen ist, bleibt im Wohnzimmer und schaut auf die nächtlich erleuchtete Straße. Eine Straße, die überall sein könnte und, wie sich erst später herausstellt, gar nicht UÇK Street heißt, jedenfalls nicht an dieser Stelle. Ich bin in Sicherheit. Am nächsten Morgen scheint die Sonne. Priština erweist sich als sehr lebendig, und ich verlasse das Haus als jemand anderes, als jemand, der in den Kosovo gekommen ist, um sich zu überraschen, als jemand, der eine Reise angetreten hat, um sich aus der Fassung bringen zu lassen. Jedenfalls so lange, bis mein Aufenthalt hier wieder endet und ich wieder zurück zum Flughafen muss.
4
Und dann lerne ich Wallmann kennen, den österreichischen Journalisten, den ich zufällig im Café Rings auf dem Mutter-Teresa-Boulevard treffe. Es ist Sonntag, und meine Verabredung für diesen Tag steht eigentlich schon fest. Es dauert ein paar Tage, bis ich meinen Aktionsradius etwas ausdehne. Das Café Rings ist nicht weit von meiner Wohnung entfernt. Von der UÇK Street zum Mutter-Teresa-Boulevard. Das entspricht auch der Entwicklung, die das Land in den letzten Monaten und Jahren durchgemacht hat. Vom Freiheitskampf zu den Segnungen der Barmherzigkeit, die sich in Form von edlen Bars und Cafés mit gepolsterten beigefarbenen Lounge-Sesseln, in denen sich die internationale Szene trifft, über die Innenstadt ausgebreitet haben.
»Ich bin eigentlich verabredet«, sage ich deswegen zu Wallmann, der nur für ein paar Tage in Priština ist und eine, wie er sagt, rein private Reise aufs Land unternimmt, aber bereit ist, mich mitzunehmen.
»Und Sie wollen in Priština bleiben?«, fragt Wallmann. Er redet unglaublich schnell, gleichzeitig mit einer Freude an der sprachlichen Präzision und Übergenauigkeit, wie man sie nur in Österreich und in der Schweiz findet. Ich soll mit aufs Land fahren, um den wahren Kosovo kennenzulernen.
»Sie müssen wirklich erlöst werden von diesem staubigen Ungetüm, von dieser realsozialistischen Architekturwüste. Wo wohnen Sie? Im Hotel?« (Das Plätschern besänftigender Beats aus den diskret in die Decke eingelassenen Lautsprechern, der Milchschaum, der sanft über den Kaffees schwebt, und Wallmann im Leinensakko und mit wirrer Frisur, der seinen Kaffee so schnell trinkt, als wäre es Mineralwasser.) Ich muss der Philosophin absagen. In einer Stunde bin ich mit ihr im Bistro De Rada verabredet. Ob ich ihr eine SMS schicken soll? Ich muss aufs Land, könnte ich schreiben. Wallmann, der schnellsprechende österreichische Journalist, behauptet, den Kosovo könne man nur verstehen, wenn man aus dem künstlichen, von Tito hingeklotzten Moloch namens Priština, den ich mir an diesem Sonntag mit der Philosophin genauer anschauen wollte, herauskommt, und zwar so schnell wie möglich.
»Also Sie wohnen doch nicht in einem Hotel?«, fragt er noch. »Na, wenigstens etwas.«
Als ich später neben ihm in seinem komfortablen Jeep sitze, den er samt Fahrer gemietet hat, sagt er: »Sie können von Glück reden, dass das hier passiert.«
»Was?«, frage ich, während ich aus dem Fenster des Wagens schaue, um den Kosovo kennenzulernen.
»Die Entführung aus dem Paradies.«
Er meint meine Wohnung in der unmittelbaren Nähe sämtlicher Lokalitäten, Bars und Cafés, den fast mikroskopisch kleinen Raum mit einer Handvoll Menschen, in deren Leben ich eintauche, um auf diese Weise in einem überschaubaren Ausschnitt Erkenntnisse zu gewinnen. Wie zum Beispiel die Erkenntnis, dass letztlich nichts dagegen spricht, sich mit Künstlern, Schriftstellern und Philosophen zu treffen, solange sie mir helfen können, das Land besser zu verstehen. Künstler, Schriftsteller und Philosophen als Vorbereiter, als Steigbügelhalter für den Eintritt in die düsteren, verschlungenen, unerschlossenen Schattenräume der Seele.
»Aus dieser Blase müssen Sie raus. Verstehen Sie«, sagt Wallmann und beugt sich etwas vor, um seinen Fahrer anzuweisen, welchen Weg er einschlagen soll. Wir fahren zuerst zu einem Ausflugsrestaurant. Es ist außerhalb der Stadt, an einem malerisch gelegenen Fluss. Aber es ist nur eine Zwischenstation.
»Haben Sie den Dick-Marty-Report gelesen?«
»Nein, aber davon gehört.«
»Ich werde Ihnen etwas zeigen«, sagt Wallmann. »Das werden Sie so schnell nicht wieder vergessen.« Er zeigt mit seinem mageren Zeigefinger zwischen den Vordersitzen zum Fenster und weist den Fahrer an, wo er zu parken hat. Ich lehne mich einen Moment im Polster des klimatisierten Wagens zurück, während wir langsam auf den Parkplatz rollen. (Wir sind irgendwo im Westkosovo, auf dem Weg in die Region Dukagjini.) Im Grunde traue ich Wallmann nicht ganz über den Weg. Unterwegs schreibe ich eine SMS an die Philosophin, nachdem ich sie telefonisch nicht erreicht habe. Es seien Umstände eingetreten, die meine Lage etwas verkomplizierten, schreibe ich und frage, ob wir unser Treffen verschieben könnten. Erst später wird mir klar, warum mich Wallmann mitgenommen hat. Er braucht einfach Publikum, jemanden, dem er das, was er hier erlebt, vorführen kann.
»Es wird nichts weiter Wildes«, sagt er, »eine ganz kleine, gemütliche Reise. Ich kenne hier ein paar Leute … Wir schauen uns das an, und dann bringe ich Sie wieder zurück.«
Er steigt aus dem Wagen, hüllt sich in sein etwas zu weites, zerknittertes Leinenjackett und erklärt mir über das Dach des Wagens hinweg: »Aber tun Sie mir einen Gefallen. Packen Sie bloß das Notizbuch wieder weg. Es ist Sonntag. Ich bin strenger Katholik.« Er läuft ein paar Meter und bleibt vor dem Restaurant stehen. »Wir sind doch nicht hierhergekommen, um zu arbeiten, oder?«
Die Terrasse des Restaurants grenzt direkt an den Fluss, an dem wir weniger sitzen, als dass wir über ihm schweben, und Wallmann parliert eine Viertelstunde ohne Punkt und Komma über Thomas Bernhard. Dafür bin ich jetzt also nach Priština gekommen, denke ich, während ich in dem starken Wind meine Serviette festhalte und auf den Fluss schaue, gleichermaßen geistesabwesend wie der Fahrer, der aber, weil er Wallmann schon eine Weile kennt, zumindest den Eindruck erweckt, als würde er Thomas Bernhard auch kennen. (Die Region Dukagjini ist traditionell Kosovos führende Region. Sie hat einen höheren Bildungsstandard, größeren Wohlstand und außerdem, wie Wallmann behauptet, einen leicht sizilianischen Touch.)
»Großgrundbesitzer ist der gewesen«, erklärt Wallmann, während er seinen Kaffee schlürft. »Ich muss an ihn denken, wenn ich hier über Land fahre. Das ist eigenartig. Thomas Bernhard kommt mir immer so vor, als würde er hier irgendwie hingehören. Vielleicht weil er so ein unglaublich gnadenloser und absolut gieriger Kapitalist gewesen ist.«
»Thomas Bernhard?«, frage ich, während ich den gelblichen Schimmer im Fluss bewundere, der das Wasser ganz zäh und cremig wirken lässt.
»Ich bin dazu übergegangen, Thomas Bernhard dafür zu hassen«, sagt Wallmann, »so wie wir Österreicher das miteinander machen. Eine Bestie, ein Blutsauger vor dem Herrn. Ich hätte ihn gerne mal in seinem tonnenschweren Mercedes gesehen, wie er über die Dorfstraßen kriecht und nach neuen Grundstücken Ausschau hält.« Wallmann macht eine abwehrende Handbewegung, während sich seine Serviette von der Untertasse löst und mit einer wehmütigen Aufwärtsbewegung dafür entscheidet davonzufliegen. Keiner rührt einen Finger. Die Umwelt, denkt man hier automatisch, kommt schon damit klar. Sie ist mit ganz anderen Problemen fertig geworden.
»Warum ist das Wasser so gelb?«, frage ich.
Der Fahrer von Wallmann beugt sich etwas vor. Er sitzt einfach mit uns am Tisch, was mich für Wallmann einnimmt. In Liberia kam es nie vor, dass irgendjemand den Fahrer mit an den Essenstisch bat oder ihn einlud, an einer kleinen Kaffeepause teilzunehmen.
»Sand«, sagt der Fahrer und nickt bedächtig. Er erklärt mir, dass der Fluss mit Sand verunreinigt ist. »Ein Verbrechen«, sagt der Fahrer.
»Illegal …« Er hebt zu einer längeren Erklärung an, aber Wallmann ist noch nicht mit Thomas Bernhard fertig.
»Kennen Sie das gelbe Haus?«, fragt Wallmann.
Ich schüttele den Kopf. Die Serviette von Wallmann flattert eilig über die hölzerne Terrasse auf den cremig beigen Fluss zu, in dem Sand ist. Illegaler Sand. Sand eines Verbrechens.
»Es könnte gut und gerne ein Roman sein. An der Geschichte hätte auch er seine Freude gehabt.«
»Ich kenne keinen Roman von Thomas Bernhard, der so heißt.«
»Genau«, ruft Wallmann begeistert. »Es gibt ihn auch nicht. Genauso, wie es das gelbe Haus nicht gibt. Es ist eine Phantasmagorie der Serben. Genauso wie diese Geschichte über den serbischen Bauern, den sie auf seinem eigenen Feld mit einer Weinflasche vergewaltigt haben. Das sind dieselben Angstphantasien und Projektionen, die wir Europäer aus der Kolonialzeit kennen. Vielleicht sollte man mal wieder Frantz Fanon lesen.«
»Es ist lange her, dass ich ihn gelesen habe«, gebe ich zur Antwort, während ich gespannt beobachte, wie die Serviette von Wallmann den Fluss fast erreicht hat und kurz davorsteht, im Wasser zu versinken.
»Im Marty-Report wird eben nachgewiesen, dass es das gelbe Haus nicht gibt. Es fand alles ein paar Kilometer weiter statt, in einem anderen Haus, und die technischen Möglichkeiten, die sie da gehabt haben, hätten ohnehin niemals ausgereicht.« Wallmann hebt seine Kaffeetasse und trinkt einen Schluck. Dann will er schon wieder weiter und lässt sich die Rechnung bringen. Ich schaue zusammen mit dem Fahrer auf den Fluss, während Wallmann auf der Toilette verschwindet. Es ist die erste Station. Ich habe mich entschlossen, diesen Tag in aller Gelassenheit über mich ergehen zu lassen, genauso wie die Hochgeschwindigkeitsmonologe von Wallmann. Im gelben Haus, so schreibt Carla Del Ponte, die viele Jahre Chefanklägerin am Internationalen Strafgerichtshof gewesen ist, seien Menschen Organe bei lebendigem Leib herausoperiert und dann zu einem Flughafen nach Tirana gebracht worden, um von dort zu einer gut zahlenden Kundschaft verfrachtet zu werden. Das gelbe Haus befindet sich in Albanien und diente schon immer verbrecherischen Banden als Basis für ihre verschiedenen Vorhaben. Jetzt hat es mythische Ausmaße angenommen. Angeblich ist es nur über eine Serpentinenstraße zu erreichen und liegt so abgelegen, dass es einem vorkommen muss, als habe man das Ende der Welt erreicht und nicht eine geheime Klinik, in der medizinische Operationen vorgenommen werden. Das gelbe Haus interessiert mich nicht weiter. Auch nicht der Dick-Marty-Report. Auf meiner Liste steht Shtime. Shtime ist ein schwieriger Ort in der Geschichte der Psychiatrie des Kosovo. Was für andere das gelbe Haus ist, ist für mich Shtime. In Shtime sind Patienten misshandelt und gequält worden, während Mitarbeiter der UN angeblich tatenlos zugeschaut haben. So zumindest ist mein Kenntnisstand. (Es ist wahrscheinlich genauso Ausdruck einer Projektion und Phantasie wie das gelbe Haus.) Wallmann bleibt lange weg. Ich sehe ihn ein paar Minuten später im Gespräch mit einem der Kellner. Sein Fahrer schaut mit anhaltendem Interesse auf den Fluss. Die Serviette hat es geschafft. Sie flattert nach einem kurzen Moment der Schwäche mit neuem Auftrieb über den Fluss hinweg und bleibt schließlich an einem Zweig auf der gegenüberliegenden Seite hängen.
»Kennen Sie die Geschichte mit dem gelben Haus?«, frage ich den Fahrer. Es gab noch vor meiner Abfahrt Berichte in den Medien, dass selbst hochrangige Politiker des Kosovo in den Fall verwickelt seien und dass die UÇK auf diese Weise angeblich ihren Freiheitskampf finanziert habe.
»Es ist ein paar Kilometer von Burrel entfernt«, sagt der Fahrer. Wallmann winkt. Ich sehe es im Hintergrund. Aber ich ignoriere sein Winken für einen Moment und konzentriere mich auf den Fahrer. Er wirkt nicht wie ein professioneller Chauffeur. Er wirkt eher wie ein Lehrer, der sich einen Tag freigenommen hat, um uns hier herauszufahren und sich den Fluss anzuschauen, der irgendwo Sand geladen hat und mit sich herumschleppt. »Es ist ganz einfach ein traditionelles Bauernhaus«, sagt er.
»Sind Sie schon mal da gewesen?«, frage ich.
»Zum Glück nicht«, sagt er und grinst.
»Glauben Sie, dass so etwas möglich ist?«, frage ich. Ich lasse offen, was ich genau damit meine, während ich weiter Wallmanns Winken ignoriere, mich stattdessen vorbeuge, als sei ich angestrengt damit beschäftigt, dem zuzuhören, was mir der Fahrer erzählt. Während Wallmann eilig auf uns zuläuft, schaut der Fahrer wieder auf den Fluss, dann sagt er: »Es wird viel geschrieben über unser Land. Zu viel.« Er nickt, als hätte auch er schon mal etwas geschrieben. »Und dann sind wir die Primitiven. Dann werden uns Dinge unterstellt. So etwas würden wir nie tun. Niemand von uns würde das tun.«
»Auf geht’s«, ruft Wallmann, dessen drahtige Erscheinung keinen Aufschub duldet. Der Wind reißt seine Haartolle von der Stirn, sein Jacket flattert um ihn herum, als wolle er in die Luft aufsteigen.
»Wir müssen noch zahlen«, sage ich, obwohl ich ahne, dass er die Rechnung schon beglichen hat.
»Sie sind eingeladen. Österreich zahlt.«
»Schreiben Sie etwas hierüber?«, frage ich ihn.
»Über das?« Er zeigt auf den Fluss, auf die Terrasse, auf die gegenüberliegende Flussseite, wo seine Serviette in einem Baum festhängt (die aber dann, als ich mich noch einmal umdrehe, schon weitergeflogen ist).
»Das hier«, sagt Wallmann und knöpft sich sein Jackett zu. »Das ist das Schöne, das Wunderbare an diesem Land. Das ist das, worüber man nicht schreibt. Worüber keine Sau auch nur ein Wort verliert. Stimmt’s?« Er beugt sich etwas herunter zu dem Fahrer, der mit seinen auf der Tischplatte abgestützten Armen gleichermaßen geduldig und ungeduldig wirkt.
»Wissen Sie, warum der Sand in dem Fluss ist?«, fragt Wallmann. Er zeigt auf den Fahrer. »Er kann es Ihnen erklären.«
Der Fahrer nickt.
»Ja? Und warum?«
»Sie bauen ihn illegal ab, sie fördern ihn ohne Erlaubnis … Für den Hausbau. Sie nehmen ihn sich einfach. Das verstärkt die Erosion, der Sand landet im Fluss, und die Fische …«
Er dreht sich zum Fluss.
»Die Fische?«, frage ich und folge seinem Blick. Auch Wallmann schaut auf den Fluss und nickt beinahe schuldbewusst. Als würde er die Geschichte schon kennen, sei aber bereit, sie sich von seinem Fahrer noch einmal mit aller lehrmeisterlichen Genauigkeit erklären zu lassen.
»Die Kiemen öffnen sich nicht mehr«, sagt er. »Und was passiert dann?«
»Ja«, sage ich, »was passiert dann?« Ich möchte bei seinem belehrenden Frage- und Antwortspiel nicht mitmachen.
»Wissen Sie die Antwort nicht?«, fragt er. Vielleicht ist er verärgert, dass ich ihn nach dem gelben Haus und dem Dick-Marty-Report gefragt habe. Vielleicht ist er aber nur genervt, dass er uns hier am Sonntag herumfahren muss, obwohl er eigentlich Besseres zu tun hat. Er schaut mich an. Er ist hartnäckig. Er wartet darauf, dass ich meine Lektion gelernt habe, dass er den Unterricht abschließen kann und dass wir weiterfahren können.
»Sie ersticken«, sagt er schließlich. Er sagt es ganz leise, mehr zu sich selbst, während Wallmann erstaunlicherweise stillhält und einfach stehenbleibt. Regungslos und ohne einen Ton zu sagen, als würden wir jetzt eine Schweigeminute für die Fische einlegen, die dort unten, unterhalb der Wasseroberfläche, in der Tiefe des Flusses um ihr Leben kämpfen oder schon vergeblich gekämpft haben.
»Die internationale Gemeinschaft«, sagt Jeton, den ich am Tag zuvor zum Kaffeetrinken getroffen habe, »das ist hier die eigentliche Komödie. Das ist der Stoff, aus dem alles gemacht ist.« Ich sitze mit ihm am Mutter-Teresa-Boulevard, im Café Rings, wo ich später Wallmann kennenlerne. Wir trinken Kaffee, und die Sonne blendet ihn so, dass er seine Sonnenbrille aufsetzen muss. Er berichtet von diversen Projekten, bei denen es um die großen Krisenthemen des Landes geht. Jeton Neziraj ist Theaterautor und Dramaturg. In einem seiner Stücke kommt ein Orchester vor, das in einer Unendlichkeitsschleife die Nationalhymne einstudiert, während das Publikum gleichzeitig darauf wartet, dass endlich die Unabhängigkeit des Landes erklärt wird. Der Blick von außen ist verzerrt und ungenau. Die internationale Gemeinschaft wendet sich ab, ignoriert das Land, und einer der Protagonisten des Stücks ist ein Geschäftsmann, der eigens ein Flugzeug gekauft hat und jetzt von einem Land zum anderen fliegt, um Werbung für den Kosovo zu machen. »Nur damit die Leute uns endlich zur Kenntnis nehmen«, erklärt Jeton. Die Abfolge der Stücke, von denen Jeton mir erzählt, ist leicht verwirrend, aber es spricht einiges dafür, dass die meisten von ihnen Komödien sind, obwohl Jeton während des gesamten Gesprächs die Sonnenbrille nicht abnimmt und nicht ein einziges Mal das Gesicht verzieht. Wallmann kennt Jeton. Aber wir sprechen nicht über ihn, er sagt nur »Jeton, der Dramatiker«, und dann nickt er. Den kenne er natürlich. Aber weiter sagt er nichts. Vielleicht sprechen wir deswegen die ganze Zeit über Literatur, über Thomas Bernhard und darüber, wie die internationale Gemeinschaft funktioniert. Nach unserem kurzen Aufenthalt am Fluss, in dem Restaurant, dessen Terrasse über dem Wasser schwebt und von dessen Tischen die Servietten wegfliegen, ist klar, dass der Fahrer alles mitbekommt und dass man in seiner Gegenwart besser nichts Falsches sagt.
»Lesen Sie den Dick-Marty-Report«, sagt Wallmann noch, während er sich anschnallt. »Aber natürlich nicht heute. Heute ist Sonntag.«
»Fahren wir jetzt nach Gllogjan?«, fragt der Fahrer.
»Jetzt fahren wir nach Gllogjan«, sagt Wallmann. »Kennen Sie das?« Er schaut mich von der Seite an. Der Fahrer dreht sich kurz um und grinst. Wallmann hebt beide Hände hoch, als wäre er ein Pianist, der sein Klavier gerade nicht dabeihat.
»Gllogjan«, sagt er und betont jede Silbe. »Noch nie davon gehört?«
Der Fahrer startet den Wagen und lässt ihn elegant, ohne auch nur die geringste Eile, rückwärts zur Straße rollen. Sein Fahrstil ist typisch für den Berufskraftfahrer, der es schon lange nicht mehr nötig hat, irgendjemandem seine Fahrkünste vorzuführen, sondern im Gegenteil seine Fahrkünste unter einer fast trägen, ausdruckslosen Routine versteckt hält und nur noch in extremen Notsituationen kurz aufblitzen lässt.
»Sie werden es bald kennenlernen«, sagt Wallmann. »Es ist ein kleines Dorf, aber das hat es wirklich in sich. Stimmt doch, oder?« Er beugt sich zum Fahrer vor. Der Fahrer konzentriert sich auf den Verkehr und reagiert nicht. Nach ein paar Metern dreht er sich aber noch einmal um. »Wenn wir die Natur nicht respektieren«, sagt er, »dann kommen die Lebewesen darin um.« Er lässt seinen Kopf langsam nach vorne pendeln. Wallmann schaut aus dem Fenster, als suche er nach neuen und unverfänglichen Gesprächsthemen.
»Und was ist jetzt genau in Gllogjan?«, frage ich. Aber ich bekomme keine Antwort. Der Fahrer hat das Fenster heruntergelassen, und der laute Fahrtwind erstickt für einige Augenblicke jedes Gespräch.
5
»Ist das nicht schlecht für das Kind?«, frage ich Jeton, während wir von einer Seitenstraße des Mutter-Teresa-Boulevards abbiegen und Richtung Stadtrand fahren, wo er wohnt. »Es geht eben nicht anders«, erklärt Jeton. Die Lüftung bläst unentwegt kalte Luft in den Wagen, während seine Tochter auf dem Rücksitz liegt und schläft. Jeton ist einer der erfolgreichsten Theatermacher des Kosovo. Er ist als Künstler und Organisator wahrscheinlich ungleich gewitzter und besser organisiert als viele Künstler, die ich in Berlin kenne, aber trotzdem schaue ich besorgt auf seine dem eiskalten Luftstrom ausgelieferte Tochter. Das Primitive, das Archaische weht durch den Wagen. Unbewusst denke ich vielleicht: Will Jeton seine Tochter jetzt hier sterben lassen? Ich fange an, mich mit der Lüftungsanlage des Opel Corsa zu beschäftigen, während Jeton den Wagen hektisch durch den Verkehr steuert. »Das ist es, was die Leute am Kosovo interessiert«, hat Jeton bei unserem Treffen im Café Rings erzählt, als seine Tochter auf seinem Schoß schläft und sein aufgeklappter Computer silbern glänzend in der Sonne steht und auf neue E-Mails wartet. »Das ist es, auf was uns die Leute hier reduzieren. Auf den Horror, der hier stattgefunden hat.« Die getönten Scheiben, die Dunkelheit im Wageninneren, die undurchsichtigen Absichten und nicht hinterfragten Projektionen. Der Dick-Marty-Bericht. Der Organhandel. »Dabei ist kaum einem KFOR-Soldaten hier irgendetwas passiert«, sagt Jeton.
Jeton findet, dass der Westen das Thema Trauma überstrapaziert. PTSD. Posttraumatic Stress Disorder. Seitdem überall PTSD herumgeistert, glaubten alle Leute im Westen, die Menschen in den Krisengebieten seien mehr oder weniger alle traumatisiert und bräuchten psychologische Hilfe, und zwar sofort. Dass der Kosovo wirklich so harmlos ist, wie es während der ersten Tage scheint, kann ich mir nicht vorstellen. Ob die Normalität nur eine Scheinnormalität ist? Eine Normalität, die mich bei meiner Verabredung mit Zamira Hyseni, einer jungen Psychologin, nervös werden lässt, so dass ich mich schon frage, warum ihr Wagen, mit dem sie vor der Bar parkt, in der wir verabredet sind, getönte Fensterscheiben hat. Arkan und seine Schergen, der paramilitärische Arm von Milošević, hatten auch abgedunkelte Scheiben, damit man nicht sehen konnte, wie die Täter, die gleich zuschlagen würden, aussehen. In Liberia sind getönte Scheiben bei Privatfahrzeugen verboten. Aber es gibt natürlich niemanden, der das überprüft. Vielleicht liegt es auch nur am Schatten draußen auf der Straße, in dem Zamiras Wagen parkt, dass mir ihre Fensterscheiben so dunkel vorkommen. Ich versuche, die Lüftungsanlage zu reparieren. Es erscheint mir als Akt der Höflichkeit, schließlich nimmt mich Jeton mit und will mich später, nachdem er seine Tochter zu Hause in ihr Bett gelegt hat, noch zum Kloster Gračanica fahren. Wahrscheinlich hätten mich die getönten Scheiben eines vor einer Bar parkenden Opel Corsa auch bei einer Berliner Psychologin irritiert, zumal wenn ihr Ehemann als Mitarbeiter des Innenministeriums auch noch Besitzer der Bar ist, in der wir verabredet sind. Wir verlassen die an der Straße gelegenen Plätze und gehen rein, Zamira fürchtet, dass mein Telefon geklaut werden könnte. Psychisches Gleichgewicht zu haben, das sei ein Luxus, sagt sie. Sie erzählt, auf dem Land würden sich die Leute immer noch an einen Imam wenden, einen muslimischen Priester, wenn es ein Problem gibt, und der übernehme dann die Rolle des Therapeuten. Zamira, die als eine der Ersten im Kosovo nach dem Krieg ihr Psychologiestudium abgeschlossen hat, bleibt es immerhin überlassen, im Frühstücksfernsehen aufzutreten, um ihren Mitbürgern zu erklären, was Anti-Social-Behaviour ist und warum es nicht gut ist, ein Kind zu schlagen, das die Socken falsch herum anzieht. Es ist eine andere Art von Auftritt als die der Lebenskrisenberater und Psychoexperten des deutschen Frühstücksfernsehens, in dem sogar die Normalität skurril, unglaubwürdig und verdächtig geworden ist. Sie steigt in ihren Wagen mit den mutmaßlich verdunkelten Fensterscheiben und verschwindet. Sie entzieht sich mir. Sofort lautet meine Frage: Hat sie mir nicht alles erzählt? Wie kann es sein, dass ihr Ehemann Besitzer der Bar ist, in der wir uns getroffen haben? Ist das verdächtig, ungewöhnlich?
»Und das neue Stück?«, frage ich Jeton, während ich mit einem abgerissenen Stück Pappe den Strom der kalten Luft zu stoppen versuche. »Um was geht es da genau?« Das neue Stück von Jeton heißt Patriotic Hypermarket, ein Bosnier soll Regie führen, und die Schauspieler stammen sowohl aus Albanien als auch aus Serbien. Mit Geldgebern ist Jeton schon in Kontakt. Es ist beeindruckend, an wie vielen Projekten er gleichzeitig arbeitet. Später holt er noch einen Amerikaner vom Flughafen ab, der auch involviert ist, bei einem anderen Stück, das irgendetwas mit der historischen Schlacht auf dem Amselfeld zu tun hat. Vielleicht denkt er, die kalte Luft könne seiner Tochter nichts anhaben oder sie sei im Gegenteil gut für sie. Etwas, das sie abhärtet, stählt, das sie überlebensfähiger macht. Ich halte die Pappe in der Hand. Sie ist ungefähr so groß wie eine Visitenkarte. Ich fühle mich verantwortlich, dass der Wagen nicht richtig funktioniert. Und ich erkläre ihm, dass ich das Problem schon lösen würde, ich hätte mein halbes Leben mit Opel-Modellen verbracht. Und dann geht die Fahrt weiter, dann fängt das Leben wieder von vorne an. Das Stück Pappe hält. Es stoppt den Luftzug, zumindest solange ich im Wagen sitze und mit Jeton unterwegs bin, bis wir schließlich von einem Regenguss und einer riesigen Überschwemmung gestoppt werden. Jeton trägt sein schlafendes Kind in sein Haus, das so aussieht, als entstamme es einem Katalog für moderne Innenarchitektur. Ein weiterer Schock, ein weiterer Ausdruck von Normalität, mit dem ich nicht gerechnet habe.
»Und sie ist nicht ein einziges Mal aufgewacht«, sage ich erstaunt. »Sie hat die ganze Zeit geschlafen. Macht sie das immer so?«
Wallmann dreht sich zu mir und fragt: »Alles in Ordnung?« Ich nicke. Ich schaue aus dem Fenster. Wir haben die Hauptstraße verlassen und fahren über einen unbefestigten Weg zu einem Dorf. »Jetzt werden Sie gleich Gllogjan kennenlernen«, sagt Wallmann und betätigt den elektrischen Fensterheber, damit kein Staub in den Wagen kommt. Kurz bevor wir den Dorfeingang erreicht haben, kann man es schon sehen. Straßenbauarbeiten. Die Arbeiter halten kurz inne und lassen uns passieren. Wallmann lächelt den Männern zu, als würde er sie kennen. Er scheint nicht zum ersten Mal hier zu sein. Der Anschein von Normalität könnte auch jetzt kaum größer sein. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass an einem Sonntag solche Arbeiten durchgeführt werden. Die Gesichter der Arbeiter sehen gleichmütig und gelassen aus. Ob sie uns sehen können? Ob unsere Fenster auch getönt sind? Ich nehme mir vor, das zu überprüfen. Ein Sandhaufen blockiert die Zufahrt zu einem von hohen Mauern umgebenen Gebäude. Der Sand aus dem Fluss, denke ich. Der Fahrer verzieht keine Miene. Er steigt kurz aus, um ans Tor zu klopfen. Wallmann beugt sich etwas vor.
»Leider ist Ramush selbst nicht da«, sagt er leichthin. »Aber Sie werden Gelegenheit haben, seinen Vater kennenzulernen.« Wir steigen aus. Wallmann holt sein Telefon heraus und fängt sofort zu telefonieren an. Es muss wohl noch das eine oder andere geklärt werden. Wir stehen vor einem einfachen Anwesen. Ob hier wirklich der ehemalige Premierminister Ramush Haradinaj wohnt? Unser Fahrer steht vor dem Tor und wartet.
»Das ist nur eine Zwischenstation«, erklärt Wallmann, als hätte er meine Gedanken erraten. »Wir holen noch jemanden ab.« Er läuft auf dem schmalen Streifen neben einem ausgehobenen Graben, der von den Bauarbeiten stammt, auf und ab und telefoniert weiter. Er stellt die Verbindung zu einem der größten Machtzentren des Kosovo her.
Das erste Mal ist mir der Name Ramush Haradinaj in Berlin begegnet, in einer Gegend, in der der ehemalige Todesstreifen, die Grenze zwischen Ost und West, in eine idyllische Park- und Erholungslandschaft verwandelt worden ist und wo ich in einem Café mit einer Frau verabredet war, die für eine internationale Organisation im Kosovo gearbeitet hat und mir erzählen sollte, welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat. Ramush Haradinaj tauchte ein paarmal auf. Als Name, als Protagonist einer Geschichte, die diese Frau mit ihrer Tätigkeit im Kosovo verband. Ein Jahr intensiver Erfahrungen, in dem sie als Wahlbeobachterin für die OSZE tätig war und vielleicht irgendwann auch Ramush Haradinaj über den Weg gelaufen ist. Sie erzählte mir von ihm in einer Mischung aus Faszination und Abscheu, während wir an dem künstlich angelegten See, dem Engelbecken, das sie selbst als Ort für unser Treffen ausgewählt hatte, Kaffee tranken. Sie war einer dieser Menschen, die in Krisengebieten gearbeitet haben und danach mit ihrem zusammengeschrumpften Leben nicht mehr zurechtkommen. Für mich aber war sie eine wertvolle Informantin, ich schrieb alles auf, was sie erzählte. Ich notierte mir den Namen HARADINAJ. Ich erinnere mich, wie sie mich korrigierte, weil das »j« zunächst in meiner Schreibweise nicht auftauchte. »Er nimmt die Leute für sich ein«, sagte sie. »Aber er ist wirklich …«, sie machte eine Pause, während sie ihren Blick über den rötlich schimmernden See schweifen ließ, »höchst gefährlich.« Sie benutzte eine Formulierung, die beinahe etwas Lüsternes hatte und eigentlich gar nicht zu ihr passte. »Ein wirklich grausamer Mann«, sagte sie. Vielleicht stand Haradinaj für ihre Erfahrung in einem Land, das in ihren Augen noch immer auf entwürdigende Weise ausgeschlossen ist und dessen Bürger noch immer ein Visum beantragen müssen, um nach Europa einzureisen. Haradinaj vereinte für sie die ganze Ambivalenz und Eigentümlichkeit dieser Erfahrung. »Sie kennen sicher die Geschichte«, sagte sie, »wie er einmal 27 Stunden ununterbrochen auf dem offenen Meer verbracht hat. Im Wasser … Ich weiß gar nicht, wo das genau war.« Sie schüttelte den Kopf, während sie gleichzeitig einen verträumten Gesichtsausdruck hatte. »Er wollte wahrscheinlich beweisen, dass er so stark und ausdauernd sein und einen ganzen Tag und eine ganze Nacht im Wasser bleiben kann. 27 Stunden. Dabei lebte er doch damals noch in der Schweiz …« Sie schrieb mir den Namen auf. Einen Namen, der etwas mit dem Kosovo zu tun hatte und hinter dem eine Geschichte versteckt zu sein schien. 27 Stunden im offenen Meer. Am Ende stimmt diese Geschichte vielleicht gar nicht. Und auch die anderen Haradinaj-Geschichten, die so kursieren, stimmen nicht oder nur teilweise. Es sind Geschichten, die die Abgründe zwischen den Welten zu überbrücken versuchen, Geschichten, die zu erklären versuchen, wie Luzern und Priština zusammengehören, das Kung-Fu-Training in den Fitnessstudios und die Jobs als Türsteher in den Nachtclubs, bei denen ein kräftiger junger Mann aus Gllogjan dafür sorgt, dass nicht die falschen Leute hereingelassen werden, um das Schweizer Nachtleben zu genießen. Ein junger Mann, der dafür sorgt, dass man unter sich bleibt. Ein Bouncer, ein Türsteher, der die Orte der Ekstase und der Entgrenzung bewacht, bevor er sechs Jahre später Premierminister wird. »Und bei alledem frage ich mich«, sagte die Ex-Soziologin und Dolmetscherin, während im Engelbecken langsam die Sonne unterging, »in welche Richtung wollte er schwimmen? Und wollte er überhaupt schwimmen? Denn wie kann man 27 Stunden im Wasser bleiben, wenn man kein Ziel vor Augen hat, wenn man nicht irgendwo hinschwimmen will? Oder sehe ich das falsch?« Sie hatte sich wirklich Gedanken gemacht. Sie hatte darüber nachgedacht. Über eine Geschichte, die Haradinaj selbst am Ende gar nicht erlebt oder einfach nur so erzählt hat. Ich werde es ihn nicht fragen können, er sitzt im Gefängnis. Er hat sich selbst gestellt und ist freiwillig nach Den Haag gefahren. Zu einem Zeitpunkt, als er gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen war. Das Tor zu dem Anwesen öffnet sich. Der Fahrer fährt den Wagen vorsichtig auf das Grundstück. Wallmann und ich folgen. Das Haus, das von hohen Mauern umgeben ist, ist ein einstöckiges Gebäude, das weniger wie ein Bauernhaus als wie ein Ferienhaus aussieht. Davor ist ein Tisch mit Stühlen aufgestellt, inmitten einer grünen, wild wuchernden Wiese.
6
Als ich später mit Wallmann wieder im Wagen sitze und wir zurück nach Priština fahren, merke ich, wie erschöpft er ist. Er bittet mich sogar, ich möge mich vorne neben den Fahrer setzen, während er im Fond ein kleines Nickerchen halte. Er recherchiert, er klappert seine Kontakte ab, besucht die Schlüsselfiguren der jüngeren Geschichte des Landes, führt Hintergrundgespräche. Dieser Sonntag, den ich mit ihm verbringe, ist Teil einer sich schon länger hinziehenden Recherche, und die Natur dieser Recherche, dieses Sammeln von Informationen und Eindrücken, macht es notwendig, dass jemand dabei ist und Zeuge dieses Prozesses wird. Vielleicht liegt es in der Natur des Nebulösen und Unbestimmten, dass Wallmann ab und zu jemanden wie mich mit dabeihaben muss, jemanden, der ihn in seinem Tun bestätigt, wie an diesem Tag, als er den Vater von Ramush Haradinaj aufsucht. Es bleibt unklar, was dabei herauskommen soll. Vielleicht ist es nur ein kleines Puzzleteil oder dient der Kontaktpflege, vielleicht ist es Vorbereitung für einen viel wichtigeren Besuch, dann, wenn Haradinaj eines Tages aus Den Haag wieder zurückkehrt.
Auf der Wiese vor dem schlichten einstöckigen Haus, wo wir wieder nur für eine Viertelstunde einkehren und möglicherweise irgendeinen Informanten, einen stringer, irgendeinen Bekannten von Wallmann treffen, kommt er einmal zu mir herüber und sagt: »Sie brauchen sich nicht immer so zurückzuhalten. Stellen Sie selbst ruhig auch Fragen.« Er deutet diskret zu dem auf der gegenüberliegenden Tischseite sitzenden Mann, der mir als UÇK-Kommandant vorgestellt wird, jemand, der hier in der Gegend mit Ramush gekämpft und den Kosovo schließlich befreit hat. Er kommt einfach so dazu. Kommt plötzlich von dem Nachbargrundstück durch ein kleines Gartentürchen herüber, läuft über die Wiese mit einer Flasche Raki in der Hand und gießt uns dann einem nach dem anderen etwas ein. Vielleicht ist es immer so gewesen, er macht die Gartentür auf und verwandelt sich. Die Türe reicht ihm gerade bis zur Hüfte, er öffnet sie, und dann schließt er sie wieder. Wallmann, sein Fahrer und ich haben uns hingesetzt, die beiden anderen Männer, von denen nicht ganz klar ist, welche Funktion sie bei diesem Zusammentreffen haben, stehen etwas abseits und prosten uns zu. In der Mitte des Grundstücks steht ein ausrangierter Mercedes, der allerdings, wie ich später erfahre, sehr wohl noch fahrtauglich ist und möglicherweise irgendwann mal wieder zum Einsatz kommt.
»Fragen Sie ihn«, fordert mich Wallmann auf, während er selbst dem UÇK-Kommandanten, der sich in diesem Moment gesetzt hat, zuprostet. »Dieser Mann«, sagt er, »der hat hier wirklich etwas erlebt. Hier sind Menschen ums Leben gekommen … Hier hat ein schmutziger Krieg getobt, und solche Leute haben dafür ihre Knochen hingehalten.« Er zeigt noch einmal auf den Mann, der durch die Gartentüre gekommen ist und der in meinen Augen eher wie ein typischer Landwirt aussieht, mit allen Insignien harter körperlicher Arbeit, so wie man es bei Menschen