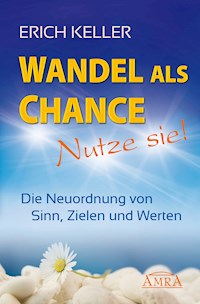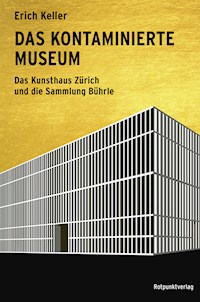
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Kunstsammlung des Waffenfabrikanten Emil G. Bührle ist die kriegerische Geschichte des 20. Jahrhunderts gespeichert. Kriegsmaterialexporte an NS-Deutschland und in die Hotspots des Kalten Kriegs hatten ihn zum reichsten Schweizer gemacht. Ausgestattet mit unerschöpflichen Mitteln kaufte er Kunstwerke, die durch Ausplünderung und Vertreibung jüdischer Sammler und Galeristen auf den Kunstmarkt gespült wurden. Über Jahrzehnte schlummerte seine Sammlung in einem Privatmuseum und diente dem Ansehen der Familie Bührle. Nun soll sie im Neubau des Kunsthauses Zürich die Stadt als Kulturmetropole aufwerten. So zumindest die Hoffnung eines Zusammenschlusses verschiedener Akteure aus Politik, Wirtschaft und Museumswelt.
Wie fand die durch Krieg, Vertreibung und Holocaust kontaminierte Sammlung Einzug in ein öffentliches Museum? Der Historiker Erich Keller zeigt in diesem Buch, wie flüchtig Erinnerungskultur ist – und wie stark die Forschungsfreiheit gefährdet wird, wenn sie unter den Druck einer neoliberalen Standortpolitik gerät. Er erklärt, wie historisch belastete Kunst ökonomisch verwertbar gemacht wird und was Provenienzforschung leisten könnte.
Geht es um problematische Provenienzen, ist oft die Rede von "belasteten" Bildern. Doch Kunstwerke aus dem 19. Jahrhundert wussten nichts von ihrer Zukunft. Was aber wollen die Museen von ihrer Vergangenheit wissen? Debatten um Raubkunst drehen sich nicht um eine entrückte Vergangenheit, sondern stellen Fragen nach politischer Verantwortung in der Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erich Keller
DAS KONTAMINIERTEMUSEUM
Das Kunsthaus Zürich und dieSammlung Bührle
Der Autor bedankt sich für die großzügige Unterstützung bei:
angela thomas und erich schmid max bill georges vantongerloo Stiftung
Paul Grüninger Stiftung
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.
© 2021 Rotpunktverlag, Zürich
www.rotpunktverlag.ch
Lektorat: Lea Haller
Korrektorat: Christoph Gassmann
Umschlag: Patrizia Grab
eISBN 978-3-85869-939-8
1. Auflage 2021
Die Zukunft wird auch nicht bewältigt
Der Kopf ist größer als der Hut
Fehlfarben, «Hier und jetzt»,aus dem Album Monarchie und Alltag, 1980
Für Eliane und Mika
Inhalt
Geschichte und Verantwortung
Bührle als Waffenindustrieller
Sammeln um jeden Preis
Von der Belastung zur Kontamination
1. Die Transformation einer Kunstsammlung
Blockade im Seefeld
Eine »gute Propagandawirkung für die Sammlung«
Die Politik des Standorts
Das Kunsthaus auf dem Kunstmarkt
Die Aufwertung der Sammlung
Wissenschaft im Dienst der Standortpolitik
Ein Rückzug auf Zeit?
2. Raum ohne Geschichte
Die Washingtoner Konferenz von 1998 und ihre Folgen
Die Schweiz als Insel: Die Provenienzforschung der Sammlung Bührle
Die Unsichtbarmachung der Opfer
Flucht in die Armut
3. Die zukünftige Erinnerung
Der lange Weg zur Erinnerungskultur
Das Flick-Museum – ein geschichtspolitisches Lehrstück
Die Herstellung von Einzigartigkeit
Belastete und kontaminierte Geschichte
Das kontaminierte Museum
Literatur- und Quellenverzeichnis
Dank
Autor
Geschichte und Verantwortung
Dreibeinige Halogenscheinwerfer beleuchten einen kahlen Raum. Im Halbkreis ruhen auf wuchtigen Gestellen, Staffeleien nicht unähnlich, zehn Gemälde aus der Sammlung Bührle. »Dies ist größte Kunst. Man kann es kaum fassen«, spricht ein Reporter der Nachrichtensendung Schweiz aktuell in die Kamera, sichtlich ergriffen. Der Wert dieser Kunstwerke, war in der Anmoderation zu hören, gehe in die Hunderte Millionen Schweizer Franken. Im blaustichigen Kunstlicht exponiert, wirken die Gemälde fremdartig und zerbrechlich. Wie Organe kurz vor der Transplantation.
Aufgezeichnet wurde der Fernsehbeitrag im November 2020 in einem unterirdischen Hochsicherheitslager in der Nähe von Bern. Hier waren die Kunstwerke auf ihrem Weg in den Kunsthausneubau zwischengelagert. Tresoranlagen dieser Art gibt es in der ganzen Schweiz. Einige befinden sich in Stollen und Höhlen des Schweizer Réduit, der Alpenfestung aus dem Zweiten Weltkrieg. Besonders beliebt ist die von unzähligen Tunneln durchlöcherte Gotthardregion; dort werden etwa Edelmetalle gebunkert. Rohstoffe und andere Sachwerte in großen Mengen lassen sich nicht in Banksafes aufbewahren. Dafür sind die geräumigen Hochsicherheitslager da.
Die Namen der Künstler, deren Werke in der Sendung gezeigt werden, sind längst zu Markennamen geworden. Sie sind weltbekannt; ihre Gemälde wurden millionenfach reproduziert, in Katalogen, Kunstbüchern, auf T-Shirts, Kaffeetassen und im Internet. Wer ein Original besitzt, gehört der hauchdünnen Schicht der Superreichen an. Oft sind die Werke Teil des Portfolios von Großbanken oder Versicherungen. Oder sie werden von einer Stiftung gehalten, nicht selten steuerbefreit, wie die Kunstsammlung des Waffenindustriellen Emil G. Bührle.
Das Original ist die seltenste Ware. Für den Philosophen Walter Benjamin unterscheidet sich das Originalkunstwerk von einer Reproduktion durch seine Geschichte. Genau genommen, spricht Benjamin davon, dass sich die Geschichte am Original vollzogen hat. Er gebraucht die Metapher der Spur, hinterlassen von der Zeit, und meint damit die unverwechselbaren physischen Veränderungen, die das Original seit seiner Entstehung erlitten habe. Die zweite Spur, so Benjamin, sei die der »wechselnden Besitzverhältnisse, in die es eingetreten sein mag«.1
Heute wissen wir, dass auch die Reproduktionen in ihrer Struktur nie identisch miteinander sind. Dementsprechend wäre also auch jede Vervielfältigung ein Unikat. Und folgt man der Spur des Originals durch Raum und Zeit, wird diese Spur nie dieselbe sein wie die ihrer Reproduktionen.
Solchen Spuren geht die wissenschaftliche Provenienzforschung nach. Früher tat sie das, um Originale zu identifizieren, sie von Kopien unterscheiden zu können. Heute werden Provenienzen erforscht, um die Legitimität von Besitzverhältnissen zu prüfen. Geklärt wird, wie Kunst- und andere Kulturobjekte in den Besitz von Museen oder Sammlern gelangt sind. Kaum mehr ein Museum kann heute auf solche Abklärungen verzichten.
Dieses Buch beschäftigt sich mit der Frage, wie die Kunstsammlung von Emil G. Bührle ins Kunsthaus Zürich gekommen ist. Es folgt der Spur eines Ensembles von Kunstwerken auf der vorläufig letzten Etappe eines Wegs, der um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts seinen Anfang nahm. Im baulich erweiterten Zürcher Kunsthaus werden diese Objekte nun zwanzig Jahre lang gezeigt werden müssen. So bestimmt es ein Leihvertrag zwischen der Bührle-Stiftung und der Zürcher Kunstgesellschaft, die als Verein das Kunsthaus betreibt.
Dass diese Verschiebung im rotgrün-regierten Zürich stattfinden konnte, ist erstaunlich und erklärungsbedürftig. Denn mit dem Namen Bührle, mit Bührles Rüstungsunternehmen und seiner Kunstsammlung ist seit Jahrzehnten ein schweres Erbe verbunden. Kein anderes Schweizer Unternehmen war tiefer mit dem nationalsozialistischen Regime verflochten, keines hat nur ansatzweise in einem solchen Umfang Rüstungsgüter in die Kriegs- und Krisenregionen des 20. Jahrhunderts exportiert, keine andere Familie hat einen nur annährend so großen finanziellen Gewinn aus Geschäften dieser Art gezogen. Kein Schweizer Kunstsammler war enger in den NS-Kunstraub verwickelt als Emil G. Bührle. Seine Kunstsammlung ist ein Archiv der kriegerischen Gewalt aus dem »Jahrhundert der Extreme« (Eric Hobsbawm).
Auf dem Kunstmarkt ist der Wert dieser Werke seither geradezu explodiert. Das führte dazu, dass die Sammlung in einem engen Interessenverbund der Stiftung Bührle, des Kunsthauses und der Stadt Zürich von ihrem Begründer losgelöst wurde. Ziel war es, ihre Funktion zu verändern. Heute repräsentieren die Kunstobjekte nicht mehr die Waffenschmiede oder den Namen Bührle, sondern den Wirtschafts- und Kulturstandort Zürich.
Damit dies gelingen konnte, wurde die Geschichte der Sammlung in zwei Stränge aufgetrennt; jeder Strang sollte separat erforscht werden. Die Forschung zur Provenienz der Werke blieb Aufgabe der Bührle-Stiftung selbst, während die Erforschung des historischen Entstehungskontexts der Sammlung als comissioned history der Universität Zürich anvertraut wurde. Von Februar 2018 bis Februar 2020 war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter dieses Projekts. Danach stieg ich wegen Uneinigkeiten über die Ausrichtung der Forschung aus. Bei der Durchsicht des noch unpublizierten Forschungsberichts entdeckte ich, dass dieser an entscheidenden Stellen abgeändert worden war, was, wie ich erfuhr, auf Druck der Sammlung Bührle und der Kulturdirektion im Präsidialdepartement Zürich geschehen ist.
Sowohl die stiftungsinterne Provenienzforschung als auch der universitäre Forschungsauftrag starteten erst, als die Verschiebung der Sammlung ins Kunsthaus längst in die Wege geleitet war. Die Bührle-Forschungen hatten nie – selbst wenn sie unabhängig und frei von politischen Einflussnahmen gewesen wären – eine kritische Aufarbeitung zum Ziel. Eine solche hätte am Anfang des Transferprozesses stehen müssen; sie wäre die Voraussetzung für eine vertiefte Diskussion gewesen. Etwa darüber, ob eine Überführung in ein öffentliches Haus der richtige Umgang mit Geschichte sei, und über die Verantwortung, die sich aus der Vergangenheit ergibt.
Das Ziel aber war die Trennung der Sammlung Bührle von ihrer Geschichte. Nicht dadurch, dass man sie verschweigt, sondern dadurch, dass man sie in einer bestimmten Weise erzählt.
Davon überzeugt, dass sich historische Verantwortung nicht wie ein Salzkorn in einem Glas Wasser auflöst, spreche ich vom Kunsthaus als einem kontaminierten Museum. Wird auf die Sammlung Bührle verwiesen, ist oft zu hören, sie sei historisch belastet. Nun hat Geschichte kein Gewicht, doch die Metapher der Last macht deutlich, dass damit bestimmte Ereignisse aus der Vergangenheit gemeint sind, die heute als problematisch wahrgenommen werden. Auch Kontamination ist eine Metapher. Sie auf das Kunsthaus Zürich zu beziehen heißt, die Geschichte der Sammlung Bührle in die Gegenwart zu verlängern und über die Bedeutung der Sammlung und ihrer Geschichte in der Zukunft nachzudenken. Denn die Sammlungsgeschichte endet keineswegs 1960 mit der Gründung der Stiftung, in deren Besitz rund ein Drittel der ursprünglich etwa sechshundert Werke eingegangen ist.
Als der Unternehmer und Kunstsammler Friedrich Christian Flick 2001 in Zürich ein Museum für zeitgenössische Kunst bauen wollte, stieß er mit seinen Plänen auf erbitterten Widerstand. Exponenten aus Politik und Kultur forderten, dass sich Flick persönlich an einer Stiftung beteilige, die ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und ihre Angehörigen finanziell unterstützt. Flicks Großvater – wie Bührle ein Waffenindustrieller – hatte in extremem Ausmaß von NS-Zwangsarbeit profitiert. Der Enkel wies 2001 die Forderung nach finanzieller Wiedergutmachung zurück; er habe, erklärte er, von seinem Großvater die Verantwortung geerbt, nicht die Schuld.
Bührle als Waffenindustrieller
Flicks Zürcher Museumspläne scheiterten also an unterschiedlichen Haltungen darüber, wer in der damaligen Gegenwart welche Verantwortung für die Geschichte zu tragen habe. Im Zusammenhang mit der Bührle-Sammlung wurde diese Frage nie gestellt. Dabei ist die Sammlung gleich doppelt belastet.
Die Geschichte von Emil G. Bührles Rüstungsfirma wurde im Kontext der Verflechtung der schweizerischen Rüstungsindustrie und des Kriegsmaterialhandels während des Nationalsozialismus erforscht.2 Die Studie von Peter Hug konnte zum ersten Mal detailliert zeigen, wie der Zweite Weltkrieg Emil G. Bührles Rüstungsfirma, die Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon (WO), zur größten Kriegsmaterialproduzentin der Schweiz und Bührle zum reichsten Schweizer gemacht hatte. Nach Zürich gekommen war der 1890 in Deutschland geborene Bührle 1924 als Prokurist im Auftrag der deutschen Heeresleitung. Hier, auf neutralem Boden, sollte er die technologische Weiterentwicklung einer Zwanzig-Millimeter-Maschinenkanone leiten.3 Der Versailler Friedensvertrag, 1920 in Kraft getreten, untersagte Deutschland die Wiederbewaffnung und den Aufbau einer eigenen Rüstungsindustrie. Das Deutsche Reich organisierte seine Wiederaufrüstung deshalb verdeckt und auf mehrere Staaten verteilt.
Die Schweiz bot beste Voraussetzungen, die pazifizierenden Absichten zu durchkreuzen. Sie hatte die Pariser Vorortverträge nicht ratifiziert und kannte keine Exportkontrolle. Auf einem unruhigen Kontinent galt sie als politisch und wirtschaftlich stabil und war dadurch als Offshore-Standort für die verdeckte Wiederaufrüstung Deutschlands überaus geeignet.
Innerhalb kürzester Zeit erwies sich der ehemalige Student der Kunstgeschichte und Angehörige paramilitärischer Kampfeinheiten der äußersten Rechten im Bürgerkrieg als der richtige Mann auf dem richtigen Platz. In der Person Bührles trafen sich rechtsnationale Gesinnung, kaufmännisches Geschick und technisches Verständnis – eine seltene Kombination. Bührle war am Maschinengewehr ausgebildet, verfügte über Fronterfahrung und war als Freikorpsangehöriger nach eigenem Bekunden an der, wie er es ausdrückte, Niederwerfung der Kommunistenaufstände in Berlin von 1918/1919 beteiligt gewesen. Bührle verehrte den Antidemokraten Oswald Spengler, teilte dessen Kriegsfaszination, kurz, Bührle vertrat die militaristischdeutschnationale Ideologie der untergegangenen Wilhelminischen Zeit. Und damit auch den unbedingten Willen, Deutschland wieder aufzurüsten und den, wie ihn die revanchistische Rechte nannte, »Schmachfrieden von Versailles« nicht zu akzeptieren.
Ohne die technologischen und industriellen Vorbereitungen an den Offshore-Standorten Schweden, Niederlande oder in der Schweiz wäre das rasante Herauffahren der deutschen Massenproduktion von Rüstungsgütern in den dreißiger Jahren nicht möglich gewesen – eine unverzichtbare Bedingung für die Entfesselung des Krieges von 1939.
In der kurzen Zwischenkriegszeit entstand nicht bloß die Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, sondern mit ihr die gesamte exportorientierte Rüstungsindustrie der Schweiz. Bührles Unternehmen überflügelte nicht zuletzt dank seinen hervorragenden Kontakten zur revanchistisch-reaktionären Elite Deutschlands im Nu alle Konkurrenten.
Die WO ließ sich rasch in die Gewinnzone führen, was die Voraussetzung schuf, sie zu autonomisieren. Vorausschauend, entkoppelte Bührle die Firma schrittweise von deutschen Interessen – nicht aus politischen, sondern aus unternehmerischen Gründen. Das Wohlwollen der reaktionären Spitzen des Deutschen Reichs blieb ihm erhalten; sein Netzwerk erwies sich als stabil und enorm weitreichend.
Auch der Machtwechsel von 1933 gefährdete Bührles Sonderstellung in keiner Weise. Die WO baute ihre Produktion fortlaufend aus, belieferte bald eine Vielzahl von Staaten, vom vorrevolutionären China zu Großbritannien, von Mexiko oder Äthiopien bis hin, im Verborgenen, zur Sowjetunion. 1938 konnte Bührle die Mehrheit der WO-Aktien übernehmen. In der Folge formte er das Unternehmen zu einer Kommanditgesellschaft um – das heißt, er wurde Alleinbesitzer, trug also das volle geschäftliche Risiko. Der Vorteil war, dass die in rasantem Tempo wachsende WO auf dem volatilen Rüstungsmarkt agil wurde. 1935 beschäftigte sie noch vierhundert, 1939 bereits zweitausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1937 konnte Bührle das Schweizer Bürgerrecht erwerben. Dieser Schritt war unabdingbar geworden, um die WO langfristig in Zürich halten zu können. Drei Jahre zuvor hatte Bührle zusammen mit dem Heereswaffenamt und dem Reichsluftfahrtministerium die Ikaria AG mit Sitz in Berlin gegründet. Die Aktienmehrheit war im Besitz von Emil G. Bührle, der sich einen direkten und von Schweizer Außenwirtschaftsbeziehungen unabhängigen Zugang zum NS-Staat sichern wollte. Die Ikaria stellte hauptsächlich Flugzeugbewaffnungen her, basierend auf der hauseigenen Zwanzig-Millimeter-Maschinenkanone. Sie sollten aus taktischen Gründen aber nicht in Oerlikon, sondern in Deutschland produziert werden. Deshalb verkaufte Bührle die Herstellungslizenz für die Schnellfeuerwaffe an die Ikaria. Für jede verkaufte Kanone strich Bührle eine Beteiligung ein. Aufgrund von Streitigkeiten um Devisen und dem Bestreben der deutschen Luftfahrtindustrie, die Kontrolle über den gesamten Sektor in staatliche Hände zu legen, zerfiel die Kooperation aber rasch wieder. Bührle überschrieb die Beteiligung an der Ikaria schließlich an seine beiden in Deutschland lebenden Geschwister.
Die Ikaria wurde in eine neu gegründete Firma integriert, die Veltener Maschinenbau GmbH. Für dieses Unternehmen errichteten die Besitzer ein werkseigenes Satellitenlager unter dem Kommando erst des KZ Ravensbrück, danach des KZ Sachsenhausen. Darin wurden ausschließlich Frauen, darunter Sinti, Romnija und Jüdinnen, aus Polen, Russland, Frankreich, Deutschland, Rumänien, Ungarn und Lettland gefangen gehalten und zur Arbeit gezwungen. Bis zu 722 Frauen verrichteten unter der Lagerleitung durch SS-Unterscharführer Heinrich Loose Zwangsarbeit für die Ikaria. Nur mit viel Glück erlebten sie ihre Befreiung durch die Rote Armee am 20. April 1945.
Genaueres über das Schicksal der Insassinnen weiß man nicht. Bekannt aber ist, dass Bührle durch seinen Lizenzvertrag 870’560,50 Schweizer Franken aus NS-Zwangsarbeit zuflossen. Weitere knapp 300’000 Schweizer Franken blieben auf einem Sperrkonto blockiert. Ob Bührle wusste, unter welchen Bedingungen in der Ikaria gearbeitet wurde? Seine engen Kontakte ins militärischindustrielle Netzwerk der NS-Eliten, die regelmäßigen Treffen mit solchen Leuten, seine rege Reisetätigkeit in Deutschland lassen dies vermuten. Auch ein fragmentarisch erhaltenes Schriftstück im WO-Archiv stützt diese Einschätzung. Wahrscheinlich von einem Anwalt verfasst, liest es sich wie eine Verteidigungsschrift Bührles, die belegen soll, wie lose seine Verbindung zur Ikaria gewesen sei. »Niemals hat Oerlikon über diese Gesellschaft etwas erfahren, noch war sie [gemeint ist die verantwortliche Veltener Maschinenbau GmbH] über Ikaria direkt oder indirekt daran interessiert«,4 wird darin mit Nachdruck und ähnlich an anderen Stellen behauptet.
Verfasst wurde das Schriftstück vermutlich im Spätsommer 1948, also etwas mehr als ein halbes Jahr nach den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. Dort war der Waffenindustrielle Friedrich Flick zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, unter anderem wegen NS-Zwangsarbeit in seinen Werken – 1950 kam er allerdings wieder frei. Wäre Bührle 1937 nicht in der Schweiz eingebürgert worden, hätte er sich ebenfalls vor Gericht verantworten müssen.
Ob Bührle davon wusste oder nicht – seit 2016 sind diese Fakten bekannt.5 Bislang wurden wegen der Gewinne aus Zwangsarbeit keine Reparations- oder Wiedergutmachungsforderungen an die Nachkommen Emil G. Bührles gestellt.
Zu Beginn des Kriegs belieferte Bührles WO auch Frankreich und Großbritannien. NS-Deutschland stellte seine Waffen und Munition nach Möglichkeit selbst her. Die WO wäre mit den britischen und französischen Bestellungen bis 1942 ausgelastet gewesen, kontaktierte im März 1940 aber dennoch die deutschen Stellen. Bührle dachte voraus. Kurz darauf war die Schweiz beinahe vollständig von den Achsenmächten umschlossen. Die WO richtete ihren Kriegsmaterialexport neu nach NS-Deutschland aus. Vom Sommer 1940 bis zum angesichts des nahenden Kriegsendes erlassenen Exportverbot von 1944 exportierten Schweizer Unternehmer Rüstungsgüter im Gesamtwert von 751,5 Millionen Schweizer Franken. 84 Prozent davon – das sind Artikel im Wert von 623,9 Millionen Franken – gingen an die Achsenmächte. Davon wiederum entfielen 543,3 Millionen auf Exporte der WO.
Möglich waren diese Exporte nur durch die vom Bund zur Verfügung gestellten Clearingkredite. Als Clearing wird der interstaatliche Zahlungsverkehr bezeichnet, der auch dann den grenzüberschreitenden Austausch von Waren ermöglichte, als der internationale Zahlungsverkehr kriegsbedingt zum Erliegen gekommen war. Der Bund stellte im Rahmen von Clearingabkommen bis Ende des Kriegs insgesamt 1100 Millionen Franken für Geschäfte mit NS-Deutschland und 390 Millionen Franken für solche mit dem faschistischen Italien bereit. Die staatliche Clearingpraxis schuf die Grundlage für neutralitätswidrige Rüstungsgeschäfte mit Deutschland und Italien; das Geld wurde darum schon unmittelbar nach dem Krieg als »Kollaborationsmilliarde« bezeichnet. Heute gilt diese Clearingpraxis als Bruch der Haager Konvention von 1906 und damit der Neutralitätspolitik.
Nutznießer des Neutralitätsbruchs waren NS-Deutschland, das faschistische Italien – und Bührles WO. Dabei hätte das Unternehmen jederzeit die Produktion auf zivile Güter umstellen können – wie andere Schweizer Firmen das getan haben. Die WO war zu keinem Zeitpunkt gezwungen, Kriegsmaterial an NS-Deutschland und seine Verbündeten zu liefern.
Die Exporte an die Achsenmächte zahlten sich indessen aus. Zum Kriegsende war Bührle der reichste Mann der Schweiz. Aus seinen Geschäften und dem exorbitanten Gewinnen daraus flossen dem Staat und dem Kanton Zürich allein zwischen 1941 und 1944 etwa hundert Millionen Schweizer Franken an Steuern zu.
Als sich Ende 1942 die militärische Niederlage Deutschlands abzuzeichnen begann, machte die WO ihren Beschäftigten Mut. Jetzt bloß keine Furcht vor dem Frieden haben, verkündete Hans Mötteli, Kadermitglied und Professor an der Handelshochschule St. Gallen in der Werkszeitung. Es gelte, sich geistig und materiell auf den Frieden vorzubereiten.
Tatsächlich gelang es Bührle, nach 1945 rasch wieder Fuß zu fassen. 1941 war er von den Alliierten wegen seiner Exporte an die Achsenmächte zwar auf eine schwarze Liste gesetzt worden – das bedeutete, dass britische und US-amerikanische Firmen keine Geschäfte mit ihm, der WO und ihren Tochterfirmen tätigen durften. Die Unsicherheit für Bührle aber währte nur kurz. Mit dem Washingtoner Abkommen vom 25. Mai 1946 konnte die Diplomatie einen veritablen Coup landen. Die Schweiz zahlte 250 Millionen Franken als »freiwilligen« Beitrag zum Wiederaufbau Europas, was gerade einmal einem Fünftel dessen entsprach, was aus NS-Deutschland an Gold aufgekauft worden war – oder ein wenig mehr als der Hälfte dessen, was Bührle während vier Kriegsjahren an Steuern entrichtet hatte. Im Gegenzug verschwanden die schwarzen Listen, und der Schweiz gelang die nahtlose Westintegration.
In der Zwischenzeit war Bührle nicht untätig gewesen. Wie schon während des Zweiten Weltkriegs hätte er den Rüstungssektor abstoßen, die breit aufgestellte Firma redimensionieren und gänzlich in eine Produktion ziviler Güter einsteigen können. Die Profite aus dem Kriegsmaterialgeschäft aber waren so ernorm hoch, dass daran nicht zu denken war. Im Gegenteil, Bührle unternahm alles, seine Profite weiterhin zu maximieren. Erst seit Kurzem ist bekannt, dass er sich dabei zwischen 1945 und 1950 auch systematisch in der Illegalität bewegte.6 Mit hoher Wahrscheinlichkeit tat er dies schon seit den dreißiger Jahren; Hinweise darauf gibt es zahlreiche.
Bührles Waffenexperten, darunter Ingenieure, die zuvor in NS-Rüstungsfirmen tätig gewesen waren, hatten eine ballistische Rakete entwickelt, die mit großer Zielgenauigkeit Sowjetpanzer durchschlagen konnte. Diese Waffe verkaufte er während des Koreakriegs (1950–1953) hunderttausendfach allein an die USA. Bührle setzte sich mit seiner ganzen Macht und dank seinen nach wie vor ausgezeichneten Kontakten in die Landesregierung gegen neutralitätspolitische Bedenken durch. Erneut wollte er die kriegsbedingt günstige Situation nutzen, um eine Tochterfirma dort zu installieren, wo die Nachfrage besonders groß war. In Asheville (North Carolina) baute er hastig ein Werk, um sich den Zugang zum hochlukrativen amerikanischen Rüstungsmarkt zu sichern. Doch die US-Konkurrenten holten in der raketengetriebenen Waffentechnik schnell auf, und bevor Bührles fabrikationsbereite Firma auch nur ein Geschoss verkaufen konnte, musste sie unter hohen Verlusten schon wieder abgewickelt werden. Trotzdem blieben die Gewinne aus dem Raketengeschäft enorm. Als Bührle starb, übernahm sein Sohn Dieter die Leitung und kannte wie sein Vater keinerlei Hemmnisse, Kriegsmaterial in die Hotspots des Kalten Kriegs zu exportieren, legal oder illegal.
Obschon Emil G. Bührle sich auch als Waffenschmuggler in industriellem Ausmaß betätigte, wurde ihm – anders als seinem Sohn Dieter Bührle – nie der Prozess gemacht. So mächtig war seine Position, so sehr hatte sich die Schweiz in ihrer militärischen Sicherheitspolitik von ihm abhängig gemacht.
Man kommt nicht umhin, in der seit über einem halben Jahrhundert andauernden Abhängigkeit des Kunsthauses von Bührles Kapital eine Fortsetzung dieses Musters zu sehen. Bührles unerschöpfliche Gelder finanzierten den elegant unterstelzten, 1958 eröffneten Anbau und machten das Kunsthaus zu einer Institution von nationaler Bedeutung. Und nun wollen Kunsthaus und Stadt Zürich mit dem in seiner Kunstsammlung geronnenen Kriegskapital in die europäische Topliga der Museen aufsteigen.
Seiner Familie hinterließ Emil G. Bührle sein riesiges Vermögen. Und eine umstrittene Kunstsammlung.
Sammeln um jeden Preis
Mit dem Sammeln von Kunst hatte Bührle schon während des Kriegs begonnen. Zum Kunstsammler aber wurde er erst im Kalten Krieg – und durch den Kalten Krieg. In den Jahren zwischen 1933 und 1945 war der internationale Kunstmarkt neu formatiert worden.7 Unter dem Druck der antisemitischen Politik des NS-Staats mussten jüdische Galeristen, Kunsthändler und Sammler Deutschland, Frankreich und andere europäische Staaten verlassen, die meisten in Richtung der USA. In der Folge wurden in großer Zahl Kunstwerke und andere Kulturgüter verschoben und auf den Markt gespült. Ab 1937 verschärfte sich der NS-Kunstraub innerhalb Deutschlands und seiner besetzten Gebiete. Das Regime ging zu systematischem Terror, Entrechtung und Ausplünderung von als jüdisch Verfolgten über. Dadurch gelangten weitere Objekte in großer Zahl in Umlauf. Nach 1945 lagen die Zentren des Kunstmarkts nicht mehr nur in Paris oder London, sondern auch in Übersee, mit dem Schwerpunkt New York.8 Auch der Schweizer Kunstmarkt profitierte langfristig von diesen enormen Umschichtungen.9 Auf diesen Nachkriegsmärkten, die direkte Folge der NS-Rassenpolitik und des Krieges waren, erwarb Bührle den überwiegenden Teil seiner Kunstsammlung.
Von 1939 bis 1945 kaufte er etwa hundert, zwischen 1946 und seinem Tod 1956 fast fünfhundert Objekte. Bührle unterhielt ein Netzwerk von Zwischenhändlern, das ihm Kunstobjekte zuspielte. Die Hälfte der insgesamt über sechshundert Kunsterwerbungen fand in der Schweiz statt, insbesondere bei Galeristen und Händlern wie Fritz Nathan in St. Gallen oder den Galerien Aktuaryus in Zürich und Fischer in Luzern, deren Rolle im NS-Kunstraub gut dokumentiert ist. Nachdem Bührles Name von den schwarzen Listen der Alliierten gestrichen war und seine Raketengeschäfte mit der US-Armee anliefen, stieß er auch auf den transatlantischen Kunstmarkt vor. Seine Besuche im politischen Washington D. C. verband er mit ausgedehnten Einkaufstouren im mondänen New York. Den Gemälden, die er unbedingt besitzen wollte, folgte er auch nach London, Paris oder Monaco.10
Für gotische Holzskulpturen brauchte er bloß nach Konstanz zu reisen, zu Benno Griebert, der im alten Schloss Meersburg am Bodensee einen schwungvollen Kunsthandel aufgezogen hatte. Griebert war eine der Schlüsselpersonen für den Kunstsammler Bührle, wie die aktuelle Forschung zeigt.11 Auch in der kürzlich erschienenen, opulent bebilderten Bührle-Sammlungsgeschichte, in der Stiftungsdirektor Lukas Gloor die Summe seiner Provenienzforschung vorstellt, taucht Griebert kurz auf.12 Mit keinem Wort wird allerdings erwähnt, dass der Kunsthistoriker Benno Griebert überzeugter Nationalsozialist gewesen war, ein sogenannter »alter Kämpfer«, mit NSDAP-Parteieintritt vor 1933. Von 1934 bis 1937 war er als Referent bei der Reichskammer der Bildenden Künste in Berlin und von 1938 bis 1939 für die Berliner Nationalgalerie tätig. Danach war Griebert Berater im Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), einer der wichtigsten NS-Rauborganisationen, zuständig für die Plünderung von Kulturgütern in den besetzten Ländern. Als stellvertretender Direktor des ERR von 1941 bis 1945 fungierte Bruno Lohse.13 Nach dessen Tod 2007 wurde in einem Tresor der Zürcher Kantonal-bank noch NS-Raubkunst entdeckt. Der einzige Zeichnungsberechtigte für das Bankfach war Grieberts Sohn Peter.14 Benno Griebert und Bruno Lohse werden den wenig erforschten Netzwerken zugerechnet, die die Spuren des Kunstraubs nach Kriegsende verwischten und für Kontinuität auf dem (Post-)Raubkunstmarkt sorgten.15