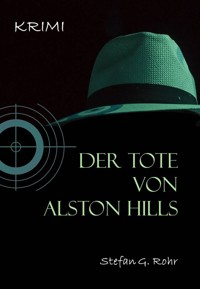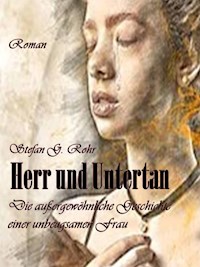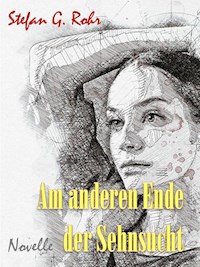Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spannung, Abwechslung und ein waschechter Thriller. Was zunächst als unvorhergesehenes, fast harmloses Unterfangen beginnt, entfaltet sich zu einem ausgewachsenen Abenteuer inmitten internationaler Machenschaften. Erzählt an vielen Orten in Deutschland, dem Orient und Griechenland - dramatisch, mitreißend, aber auch wohltuend immer wieder mit feinem Humor unterlegt. Dieser gut verschachtelte Roman – mit seinen vielen sich nach und nach zu einem Ganzen zusammenfügenden Parallelgeschichten – bleibt stets abwechslungsreich und hält seine Leser dauerhaft in Atem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan G. Rohr
Das Kontingent
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Das Kontingent
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Epilog
TEIL 1
TEIL 2
TEIL 3
TEIL 4
TEIL 5
TEIL 6
TEIL 7
Impressum neobooks
Das Kontingent
Prolog
Denn wer den anderen liebt,
hat damit das Gesetz erfüllt.
(Römer 13,8)
Sie steht immer noch da, am selben Platz, und man könnte meinen, es wäre in den letzten Monaten überhaupt nichts geschehen. Unsere alte Bank im Hof, ein wenig rostig und mit rissigem Holz, direkt neben dem Eingang zum Treppenhaus. Ich sitze wieder hier, mit einer Zigarette in den Fingern und schaue mit müden Augen in den Innenhof. Wie immer steht die Haustüre neben mir offen, und es zieht mir der Geruch von Keller und Fahrrad-Öl in die Nase.
Aus geöffneten Fenstern klingen Stimmen herab. Würde ich mir Mühe geben, so könnte ich die Gesprächsfetzen aufgreifen und vielleicht sogar zu sinnvollen Sätzen zusammenfügen, zumindest doch erraten können worüber gesprochen wird. Doch ich gebe mir diese Mühe nicht. Was gesagt, worüber gelacht wird oder weswegen eines der Kinder gerade weint, ist mir jetzt nicht wichtig. Es beruhigt mich einfach nur, dass die Stimmen da sind. Sie erfüllen mich mit Wärme und einer eigenartigen, kryptischen Freude, der aber gleich wieder meine Nachdenklichkeit folgt.
Schritte hallen gedämpft irgendwo durch das Treppenhaus. Ich hoffe, dass jetzt niemand an mir vorbeikommen wird. Ich möchte jetzt weder sprechen noch zuhören müssen. Mir schießt ein Gedanke in den Sinn: Ist es nicht wirklich gut so, dass es nach außen den Anschein hat, kaum etwas hätte sich geändert, fast alles sei noch so wie vor kurzer Zeit? Nicht auszudenken wenn es anders wäre. Und selbst der Himmel ist bemüht, sich nichts anmerken zu lassen. Graue Wolken ziehen durch das Viereck, das unser Innenhof nach oben hinaus frei lässt, und es riecht jetzt nach aufkommender Regennässe und feuchten Pflastersteinen.
Trotz der kühlen Feuchte, die langsam an meinen Beinen emporkriecht und mich nach und nach frösteln lässt, bleibe ich noch ein wenig sitzen. In meiner Brusttasche steckt eine schmale Schnapsflasche. Ein paar Schlucke aus ihr habe ich bereits genommen. Heute habe ich den Rest des Calvados hineingefüllt. Der edle Brand stand einige Wochen herrenlos bei mir herum, und ich erinnere mich noch gut, wie wir ihn damals geöffnet und mit welchen Gedanken wir ihn zu dreiviertel geleert haben. Obwohl es erst vor Kurzem war, kommt es mir vor, als lägen Jahrhunderte zwischen diesem Tag und heute.
Bevor ich heute hinunter in unseren Hof gegangen bin, habe ich mich erwischt, dass ich in meinen Spiegel geäugt und kritisch geprüft habe, ob ich vielleicht anders aussehe als noch vor dieser Reise. Wie ein Laser-Scanner habe ich mein Gesicht mit meinen Blicken abgetastet, jedes Fältchen, meine Mundwinkel, ja sogar meine Augen selbst. Gucke ich anders? Kann ein geschultes Auge, ein Fachmann, etwas entdecken? Ich bin mir meiner da nämlich nicht sicher. Wenn es dumm käme, dann würde mich sicher irgendein Zucken, eine schräge Miene, ein zu schnelles Wegschauen oder ein leichtes Zittern schnell verraten können.
Der Rest meines alten Calvados verschwindet mit einem großen Zug in meinem Mund. Das sanfte Apfelaroma erfüllt meinen Gaumen, und das Brennen des Alkohols in meiner Kehle setzt eine kurz aufhellende wohlige Wärme frei. Ich bekomme Gänsehaut und muss gleich über mich selbst lächeln. Zu befürchten, dass jetzt noch alles auffliegen könnte, sich Beweise finden ließen, ist einfach albern. Ich bin mir da absolut sicher – doch in meinem tiefsten Innern scheint die Angst dennoch nicht weichen zu wollen. Sie hat sich dort wie ein Ölfleck ins Gewebe eingesogen und einen grauen Schatten hinterlassen.
Ich lehne mich nach hinten und schließe die Augen. Ich kann wieder das Meeresrauschen hören, und für einen kurzen Moment glaube ich sogar, das salzige Wasser auf meinen Lippen zu schmecken. Ich sehe die Sterne am Himmel und glaube nun sogar den lauen Wind auf meinen Wangen zu spüren. Das ist alles bereits sehr weit weg, fast vorbei, und das Gras hat begonnen, die Vergangenheit zu überdecken. Gut so! Irgendwann, vielleicht bald, werde auch ich vergessen haben. Dann wird es wieder ganz so sein wie es zuvor war. Nicht alles, das ist unmöglich, aber doch das meiste.
Ich öffne die Augen. Die Dämmerung hat eingesetzt, und die Fenster um mich herum sind nun alle geschlossen. Es ist den meisten wohl schon zu kalt geworden. Der Herbst nimmt alles in den Griff, und der nahe Winter ist deutlich zu spüren. Ich knöpfe mein altes Sakko zu und schlage den Kragen hoch. Bisher habe ich es bewusst vermieden, meinen Blick auf die ehemalige Werkstatt zu richten. Es ist der Ort, an dem die Geschehnisse der vergangenen Monate ihren Anfang nahmen – unscheinbar, versteckt, und deshalb vielleicht gerade wie geschaffen für einen Plan, dessen Umfang und Ausgang keiner von uns wirklich überschaut hatte. Es ging in jenen Tagen aber eine unausweichliche Kraft von ihm aus, die ich mir bis heute nur vage damit erklären kann, dass es wohl mehr zwischen Himmel und Erde geben muss, als wir es uns vorzustellen trauen. Wie an Fäden geführt wurden wir zu dem geleitet, was wir ganz offensichtlich tun sollten. Und deswegen bleibe ich wohl auch weit davon entfernt, mich mit irgendwelchen Eitelkeiten zu schmücken.
Mit dem Calvados im Blut fasse ich all meinen Mut zusammen, nun doch hinüberzuschauen. Irgendwann muss es eh geschehen. Und da ich hier jetzt wohlbehalten sitze, werde ich diesen Blick dorthin wohl auch aushalten, denn es hätte ja auch völlig anders ausgehen können.
So sehe ich jetzt zum ersten Mal wieder das dunkle Fenster und die nun verschlossene Tür. Ich habe einen Schmerz erwartet und bin erleichtert, dass ich nichts dergleichen verspüre. Ich wage mich deshalb weiter. Wage mir Licht vorzustellen, Licht, das wie damals durch die matten Scheiben aus dem kleinen Betrieb schien. Ich beginne die Maschine zu hören, das monotone Stampfen des Gegengewichtes, spüre dessen Vibration und vernehme das Klappern von Farbdosen. Ich sehe den Schatten des alten Mannes, wie er sich bewegt, höre leise seine Stimme, wie er mit sich selbst redet, flucht und gleich darauf in Fröhlichkeit umstimmt. Die Türe öffnet sich jetzt, der Geruch von Farben, Verdünnern und Maschinenölen überzieht den Hof, und plötzlich ist alles wirklich wieder so wie an jenem Tag, an dem alles begann.
Kapitel 1
Auch an diesem Abend sitzen wir hier auf dieser Bank, einige von uns stehen im Halbkreis davor. Es ist einer der herrlichen Frühsommerabende, und unsere kleine Hausgemeinschaft hat sich hier, wie fast an jedem Abend, wieder einmal zusammengefunden. Es wird geraucht, ein Schnäpschen umhergereicht und geplaudert. Da sitzt unser Vermieter Willi mit seiner Tüte Lakritz. Davor stehen der stets ein wenig schwitzende Fritz, der dünne lange Ruprecht und unser lebenslustiger Fredo, der wie immer der lauteste ist und fröhlich poltert.
Einen Anlass für unsere Treffen benötigen wir nie, so auch an diesem Tag nicht. Ich will es aber auch nicht als Ritual bezeichnen, mehr als Gewohnheit, geboren aus dem Umstand, dass es für uns alle wenig andere Gelegenheiten der Zerstreuung und Ablenkung gibt. Denn niemand von uns kann sich mehr als das hier leisten.
Wir sind in den wenigen Jahren unseres Zusammenwohnens in diesem Haus, trotz all unserer Unterschiedlichkeiten, freundschaftlich zusammengewachsen. Zu unserem Kreis gehören natürlich noch Kalli und Marta. Kalli betreibt, trotz seines bereits hohen Alters, in der Hofwerkstatt eine kleine Druckerei und kommt meist nie vor dem Dunkelwerden aus seinem Betrieb. Und die liebe Marta bleibt unseren Hof-Treffen ohnehin zumeist fern, denn solche sind mit ihrem Anstand als Witwe und Klavierlehrerin nicht vereinbar.
Die Uhr der alten Kirche in der nächsten Straße schlägt gerade sieben und Julius, Kallis Sohn, kommt nach Hause. Wie immer stellt er sich kurz in unseren Kreis, um danach, bevor er in seine Wohnung im vierten Stock geht, erst noch einmal kurz in der Druckerei seines Vaters vorbeizuschauen.
Doch heute sollte es anders enden als sonst. Als Julius die Türe des kleinen Betriebes öffnet, sieht er seinen Vater regungslos auf dem Boden liegen, direkt neben der alten Druckmaschine, die sich immer noch im Leerlauf dreht. Ein Blick genügt, um zu wissen, dass der Tod schon von vor ein paar Stunden gekommen war.
Julius kniet sich neben den Alten und nimmt seine Hand. Schweigsam und ganz ruhig streichelt er den kalten Handrücken des Toten, und seine Tränen rollen über sein junges Gesicht herab auf den Boden. Nach ein paar Minuten legt er den Arm seines Vaters behutsam auf dessen Bauch, steht auf und verlässt die Werkstatt. Kreidebleich kommt er auf uns zu, und wir wissen sofort, dass etwas Schreckliches passiert sein musste.
Wir haben Kalli tagsüber nie vermisst. Er war meist die ganze Zeit über allein in seiner Druckerei und stets beschäftigt. Mal hörten wir das Rumpeln seiner Druckmaschine, dann aber gab es wieder Tage, an denen nichts von ihm zu vernehmen war. Für uns war die heutige Stille um ihn also ganz normal. Kalli kam ja irgendwie immer wieder zum Vorschein, stellte sich noch einmal kurz zu uns oder wir hörten des Späteren seine Schritte auf der Treppe, wenn er hoch zu seiner Wohnung stieg. Marta kochte ab und zu für ihn, aber auch sie bekam ihn so manchen Tag überhaupt nicht zu Gesicht.
Jetzt stehen wir wie die begossenen Pudel in der Werkstatt, und unsere Bestürzung verschlägt uns allen die Sprache. Ruprecht ist der erste unter uns, der wieder klar bei Verstand ist. Er ruft den Rettungsdienst, obwohl wir doch alle wissen, dass hier keine Rettung mehr möglich ist. Julius hat sich derweil auf einen Stuhl neben seinen toten Vater gesetzt und blickt starr auf den Leichnam. Niemand spricht ein Wort, keiner wagt in diesem Moment einen Ton herauszubringen.
Wenige Minuten später leuchtet bereits das blinkende Blaulicht durch die Hofeinfahrt, und wir hören das Trampeln des herannahenden Rettungsteams. Der Notarzt schießt durch die Türe, schiebt uns unsanft beiseite, beugt sich über den alten Mann, tastet ihn ab, öffnet das Hemd und sucht nach einem vielleicht nur versteckten Herzschlag. Doch es dauert gerade ein paar Wimpernschläge, bis er sich zu uns umdreht und fast entschuldigend den Kopf schüttelt. Nach seiner Meinung sei der Mann bereits fünf oder sechs Stunden nicht mehr am Leben, und so, wie es für ihn aussähe, sei er einem Herzinfarkt erlegen. Mit einem kurzen, pragmatischen Nicken gibt er das Zeichen für den Abtransport.
Kalli heißt nicht wirklich Kalli. In seinem Ausweis steht Georg Leibnitz. Am Tage seines Todes ist er gerade 74 Jahre alt, ein Alter, das viele als zu jung zum Sterben bezeichnen. Wenn aber bedacht wird, dass er bereits im Alter von fünfzehn Jahren seinen ersten Lehrtag hatte und seither nie eine Pause gemacht hat, ist er schon ziemlich alt geworden.
Die Ironie des Schicksals hat ihn seinen letzten Atemzug dann auch noch dort machen lassen, wo er die letzten fünfzig Jahre seines Lebens geschuftet hat: in seiner kleinen Druckerei. Dort, wo er bis zuletzt versucht hat, sich gegen die moderne Welt zur Wehr zu setzen. Verdient hat er dabei kaum noch etwas. Schon lange nicht mehr.
Sein Betrieb umfasst gerade einmal hundert Quadratmeter. Mittendrin steht sein `Schätzchen´, eine alte Druckmaschine aus den sechziger Jahren. Alles, was er so für eine gute Arbeit braucht, hat er sorgsam geordnet in Regalen und Schubladen sortiert. Die alten Setzbuchstaben zum Beispiel, die vielen Stanzformen, Farben, Reinigungsmittel oder Öle, Ersatzteile und Schrauben, Werkzeuge, Pantonefächer, Messerklingen und seine vielen Aufzeichnungen. Sein, wie er ihn immer respektvoll nannte, `Drucksaal´, riecht nach Maschinenschmiere und Fetten, nach Lösungsmitteln und vor allem nach harter Arbeit.
Als Kalli seinen Betrieb hier eröffnete, auch viele Jahre danach, hatte er mehr als genug zu tun. Sein Einkommen deckte die laufenden Kosten ab, auch die Ausbildung seines Sohnes war gewährleistet. Nicht selten blieb auch mal etwas mehr übrig, das für ein gutes Leben und ein sicheres Auskommen seiner Familie reichte. Seine Hochzeitskarten waren hochbegehrt, denn sie stellten wahrlich kleine Kunstwerke dar, ebenso wie seine Geburts- oder Konfirmationsanzeigen. Mit Hingabe prägte er die erhabenen Schriften, silbernen Ornamente oder den goldenen Lorbeer zu Ehren des Jubilars oder zum Abschied von einem geliebten Menschen. Viel zu früh auch für seine eigene Frau.
Er druckte in jener Zeit Visitenkarten für die Herren Direktoren, Maler und Rechtsanwälte der Umgebung. Und das waren zu Beginn nicht gerade wenige hier in Hamburg-Altona. Er stellte Broschüren und Präsentationen für kleinere sowie auch ein paar große Firmen her, unzählige Werbeplakate, für den Metzger Czech, den Lebensmittelladen von Herrn Manzel, Frau Feddersens Heißmangel im Nebenhof oder für das Spielwarengeschäft „Röhr“ an der Ecke. Nach und nach aber mussten diese kleinen Läden aufgeben. Und mit ihrem Verschwinden ging das Geschäft von Kalli jedes Mal ein Stückchen mehr zurück.
Er galt nie als profaner Feld-Wald-und-Wiesendrucker. Vielmehr als Künstler, Improvisateur, Präzisionsfanatiker – vor allem als Purist. Seine größte Leidenschaft war die Kunst der schönen Schriften, die Kalligraphie. Diese brachte ihm frühzeitig seinen Spitznamen ein. Julius hat diese Passion ebenfalls im Blut und ist, genau wie sein Vater, vom Druckhandwerk in seinen Bann gezogen worden. Mittlerweile schon fast dreißig, hat er gerade sein Druckingenieursstudium beendet und seinen ersten Job in einem Großbetrieb angetreten.
Kalli gehört zu unserem Haus wie die Bank und die Pflastersteine im Hof. Als ich vor ein paar Jahren hier einzog, lebte und arbeitete er bereits fast fünfzig Jahre an diesem Ort, einem alten Mietblock aus den Dreißigern, typisch für seine Zeit in U-Form gebaut. Eine einstöckige Zeile schließt den Bau zu einem Rechteck. Ursprünglich war dieser Teil einmal als Stall gedacht, um irgendwann zu Garagen und wenig später zu einer kleinen Druckwerkstatt umgebaut zu werden.
Das Ganze gehört Willi. Inmitten des alten Teiles von Altona und nahe am Bahnhof gelegen, hat er es von seinem Großvater geerbt. Das ist nun aber auch schon viele Jahre her. Er ist seither Vermieter, Hausverwalter und Hausmeister in einer Person. Irgendwann war er in grauer Vorzeit Handwerker und wahrscheinlich trägt er deshalb mit besonderer Vorliebe dunkelrote oder blaue Overalls, in deren Latz er fast immer seine Hände versteckt. Diese Haltung signalisiert nicht nur Gelassenheit, sie hilft den bereits umfangreich gewachsenen Bauch etwas zu kaschieren. Seine O-Beine sind überdurchschnittlich ausgeprägt, wie er selbst sagt: Wohl etwas zu sehr über die Tonne gebügelt.
Willi hatte schon als Kind Bluthochdruck, und sein sichtbares Übergewicht wirkt dem nicht unbedingt entgegen. Ungeachtet seiner Figur ist er ständig dabei irgendetwas zu naschen. Am liebsten Lakritz. Seinen unbändigen Appetit an diesen Dingern konnten wir ihm auch dadurch nicht nehmen, indem wir ihm mit absolut ernsthafter Mine einmal erklärten, dass das Zeug aus Pferdeblut hergestellt wird. Er stopfte sofort ein paar Lakritzen nach, kaute genüsslich und begann mit verschmitztem Lächeln und einem Augenzwinkern, das Wiehern eines Gaules nachzuahmen. Das allerdings hörte sich eher nach einem durchgedrehten Zirkus-Pony an. Wir beschlossen daraufhin, ihm seine Leidenschaft nicht mehr weiter ausreden zu wollen.
Das Haus ist Willis Leben und einzige Einnahmequelle. Er hält alles so gut es geht in Schuss. Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger – wie er immer sagt. Dennoch bleiben die meisten Mieter nicht lange. Es gibt schönere Häuser, in besseren Gegenden Hamburgs. So stehen nun schon einige Wohnungen länger leer. Willi nimmt das mit einer für uns erstaunlichen Gelassenheit. Wie er einmal gesagt hat, kommen ihm nur die richtigen Mieter ins Haus. Da lässt er lieber die paar Einheiten unvermietet, als Rabauken ins Haus zu lassen. Uns ist es recht, und er wird wissen was er tut.
Während wir noch alle mit dem Schock zu kämpfen haben, ist es Willi, der Julius am Arm packt, sanft vom Stuhl hochzieht und sich anschickt, mit ihm die Werkstatt zu verlassen. Durch das Blaulicht alarmiert, ist auch Marta aus ihrer Wohnung von oben zu uns gerannt und hat die letzten Szenen schockiert und mit vorgehaltenen Händen auf ihrem Mund beobachtet. Dann hat sie Julius in den Arm genommen und ihn lange festgehalten. Sie ist die einzige Frau in unserem Kreise, unsere gute Fee. Sie gewinnt dann auch als nächste von uns ihre Fassung wieder. Während Willi mit Julius langsam in den Hof geht, begibt Marta sich wieder in ihre Wohnung, um uns allen einen Tee zu kochen. Und – es sollen ja tatsächlich noch Wunder geschehen – einen Kirsch habe sie auch noch im Schrank.
Wir anderen setzen uns langsam in Bewegung, um Willi und Julius zu folgen. Weiß wie Kalkeimer und mehläugig trotten wir prozessionsartig über den Hof und halten erst wieder vor der Bank, auf der wir gerade eben noch so unbekümmert gesessen haben. Der Eindruck, den wir in diesem Moment machen, ist wohl noch eine große Portion trauriger als er normalerweise ohnehin schon ist. Unsere kleine Gruppe besteht aus ein paar Menschen, die in diesem Haus entweder klebengeblieben sind, oder deren Schicksalswendungen einen besseren Ort nun nicht mehr zulassen. Vielleicht auch beides zusammen. Wir empfinden das mittlerweile aber gar nicht mehr als Drama, auch nicht als eine Art der Unzumutbarkeit. Obwohl wir alle zuvor schon deutlich bessere Gesichter des Lebens gesehen haben, entstand mit unserem hiesigen Einzug eine Art vollendete Kunstform, den vorerst letzten Schritt auf unserem Abstieg auf diese Weise zu meistern. Es ist die Kunst, sich in Zufriedenheit auf ein bisher als unerträglich angenommenes Minimum reduzieren zu können. Dabei ist zwischen uns nicht etwa eine lamentierende Leidensgenossenschaft entstanden, vielmehr eine Freundschaft, ein Zusammenhalt und ein Miteinander. Und das ist für uns alle in dieser Güte etwas völlig Neues, bisher Nichtgekanntes.
Marta, aber auch Kalli, wohnen schon viel länger als der Rest von uns in diesem Haus. Marta ist für uns alle hier eine Mischung aus guter Freundin, älterer Schwester, manchmal auch Mutter. Ihre Mitte siebzig sieht man ihr nicht wirklich an, denn sie hat noch ein sehr glattes Gesicht und schöne volle Haare, die sie stets ein wenig blond hält. Sie ist zwar Klavierlehrerin, doch mit ihren meist hochgeschlossenen Kleidern, hellen Spitzenkragen und ungalanten Schnallenschuhen könnte sie sich genauso gut der deutschen Grammatik verschrieben haben. Sie lebt uns Tugendhaftigkeit vor, und so manche unserer Launen und Eigenarten, Laster und Gewohnheiten treffen bei ihr auf Missfallen, welches sie prompt und unermüdlich mit fürsorglichen Predigten und Apellen unverblümt mitteilt.
Sie hat von ihrem Mann eine kleine Rente, die sie über Wasser hält. Zusammen mit den Einnahmen aus ihren Klavierstunden ist sie unter uns so etwas wie der Krösus. Die Zahl ihrer Schüler sinkt zwar rapide, doch es bleiben immer noch ein paar Eltern, die ihren Kindern ein wenig Kultur vermitteln lassen. Mozart, Beethoven und Chopin allerdings drehen sich bei den gehackten Etüden der Probanden regelmäßig in ihren Gräbern herum. Auch nicht gerade ein schönes Dasein, wie ich finde. Und wir, als die gequälten Zwangszuhörer, werden dann immer einmal wieder dadurch entlohnt, dass uns Marta persönlich ihre hohe Kunst beweist.
Ihre Finger sind, trotz ihres Alters, geschmeidig und flink, absolut sicher und mit einem verzaubernden Anschlag gesegnet. Unter uns ist sie die ruhende Kraft und sorgt für Ausgleich und Gelassenheit. Als Katholikin geht sie uns zwar des Öfteren mit wiederholten Ermahnungen und Zurechtweisungen in Bezug auf unser in ihren Augen allzu loses und manchmal sogar sündhaftes Leben auf die Nerven, aber im Herzen liebt sie uns alle, so wie wir sind und meint es nur gut, denn sie sorgt sich schließlich um unser Seelenheil.
Während in der Druckwerkstatt noch das Licht brennt und sich der gelbliche Schein kegelförmig über den Hof ergießt, sitzen wir in dieser lauen Juninacht zum zweiten Mal auf unserer Bank, der Rest steht abermals im Halbkreis um die Sitzenden herum. Wir trinken Martas Früchtetee, aber dieser ist für uns eigentlich mehr ein Alibi. Unsere Aufmerksamkeit gehört eindeutig der Flasche Kirschwasser, die wir, so gerecht wie es zwischen routinierten Schlitzohren eben geht, in unsere Teegläser verteilen. Nur Willi hat erst einmal einen großen Schluck direkt aus der Flasche genommen, als diese unter kaum merklich angehobenen Augenbrauen von Marta in unsere Verfügung übergeht. Der Alkohol belebt schnell unsere Gemüter und erzeugt eine warme Ausstrahlung in unserer Bauchgegend, die die dumpfe Leere in unseren Köpfen wohltuend überstrahlen lässt.
Wir sprechen nicht viel, und wenn einer etwas sagt, dreht es sich um die Unvorhersehbarkeit des Todes, und dass wir Julius jetzt trösten und auffangen müssen. Der Junge sitzt inmitten von uns und starrt mit geröteten Augen in den Himmel über unserem Hof. Wir sorgen dafür, dass er nochmals einen guten Schluck mehr erhält, denn wir erhoffen uns damit eine schnellere Bettreife unseres Schützlings.
Marta schaut immer wieder in die Runde, sieht mich an, Willi, Ruprecht, Fritz und Fredo. Ihr Blick ist so tief traurig, dass es mir den Hals zuschnürt. Gleichfalls aber habe ich für eine kleine Sekunde das Gefühl, sie schaue uns an, sich fragend, ob einer von uns vielleicht der nächste sei.
Da ist unser Ruprecht, mit vollem Namen: Dr. Ruprecht Scholz. Äußerlich passt er eigentlich gar nicht so recht zu uns, denn er bevorzugt bis heute, seine Anzüge aus besseren Zeiten aufzutragen. Damit wirkt er stets ein wenig `overdressed´. Bei näherer Betrachtung stellt man allerdings fest, dass selbst ein klassischer Stil irgendwann einmal aus der Mode kommt, der Stoff an den besonders beanspruchten Stellen sichtbar dünner wird und seinem Träger dann ein etwas ärmliches Aussehen verleiht. Ruprecht ignoriert das jedoch. Wichtiger für ihn ist es, sich von der Allgemeinheit abzuheben. Ihn einmal ohne eine Krawatte zu ertappen, gehört zu den seltenen Momenten und kann deshalb an einer Hand abgezählt werden. Seine bis heute hagere, dünne Figur lässt ihn mit seiner Größe von fast zwei Metern noch schlaksiger wirken als er ohnehin ist, und stehen wir im Kreise zusammen, ragt sein Kopf wie der Hamburger Michel aus unserer Mitte hervor.
Ruprecht ist eigentlich Rechtsanwalt, einst einmal mit einer gutgehenden Kanzlei. Doch diese hat er nicht mehr. Mit seinen sechzig Jahren wäre er zwar noch lange nicht zu alt um zu arbeiten, doch er hat vor einigen Jahren seine Gerichtszulassung verloren. Schuldlos, wie er stets beteuerte, reingelegt. Sein Sozius zog noch am gleichen Tage Ruprechts Geschäftsanteile ein, ließ ihn seine persönlichen Sachen in einen leeren Gerichtsaktenkarton packen und warf ihn kurzerhand aus der Kanzlei. Seit diesem Moment ist Ruprecht mittellos. Zwar besaß er damals noch ein schönes Haus in bester Gegend, eine hübsche Lebensversicherung und ein paar gut entwickelte Wertpapierfonds. All das aber hatte er, wie man das für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle ja so macht, seiner lieben Frau übertragen. Diese riet ihm sodann fürsorglich und sportlich zu einem totalen Neuanfang. Und zwar ohne sie. Sie selbst wollte natürlich nicht noch einmal neu anfangen und behielt was ihr gehörte. Das war der Moment, als Ruprecht von Sozialhilfe zu leben begann und in dieses Haus zog.
Damit passt er allerdings wieder ganz vortrefflich hierher. Allein schon deshalb, weil er ein direktes Schicksals-Pendant unter uns hat: Fritz Musiol, Diplomkaufmann und ehemaliger Immobilienmakler. Im Gegensatz zu Ruprecht ist Fritz unser `kleiner Dicker´. Er steht auf dem Standpunkt, dass niemand ein Six-Pack braucht, wenn ein ganzes Fass zur Verfügung steht. Die Gürtel seiner Hosen schnüren diese auf eine Art fest, die seinen Altherrenbauch von unten her wie einen mit Wasser gefüllten übergroßen Luftballon herausquellen lassen. Auf der Herrentoilette ist er deshalb allein auf seinen Tastsinn angewiesen.
Fritz neigt zudem zur Körpernässe und führt aus diesem Grunde immer mindestens ein größeres Stofftaschentuch mit sich. Da für ihn selbst bereits die Überwindung der ersten Hausetage eine sportliche Herausforderung darstellt, beginnt er sich schon nach wenigen Stufen die Stirn zu tupfen. Vor seiner Wohnungstüre sind dann Hals und Nacken dran. Figürlich ist Fritz somit am ehesten den Wirtschaftswunderzeiten der fünfziger Jahre zuzuordnen, was auch mit seiner eigentlichen Profession einhergehen könnte. Direkt nach seinem Studium wurde er nämlich Gewerbemakler in dieser schönen Hansestadt, in der so viel gebaut wird.
Sein Erfolg war dann auch buchstäblich. Mitglied in den vornehmsten, und verbindungsreichsten Clubs der Stadt, beste Beziehungen zu Staatsräten und Regierungsdirektoren. Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen der besseren Gesellschaft Hamburgs. Er häufte Millionen an. Diese allerdings verpufften bei einer Fehlspekulation in Dubai. Er verlor alles und musste Insolvenz anmelden. Dass er nicht ins Gefängnis gehen musste, konnte er befreundeten Spitzenanwälten, vor allem aber seinem Schwarzgeldkonto in der Schweiz verdanken. Er machte rechtzeitig eine Selbstanzeige und bezahlte alle Steuerschulden, seine Anwälte sowie das Minus aus seiner Fehlinvestition. Übrig blieb nichts. Somit auch keine Freunde. Mit dem besten von ihnen zog seine Ehefrau kurzerhand nach Mallorca, unmittelbar, nachdem sie das spärliche Restguthaben des gemeinsamen Privatkontos noch geleert und dieses bis zur maximalen Kreditlinie belastet hatte. Während er jetzt von der Grundsicherung lebt, verkauft sie nun als Maklerin Villen und Grundstücke auf den Balearen. Man muss den Hut ziehen.
Wie in den meisten Gemeinschaften gibt es auch bei uns einen Draufgänger, der sich seiner Rolle mit Hingabe verschrieben hat. Bei uns ist das Fredo, in dessen Geburtsurkunde `Friedrich Dominik Weitzmann´ steht. Fredo ist vierundzwanzig Stunden durchgängig gut aufgelegt, hat immer einen passenden Spruch parat, und das, was in der Fauna allgemein als instinktive Scheu bezeichnet wird, ist ihm so fern wie einem Inuit das Kokosnussöffnen. Er ist groß, kräftig und könnte es jederzeit mit einem Profiringer aufnehmen. Sein weißer Vollbart gleicht seinen mittlerweile fast kahlen Schädel mit vollendender Symmetrie aus. Fredo strahlt eine Art selbstverständliche Autorität aus, der man sich fast automatisch unterstellen möchte. Auch vermittelt er mit allen Gebärden eine ruhige Sicherheit, und man fühlt sich in seiner Gesellschaft fast ein wenig geborgen. Doch wenn Fredo einmal ärgerlich wird, dann rette sich wer kann.
Er wurde von seinem Vater bereits mit vierzehn als Schiffsjunge zu einer Hamburger Reederei gebracht, wo ein Bananendampfer auf ihn wartete. Mit sechsundzwanzig wurde er Schiffsoffizier und mit vierunddreißig Kapitän auf einem Containerschiff. Beim `Heiteren Berufe-Raten´ bräuchte Fredo erst gar nicht anzutreten. Sein Gang, seine Stimme und seine Sprache entlarven ihn bereits nach wenigen Sekunden. Ein Mannsbild sondergleichen, mit wuchtigem Auftritt und keckem Augenzwinkern, das besonders bei den Mädchen in den Häfen der nahen und fernen Länder Aufmerksamkeit erregt haben wird.
Irgendwann braucht aber auch der noch so sprunghafteste Seemann einen festen Hafen und Fredo heiratete. Während er auf den Weltmeeren unterwegs war, wartete sie all die Monate sehnsüchtig auf ihn. Ihre Sehnsucht war so groß, dass sie sich mit einem Pizza-Lieferanten tröstete. Aufgrund der vielen neuen Lieferservices zog es Fredo vor, hiernach nicht noch einmal zu heiraten und verschrieb sich nun ganz der Seefahrt. Er fuhr unter griechischer Flagge an die dreißig Jahre, und es gibt kaum ein Land, das er nicht gesehen hat. Mit der Wirtschafts- und Bankenkrise ging auch seine Reederei Konkurs. Seine Betriebsrente und Altersversorgung hatte sich damit gleichermaßen in Rauch aufgelöst. Und weiterfahren lassen sie ihn nicht mehr. Zu oft hat er dafür seinen Kummer ertränkt. Sein Patent hat sich seiner Rente angeschlossen – und somit nur noch Erinnerungswert.
Genau genommen sind die meisten von uns Verlierer. Jeder hat dafür so seine eigene Geschichte, Interpretation und Rechtfertigung. Tatsache aber ist, dass wir wohl eindeutig zur Gruppe der Gestrandeten gehören, allesamt kaum in der Lage, uns über Wasser zu halten. Unser Haus scheint das irgendwie anzuziehen. Ich selbst wohne hier nun fast fünf Jahre. Die Wohnung, wenn man 34 Quadratmeter als eine solche bezeichnen kann, hat mir zwar nicht gefallen, es blieb jedoch kein anderer Ausweg. Heute bin ich froh, hier gelandet zu sein.
Die Dynamik meines Lebens ist am ehesten mit der einer Wanderdüne zu vergleichen. Etwas Spektakuläres sucht man bei mir vergebens. Ich begann früh ein Praktikum bei einem Wochenblatt und verkaufte Kleinanzeigen. Als der Verlagsinhaber nach einer Alkoholfahrt für einige Wochen im Krankenhaus lag, schrieb ich versuchsweise einige Artikel. Es war ja kein anderer da. Erstaunlicherweise kam es so plötzlich bei diesem Blättchen zu ersten wohlgemeinten Leserbriefen. Als ich dann wieder Anzeigen verkaufen sollte, erhielt ich einen Anruf von einer richtigen, großen Zeitung. Es wäre dort eine Volontärs-Stelle frei und ich sollte doch mal vorbeikommen. Kurz darauf begann ich in der Redaktion `Lokales´.
Dort blieb ich, bis zu der ersten Welle der Massenentlassungen in der Zeitungswirtschaft. Da war ich fast Mitte Fünfzig. Nach der vierhundertsten Bewerbung gab ich schließlich die Hoffnung auf, irgendwie weiter als Journalist arbeiten zu können. Meine kleine Abfindung habe ich als Langzeitarbeitsloser längst aufgezehrt. Deshalb verbessere ich seit einiger Zeit meine Sozialhilfe durch Zeitarbeitseinsätze als Aushilfsarbeiter. Da ich als ungelernt gelte, liegt mein Lohn in der Größenordnung, die andernorts am Sonntag im Klingelbeutel landet. Das Schreiben lasse ich zwar nicht ganz sein, doch es ist eher für mich selbst, für mein Selbstwertempfinden, und manchmal sende ich tatsächlich auch etwas ein.
Eine schöne Truppe also, die sich hier hat ans Ufer treiben lassen. Es gibt sicher illustre Gesellschaften. Doch vielleicht ist es gerade diese Mischung, die all das, was noch geschehen sollte, erst zustande kommen ließ. Heute jedenfalls denke ich, dass es anders nie geklappt hätte. Wenn wir zu diesem Zeitpunkt geahnt hätten, was alles auf uns zukommen würde, hätten wir womöglich anders entschieden. Aber hätten wir wirklich?
Julius ist inzwischen alkoholgeschwängert eingeschlafen, und sein Kopf liegt auf Martas rechter Schulter. Gut so, denn die nächsten Tage würden bestimmt kein Zuckerlecken für ihn werden. Unter bösen Blicken von Marta zünden wir Raucher uns noch eine Zigarette an und reichen den Rest Kirschwasser herum. Es ist noch einmal stiller unter uns geworden. Der klare Himmel zeigt seine Sterne, und die, die wir durch den Schacht des Innenhofes sehen können, funkeln als wäre nichts geschehen. Ich ertappe mich dabei, eine Sternschnuppe zu erhoffen. Ich weiß, was ich mir jetzt wünschen würde. Doch an diesem Abend soll ich einfach keine sehen.
Es kommt jemand durch den Hofeingang. Wir sehen, dass es Sharif ist, neben Julius der andere Jungbewohner in unserer Gemeinschaft. Wenn wir ihn ärgern wollen, nennen wir ihn kurz „Shah“. Er betont dann immer gleich, dass er Syrer und nicht Perser sei. Wir finden das zwar nicht unbedingt so weltentscheidend, aber er besteht nun einmal darauf. Mit seinem unübersehbaren orientalischen Äußeren sowie seinem Akzent könnte er ebenso gut aus dem Irak, dem Libanon oder der Türkei stammen. Sein Herz brennt natürlich für seine Heimat, eine Region, die wir vor seinem Einzug in unser Haus lediglich als eine der vielen totalitären Regime-Staaten und, seit dem arabischen Frühling in jüngster Zeit, als eines der Krisengebiete des Nahen Ostens kennen.
Sharif al-Basir ist so alt wie Julius. Seine schwarzen Haare sind enorm lockig, und Marta sagt immer, dass er als Baby wohl ausgesehen haben müsste wie der Botticelli-Engel eines Kalifen. Sharif studiert Maschinenbautechnik und will als Ingenieur irgendwann einmal zurück in seine Heimat, um dort sein Land aufzubauen. Marta hatte anfänglich den Kontakt zu ihm gescheut, als sie aber erfuhr, dass er zur christlichen Minderheit gehört, war sie beruhigt. Einen Moslem zwei Etagen höher zu wissen, wäre ihr irgendwie nicht geheuer gewesen.
Als wir ihm vom Tod Kallis erzählen, steht Sharif die pure Fassungslosigkeit in den Augen. Er ist noch nicht sehr lange bei uns, aber sein herzliches Wesen, seine Klugheit und seine Hilfsbereitschaft haben ihn schnell einen von uns werden lassen. Julius und er ziehen ab und zu gemeinsam um die Häuser, und die beiden verbindet inzwischen eine echte Freundschaft. Denn beide sind gleichermaßen intelligent, talentiert und mit Erfolg bei der Sache.
Julius kam in diesem Haus zur Welt, und seine Mutter starb noch in derselben Nacht. Er wuchs mithilfe der Nachbarsmütter und natürlich mit Martas Hilfe auf. Seinen Vater liebte er über alles und war deshalb durch nichts zu bewegen, unsere Wohngemeinschaft zu verlassen und in eine schönere Wohnung und Gegend zu ziehen. Wie oft haben wir ihm aber genau das angeraten, da er hierher ja auch kaum ein vernünftiges Mädel bringen kann. Erst Recht nicht, wenn es was Ernstes werden sollte. Sich mit diesem Haus und dazu vielleicht noch uns anfreunden zu können, dafür muss man schon einiges verkraften. Er ist aber bis heute geblieben und sorgt immer wieder dafür, dass auch mal wieder das Licht des normalen Lebens zu uns vordringt.
Nach und nach löst sich unsere Gruppe auf. Ich gehe als Letzter, reichlich alkoholgeschwängert, ins Bett, und mein Schlaf ist schwer und traumlos. Die sich anschließenden Tage vergehen wie im Fluge. Die Trauer um unseren Freund hält uns voll und ganz im Würgegriff. Wir treffen alle Vorbereitungen für Kallis Beerdigung und staunen nicht schlecht, was es alles zu organisieren und zu bedenken gibt.
Nach noch nicht einmal einer Woche haben wir uns auf dem Altonaer-Hauptfriedhof zusammengefunden, stehen als sehr kleine Trauergemeinschaft um das Grab und übergeben Kallis Asche der bereitwillig wartenden Erde. Ebenso schmucklos wie er sein Leben geführt hat, verläuft seine letzte Zeremonie. Wir können uns eben nicht viel leisten. Und zu allem Übel beginnt es dann auch noch zu regnen. Wir werfen jeder eine Schippe des nun schon nassen Sandes auf die Urne, verharren ein paar Augenblicke des Gedenkens an unseren Freund und Wegbegleiter und reichen die Schaufel an den nächsten. Als wir gehen, drehe ich mich nach wenigen Schritten noch einmal um. Marta hat noch ein paar Blumen auf das frische Grab gelegt. Es sieht fast so aus, als hätte diese dort jemand vergessen.
Ich habe mich seither oft gefragt, ob Kalli wohl schon wusste, was wir in den wenigen Tagen und Wochen hiernach erleben würden. Ob er sich vielleicht sogar gefreut hat, ob er zufrieden war, dass wir uns so entschieden haben wie wir es taten. Zugesehen haben wird er uns in jedem Fall. Da bin ich mir sicher.
Kapitel 2
Im Treppenhaus höre ich Schritte, die vor meiner Türe verhallen. Es folgt ein leises Klopfen. Ich höre Willis Stimme:
„Bist Du schon wach…?“
Er klopft erneut. Als ich die Tür öffne, drängelt er auch schon an mir vorbei und geht schnurstracks in mein Wohnzimmer.
Ich denke mir nichts Böses. „Darf ich Dir einen Kaffee anbieten?“, frage ich leicht ironisch. „Die frischen Brötchen und die Marmelade kannst Du gleich in die Küche bringen.“
„Die Armentafel ist zwei Straßen rechts“, kontert Willi und lässt sich schlaff in meinen alten Ohrensessel fallen. Ich muss lächeln, typisch Willi. In meiner kleinen Küche stelle ich die Kaffeemaschine an und sehe durch die geöffnete Türe, wie mein Besucher eine Zigarettenschachtel hervorholt und sich eine anzündet. Er macht ein sorgenvolles Gesicht und ruft mir ohne weitere Umschweife zu:
„Wir müssen dem Jungen helfen.“
Ich reiche Willi die Tasse. „Ich habe übrigens nur noch zwei Kaffee-Pads. Nur für den Fall, dass Du Dich hier häuslich niederlassen möchtest. Und Lakritz habe ich auch keine.“
Willi überhört das wie immer und nippt an seinem Becher. „Die Haushaltsauflösung, der Betrieb. Und womöglich wird er mit der Bank Schwierigkeiten bekommen“, sagt er bedenklich und nippt erneut.
„Beim Aufräumen kann ich helfen. Mit Banken kenne ich mich nicht aus. Aber was ist denn da problematisch?“, antworte ich und hoffe, dass meine Besorgnis unbegründet ist.
„Der Kleine soll das Erbe bloß nicht annehmen.“ Willi scheint mehr zu wissen.
„Erbe? Was für ein Erbe denn?“, frage ich erstaunt.
„Eben nichts, sogar weniger als nichts, wenn Du verstehst.“ Willi wird etwas lauter.
Ich verstehe aber eben nicht und warte gespannt auf die Auflösung. Willi scheint genervt zu sein. „Ein Millionär wie Du wird es kaum nachvollziehen können, aber Kalli hat nur Schulden hinterlassen.“
„Und Du weißt davon?“ Ich schaue ihm direkt in die Augen und mir schwant jetzt immer weniger Gutes.
„Schließlich war ich sein Vermieter.“ Willi ist wirklich überzeugt, dass sein Metier das rechtfertigt.
Er erzählt, dass der alte Drucker schon seit langer Zeit mehr oder weniger pleite war. Ohne Altersversorgung war er gezwungen, einfach immer weiter zu machen, bis er umfallen würde. Das sei ja nun auch geschehen. Was von seiner Hände Arbeit irgendwann einmal übrig war, sei in die Ausbildung von Julius geflossen. Die Aufträge seien ausgeblieben und die wenigen Arbeiten, die er noch gemacht hat, hätten so gut wie nichts mehr eingebracht. Gereicht hatte es schon lange nicht mehr.
Willi selbst habe dann zuerst auf die Gewerbemiete, irgendwann dann auch auf die Wohnungsmiete verzichtet. Kalli hatte immer versprochen, er würde es einmal zurückzahlen. Willi habe zuletzt sogar die Kosten für Strom, Gas und Wasser übernommen, sonst wäre Kalli regelrecht auch das Licht abgedreht worden. Willi musste ihm versprechen, niemandem etwas davon zu erzählen, erst Recht nicht seinem Sohn. Er hätte sich zu sehr dafür geschämt.
„Dann müssen wir Ruprecht zu Rate ziehen. Der alte Paragraphenfuchs wird wissen, was zu tun ist.“ Ich wende mich zur Türe. Aber da klingelt mein Telefon. Ich greife den Hörer, kritzle mir eine kurze Notiz auf einen Zettel und lege kurz darauf wieder auf.
„Willi, so wie es aussieht, muss ich arbeiten. Ich lege das jetzt in Deine Hände. Geh zu Ruprecht und kläre das. Wir sehen uns heute Abend.“ Heute wartet wieder die Papierfabrik auf meine Arbeitskraft. Ich mache mich deshalb schnell fertig und verschwinde in Eile, zuvor aber packe ich noch meine Arbeitskleidung ein, denn es wird sicher wieder schmutzig werden.
Als ich am Abend nach Hause komme, habe ich den Körpergeruch eines Iltis angenommen. Diese Papierfabrik ist ein Moloch, und es riecht dort, als wären überall Stinkbomben geplatzt. Der Geruch klebt einem förmlich in den Schleimhäuten und erinnert noch nach Stunden daran, dass man ein klägliches Leben führt. An meiner Wohnungstüre finde ich einen Zettel von Marta: `19 Uhr Essen´. Eine solche Aufforderung darf man bei Marta nicht unbeachtet lassen, und man muss pünktlich sein.
Ich habe gerade noch Zeit für die Dusche. Da alle pünktlich sein möchten, treffen wir uns auch genau um sieben vor Martas Wohnung. Obwohl wir noch gar nicht geklingelt haben, öffnet sie uns und bittet mit einer gekonnten Handgeste zum Eintritt. Marta hat ein blaues Kleid angezogen, das am Hals von einem kleinen, unauffälligen weißen Kragen abgeschlossen wird. Ihre Lesebrille trägt sie auf der Nase, und es kommt uns ein angenehmer Duft nach Frikadellen, Gurken und Dill entgegen.
Wir haben etwas Mühe, allesamt Platz an ihrem Esstisch zu finden. Da sind Willi, Fredo, Fritz und auch Julius. Es klingelt, und nach wenigen Sekunden ist – ein wenig außer Atem – auch Sharif al-Basir da. Unter dem Arm hat er drei gekühlte Flaschen Riesling. Ein wahrer Schatz der Bursche, denn Marta hat in gewohnter Weise nur Wassergläser auf den Tisch gestellt. Als sie die Flaschen bemerkt, leuchtet kurz ihr Gesicht, dann aber schüttelt sie den Kopf: einen Korkenzieher besäße sie nicht. Der Wein müsse deshalb wohl warten – oder besser, ein anderes Mal getrunken werden. Doch Sharif grinst unverhohlen und zieht einen Öffner aus der Hosentasche. Auch Marta muss jetzt schmunzeln. Was soll´s. Und außerdem hat Sharif so tolle Grübchen, wenn er lacht.
Julius war heute einige Zeit in der Druckwerkstatt. Er saß dort lange schweigend, im stillen Gedenken an seinen Vater. Manchmal hat er sogar gelächelt, dann, als er die akkurate Ordnung in den Regalen und die sorgfältig aufgereihten Werkzeuge betrachtete. Liebevoll und mit größter Genauigkeit hatte sein Vater alte Schriftzeichen sortiert, Stanzplatten beschriftet und nummeriert. Auf einigen las Julius die Kundennamen aus längst vergangenen Zeiten. Er fand Ordner mit alten Visitenkarten, fast feierlich abgelegt die Broschüre eines Autohandels. Sie stammt von 1969 – dem Jahr der Mondlandung. Während er sich das alles noch einmal in Ruhe betrachtete, wurde ihm abermals klar, dass niemand so einen Kleinbetrieb übernehmen und fortführen würde. Gerade Julius wusste das. Was bliebe wäre wohl wirklich nur Alteisen, und vielleicht fände sich ein Sammler für die Maschinenteile. Nicht viel für ein ganzes Leben.
Wir essen, ohne viel zu reden. Der Riesling ist schnell geleert, und ich hole die Kiste Weizenbier, die bei mir in der Küche steht. Martas Blick spricht Bände. Doch wie immer wird diesem gekonnt begegnet.
„Intelligenz säuft, Dummheit frisst!“, verteidige ich uns, und Ruprecht schaut sofort zu Willi, der sich daraufhin spontan und lauthals beschwert.
„Was willst Du denn damit sagen?“, ruft er mir zu.
„Beruhige Dich wieder“, werfe ich Willi zu. „Du säufst doch selbst. Damit ist doch alles geklärt.“
Willi murmelt noch etwas halblaut in die Runde. Dann gibt er auf.
Julius fasst sich in die Hosentasche und holt einen mittlerweile schon etwas zerknüllten Brief hervor.
„Von der Sparkasse“, sagt er und blickt uns nacheinander an. Wir hören spontan auf zu albern und warten auf seine Auflösung.
„Es sind über sechzigtausend Euro Schulden auf dem Konto meines Vaters. Und jetzt wollen sie das Geld, von mir.“ Julius war nun fast völlig in sich gesackt.
„Moment, Moment!“, ruft Ruprecht. „Du brauchst das Erbe nicht anzutreten. Ich kann dir dabei…“
„Habe ich aber schon“, unterbricht ihn Julius. „Ich kann meinen Vater doch nicht als Kreditschuldner dastehen lassen!“
„Julius!“ Marta ist aufgesprungen. „Glaubst Du denn, Dein Vater hätte das so gewollt? Dich so zu belasten? Gibt es denn keine andere Möglichkeit?“
„Hast Du etwas unterschrieben?“ Ruprecht schaut Julius argwöhnisch an. Und dieser nickt. „Da gibt es kein Ausweichen mehr, wie ich denke“, stellt Ruprecht fest, tupft sich mit der Serviette die Mundwinkel ab und atmet tief durch. „Schöner Mist!“
Ich greife mir den Brief der Bank und lese ihn durch. Als ich fertig bin frage ich Julius: „Kannst Du das Geld überhaupt aufbringen?“
„Derzeit nicht. Ich habe aber schon mit der Bank gesprochen, und die haben mir gesagt, dass ich einen Kreditantrag stellen soll. Sie würden mir auch einen günstigen Zinssatz einräumen. Ich soll dafür eine Gehaltsabtretung unterzeichnen und eine Lebensversicherung abschließen.“
„Wir werden das anfechten…“ Ruprecht hebt seinen Finger und wedelt mit diesem drohend in der Luft. „So leicht geht das alles nicht.“
„Ich habe noch zweitausendfünfhundert Euro als Notgroschen auf meinem Sparbuch. Die kannst Du haben.“ Marta steht auf und will an ihre Kommode gehen.
„Selbst wenn wir alle unsere Konten plündern, ich meine, was es da noch zu plündern gibt, dann reicht das doch nie für eine Auslösung von Julius – oder?“ Ich hoffe, dass jetzt einer aufspringt und mir widerspricht. Aber es bleibt still.
„Dass es so viel ist, hatte ich nicht gedacht…“ Julius wird immer leiser.
Fredo sieht Willi an, so dringlich, dass wir alle ganz gespannt sind, was jetzt kommen mag. Willi hat gerade seinen letzten Bissen im Mund und schaut über den Tisch, ob nicht noch ein Restchen übrig ist, dessen er sich erbarmen sollte. Als er merkt, dass wir ihn alle ansehen, fragt er kurz und rollt dabei fast mit den Augen:
„Was… ?!“
Und als wir nicht antworten: „Leute, was denn? Was wollt ihr?“
„Wieviel ist dieser ganze Schuppen wert, Willi?“ Fredo hat eine klare Frage formuliert, deren Antwort wir gespannt erwarten.
„Vergesst es, Freunde.“ Willi winkt ab. „Ich habe über die Jahre so viele Hypotheken aufgenommen, da ist keine Luft mehr. Im Gegenteil. Dieselbe Bank hat mich gerade aufgefordert, eine zusätzliche Sicherheit zu bringen. So sieht`s aus. Leere Kassen, hoch die Tassen. Reich mir doch noch mal eine Flasche von dem Weizenbier herüber – vielen Dank!“
Ich bin völlig erschüttert. „Ja, aber Deine Mieteinnahmen und so…!“
„Schaut Euch mal den Leerstand bei mir an. Müsste modernisieren. Dann könnte ich sicher die Mieten vervierfachen. Ihr seid dann alle draußen. Und? Was wäre dann mit uns?“ Willi trinkt einen Schluck.
„Ein Altruist!“, ruft Ruprecht kopfschüttelnd. „Ja, gibt`s denn noch so was?“
Wir sitzen ernüchtert in der Runde und sind sprachlos. Selbst Fredo bringt keinen Mucks mehr heraus.
„Irgendwas wird uns einfallen!“, ruft er dann aber nach einigen Minuten. „Erst einmal stellen wir die ganze Bude auf den Kopf und den Schuppen im Hof und suchen nach Verwertbarem. Vielleicht hat Kalli ja irgendwo…“
„Ihr werdet nichts finden“, entgegnet Julius frustriert. „Aber tut Euch keinen Zwang an.“
„Man soll nichts unversucht lassen.“ Marta ist jetzt bestimmend, steht auf und geht zu ihrem Klavier. Es soll nun auch niemand widersprechen, und so lenkt sie vom Thema ab, indem sie den Klavierdeckel öffnet und sich kurz konzentriert. Insgeheim haben wir in diesem Moment alle gehofft, dass sie es tun würde. Marta beginnt. Sie spielt Händel, Mozart und Schubert mit einer solchen Hingabe und Virtuosität, dass es uns den Atem verschlägt. Willi heult auf Anhieb wie ein Schlosshund und verschluckt sich mehrfach an seinen Lakritzen.
Fredo applaudiert immer wieder, obwohl das jeweilige Stück noch gar nicht zu Ende ist. Aber wir sind ihm nicht böse.
„Auf See hat er wenig Kultur entwickeln können“, neckt ihn Ruprecht.
Marta wechselt das Genre und lässt Dixie und Oldtime erklingen. Sie greift in die Tasten und spielt als wäre sie inmitten von St. Louis der zwanziger Jahre. Willi klatscht den Takt als ginge es um sein Leben. Der Boden bebt unter unseren Füßen, und wir freuen uns, dass der Vermieter sich nicht beschweren kann, er sitzt schließlich inmitten unserer Gemeinschaft. Und außerdem sind fast alle Bewohner dieses Hauses hier gerade versammelt.
Julius und Sharif sind indes kurz nacheinander gegangen. Wir hatten so viel Spaß, dass wir nicht einmal bemerkt haben, dass sie fort waren. Ich schäme mich und verabschiede mich aus unserer Runde. Morgen früh wollen wir loslegen, und das kann ein langer Tag werden. Vor dem Zubettgehen stelle ich mich noch kurz ans Küchenfenster, um eine letzte Zigarette zu rauchen. Ich sehe in den Hof hinab und erblicke nun wieder Sharif. Er schaut nach oben zu mir und ich gebe Zeichen, dass ich noch einmal kurz zu ihm herunterkomme.
„So schnell geht das alles“, beginnt der junge Syrer nachdenklich. „Gestern war Kalli noch da, jetzt ist seine Asche schon in der Erde. Der Tod ist jedes Mal etwas Niederschmetterndes, findest Du nicht auch?“
Ich sehe Sharif an: „Er begleitet uns sekündlich. Vom ersten Moment unseres Lebens an. Eigentlich verwunderlich, dass er einen immer wieder überrascht.“
Sharifs Blick ist leer, und er scheint gerade nicht wirklich auf etwas zu schauen:
„Andernorts sterben täglich Menschen. Niemand ist dort mehr überrascht. Das Sterben ist dafür viel zu sehr Alltag geworden, gefühllose Routine. Doch man stirbt dort nicht in Frieden, es ereilt die Menschen kein natürlicher Tod. Sie werden ermordet, nachdem sie verfolgt und gequält, vergewaltigt und gefoltert wurden. Diese Toten besingt man anders. Der Herztod eines alten Mannes tut weh, weil ein Teil von Dir nach einem langen Leben gegangen ist. Aber ermordete Brüder und Schwestern, Väter und Mütter, denen niemand hilft, während sie von fanatischen Mörderhorden dahingeschlachtet werden? Das reißt Dir Dein Herz heraus, Deine Gedärme. Dein Verstand wird Dir geraubt. Und Du möchtest am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Erst Recht, wenn Du nicht helfen kannst, weil Dich tausende Kilometer trennen.“ Sharif laufen Tränen über sein junges Gesicht, und seine Verzweiflung ist unübersehbar.
Ich will meinen Arm über seine Schulter legen und etwas Sinnreiches antworten, doch er steht auf und wendet sich zum Gehen.
„Niemand hier hat auch nur die geringste Ahnung, was in meinem Land gerade passiert“, ruft er. „Und meine Familie, meine Freunde – alle sind wir Christen, haben nie jemandem etwas getan. Die Welt sitzt derweil am Fernseher und schaut in den Nachrichten, wie die schwarzen Flaggen wehen. Dann kommt ein wenig Mitleid auf. Und die Politiker? Sie verstecken sich hinter ein paar Hilfsgeldern, hinter Verhandlungen mit Schurken, die die Schurken von gestern nur abgelöst haben. Und das Abschlachten ganzer Völker geht unbeirrt weiter.“
Ich sehe ihn an. So hatte ich ihn bisher noch nicht erlebt. Leidenschaftlich, zugleich voller Angst. Und er hat Recht. Ich kann ihm das nicht in Abrede stellen, und ich fühle mich plötzlich völlig hilflos und leer.
Ich würde jetzt gerne wissen, wie es seiner Familie geht. Sind auch sie betroffen, hat er Kontakt? Doch Sharif ist aufgestanden und bereits die Treppe hinauf verschwunden, ohne dass er noch etwas geantwortet hat.
Ich folge ihm mit schweren Schritten, und seine Worte klingen in meinen Ohren. Ich werde nicht gleich einschlafen können, und so drehe ich mich und meine Gedanken kreisen.
Kapitel 3
Mit einer Tasse Kaffee in der Hand zum Frühstück gehe ich zur Wohnung von Kalli. Die Türe ist nur angelehnt, und ich öffne sie einen kleinen Spalt. Drinnen, im Flur, stehen Fredo und Fritz. Julius und Ruprecht sind bereits an den Regalen im Wohnzimmer beschäftigt. Während ich noch in der Türe stehe, kommt Willi hinter mir die Treppe herunter.
„Kommt herein!“, ruft Julius fast beiläufig uns Neuankömmlingen zu und wendet sich sofort wieder seiner Arbeit zu. Wir drei stehen ein wenig unentschlossen herum und wissen nicht, was wir hier nun eigentlich sollen.
Julius schaut uns freundlich an: „Ihr wolltet Euch umschauen. Bitte, tut Euch keinen Zwang an.“ Geschäftig macht er weiter. „Ich denke, dass ich das meiste wohl abholen lassen werde. Aber die paar Bilder, Fotos und die persönlichen Unterlagen möchte ich auf jeden Fall behalten.“
Ich gehe nun auch ins Wohnzimmer, in dem ich zuvor bisher nur einmal gewesen bin, und das ist schon länger her. Es ist ein kleines Zimmer mit einem hölzernen Couchtisch, einem etwas zu wuchtigen Sessel mit dazugehörigem Sofa und einem ledernen Fernsehsessel. Ein hellbraunes Ungetüm mit deutlichen Abnutzungserscheinungen. Den Rest des Raumes füllt eine Regalwand mit vielen Fächern, in denen der alte Mann seine Bücher aufbewahrte. Ich gehe näher und schaue mir die Literatur etwas näher an. Da sehe ich Dostojewski, Remarque, Mann, Stifter, Strindberg und Zola. Ich bin fasziniert.
„Julius!“ Ich drehe mich um und bin etwas aufgeregt. „Julius, hier stehen wirklich schöne Bücher.“
„Du kannst sie alle haben.“ Julius kramt direkt unter mir in den Schubladen der Regalwand und holt verschiedene Aktenordner hervor. Ich nehme einen in Leder gebundenen Roman von Oscar Wilde in die Hand, `Das Bildnis des Dorian Gray´.
„Du musst diese Bücher unbedingt selbst behalten. Und vor allem lesen!“, flehe ich Julius fast an.
„Nimm Du sie gerne an Dich. Ich habe keinen Platz.“ Julius scheint wirklich kein Interesse daran zu haben.
Ich zögere. Bücher muss man doch behalten, man entsorgt sie nicht, ebenso wenig wie man sie verbrennt oder einfach achtlos in den Mülleimer wirft. Bei einem meiner letzten Einsätze in der Papierfabrik schuftete ich gerade auf dem Rohstoffhof und kehrte die Reste von beschädigten Altpapierballen zusammen, als ein Kleinlaster vorfuhr. Er kippte eine ganze Ladung Bücher direkt vor meine Füße. Auf der Plane des Lasters stand `Wohnungsauflösungen´, und sie schütteten die Bücher eines wohl gerade Verstorbenen, vielleicht war er Professor, Schriftsteller oder Lehrer, einfach so in den Dreck. Nach dem Wiegeprotokoll erhielten sie ein paar Euro und das war`s.
An jenem Tag verbrachte ich meine Mittagspause damit, in dem Bücherhaufen herumzustöbern und zu retten, was noch rettbar war. Viele der Werke waren bereits stark durchnässt und unbrauchbar. Aber ich fand Tolstoi, Dickens, Poe und Stoker. Der Hofmeister der Fabrik zeigte mir den Vogel, genehmigte mir aber, drei große Kartons mit Büchern an die Seite zu bringen, die ich am Abend dann wie einen Schatz mit nach Hause nahm. Ich blätterte bis tief in die Nacht in meinen literarischen Juwelen, las in deren Einbänden Widmungen zum Geburtstag, 1948, zur Konfirmation, zum bestandenen Abitur, studierte die mit Bleistift notierten Anmerkungen, Hinweise und interpretierte die unkommentierten Unterstreichungen von Textstellen oder die Ausrufe- und Fragezeichen am Blattrand, die jemand dort einmal hinterlassen hatte.
Diese Bücher wurden offensichtlich lebendig gehalten, sie dienten ihrem Besitzer als Quelle von Wissen und Erbauung. Die Autoren hatten ihren Leser gepackt, verwundert, überzeugt oder zum Nachdenken gebracht. Diese Bücher wurden immer wieder herausgeholt, gelesen, bearbeitet und mit Zugewinn zurückgestellt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Akt. Bis zur nächsten Erkenntnis. Diese Bücher hatten ihren Besitzer sein Leben lang begleitet. Dienten ihm zur Entspannung, bei Krankheit zur Zerstreuung, in der Trauer zur Erlösung.
Ich starte einen letzten Versuch: „Julius, Du bist dabei, ein intellektuelles Schwerverbrechen zu begehen. Möchtest Du ins Gefängnis der Dummen und Ahnungslosen kommen?“ Ich lächle zwar, mein vorwurfsvoller Ton allerdings ist nicht nur vorgetäuscht. „Dann musst Du Deinen Knastkumpanen zur Strafe Mangas vorlesen – und natürlich erklären.“
Julius murmelt etwas und blättert weiter in den gefundenen Ordnern herum. Fredo kommt aus der Küche und vermeldet fast militärisch, dass dort weder Wertsachen noch irgendetwas Besonderes zu finden gewesen sei. Nur ein paar Töpfe, Tassen, Teller und Besteck. Auch die Lebensmittelvorräte scheinen mehr als überschaubar. Nach kurzer Zeit stellen wir alle fest, dass der Besitz von Kalli auf einen Kleintransporter passen würde und wir damit zum Recyclinghof fahren sollten.
„Komm“, fordert Fredo mich auf, „wir schauen uns mal in der Druckerei um. Vielleicht finden wir da etwas. Und wenn nicht, dann können wir die Maschine immer noch einschmelzen und Hantelgewichte aus ihr gießen.“
Fritz und Ruprecht wollen jedoch noch etwas in der Wohnung weitermachen. Also gehen Fredo und ich hinunter und betreten wenige Augenblicke später bereits schon die Druckwerkstatt.
Mein Blick schweift etwas unmutig umher. So recht kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier verborgene Schätze zu entdecken gibt. „Hier ist doch nichts zu finden“, sage ich und habe meine Mühe, mich auf eine, wie mir scheint, doch vollkommen hoffnungslose Suche nach irgendetwas zu machen. Fredo aber ignoriert meine Skepsis. Er zieht bereits Schubladen auf und kramt in diesen herum. Sodann geht er an verschiedene Regale, zieht alles hervor, was dort deponiert ist und schaut hinter jeden Gegenstand. Ein mir unbekanntes Jagdfieber scheint ihn gepackt zu haben. Keine Ritze lässt er aus, akribisch sucht er alles ab.
Er bemerkt meine Unentschlossenheit. „Geh Du und schau mal, was dahinten rumsteht.“ Fredo kommandiert kompromisslos und deutet auf den hinteren Bereich der Druckerei, die von einer dünnen Lattenwand halb abgetrennt wird. Ich tue wie mir aufgetragen und gehe nach hinten. Es ist dunkel, und ich sehe zuerst fast gar nichts.
„Du brauchst Licht!“ Fredo reicht mir eine Taschenlampe, die er selbst gerade entdeckt hat. Das fahle Schimmern der alten Lampe mit ihren schon schwachen Batterien wirft einen trüben Kegel in das Hintere des Raumes. Ich entdecke mehrere leere Kartons, einige alte Farbdosen und verschiedene, fein geordnete Stapel mit unbedrucktem Papier.
Fredo schaut mir über die Schulter und zeigt in eine der Ecken. „Was ist das da? … Dahinten!“ Seine Seemannsaugen haben sofort etwas erspäht, das ich erst jetzt sehe, nachdem ich mit zugekniffenen Augen konzentriert in die gezeigte Richtung geschaut habe. Wir gehen näher. Unter einer verstaubten Plane, die ich vorsichtig lüfte, entdecken wir eine Palette mit einem großen Papierstapel.
„Papier!“, sage ich lustlos und nochmals mehr ernüchtert. Ich lasse die Plane wieder fallen. „Sehr erstaunlich, das hier zu finden, oder? Das Bernsteinzimmer wird dann ja wohl in einer der anderen Ecken sein.“
„Lass doch mal sehen.“ Fredo lässt sich nicht beirren, schiebt mich beiseite, krabbelt über die Kartons zu dem Stapel und schaut unter die Plane. „Das scheint aber irgendwie schon bearbeitet zu sein“, meldet er sich von weiter hinten.
Meine Spannung sinkt auf den Nullpunkt. „Altpapier! … Fredo, wir sind reich! Das tauscht uns meine Papierfabrik gegen einen Kantinengutschein.“
Fredo hat sich von dem Stapel einen einzelnen Bogen geschnappt und kommt damit ans Licht. Er hält ihn gegen das Fenster ins Licht und reibt mit den Fingern über dessen Oberfläche. Sorgsam betastet er das Papier zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann wird er ganz blass: „Ich glaube, mein Schwein pfeift…“ Und nach wenigen Sekunden wird er laut: „Das gibt`s ja nicht! Ich werd´ verrückt…“
Er kann seinen Blick gar nicht ablassen. Dann hält er auch mir das Papier hin und nickt, ich solle es mal selbst probieren. Ich fühle ebenfalls und schaue mir den Bogen genauer an. Erkennen kann ich nichts, und ich zucke immer noch extrem gelangweilt mit den Schultern.
Fredos Stimme zittert: „Geht denn bei Dir kein Licht an?“ Er hält mir den Bogen unmittelbar vors Gesicht. Ich schüttele aber den Kopf, habe keinen blassen Schimmer.
Mein Gegenüber wird drastischer: „Glotz doch nicht so blöd, Mensch! Mach einfach mal die Augen zu.“
Ich tue, wie mir geheißen. Fredo steckt mir das Papier zwischen meine Finger und befiehlt: „Jetzt fühle das Papier! Los! Noch mal…, nun mach schon!“
Während ich meine Augen geschlossen halte, reibe ich immer wieder an der Ober- und Unterseite. Und ja, tatsächlich, irgendwie kommt mir das Gefühl bekannt vor. Nur, ich kann es nicht zuordnen. So versuche ich es noch einige Male.
Mir fehlen aber die Worte, ich kann es nicht beschreiben, und so fällt mir nichts Besseres ein als: „Irgendwie vertraut… ja… nur…“ Ich verstumme und versuche mich nur noch auf das Papier zu konzentrieren. „Mensch, an was erinnert mich das denn bloß…?“
„Du bist schon so verarmt, dass Du total entwöhnt bist.“ Fredo ist vollkommen aus dem Häuschen. „So fühlt sich Geld an. Geld, verdammt! Du bist doch wirklich eine arme Kirchenmaus!“
Ich halte meine Augen weiter geschlossen und wiederhole noch einige Male die gleiche Prozedur. Tatsächlich, Fredo hat Recht, jetzt – wo er es doch gesagt hat – fühle ich es auch. Es ist tatsächlich ganz so wie Geld.
Fredo reißt mir den Bogen fast aus der Hand und hält ihn wieder ins Licht. „Blitz und Donner! Das fühlt sich nicht nur so an, das sieht auch so aus!“, schreit er in den Raum. Er zeigt auf verschiedene Stellen im Bogen und zwinkert mir zu. Ich sehe allmählich, was er meint. Da sind dünne, silberne Streifen angeordnet, und als ich ganz nah komme entdecke ich Wasserzeichen. Ordentlich angereiht, über das ganze Papier verteilt.
„Fredo, ist das etwa….? Das ist doch nicht wirklich…?“ Ich wage es nicht zu sagen.
„Es ist, es ist! Darauf kannst Du wetten.“ Fredo rückt noch näher an das Fenster zum Hof. „Das hier, mein Bester, ist ganz offensichtlich Banknotenpapier. Verstehst Du jetzt? Das Papier, aus dem Geldscheine gemacht werden. Es ist lediglich noch nicht bedruckt!“
Die Bedeutung will mir immer noch nicht ganz in den Kopf. Wir holen ein zweites Blatt vom Stapel. Es ist mit dem ersten vollkommen identisch.
Fredo ist in hellster Freude: „Was man damit alles machen kann…“
„Wie…? Was denn machen?“ Ich bin immer noch vollkommen arglos.
Fredo hat einen roten Kopf. „Hallo Jupiter, hier Erde. Wie lang ist eigentlich Deine Leitung? Was kann man wohl aus Banknotenpapier machen… häh?“
„Geld!“, antworte ich wie ein Erstklässler.
„Jetzt bist Du bei mir.“ Fredo scheint erleichtert. „Und mit viel Papier kann man viel Geld herstellen. Das hier könnten Millionen werden. Unfassbar!“
„Gut, dass Du im Konjunktiv sprichst, denn ich denke, dass so etwas eine Menge Ärger einbringen kann.“ Meine Befürchtung möchte ich nicht weiter konkretisieren. Ich kenne Fredo und seine Späßchen. Mir drängt sich zudem eine ganz andere Frage auf: „Aber davon einmal abgesehen, wie kommt das hierher? Was hat denn Kalli damit am Hut gehabt?“ Ich überlege kurz selbst. „Wenn das wirklich echt ist, dann ist hier doch was faul.“
„Es ist todsicher echt.“ Fredos Grinsen wird nicht geringer. „Und Ruprecht würde jetzt sagen: höchst strafwürdig. Fauler geht also nicht. Das `Woher´ und `Wieso´ müssen wir noch herausfinden.“
Das `strafwürdig´ hat mich wachgerüttelt. „Wir sollten am besten gleich die Polizei verständigen…“
„Bist Du besoffen? Ganz sicher nicht!“ Fredo legt den Bogen auf den Tisch. „Was glaubst Du, was die hier veranstalten? Da sitzen wir erst einmal in U-Haft und die Kumpel dort knobeln, wer von uns mit wem zum Duschen geht.“
„Aber wir sind völlig unschuldig!“, verteidige ich mich sofort.
Fredo denkt weiter: „Und bettelarm! Zudem jetzt auch noch hoch verschuldet. Seit gestern Abend weißt Du das. Und es gibt keinen unter uns, der nicht sofort verdächtigt würde, sich seine Portokasse damit etwas auffrischen zu wollen.“
„Wir müssen sofort mit Ruprecht reden“, werfe ich aufgeregt ein.
„Ja, auch mit Ruprecht. Wir müssen jetzt aber alle in den Kriegsrat einladen. Das hat nämlich Dimension, das Ganze!“ Fredo wartet erst gar nicht mehr auf meine Antwort, sondern ist schon dabei, die Druckerei zu verlassen. Er hat den Papierbogen eingerollt und sich unter den Arm geklemmt.
Ich stehe noch wie ein Trottel da und kann mich kaum rühren. Fredo schaut zurück zu mir: „Und? Worauf wartest Du jetzt noch? Komm endlich!“