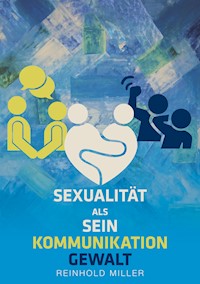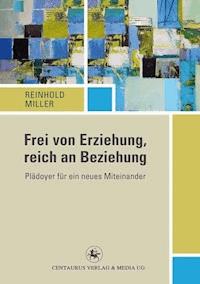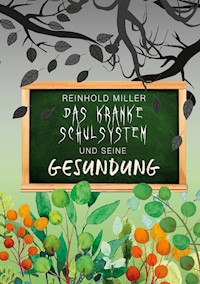
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autor, Dr. Reinhold Miller, beschreibt die Schule, wie sie sich ihm im heute darstellt - als ein Wirkungsfeld für Stagnation! Er war selbst Lehrer und arbeitet als Coach, Fortbildner und als Schulexperte. Aufgrund seiner breit gefächerten beruflichen Erfahrung wirft er einen kritischen Blick auf das herrschende kranke Schulsystem und fordert, ein "Weiter so wie bisher" zu stoppen. Sein Hauptanliegen ist die Gesundung des jetzigen Systems. Deshalb gibt praktische, konkret formulierte und gut umsetzbare Hinweise und Impulse, wie mit den besonderen Belastungen des gegenwärtigen Systems umzugehen ist. So vermittelt er Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, ausführlich Entlastungen, Möglichkeiten der Resilienz, der Immunisierung und erfolgreicher Kommunikationen. Er betont eine grundsätzliche Änderung des Unterrichts und befürwortet die Mutation des Lehrberufs zur Lernbegleitung. Ferner weist er auf Fehler eines Systems hin, in dem die Schüler noch als Objekte betrachtet werden, was sich in Verfahrensweisen und Vorschriften spiegelt. Die Schule muss sich seiner Meinung nach für die Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen mehr öffnen, ihre Bedürfnisse wahrnehmen und vor allem ihre Selbstverantwortung stärken in einer Welt der Globalisierung und Internetisierung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
EINLEITUNG
Teil 1: STAGNATIONEN
»Das war schon immer so!« – War es das?
Bürokratie
Verbeamtung
Stoffpläne
Gleichheit
Erziehung
Benotung
Bestrafung
Belohnung
Lehren
Teil 2: VERÄNDERUNGEN
Die einzige Konstante in unserem Leben sind Veränderungen
Lernwelten
Lebenswelten
Bildung
Schulqualität
Individualität
Globalisierung
Digitalisierung
Arbeit und Beruf
Teil 3: »KRANKHEITEN«
Ein krankes System produziert kranke Menschen.
Berufswahl
Überforderungen
Erschöpfung
Burnout
Psychosomatische Störungen
Depressionen
Ängste
Orientierungslosigkeit
Sinnverlust
Teil 4: GESUNDUNGEN
durch Selbstverantwortung, Freiheit und Kooperation
Selbstbewusstsein
Autonomie
Empathie
Resilienz
Dissoziation
Beziehungen
Kommunikation
Immunisierung
Aus- und Weiterbildung
SCHLUSS: LEBENSWEISEN
Die Gegenwart ist die Zukunft
Die Schule ist Stätte des multiplen Lernens
Das System Schule und die Personen: eine gesunde Partnerschaft
Literaturverzeichnis
EINLEITUNG
Der Anlass, dieses Buch zu schreiben, war für mich Richard David Prechts Freiheit für alle mit dem Untertitel Das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten (Ersterscheinung Frühjahr 2022). Darin enthalten sind zwei Kapitel mit den Titeln Zeitgemäße Ziele der Pädagogik und Die Schulen der Zukunft.
Seine Ausführungen und Anregungen brachten in mir Gedanken zum Thema Schule in Bewegung. So kam mein Titel zustande: Das Ende des Schulsystems, wie wir es kannten – mit der letztlich endgültigen Formulierung: Das kranke Schulsystem und seine Gesundung.
Mein Wissen, meine Kompetenzen und mein Motiv, darüber ein Buch zu schreiben, beruhen auf insgesamt 72 Jahren Leben in und mit der Schule: Volksschule, Gymnasium (Internat) mit Abitur, Hochschulen und Universitäten mit den Fächern Philosophie, Theologie, Pädagogik und Psychologie, Lehrer in einer Grund- und Hauptschule, Lehrerfortbildner und Schulberater im Auftrag eines Kultusministeriums, Ausbildung zum Kommunikationsexperten und Therapeuten, Promotion zu einem Thema aus dem Bereich der Lehrerfortbildung, bis zum heutigen Tage Einzelberatung und Leitung von Gruppen, Supervision und Coaching. Und seit vierzig Jahren bin ich zusätzlich in ähnlichen Berufen in außerschulischen sozialen Bereichen, Wirtschaft und Industrie tätig.
Meine gesamten Erfahrungen mit »Schulmenschen«, also mit Verwaltungsbeamten und Verwaltungsbeamtinnen, Lehrkräften, Schülerinnen, Schülern und Eltern mündeten in der Erkenntnis, dass sie weitaus mehr Belastungen als Entlastungen, Zeitdruck als Zeiträume, Beschwerden als Erleichterungen, stoffliche Überbordung als nachdenkliches Innehalten, Unbehagen als Behagen, Unzufriedenheit statt Zufriedenheit, Zwänge statt Freiheiten, Resignationen statt Glücksmomente haben, ergänzt durch die bitteren Informationen von Experten und Expertinnen, dass Lehrerinnen und Lehrer die größte Klientel in ambulanten und stationären Einrichtungen mit physischen und psychischen Belastungen und Krankheiten seien..
Bereits 1989, vor über dreißig Jahren, schrieb ich zur Entlastung von Lehrerinnen und Lehrern sowie zur Ermutigung das Buch Sich in der Schule wohlfühlen (was einen Kultusminister zu der spöttischen Bemerkung veranlasste: »Wir haben doch keine kranken Lehrer.«).
Doch, wir hatten und haben sie, was mich wiederum dazu veranlasste, Personen der Schulbehörde, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und ggf. auch Eltern hilfreich durch ungezählte Gespräche, Vorträge, Kurse und Seminare zu begleiten.
Dabei legte und lege ich auch weiterhin meine Finger in Wunden und Balsam auf Narben mit dem Ziel der Gesundung. Ich erhebe meine Stimme, wo auch immer ich es vermag, wenn ich Gleichgültigkeit, Verschleierungen, Durchsetzungsmentalität, Ideologien, Abwertungen, Missachtung, Bagatellisierung, Trivialisierung und mangelnde Professionalität entdecke.
Meinen Respekt und meine Wertschätzung gebe ich denjenigen Menschen im System Schule, die sich in ihrer Arbeit mit all ihren Kräften einsetzen, die ihre professionellen Kompetenzen und menschlichen Zuneigungen einbringen, ihren Beruf vorbildlich gestalten und die ihn mit Freude und hohem Engagement bis an ihre Grenzen und oft darüber hinaus ausüben. Menschen, die sich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen einsetzen, die Vorschläge und Ideen haben, die das schwere Schulschiff in frisches Fahrwasser führen, die gegen ein System Widerstand leisten, wenn es seine Macht missbraucht.
Starke Persönlichkeiten und positive Beispiele gibt es in den Behörden, in Schulen und schulnahen Institutionen in vielen Fällen – und inzwischen, erfreulicherweise, auch Ansätze im System, um Änderungen herbeizuführen. Mein Dank richtet sich an alle Engagierten, Weitsichtigen, Handlungsentschlossenen und Ideenexperten.
Insgesamt aber ereignen sich die Neuansätze und zukunftsorientierten Veränderungen leider (noch) nicht flächendeckend: Zu häufig haben Ideologien das Wort, zu groß sind generelle Widerstände, zu divergierend wirken sich die politischen Vorhaben in den sechzehn Bundesländern aus, zu egozentrisch und eigennützig agieren Institutionen und Verbände, zu wenig durchdacht sind gut gemeinte Vorschläge, Wesentliches zu ändern, zu wenig finanzielle Mittel werden im gesamten Bildungsbereich ausgegeben.
Angesichts der derzeitig 11 Millionen Schülerinnen und Schüler und der etwa 800.000 Lehrkräfte scheinen die politisch Verantwortlichen nicht in der Lage zu sein, die notwendigen strukturellen, finanziellen, organisatorischen und inhaltlichen Maßnahmen für Bildung, Schule und Fortbildung zu treffen. (Gar nicht weitergedacht an die bitteren Prognosen, was den Lehrermangel in der Zukunft angeht.)
Je mehr ich mich beruflich im Schulsystem bewegte, es reflektierte und mit Personen in Kontakt kam, die darunter litten, desto mehr wurde mir bewusst, dass das System Schule inzwischen krank geworden ist, was mich zu dem Satz brachte: »Ein krankes System produziert kranke Menschen.«
Wenn ich von System spreche, dann von einer Gesamtheit von Elementen, die entweder zusammengehören (Familie, Schule, Betrieb, Gewerkschaft) oder technisch aufeinander bezogen sind (PC-System, Wirtschaftssystem, Maschinensystem).
Der Soziologe Niklas Luhmann sagte warnend: »Systeme sind selbstverliebt und dadurch nur schwer zu verändern.« Und das heißt, dass sie in ihrem Kern nach innen zusammenhalten und gleichzeitig nach außen streben – und sich deshalb grundsätzlich immer in einem inneren Spannungsverhältnis befinden.
Alfred Lorenzer hat eine ganze Reihe von Thesen über das Schulsystem aufgestellt (siehe Koerrenz, S. 35ff.), von denen ich einige (mit Kommentar) nenne, weil sie Einblicke in die Komplexität, Polarität, Differenzierung, Verletzbarkeit und Verwerfungen geben:
Wenn sie nicht geschützt werden, die Menschen in der Schule, entwickeln sie Krankheitssymptome im und durch das System, zum Beispiel weil
Kultusministerien
Obrigkeitsdenken, Durchsetzungsstrategien und Rechtsvorschriften majorisieren statt kooperativ zu handeln.
Schulbehörden
sich als Schulaufsicht verstehen statt als schulische Beratungsstellen
Schulleitungen
ihre Führungskompetenzen einschränken müssen und Diskurs und Vereinbarungen durch behördliche Vorschriften unterbunden werden
Lehrerinnen und Lehrer
pausenlos (!) und weit über ihre Grenzen hinaus agieren müssen und sie zu wenig Unterstützung in ihrem Alltag bekommen: Personalmangel, zu große Klassen, ungünstige Arbeitsbedingungen, Zeitdruck, Lehrplandominanz, Sandwichzustände, Ausleseverfahren, Benotungszwang, finanzielle Engpässe.
Schülerinnen und Schüler
durch überfrachtete Lehrpläne, lernfeindliche Arbeitszeiten, undurchsichtige Benotungen, realitätsferne Reglementierungen und mangelhafte Transparenz überfordert und psychisch belastet werden.
Eltern
die Schule meiden; nur zu Beschwerden in die Schule kommen, das Thema Schule Stress auslöst und sie sich zwischen dem System Schule und sich in ihren eigenen und den kindgemäßen Ansprüchen eingezwängt fühlen.
Insgesamt wird deutlich, dass diese Art Schulsystem primär nicht für die Personen da ist, die in ihm tätig sind, sondern dass – leider – gesagt werden muss: Es ist (hauptsächlich) für die Bedürfnisse der Gesellschaft unter staatlicher Aufsicht da:
Die Stoffpläne sind entsprechend danach ausgerichtet. Es herrscht Schulpflicht. Schulschwänzen ist Normalität. Bildung dient dem Erwerb der Arbeit und der Zunahme des Kapitals. Der Anspruch, dass alle gleichmäßig behandelt werden, hat Priorität.
Die Leitfrage
seit Jahren lautet: Wie motiviere ich Schüler und Schülerinnen (um zu gesellschaftlichen Zielen zu gelangen)? Die Kinder und Jugendlichen »lernen für das Leben«. Ob sinnvoll oder nicht. (Wie sieht dieses spätere Leben aus?)
Das »Kein Bock auf Schule« der Kinder und Jugendlichen wird bagatellisiert. (Es werden zu wenige von deren Botschaften eruiert und analysiert.)
Für viele hat Schule keinen Sinn. (Zitat einer Gymnasiastin: »Die Schule ist für mich nicht gut genug.«)
Die Kinder und Jugendlichen werden auf die
Erwerb
sarbeit vorbereitet. (Das ist zu wenig und diese Zielorientierung zu eng.)
Sie erfahren Verständnis, Zuwendung, Betreuung, Unterstützung. (Wie wohltuend, dass auf der Beziehungsebene Empathie spürbar ist.)
Immer noch Realität: Tafelbenutzung, Anschriebe, Abschriften, Strafaufgaben (alte Muster werden hartnäckig »verteidigt«).
Die Schule ist ein Ort der Auslese mit dem Mittel der Benotung. Und die Tatsache, wie subjektiv und relativ sie ist, scheint kaum bekannt zu sein.
Die Wochenarbeitszeit der Jugendlichen ist höher als die der Erwachsenen (Kinderarbeit durch die Hintertür).
Das Lehren bestimmt das Lernen und wird in
Stunden
plänen organisiert. (Es muss umgekehrt sein: Ich kann nur lehren, wenn ich über das Lernen Bescheid weiß, siehe auch Teil 2:
Veränderungen
.)
Die meisten Kosten von Eltern für die Schule sind Zahlungen für den
Nachhilfe
unterricht.
Lehren, Belehren, Beibringen sind Methoden, die zu kurz greifen, Freude, Lust, Neugier und Interesse schwinden im Lauf der Schulzeit (Stoffvermittlung hat Priorität).
Pauken wird zur Gewohnheit – und das rasche Vergessen auch. Sitzenbleiben wird als notwendige didaktische Maßnahme akzeptiert (mit bekanntermaßen »Nullerfolg«).
Der vergebliche Versuch, den Begriff Kompetenzen mit Inhalten zu füllen, angesichts der Prognose, dass die derzeit Lernenden etwa 90 Jahre alt werden, ist letztlich gescheitert (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Seit Jahrzehnten ist die Dreifacherkenntnis unverändert, warum Kinder und Jugendliche in die Schule gehen:
1. Um Freundinnen und Freunde zu treffen und mit ihnen beisammen zu sein.
2. Weil es dort nette, hilfreiche und gute Lehrer/innen gibt.
3. Weil es dort etwas Neues, Tolles, Interessantes zu lernen gibt.
Zweimal also sind es zwischenmenschliche Beziehungen und einmal die Sache, die in der Schule dominieren. (Die Pandemie zeigt u. a. deutlich, dass nicht das Home-Learning das größte Problem der Kinder und Jugendlichen ist, sondern die Home-Isolierung sowie der Mangel an Sozialkontakten in der Schule und anderswo.)
Die oben genannten Thesen A. Lorenzers sind äußerst präzise formuliert und zeigen die Systemwirklichkeit der Schulen unter dem Aspekt staatlicher und gesellschaftlicher Einflüsse und Vorgaben. Das bedeutet jedoch nicht, dass Systeme grundsätzlich so sind.
Ich schreibe auch deshalb bewusst von kranken, nicht aber von toten Systemen. Sie haben durchaus auch funktionierenden und erfolgreichen Charakter, und sie sind »kein Sand im Getriebe«. Wir kennen Begriffe wie: Der Motor läuft wie geschmiert. Die Maschine läuft rund. Das System funktioniert einwandfrei.
Merkmale eines gesunden Schulsystems sind demnach:
Die Personen arbeiten mit Freude und Zuversicht. Sie schätzen und unterstützen sich gegenseitig, sind interessiert an der Sache. Sie kommunizieren und kooperieren offen, vertrauensvoll und sind authentisch. Absprachen und Vereinbarungen werden ausgehandelt und eingehalten. Die Einzelnen übernehmen – ihrer Fähigkeit entsprechend – Verantwortung. Die Fluktuation ist gering, die Krankheitsquote ebenfalls. Und auch hier gibt es eine Trias:
Vertrauen statt Verordnungen, Empathie statt Durchsetzung, Verstehen statt Bewerten. Und es bedarf der Zusammenarbeit und aufeinander abgestimmter, differenzierter Aktionen von Staat, Gesellschaft und Schulen, damit aus dem kranken System Schule ein gesundes werden kann, das in Gegenwart und Zukunft förderlich ist. Und das sich zu einem Schulsystem entwickelt, das wir bisher so nicht kannten (!), weil es vor allem die Menschen umfassend im Auge behält und ihnen die Möglichkeit gibt, Sinn in ihrem Tun zu finden und entsprechend ihr Leben zu gestalten (siehe auch Precht, S. 459 ff.).
In 36 Stationen zeige ich die Prozesse von der Stagnation bis hin zur Gesundung:
Die Stagnationen signalisieren, dass wir an alten Mustern hängen, an Vertrautem. Aber auch, dass wir die Notwendigkeit der Veränderungen nicht wahrhaben wollen, dass wir uns sicher fühlen durch Beharren und manchmal die Augen verschließen, um nicht ansehen zu müssen, wie unsere eigene Zukunft gefährdet ist und wir dadurch den Einfluss in der Welt, in der wir leben, verlieren.
Der Preis ist zu hoch, wenn wir die Stagnationen nicht als conservare (lat.: bewahren) begreifen, sondern als Entwicklungsverhinderung. Es gilt, unseren Wurzeln das Wachstum zu ermöglichen.
Die Veränderungen sind deshalb notwendig und zeitlich unaufschiebbar, weil durch die Globalisierung, die Digitalisierung, das Internet und die mangelnde Nachhaltigkeit bis ins Innerste unser gesamtes »Bildungs-« und Schulsystem tangiert, gefährdet und dadurch in die Wirkungslosigkeit getrieben wird, wenn wir sie nicht ernst nehmen und nicht in das Zentrum unserer Lebenswirklichkeit nehmen.
Zudem leben wir in einer Mehrgenerationensituation, die unser Zusammenleben extrem beeinflusst und hohe persönliche Anforderungen an uns stellt: von Urenkeln bis Urgroßeltern im Zeitraum von etwa 90 bis 100 Jahren in Multibeziehungskonstellationen! Und auch die gesamte Arbeitsvielfalt und die Arbeitsgewohnheiten werden auf den Kopf gestellt. Deutliche Anzeichen sind jetzt schon mit gravierenden Auswirkungen auf den Lehr(er)beruf und das individuelle und kreative Lernen unserer Kinder und Jugendlichen erkennbar.
Die Krankheiten zeigen erschreckend das Ausmaß, wie sehr das System Schule unsere Lebenschancen aufs Spiel setzt, und zwar die aller Beteiligten, in den Behörden, den einzelnen Schulen und im Elternhaus. Nicht: »Was machen wir falsch?«. Die Antwort: Es gar nicht erst es so weit kommen zu lassen …
Die Gesundungen geben der Schule wieder den nötigen Atem, vernichten das jetzige kranke System, das unnütz, unattraktiv, menschenunfreundlich und pädagogisch handlungsunfähig geworden ist und das sich mehr der Gesellschaft verpflichtet fühlt als den einzelnen Menschen in allen schulischen und schulnahen Bereichen.
Meine Gesundungsvorschläge stärken die Selbstverantwortung der Betroffenen, schaffen Raum für notwendiges freies Agieren und ermöglichen Kooperation für zielgerichtetes Handeln. Ziele sind ein zufriedenes bis glückliches Leben unserer Kinder und Jugendlichen, ein erfülltes Berufsleben unserer Lehrerinnen und Lehrer, eine selbstbestimmte Arbeitszeit für alle und ein sinnvolles Sein inner- und außerhalb der Schule.
* Ich bin auf dem Weg in eine Schule. Ein Junge überholt mich. Ich passe mein Tempo dem seinen an, frage ihn, warum er es so eilig habe, und bekomme zur Antwort: »Damit ich nichts verpasse.«
Eine Schule ist dann gesund, wenn die Kinder und Jugendlichen zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern mit Freude und Neugier in das »Haus des Lernens« gehen dürfen, sie dort von Menschen mit dem Ziel betreut und begleitet werden, in der Gegenwart zurechtzukommen, und in die Zukunft hinein vorbereitet sind. Eine Schule des Lernens ist offen für diejenigen, denen das Lernen Heimat ist und ihnen Sinn gibt.
Meine Stationen beziehen sich auf die Schule und die sie umgebenden Wirklichkeiten, mit dem Ziel, dass die Menschen diese selbstständig, kommunikativ, kooperativ und somit erfolgreich gestalten können.
Was uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte begleiten wird, so meine Vermutung: Die unsägliche Trias: (1) Coronavariationen (2) Kriege und globale Grenzüberschreitungen (3) die Zerstörung unseres Planeten Erde. Wir brauchen, bleibend, eine gesunde Schule, die uns in dieser Trias beim Über- und Weiterleben begleitet, eine Schule der Freiwilligkeit und Sinnhaftigkeit, keine Schule, die man absitzt; nicht nur eine Schule als Lernort, keine Schule für das Leben, sondern eine Schule als Lebensort.
Teil 1: STAGNATIONEN
»Das war schon immer so!« – War es das?
»Konservativ ist mir Fortschritt genug.« Diesen Satz höre ich öfter, ernst gemeint als Verteidigung von Gewohntem oder manchmal auch als spöttischen Konter.
Es braucht weder die Verteidigung noch den Konter, um zu erkennen und einzusehen, wie grundsätzlich wichtig das Bewahren ist und wie schlimm, wenn Verlieren und Loslassenmüssen geschehen, im Kleinen wie im Großen:
* Meinen Teddybären, den ich lieb gewonnen hatte, mit vier Jahren. Ich habe ihn bis heute noch, 75 Jahre lang.
* Meine Frau wurde als junges Mädchen aus ihrer Heimat vertrieben, nur mit einem Köfferchen in der Hand. Aus ihrem Kinderzimmer konnte sie nichts mitnehmen.
* Frau N. hätte so gern ihre Liebe zu ihrem Mann bewahrt. Sie ist ihnen abhandengekommen.
* Der Vater will die Firma behalten, in der vierten Generation. Der Sohn will andere Wege gehen.
* Herr T., dem KZ entkommen, konnte sich seine Wertschätzung Deutschen gegenüber in seinem Herzen bewahren: »Es waren nicht alle so.«
* Es gibt das Wort »aufbewahren«. Es verwendet jemand, der etwas Schönes, Wertvolles, Wichtiges, Kostbares nicht verlieren will – und oft auch einen entsprechend angemessenen Ort sucht.
* Gewinn und Schmerz begegnen sich auch im Großen: In der Politik zwischen den Parteien; in der Wirtschaft zwischen den Konzernen; in der Industrie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer; im Sport zwischen Fußballern und Vorständen; in der Kunst zwischen Tradition und Moderne.
Der Satz ist allgemeingültig, wenn gesagt wird: Ich bewahre mir, weil …
mir jemand oder etwas wichtig, nahe und zur Heimat geworden ist.
ich mich sicher, geborgen, geschützt fühle.
das Festhalten Gewinn und das Loslassen und die Trennung Verlust sind und schmerzen.
Das Loslassen und sich auf Veränderungen einlassen zu können ist bisweilen äußerst ambivalent, was die meisten von uns beim Umziehen in eine andere Wohnung sehr realistisch erleben: Was geben wir ab, was werfen wir weg, was entsorgen wir (wie unterschiedlich doch die Verben sind!) und was behalten wir (unbedingt) und geben es nicht her?
Der Begriff Stagnation weist in eine andere Richtung im Gegensatz zum Bewahren, nämlich in Richtung Stillstand – und dies bedeutet Bewegungstod (= Herzstillstand) und damit das Ende jeglicher Bewegung, auch im System Schule, in dem Menschen leben.
Nachfolgend zeige ich neun Stationen auf, die zumindest die Gefahr der Entlebendigung in sich tragen.
Bürokratie
»Ein Kind ist kein Aktenordner«, schreibt Joachim Bauer (Lob der Schule, S. 13). Und weiter: »Die Akteure der Schulbürokratie tun, was Bürokraten gerne machen: Sie greifen zu bürokratischen Maßnahmen. Konkret: Sie versuchen, das Problem mit Standards und Kontrollen zu lösen.« (Ebd.)
Verwalten hat etwas mit Vertrauen zu tun, denn: Ich verwalte das, was mir jemand anvertraut: Meine Finanzen, meine Wohnung, meine Interessen, mein Unternehmen. Deshalb behagt mir der Begriff Verwaltung weitaus mehr als das Wort Bürokratie.
Was das System Schule und Schule als Lernort angeht, stehen die beiden in einem Konflikt: Hier die Menschen mit ihren Bedürfnissen, Anliegen, Prozessen, Aktionen und Interaktionen, Zielen, Wünschen, Vorhaben und Herausforderungen – dort Menschen, die bestrebt sind, Bestehendes zu verwalten, Ordnung zu schaffen, sie herzustellen, auf Einhaltung von Vorschriften und Regeln zu achten, Mahnungen, Abmahnungen, Sanktionen auszusprechen oder gar Rechtsverletzungen zu ahnden.
Es begegnen sich Personen auf der Beziehungs- und Sachebene, auf den ersten Blick unvereinbar, streitbar widersprüchlich, notwendig … wobei jede Seite unterschiedliche Positionen, Wahrnehmungen und Anspruch auf »Richtigkeit« hat. Das Interessante und Spannende dabei ist: Wer Regeln »erfindet« und sie aufstellt, ist ein »Regelwerker«. Wer sich für Schülerinnen und Schüler einsetzt, ist ein »Schulwerker«, auch Lehrer genannt. Und wenn beide »als Schuster bei ihren Leisten bleiben«, gibt es keine zufriedenstellenden Lösungen, sondern Stagnationen.
* Ich habe in meiner Zeit, in der ich sowohl in einem Kultusministerium als auch in der Lehrerfortbildung tätig war, öfter zwischen Regel- und Schulwerkern vermittelt. Am schwierigsten war es immer dann, wenn beide auf ihren Standpunkten verharrten und zugaben, von jeweils der anderen Seite wenig zu wissen und wenig zu halten. Das heißt: Ohne gegenseitigen Respekt geht es nicht.
* Ein Regelwerker und ein Schulwerker halten sich in einem Wald auf, wissen nichts voneinander, stoßen aber – rein zufällig – in der Dunkelheit gleichzeitig auf ein Ungetüm. Aus Vorsicht strecken sie die Arme aus, betasten es und setzen ihren Weg fort. Als es hell wird, begegnen sie sich, stapfen nebeneinander her, bis der eine sagt: »Mir ist heute Nacht ein Ungetüm begegnet. Ich konnte es nur betasten. Muss ein Tier gewesen sein mit einem Rohr.« Darauf der andere: »Das mit dem Rohr kann nicht stimmen. Das war ein dünner Pinsel, den ich ertastete.« Da wurden beide stutzig, schauten sich an und begannen, schallend zu lachen …
So ist das mit den verschiedenen Wahrnehmungen und Wirklichkeiten, auch in den Behörden und Schulen, in der Verwaltung und in den Lernstätten. Können beide kompatibel sein? Kommen beide zusammen, trotz verschiedener Wahrnehmungen, Positionen, Aufgaben und Tätigkeiten?
Der Kernsatz lautet: Nicht der Mensch ist für die Verwaltung da, sondern die Verwaltung für den Menschen. Beide haben Berechtigung: