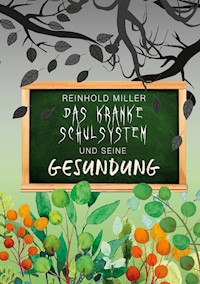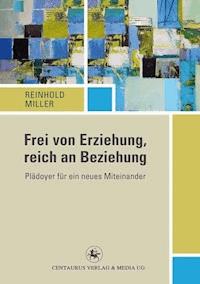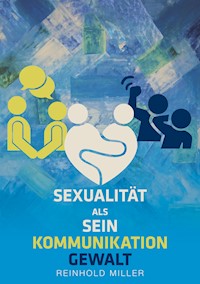
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Schulexperte, Kommunikationstrainer und Beziehungsdidaktiker Dr. Reinhold Miller widmet sich in seinem neuesten Werk der Sexualität und den verschiedenen Ebenen, auf denen sie von den Menschen erlebt wird: als Teil des menschlichen Seins, in der Kommunikation, aber auch in Situationen, in denen Macht und Gewalt im Rahmen der Sexualität ausgeübt werden. Dabei lässt er seine in der beruflich ausgeübten Beratertätigkeit gewonnenen persönlichen Erfahrungen mit einfließen, ebenso kann man Distanz einfließen lassen, die er aufgrund seines Theologie-Studiums zu der (teilweise immer noch) vorherrschenden klerikalen Sicht auf die Sexualität gewonnen hat. Es kommen viele Empfehlungen zum Einsatz, die ihm aus seiner beruflichen Tätigkeit vertraut sind. Aus dieser breit angelegten Perspektive heraus gelingt es ihm, stärkende und probate Handlungsweisen überzeugend zu vermitteln. Beim letzten Thema, der Sexualität im Alter, lässt er uns teilnehmen an seinen Erfahrungen, da seine Frau ihre letzten Jahre in einem Heim verbrachte und beide Ehepartner aufgrund der Pandemie schmerzvolle Zeiten der Trennung erfahren mussten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Margarethe, meine geliebte Frau † 2022
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Teil 1: Sexualität als Sein
1. Der Zufall und seine Folgen
2. Selbstbewusstsein und Respekt
3. Wertschätzung und Empathie
4. Beziehung statt Erziehung
5. Existenzielle Bedrohung: Brust- und Prostatakrebs
Teil 2: Sexualität als Kommunikation
1. Realität und Bedeutung
2. Die Sprache und ihre Wirkung
3. Praktizierte Sexualität
4. Trennungen
5. Liebesbeziehungen
Teil 3: Sexualität als Gewalt
1. Gewalttätig
2. Macht und Herrschaft
3. Täter und Opfer
4. Schutz, Immunisierung, Solidarität
5. Klerikale Sexualität
Teil 4: Sexualität am Lebensabend
1. Wahrnehmungen
2. Abschiede
3. Berührungen
4. Veränderungen
5. Liebende
Rückblick und Ausblick
Literaturverzeichnis
Vorwort
»Pfui!«, sagte mein Vater, als er sah, dass ich mit meinem Genital spielte. Da war ich vier, mein Vater fünfundvierzig und streng katholisch.
»Ich liebe dich«, sagte meine Frau, als ich ihr übers Haar strich. Da war ich siebenundsiebzig, sie einundneunzig und im Rollstuhl eines Pflegeheimes.
Zwischen diesen beiden Kommunikationen liegen nun dreiundsiebzig Jahre meines Lebens mit einer Fülle von Selbsterfahrungen, zwischenmenschlichen Kontakten, schwerwiegenden Entscheidungen, beeindruckenden Erlebnissen, erinnerungsbleibenden Begegnungen, gravierenden Schicksalsschlägen, wertvollen Beziehungen, privater wie beruflicher Art, und 48 prägenden, intensiven, phasenweise belasteten und dennoch unvergesslichen und liebevollen Jahren der Ehe – immer auch im Erlebnisbereich unserer beider sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten und unserer eigenen weiblichen/männlichen Sexualität als Mädchen/Junge, Jugendliche und Erwachsene.
Was dieses Buch betrifft, so bewegen mich sechs Themen der Sexualität im Kontext privater Lebensweisen sowie in zwischenmenschlichen Beziehungen (innerhalb unseres Kulturkreises):
(1) Das Verständnis menschlicher Sexualität
(2) Bedeutung, Folgen und Konsequenzen der Sexualität
(3) Die Vielfalt zwischenmenschlich praktizierter Sexualität
(4) Der Ursprung und das Verstehen von Gewalt
(5) Sexualisierte Gewalt
(6) Der Zusammenhang zwischen Sexualität, Erotik und Liebe Biografisches, zum besseren Verständnis meiner Motive und Ziele:
Dr. Dipl. Theol. Dipl. Päd. Reinhold Miller (m), Jahrgang 1943; Abitur, Studium der Philosophie, Theologie (katholisch und evangelisch), Pädagogik und Psychologie; Promotion. Kurzzeitig Lehrer, dann vierzig Jahre hauptberuflich als Kommunikationsexperte, Coach und Beziehungsdidaktiker; bundesweit und in Österreich, der Schweiz und Südtirol tätig; Autor zahlreicher Fachbücher.
Ich bin kein Mediziner, kein Sexologe oder Sozialwissenschaftler, sondern ein Fachmann, der sich in menschlichen und zwischenmenschlichen Lebens- und Verhaltensweisen auskennt und die Sexualität als menschliches Phänomen betrachtet, die sozialverträglich statt gewalttätig gleichwertig und gleichberechtigt von weiblichen, männlichen und diversen Menschen gestaltet werden kann.
Drei Bemerkungen vorab
1. Ich verwende meist den Begriff sexualisierte Gewalt statt Missbrauch, um nicht den Anschein zu erwecken, Sexualität könne man (positiv) »brauchen« oder (negativ) missbrauchen.
2. Alle Texte beziehen sich auf Studien im Bereich der humanistischen Psychologie, auf theoretische und praktische Erkenntnisse der menschlichen Sexualität und auf meine Beratungs- und Therapieerfahrungen über vier Jahrzehnte hinweg im Umgang mit Einzelpersonen, Paaren und Gruppen.
3. Ab und zu berichte ich über eigene Erfahrungen, spreche sie persönlich aus, zeige auf, was sie für mich bedeuten und was sie bei anderen ausgelöst haben.
Meine Motive
Das Thema »Sexualität und sexualisierte Gewalt« in mein berufliches Repertoire aufzunehmen, beruht auf vielfältigen Erfahrungen, Erkenntnissen und Einsichten über Jahrzehnte hinweg:
Als
Lehrer
in einer Hauptschule, in der »Du schwule Sau, du Hure, du Wichser« und Ähnliches im Sprachschatz der Schülerinnen und Schüler zunahmen. Ich wurde hellhörig und war in der Lage, mit ihnen zu arbeiten, mit dem Ziel, fair miteinander umzugehen (ab 1975).
Als
Autor
, an den ein Verlag mit der Bitte herantrat, ein Schülertrainingsheft zu schreiben, weil die Beschimpfungen in den Schulen sich immer mehr ausbreiteten. Es entstand das Heft: »Du dumme Sau!«, das von Lehrerinnen und Lehrern erwartungsvoll aufgenommen und als Trainingshilfe eingesetzt wurde (ab 1990).
Als
Beziehungsdidaktiker
, der in seiner Beratungstätigkeit und über die sozialen Medien wahrnahm, wie die Beschimpfungen und Beleidigungen, die Abwertungen und Übergriffe, die physischen und psychischen Gewalttaten extrem sexualisiert und weit in das Alltags- und Privatleben der Menschen aus allen Schichten eindrangen (ab 2000) – und die sich bis heute in einem Ausmaß ausgebreitet haben, dass sie die Begrenzung, Verhinderung und Steuerung ungemein erschweren (ab 2010).
Als
Berater
und
Coach
, der über die Missbrauchsskandale bestürzt war (vorwiegend in der katholischen Kirche, wobei die Betroffenen noch bis heute auf entsprechende Entschädigung warten), und der zum Begleiter und Helfer für Menschen wurde, die unmittelbar und mittelbar betroffen waren (ab 2010).
Als
Zeitgenosse
, der über die sexualisierte Gewalt schockiert ist, vor allem Kindern und Jugendlichen gegenüber (seit Kurzem als Verbrechen deklariert), deren Ausmaß nicht abzusehen ist und deren Schrecklichkeiten in den Medien und der realen Wirklichkeit immer umfangreicher wahrzunehmen sind (ab 2020).
Als
Privatmann,
der persönlich betroffen ist und der sich kommunikativ und mental solidarisch mit denjenigen Menschen verbunden fühlt, die radikal jeglichen Formen sexualisierter Gewalt entgegentreten und sich für Gleichberechtigung und Gleichgerechtigkeit der Geschlechter einsetzen (ab 1990).
Meine Ziele
Aus meinen Wissenspotenzialen, durch Erfahrungen und Erkenntnisse über vier Jahrzehnte hinweg und aufgrund der immensen Bedeutung der Sexualität sowohl im Leben der Einzelnen als auch in der Wahrnehmung und Darstellung in der Öffentlichkeit erwuchsen für mich folgende Ziele:
hervorzuheben, welche zentrale Rolle die Sexualität – grundsätzlich primär als Seinszustand im Leben aller Menschen – spielt;
bewusst zu machen, dass menschenfreundlich praktizierte Sexualität die beste Voraussetzung ist, der sexualisierten Gewalt keine Chance zu geben;
zu reflektieren, welche persönlichen und zwischenmenschlichen Auswirkungen sexuelle Verhaltensweisen und Praktiken für Körper und Seele haben;
zu zeigen, dass die menschliche Sexualität (u. a.) als Form der Kommunikation und Beziehung gelebt werden kann;
deutlich die sexualisierte Gewalt zur Sprache zu bringen (sexuell beleidigende, herabwürdigende, verletzende und verbrecherische Haltungen und Handlungen) und sie als pervers zu deklarieren;
Menschen zu helfen, wie sie sich gegen sexuelle Gewalt immunisieren, sich von den Folgen befreien und würdig leben können;
deutlich zu sagen, dass nicht die Gewalt unser aller Leben dominieren darf, sondern dass es die Liebe ist, die uns am Leben erhält.
Und schließlich beziehe ich immer wieder meine eigene Person in das Gesamtgeschehen mit ein: als Betroffener, Beobachter, Begleiter in meinen Beziehungen zu Menschen, die ihre Sexualität individuell und sozial leben möchten.
Seit es Menschen gibt, ist Sexualität ihr Thema, sei es offen, subkutan oder tabuisiert. Die digitale Realität hat sich immer mehr in die Öffentlichkeit gedrängt, naturgemäß, überbetont, unangemessen, schließlich Grenzen sprengend und damit jeglicher Art von Gewalt preisgegeben.
Es ist an der Zeit, zu den Ursprüngen zurückzukehren und die Sexualität als hohes Gut und wertschätzende Verhaltensweise zu sehen und zu leben, was nur möglich ist, wenn wir Menschen grundsätzlich respektvoll miteinander umgehen.
Bemerkung
Ich wende mich an Menschen jeglichen Alters und bitte die interessierten Erwachsenen in der Begegnung mit und in ihren Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen, die von mir beschriebenen Haltungen, Einstellungen und Verhaltensweisen jeweils entsprechend anzusprechen, zu vermitteln und selbst zu leben. Sexualität ist ein zentrales Phänomen im Leben jedes Menschen, sei es verinnerlicht oder angesprochen, erwähnt oder verdeutlicht, tabuisiert oder verbreitet, und das unserer Kommunikation einen besonderen und vielfältigen Sinn gibt.
Einleitung
In Teil 1 geht es um die Sexualität als grundsätzliches Sein in jedem Leben von Menschen und was dies bedeutet: Sie können nicht nichtgeschlechtlich sein und sind darin ein Zufall der Natur. Sie können sich nicht für oder gegen das Leben entscheiden: Sie werden geboren. Diese Tatbestände und deren Reflexion sehe ich als äußerst wichtig an, um die eigene Sexualität als Mensch zu verstehen, sie mit anderen zu leben und dadurch Voraussetzungen zu schaffen, sexualisierter Gewalt keine Chancen zu geben, d. h. also, sie zu verhindern bzw. zu reduzieren, sich die eigene Sexualität bewusst zu machen und sie menschenwürdig als Bollwerk gegen sexualisierte Gewalt zu leben.
In Teil 2 thematisiere ich das zwischenmenschliche Zusammensein im Kontext sexueller Funktionen, Formen, Verhaltensweisen und Praktiken, solitär und sozial, die grundsätzlich kommunikativ und dialogisch sind. Dabei wird deutlich, wie vielfältig diese Kommunikationen und Variationen sind, vor allem, seit die Genetik und medizinische Wissenschaften enorme Erfahrungen gesammelt und Erkenntnisse gewonnen haben. Dieser Reichtum entzieht der sexualisierten Gewalt den Boden.
In Teil 3 entlarve ich die Gewalt von Menschen im Rahmen der Sexualität – im weitesten Sinn – als Perversion (= Abweichung, Verdrehung). Etwa 90 % der Männer und 10 % der Frauen sind sexuelle Gewaltmenschen – vor allem mit dem Hauptmotiv der Machtausübung. Die Opfer und Täter brauchen Hilfe, um aus den schrecklichen Taten und den erlittenen Leiden herauszukommen und heilsame Wege zu finden und zu beschreiten.
In Teil 4 zeige ich, dass Sexualität, als Seins- und Verhaltensweise, bis zum Lebensende anhält und erfüllt gelebt werden kann, aber auch, dass sie leider immer noch weitgehend abgetan oder tabuisiert wird. Auf der einen Seite steht die Tragik, Abschied von gelebten sexuellen Beziehungen nehmen zu müssen, auf der anderen Seite das Geschenk physischer und psychischer Nähe, Zärtlichkeit und Innigkeit als Ausdruck bleibender Liebe bis zum Tod zu bekommen.
Diese Reihenfolge habe ich deshalb so gewählt, um zu verdeutlichen, dass der sexualisierten Gewalt, der unglaublichen Missbrauchswelle in der heutigen Zeit und der Grenzenlosigkeit via Medien nur dann erfolgreich Widerstand geleistet werden kann, wenn wir bei den Ursprüngen und Wurzeln der Sexualität beginnen, und das heißt, die Sexualität grundsätzlich als Seinsweise zu verstehen und sie nicht zu trivialisieren, indem wir von der »schönsten Nebensache« reden: schön oder nicht schön – und schon gar nicht Nebensache, sondern zentrales Phänomen in unserem Leben.
Dieses Sein als Wirklichkeit ist von sexuellen Stimuli, Impulsen, Werbebotschaften, grenzenlosen Darbietungen, Offenlegungen von Praktiken und Handhabungen via Internet umgeben. Sie alle prägen unser Fühlen, Denken, Reden und Handeln.
Hierzu einige Beispiele
»Hey, du Hure«, sagt ein 14-jähriger Junge zur Schulleiterin, als er das Schulhaus betritt. Im anschließenden Gespräch entschuldigt er sich und bemerkt: »Das sagt mein Vater jeden Tag zu meiner Mutter.«
Ein Neunjähriger: »Ich weiß, was Ficken ist. Wenn mein Vater seinen Pimmel in meine Mutter steckt.«
»Porno ist geil! Wir treffen uns schon vor der Schule – und zieh‘n uns einen runter. Hausaufgaben sind Scheiße!« (Jungs zum Lehrer)
Ein Lehrer nimmt einem Schüler einen Spickzettel weg. Er liest den Inhalt; fünfmal der gleiche Satz: »Mädchen sind zum Ficken da.«
In Arbeitspausen verschwinden Pärchen in ausgesuchten Räumen für »Quick-Ficks«.
Lehrmädchen werden von Meistern oder Kollegen »zurechtgebumst«. Frauen müssen sich, gezwungenermaßen, den sexuellen Wünschen ihrer Vorgesetzten beugen. Ad infinitum.
Sexualität, wie in diesen beschriebenen verbalen und nonverbalen Verhaltensweisen, wird zum Leistungssport deklariert; auf dreifache Körperöffnungen reduziert (vaginal, oral, anal) und zum »Treffpunkt« von Penislänge und »Vaginaquadratzentimetern«, Missbrauch und Sinnentwertung zugleich. Ich nenne dies genitale Kopulation im Gegensatz zur sexuellen Kommunikation.
Sexuelle Stimuli gibt es überall, in den Familien, auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit, beim Shoppen, im Freizeit- und Sportbereich, in Wirtschaft, Industrie, Politik und Kunst, in den Medien im Blickfeld der Menschen, im Reden wie im Tun: geile Blicke, plumpe Anmache, eindeutige (oder zweideutige) Bemerkungen, sexuelle Anspielungen, übergriffige Einladungen, schamlose Gesten …
Es ist ein Irrtum, zu glauben, sie hätten keine Wirkungen auf uns Menschen. Das Hirn speichert die Wahrnehmungen und Einflüsse, die Bilder und Fantasien, und zwar in zwei »Depots«: im Unbewussten (dessen Dynamik uns verborgen ist) und im Bewussten (dessen Dynamik augenscheinlich ist).
Es ist meist wirkungslos und zu spät, wenn die Kampagnen gegen sexualisierte Gewalt als Notdienstmaßnahmen, »Löschaktionen« oder Reparaturen in Akutfällen angewendet werden. Deshalb ist eine Prophylaxe von großer Bedeutung, weil sexualisierte Gewalt nicht erst dann zu bekämpfen ist, wenn sie latent oder augenscheinlich auftritt und Schäden bewirkt, die oft irreparabel im Leben der Betroffenen sind. Generell müssen die Wurzeln der Sexualität thematisiert und in das Leben integriert werden.
Das heißt: Zwei »Stränge« der Sexualität sind von Lebensanfang an vorhanden, und zwar die genetisch-biologische durch die Geburt sowie die zwischenmenschlichen durch Kontakte und Beziehungen – in allen Konstellationen.
Deshalb muss in jedem Zeitalter und in jeder Phase des menschlichen Lebens durch respektvolles Verhalten und zwischenmenschliche Zuwendung verhindert werden, dass sexuelle Fehlhaltungen, unwürdige Missstände, menschliche Erniedrigungen oder gewalttätige und kriminelle Verhaltensweisen entstehen und sich entwickeln können: »Wehret den Anfängen!« Und dies geschieht durch menschenfreundliche Grundhaltungen, wie Selbstbewusstsein, Wertschätzung, und gegenseitige Solidarität. Fehlen sie im Umgang miteinander, so verliert das Selbst seinen Halt, werden die Beziehungen brüchig und mutieren im Bereich der Sexualität zu menschenverachtenden Einstellungen sowie perversen und kriminellen Handlungen.
Ein Blick in unsere Kindheit, in zwei mögliche Welten:
Die eine mit Erfahrungen von Wahrgenommenwerden, Geborgenheit, Zuwendung, Zuneigung. Wertschätzung, Schutz, Vertrauen, Ermutigung, Akzeptanz, Entwicklungsförderung, Loslassen, Begrenzen, Unterstützung, Tröstung, Stabilität, Verlässlichkeit, Achtsamkeit, Fürsorge, Selbstbestimmung und
gegenseitiger
Empathie – schlichtweg durch Liebe.
Die andere mit Erfahrungen von Abwertung, Erniedrigung, physischer und psychischer Gewalt, Misstrauen, Strafmaßnahmen, Bloßstellung, Alleingelassensein, Verlorenheit, Angst, Hass, Aggressionen, Erpressung, Drohungen, Verharmlosung – schlichtweg durch Lebenszerstörung.
Dann müssen wir nicht lange rätseln, in welche Richtungen und Auswirkungen jeweils die eine oder die andere Welt führen.
Weil unter der sexualisierten Gewalt zu 90 % die weiblichen Menschen leiden, ist sie mit allen Haltungen, Verhaltensweisen und Aktionen gekoppelt, die die weibliche Emanzipation verhindern oder ihr schaden. Deshalb:
Die Entwicklung der Sexualität, deren gelebte Realität und jegliche Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt müssen mit der Förderung persönlicher und zwischenmenschlicher Emanzipation einhergehen.
Dabei ist zu beachten, dass die naturgegebene Genetik und förderliche Beziehungen zwei Seiten einer Medaille sind, im Wechselspiel zueinander stehen, sich gegenseitig bedingen und je eine eigene Dynamik, eine eigene Plastizität haben. Sie sind die Grundlage jeglicher Entwicklung und gleichsam der »Wirkstoff« für das gesamte Leben. In welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, bleibt offen und hängt von den realen Gegebenheiten, den Motiven des Einzelnen, den gesellschaftlichen Bedingungen, den Zufällen und den Schicksalsereignissen ab.
Teil 1: Sexualität als Sein
In der Konsequenz bedeutet dies: Es gibt keinen Menschen ohne biologische Geschlechtlichkeit.
1. Der Zufall und seine Folgen
Es ist äußerst spannend, den evolutionären Weg von der Ungeschlechtlichkeit zur Geschlechtlichkeit von Lebewesen zu verfolgen:
Die Entstehung der Sexualität ist einer der Hauptfaktoren und gleichzeitig ein Ergebnis der biologischen Evolution. Geschlechtslose Lebewesen, und zwar in Form von Einzellern (z. B. Bakterien), die sich durch Teilung bzw. Spaltung asexuell (vegetativ) fortpflanzen bzw. vermehren, gibt es seit ungefähr 3,5 Milliarden Jahren. Die Fortpflanzung und Vermehrung durch einfache Zellteilung führten fast ausschließlich zu genetisch identischen Nachkommen.
Die Entwicklung von genetisch unterschiedlichen Geschlechtern und Paarungstypen kann als Ausgangspunkt für die Entwicklung höherer Lebewesen angesehen werden. Vermutlich erst vor 600 Millionen Jahren entwickelte sich die Geschlechtlichkeit (Sexualität) von Lebewesen durch die Entstehung weiblicher und männlicher Geschlechtszellen. Am Ende dieser Evolutionsphase ist die Fortpflanzung mit einer Vereinigung und Neuaufteilung der Genome (Gesamtheit aller Träger der Erbinformation einer Zelle) zweier Individuen verbunden. Im Ergebnis führt dies zu genetisch verschiedenen Nachkommen. Sexualität erhöht demzufolge die Variabilität der Individuen einer Population und damit die Fähigkeit zur Anpassung. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei verschiedene Genome vereinigt werden, wird dadurch erhöht, dass es mindestens zwei verschiedene Paarungstypen gibt. Dadurch, dass nur die Genome zweier verschiedener Paarungstypen vereinigt werden können, wird die Vereinigung von identischen Genomen verhindert. Bei den meisten Lebewesen kommen nur jeweils zwei Paarungstypen vor, die im Fall der Ogamie (Vereinigung einer großen unbeweglichen Eizelle mit einer kleinen, meist beweglichen männlichen Geschlechtszelle) als Geschlechter mit männlich und weiblich bezeichnet werden. Die Entwicklung eines durch Hormone gesteuerten Systems war ein weiterer Schritt der Evolution zur Herausbildung sexueller Verhaltensweisen.
Menschliche Geschlechtlichkeit
Der Weg zur Geschlechtlichkeit der Menschen (auch bezeichnet als Menschengeschlecht) war allerdings noch sehr, sehr weit, bis sich Menschenaffen entwickelten, was etwa vor ca. 250.000 Jahren (die Angaben schwanken) stattfand:
»Ob es uns gefällt oder nicht, wir gehören der großen und krawalligen Familie der Menschenaffen an. Unsere nächsten lebenden Verwandten sind Gorillas und Orang-Utans. Am allernächsten stehen uns jedoch die Schimpansen. Vor gerade mal sechs Millionen Jahren brachte eine Äffin zwei Töchter zur Welt: Eine der beiden wurde die Urahnin aller Schimpansen, die andere ist unsere eigene Ur-Ur-Ur-Großmutter.« (Y. Harari, Geschichte der Menschheit, S. 13)
Bei diesem Zitat kommen mir die Meinung bzw. der Glauben von Menschen aus meiner Kindheit in den Sinn: »Wir stammen doch nicht vom Affen ab. Wir sind doch die Krönung der Schöpfung, Gottes Geschöpf.«
Dass die Menschen (Homo sapiens) sich vermehren können, verdanken sie der Zweigeschlechtlichkeit, weiblich und männlich, mit dem evolutionären Ziel der Fortpflanzung. Die gesamten genetischen Informationen sind in jeder einzelnen Zelle des Organismus vorhanden, und zwar in Form von DNA, die in den Chromosomen repräsentiert sind. Bestimmte Chromosomen sind für die Geschlechtlichkeit des Menschen »zuständig«:
Jeder Mensch hat 23 Chromosomenpaare, 22 davon sind bei weiblichen und männlichen Personen äußerlich gleich, das 23. Chromosomenpaar, die Geschlechtschromosomen X und Y, sind genetisch unterschiedlich. Bei einer XX-Paarung entsteht ein weibliches und bei einer XY-Paarung ein männliches Individuum. Treffen Eizelle und Spermium (mit jeweils einfachem Chromosomensatz) aufeinander, kann entweder ein weibliches oder ein männliches Geschlecht entstehen. Die Eizelle bringt ein einzelnes X-Chromosom mit und das Spermium ein einzelnes X- oder Y-Chromosom. Bei der Befruchtung entsteht eine XX- oder XY-Paarung. Das heißt:
Wir alle sind – geschlechtlich – reiner Zufall der Natur. Fast acht Milliarden Erdbewohner haben zweierlei gemeinsam: das Menschsein und die Geschlechtlichkeit weiblich oder männlich.
Von »fließender Identität« (gender-fluid) ist die Sprache, unterschiedlich und vielfältig, weil die sexuellen Verhaltensweisen dynamisch und nicht statisch sind, z. B. eben nicht: einmal Frau, immer Frau, einmal schwul, immer schwul.
Bio-Mediziner erklären diese Entwicklungsverschiedenheit der beiden Geschlechter durch sogenannte Verzweigungen in den ersten Wochen der Embryonalzeit: Weibliche und männliche Zellen berühren sich, nehmen Einfluss auf gegensätzliche Zellen, verbinden sich, mehr oder weniger stark, sodass weibliche und männliche Menschen entstehen, die jedoch nicht immer eindeutig, sondern geschlechtsspezifisch variabel sind und die bei der Weiterentwicklung (intra- und extrauteral) sowie durch Einflüsse von Hormonen und der Umwelt prägend, variabel und veränderbar sind.
Dass bisher lediglich von Mädchen und Jungen die Rede ist, ist auf die gesellschaftliche Vereinbarung zurückzuführen: Die Geschlechtsmerkmale bestimmen das Geschlecht. In Zukunft bestimmt der Einzelne sein Geschlecht selbst, was gar bis zu der Entscheidung gehen kann, kein Geschlecht zu haben, sondern (schlichtweg) Mensch zu sein.
Durch die gewollte oder ungewollte Zeugung, Embryonalzeit und Geburt entstehen wir Menschen, und im Laufe unseres Lebens erleben wir uns in der Spannung zwischen glücklicher Annahme und abgrundtiefer Ablehnung, himmelhochjauchzend und todesbereit, suchend und findend, hin- und hergerissen, bewusst und unbewusst, überzeugt und schwankend, gegenwärtig und zukunftsbange … und inzwischen frei in der Wahl der Geschlechtlichkeit.
Ich bin noch nie auf den Gedanken gekommen, meine männliche Geschlechtlichkeit verändern zu wollen, und stelle mir jetzt vor, wie es mir wohl ginge, wenn ich transsexuelle Veränderungswünsche hätte.
Wie auch immer: Ich bleibe Mensch.
Michael Hatzius jedoch, Kabarettist und Puppenspieler, durch seine Figur ECHSE bekannt geworden, lässt diese zum Publikum sagen: »Sie haben es leicht, weil Sie es nur mit einer Art zu tun haben, nämlich dem MENSCHENgeschlecht. Ich habe es da viel schwerer, weil ich ein TIER bin und mit vielen Arten zurechtkommen muss.« Das gibt zu denken.
Der Prozess
Schon im Mutterbauch haben wir Empfindungen und spüren »Lebendigkeit«. Irgendwann nach der Geburt beginnen wir wahrzunehmen, dass wir »jemand« sind, dass es viele andere Jemands neben uns gibt – und nun beginnt ein Prozess in verschiedenen Stufen und in unterschiedliche Richtungen:
Nach unseren Wahrnehmungen schließen sich möglicherweise beliebige oder genaue und teilweise gezielte Beobachtungen an. Daraus können unterschiedliche Erfahrungen, Kenntnisse und Erkenntnisse entstehen, die Empfindungen und Gefühle, Zustimmungen, Verunsicherungen und Ablehnungen auslösen. Wir erkennen die vielfältigen Unterschiede von uns Menschen (Aussehen, Prägungen, Verhaltensweisen, Haltungen u. a. m.). Wir beginnen zu vergleichen, wir bewerten, wir entscheiden und gelangen schließlich zu eigenen Erkenntnissen, Handlungen und Identitäten bezüglich unseres Seins und Lebensstils und vor allem unserer sexuellen Orientierung – als kleines Kind, als Mädchen und Jungen, als Frau und Mann, als Ältere und Alte und schließlich als Hochbetagte in der Dynamik von Stabilität und Instabilität, Beibehaltung und Veränderungen, Umwandlungen und Zerrissenheit, physisch und psychisch.
Dieser Prozess ereignet sich ein Leben lang, vom ersten bis zum letzten Atemzug, betrifft also alle Menschen, in jeder Zeit und jeder Lebensspanne, und findet sowohl in uns selbst als auch inmitten unserer Umwelt statt. Er ist durch unsere Begegnungen mit Menschen beeinflusst, am stärksten durch die Erziehung, durch unsere Erlebnisse und Erfahrungen, durch glückliche Momente und liebevolle Beziehungen, durch schmerzliche Trennungen, schockierende Krankheiten, traumatische Schicksalsschläge, durch kulturelle und politische Ereignisse und durch Veränderungen in der Natur und globale Krisen (das jüngste Beispiel: die Coronapandemie!).
Die einzige Konstante in unserem Leben sind die Veränderungen in unserer inneren und äußeren Welt.
In diesem Prozess erfahren wir, dass wir entweder weibliche oder männliche Menschen und nur dann divers sind, wenn diese Merkmale nicht genau bestimmbar sind. Dies sind biologische Bezeichnungen. Alle anderen, wie Frau und Mann, Knechte und Mägde, Untertanen und Könige, Herrscher und Sklaven, sind gesellschaftliche Benennungen:
»Die meisten Gesetze, Regeln, Rechte und Pflichten, die Männlichkeit und Weiblichkeit definieren, haben mehr mit der menschlichen Fantasie zu tun als mit der biologischen Wirklichkeit […]. Der Mann ist vielmehr ein männlicher Angehöriger einer erfundenen männlichen Geschlechtsordnung […]. Eine Frau ist vielmehr eine weibliche Angehörige einer erfundenen menschlichen Ordnung […]. Das biologische Geschlecht ist Kinderkram, aber das gesellschaftliche Geschlecht ist eine todernste Angelegenheit.« (Y. Harari, S. 186 f.) Und Simone de Beauvoir betont 1945, mit 37 Jahren: »Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht.«
Historisch betrachtet werden die weiblichen Menschen gegenüber den männlichen Menschen bis auf den heutigen Tag zumeist persönlich, familiär, sozial, gesellschaftlich, beruflich, wirtschaftlich und politisch benachteiligt – und müssen zwangsweise hierarchisch leben und feministisch kämpfen.
Hierarchie hat »in allen bekannten Gesellschaften eine zentrale Rolle gespielt: die Hierarchie der Geschlechter. In jeder Gesellschaft gibt es Männer und Frauen, und in jeder, aber auch in jeder Gesellschaft werden Männer gegenüber Frauen bevorzugt.« (Y. Harari, S. 180 ff.).
Einige Beispiele
Das Patriarchat »lässt grüßen«, offen und durch manche Hintertür.
Ein gravierendes Beispiel aus dem Bereich der deutschen Politik (ab dem Jahr 1949) zeigt diese Haltung. T. Körner, Journalist, hat ein Buch mit dem Titel veröffentlicht: In der Männer-Republik. Wie Frauen die Politik eroberten (Köln 2020): »Viele Jahrzehnte waren Frauen im politischen Betrieb eine Ausnahme. Politik war Männersache.« (U 2) Im ersten Kabinett Adenauer war keine Frau vertreten, und bis zum heutigen Tag sind sie in der Politik in erheblicher Minderheit. Der Autor weist nach, was Frauen in der Politik ertragen, erdulden, erleiden mussten: Ignoranz, Hohngelächter, Bloßstellungen, Abwertungen, Erniedrigungen, verbale und gestische Missachtungen, und wie sehr sie um ihre Gleichberechtigung kämpfen mussten.
Um jedoch nicht einseitig zu sein: Männliche Menschen leiden ebenfalls unter dieser Herrschaft, weil sie nicht so sein wollen und nicht so sind wie ihre männlichen Mitmenschen. Ihre Gene und Sozialisationen weisen u. a. auf Sozialfähigkeit, Empathie, Kooperation hin, während die Gene und Sozialisation der ehrgeizigsten, aggressivsten und konkurrenzfähigsten Männer nach wie vor die Oberhand behalten:
»Wie kam es, dass eine vermeintlich kooperativere Gruppe, nämlich die Frauen, von einer vermeintlich weniger kooperativen Gruppe, nämlich den Männern, beherrscht wird? Das ist die große Frage in der Geschichte der Geschlechter, und auf sie haben wir bislang keine überzeugende Antwort.« (Y. Harari, S. 195, 197)
Aus dieser Ungleichheit im zwischenmenschlichen Umgang entstand das Bemühen der Frauen um Gleichheit in Form der sogenannten Emanzipation, ursprünglich »die Entlassung des Sohnes aus der Gewalt des Vaters bzw. die Freilassung von Sklaven« (!) mit dem späteren Bedeutungswandel, die patriarchalische Struktur zu brechen. Es brauchte also keine Emanzipation, wenn die Gleichwertigkeit und Gleichstellung der weiblichen und männlichen Menschen Realität wären.
Deshalb musste es das Bestreben von Männern sein, sich als Mann so zu geben und zu verhalten, dass Frauen ihnen gegenüber nicht in den Zugzwang kommen, sich emanzipatorisch verhalten zu müssen. Autonom und authentisch zu sein, ist bereits schwer genug.
Viele Lehrpersonen sagen (sich) immer noch, dass sie die Schüler:innen
gleich
behandeln. Meine Antwort darauf lautet: Bitte nicht, denn Sie haben immer Ungleiche vor sich, die ungleich (= individuell) behandelt werden wollen.
Die Entscheidung
Die Geschichte, die Politik, die gesellschaftlichen Prozesse, die Literatur und andere Künste, die Alltagserfahrungen zeigen uns gelungene Beziehungen, erfüllte Paarschaften, dauerhafte und gescheiterte Verbindungen, glückliche Konstellationen, Wirrungen und Irrungen bei Trennungen.
All das begegnet uns im Leben, sodass das Ja und Nein zum eigenen Geschlecht, die Fragezeichen, die Zweifel und die Änderungen unsere Begleiter sind. Letztlich geht es um die Übereinstimmung unseres Selbst mit der wie auch immer gearteten Natur oder im Widerspruch zu ihr und, um im Bild zu bleiben: Ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit oder ich schwanke ständig von einem Bein zum anderen und bin dadurch grundsätzlich instabil, körperlich wie seelisch.
Das Ja zum eigenen Geschlecht bedeutet jedoch nicht, den unnatürlichen Himmel auf der natürlichen Erde zu haben. Die Natur kennt Wachstum, Entfaltung, Unterschiedlichkeiten, Leben, Überleben und Sterben, Konstruktion und Destruktion, Essen und Gefressenwerden, sodass die Entscheidung hin zur eigenen Natürlichkeit bisweilen extrem schwerfällt zwischen den extremen Polen Suizid (das Nein zum Leben) und Selbstakzeptanz (das Ja zum Leben), in welchem »geschlechtlichen Gewand« auch immer.
Das Glück und das Unglück
Sie sind die beiden Eckpfeiler im Spannungsfeld der Möglichkeiten, die eigene Sexualität als Seinsweise zu betrachten, zu reflektieren und entsprechend zu verwirklichen. Zwischen ihnen gibt es eine Fülle von Variationen, die alle subjektiv im Fluss des Lebens, in Augenblicken und Langzeitversionen, häufig gekoppelt mit der Frage nach dem Sinn des Lebens und dessen Bejahung oder Verneinung, angesiedelt sind.
Bereits die biologische Betrachtung im Vergleich weiblich–männlich legt den Schluss nahe, die weibliche Version sei benachteiligt bzw. belasteter (Menstruation, Schwangerschaft, Geburt, Erziehung, Wechseljahre) als die männliche. Dies ist aber nicht der Fall, wenn man die Fülle in der Verschiedenheit an Befragungen und Meinungen wahrnimmt und zusätzlich die physischen, psychischen, sozialen, familiären, beruflichen, gesellschaftlichen, politischen und historischen Ursachen in Betracht zieht.
Sie zusammen ergeben ein Gesamtbild, das eindeutig zeigt, dass die subjektiven Entscheidungen der weiblichen und männlichen Menschen universale Ausmaße annehmen: für die einen Glück, für die anderen Unglück, Wunderbares und Katastrophe, herbeigesehnt und verflucht, selbstverständlich und irritiert, Gottes Geschenk und schicksalsträchtig, gegeben und erduldet, akzeptierter Zufall und ereigneter Unfall.
Die biologischen Tatsachen werden allerdings zunehmend von Menschen durchbrochen, umgangen oder durch zwei Arten der »Geschlechterumwandlung« verändert:
a) äußerlich: mittels Transvestismus (trans: hinüber, vestire: kleiden): Durch entsprechende Kleidung, Accessoires, Aussehen, Gestik u. a. wird die Wandlung in das jeweils andere Geschlecht vollzogen.
b) innerlich: mittels Transsexualität. Durch medizinische/operative Behandlungen (2019: 2.324 Umwandlungen in der BRD) mutiert das bisherige Geschlecht bleibend in das Gegengeschlecht.
Die Motive von Menschen für ihre geschlechtliche Umwandlung sind biologischer, rationaler und emotionaler Natur und werden von der isie umgebenden Umwelt beeinflusst.
Vermutlich werden die Errungenschaften, Forschungen und Techniken der Genetik es ermöglichen, dass sich die geschlechtlichen Abhängigkeiten reduzieren, sodass sich die persönlichen Orientierungen und Wünsche dadurch verändern bzw. entsprechend erfüllt werden können.
Die fast acht Milliarden Menschen auf unserer Erde sind mit ihrer eigenen Geschlechtlichkeit konfrontiert. Sie können sie im Prozess ihres gesamten Lebens negieren, thematisieren, bejahen oder verneinen und (im Rahmen der Möglichkeiten) dann entscheiden, wie sie ihre Geschlechtlichkeit in ihre Persönlichkeit integrieren.
Ein bedeutsames Phänomen ist in diesem Zusammenhang das SELBSTbewusstsein und als Folge die Selbstbestimmung, die gleichsam die Führungsrolle auf dem Weg zu Klärungen, Entscheidungen und entsprechenden Verhaltensweisen übernehmen.
2. Selbstbewusstsein und Respekt
In den nächsten drei Abschnitten geht es um sechs zwischenmenschliche Haltungen: Selbstbewusstsein, Respekt, Wertschätzung, Empathie, Erziehung und Beziehung, die alle zentrale Bedeutung für die Gestaltung und das Zusammenleben von uns Menschen haben.
Faktisch gibt es immer noch keine übergreifende Menschensolidarität (und dies als Artgleiche), sondern eine Solidarität zwischen Frauen als Unterdrückte und zwischen Männern als Unterdrücker, ganz abgesehen von den Feindseligkeiten und Kriegen seit Jahrtausenden unter den Menschen generell.
Die Haltungen im Bereich der Kommunikationen, die ich im Folgenden ausführe, beziehen sich deshalb auf die weiblichen und männlichen Menschen, mit dem Ziel, zu zeigen, wie anstelle der Geschlechterkriege mit Siegern und Verliererinnen Solidarität der beiden Geschlechter untereinander zu erreichen ist, einschließlich der Konsequenz, auch sexuelle Gewalt einzugrenzen und zu minimieren.