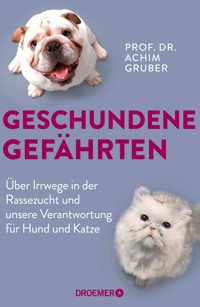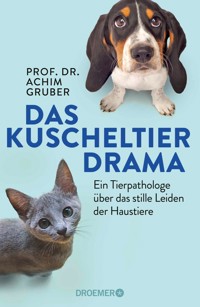
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"312 Seiten, die nicht nur etwas über Tiere verraten, sondern noch mehr über die Gesellschaft." Süddeutsche Zeitung "Wir lieben unsere besten Freunde krank und zu Tode – weil wir sie züchten und halten, wie es uns gefällt, und nicht, wie es gut für sie wäre. Es ist höchste Zeit, die Opfer, die wir unseren Haustieren abverlangen, zum Thema zu machen!" sagt der Tier-Pathologe Achim Gruber, der aufklären will über Tierwohl und artgerechte Haltung - nicht anklagen. Der SPIEGEL-Bestseller endlich im Taschenbuch. In fast jedem zweiten deutschen Haushalt leben Haustiere. Wir lieben unsere Hunde, Katzen, Kaninchen, Vögel, Fische, Pferde und Exoten, wir verwöhnen sie, und sie werden Freunde und Lebensbegleiter, wir tun scheinbar alles für das Tierwohl. Doch die zunehmende Nähe birgt auch Gefahren für beide, Haustier und Mensch, und oft bleiben artgerechte Haltung und das Tierwohl auf der Strecke. In seinem Sachbuch-Bestseller spricht der Tier-Pathologe und -Forensiker Prof. Dr. Achim Gruber erstmals über seine Erfahrungen bei der Obduktion am Seziertisch. Er klärt auf, gibt Tipps zur Vermeidung von Fehlern und kritisiert leidvolle Trends in unserer oftmals wenig artgerechten Haustier-Haltung. Jährlich kommen tausende Haustiere auf mysteriöse Weise zu Tode. Sie werden Opfer von Gewaltverbrechen, Vernachlässigung oder einfach Unkenntnis. Altbekannte Killer-Keime schlagen zu, weil wir sie nicht mehr im Blick haben, und neue kommen durch Hunde-Import, Globalisierung und Klimawandel hinzu. In unseren Wohn- und Kinderzimmern lauern so auch Gefahren für uns Menschen, und manchmal bringen wir Haustiere durch Erreger um, die wir auf sie übertragen. Gleichzeitig werden Haustiere zu chronisch kranken Krüppeln herangezüchtet, als Waffe oder Statussymbol missbraucht oder aus falsch verstandener Tierliebe unbewusst gequält. Niemand kennt diese dunkle Seite der Haustier-Haltung besser als Prof. Achim Gruber. Er leitet die Tier-Pathologie der Freien Universität Berlin und berichtet spannend, lehrreich und unterhaltsam von Tier-Schicksalen, die unter die Haut gehen: Hunde, die blind und taub gezüchtet, Nackt-Katzen, die tätowiert, und Pferde, die gedopt werden. Professor Grubers bewegende Tier-Geschichten aus dem Obduktions-Saal zeigen, wie es wirklich um die Beziehung der Deutschen zu ihren Haustieren steht. Denn Achim Gruber ist ein leidenschaftlicher Anwalt der Tiere, der vor allem aufklären möchte, wie das Verhältnis des Menschen zu seinem Haustier sorgloser gelingen kann.Sein Ziel: das artgerechte Zusammenleben von Mensch und Tier - denn nur so ist das Tierwohl sicher. "Bei Professor Achim Gruber geht es zu wie beim Sonntagskrimi." Der Tagesspiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Prof. Dr. Achim Gruber
mit Shirley Michaela Seul
DAS KUSCHELTIERDRAMA
Ein Tierpathologe über das stille Leiden der HaustiereMit einem Vorwort von Michael Tsokos
Illustrationen von Linus Beckmann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In Deutschland werden rund 30 Millionen Haustiere gehalten. Sie werden von ihren Besitzern geliebt und verwöhnt, sind beste Freunde und vielfach auch Lebensbegleiter. Doch jährlich kommen tausende Haustiere auf mysteriöse Weise zu Tode. Sie werden zu chronisch kranken Monsterwesen herangezüchtet, als Waffe oder Statussymbol missbraucht, vernachlässigt oder aus falsch verstandener Tierliebe oder Egoismus gequält.
Keiner kennt diese dunkle Seite der Tierhaltung besser als Prof. Achim Gruber. Er leitet die Tierpathologie der Freien Universität Berlin und berichtet in seinem Buch von Tierschicksalen, die unter die Haut gehen. Seine bewegenden Geschichten aus dem Obduktionssaal zeigen, wie es wirklich um die Beziehung der Deutschen zu ihren Haustieren steht.
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Motto
Vorwort
Eröffnung
Auf der Fährte des Tierpathologen
Ein kurzer Blick auf die Tierpathologie
In der Praxis
Aufschneider
Erweiterte Euthanasie
Wenn Tier und Mensch Tisch und Bett teilen
Teilen verboten
Metamorphosen
Im Sektionssaal
Die »Braut des Pathologen«
Kampfhunde an der Leine
Ausgestopft
Promi-Leichen
Angeklagt
Die Schönheitskönigin
Die fünf Fragen des Richters
Der Schuss
Weidmannsheil
Fehlschuss
Das Urteil
Das Pferd unter der Decke
Veterinärpolizei
Abgenagt
Kannibalismus
Falsche Tierliebe
Angesteckt
Wenn Zebras Eisbären töten
Im Herzen und in Hendra
Der Klub der tödlichen Vier
Viren
Bakterien
Parasiten
Pilze
Der Todeskuss
Der Preis der Freiheit
Der Wurm drin
Die gefährlichste Parasitenzoonose Mitteleuropas
Der Fuchsbandwurm im Menschen
Andenken mit tödlichen Folgen
Der Dackel und das Stöckchen
Der Maulkorb
Angezeigt
Tollwut!
Der Taubenkrimi
Trojanische Zysten
Boten der Menschheit
Heimliche Jäger
Der Seher von Old Europe
Tot geglaubt lebt länger
Der unglückliche Felix
Tödliche Pickel
Lepra im Wartezimmer
Vom Schwinden der Schwindsucht: Tuberkulose
Angehustet
Zurück zur Natur
Reinrassige Irrwege
Beste Freunde?
Eine kurze Geschichte der Hundezucht
Deutsche Schicksale
Krummbeiner
Herzhusten
Die doppelte Witwe
Ein Hund wie mein Mann
Zwei gebrochene Herzen
Atemlos durch Tag und Nacht
Die Wahl der Qual
Das baumelnde Auge
Am Ende
Ihr Hund hat Mops
Nur Gehirn
Schönheit muss leiden
Nasentruppe und Sportmöpse
Germany’s Next Top Dog
Zuchtziel: Mangel
Und noch mehr Menschwerdung
Kindchenschema und paradoxes Helfersyndrom
Der Weißtiger
Merle-Faktor
Mendeln – gewusst, wie
Wohnzimmervermehrer und freie Liebe
Namenlos
Vier Sünden
Im Gruselkabinett der Zuchterfolge
Inzest
Beliebte Vererber
Flaschenhälse
Eine Nachkriegsliebe
Tödlicher Kopfschmerz
Jagd vorbei
Vollgemüllt
Im Dschungel der Gene
Monster, Mumien und Mutanten
Zucht ohne Ordnung
Tierwohl in Menschenhand
Gespaltene Züchterwelt
Federhauben
Mutter Courage
Sehnsucht nach Adel
Designerrassen
Genwissenschaften in der Heimtierwelt
Im Spiegel
Nachwort zur Taschenbuchausgabe
Dank
Leseempfehlungen und Auszug aus der genutzten Literatur
Die »Tiergeschichten« in diesem Buch haben sich so oder so ähnlich zugetragen. Namen und Orte wurden verändert, um Tiere und Personen zu schützen.
Wegen der überwiegenden Zahl von Frauen im tierärztlichen Beruf wird in diesem Buch die weibliche Form »Tierärztin« stets für beide Geschlechter verwendet.
Die in diesem Buch dargestellten Bewertungen sind Standpunkte des Autors und nicht unbedingt der Freien Universität Berlin.
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.
Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen.
Aus § 1 und § 2, Tierschutzgesetz
Vorwort
Es ist noch keine zwei Jahre her, dass ich einen Vormittag mit Achim Gruber in dem von ihm geleiteten Institut für Tierpathologie der Freien Universität Berlin verbringen durfte.
Als Rechtsmediziner mit über zwei Jahrzehnten praktischer Erfahrung an Tatorten und in Sektions- und Gerichtssälen ist mir eigentlich nichts Skurriles und Bizarres mehr fremd, was Menschen sich und ganz besonders anderen Lebewesen antun, egal wie ungewöhnlich und schräg diese Geschichten auch sind. Das dachte ich zumindest.
Und dann wurde ich an diesem Vormittag in Berlin-Dahlem eines Besseren belehrt. Denn diesmal war nicht ich es, der spannende Geschichten aus seinem Berufsalltag erzählte und mein Gegenüber lauschte verblüfft und sprachlos, was da wohl noch alles kommen würde. Nein, diesmal war es genau andersherum. In diesem Moment war ich es, der staunend nicht genug von den Geschichten bekommen konnte, die Achim Gruber mir von seinen Begegnungen mit seinen vierbeinigen, gefiederten oder schwimmenden Patienten erzählte und von seinen Schilderungen der Untersuchung ihrer toten Körper, knöchernen Überreste oder der mikroskopischen Spuren ihrer winzig kleinen Killer.
»Tierpathologen lösen auch Kriminalfälle«, schreibt Gruber. In der Tat, forensische Fragestellungen werden auch in der Tierpathologie bearbeitet. Und das hat seine absolute Berechtigung. Das weiß ich spätestens, seit ich vor fünfundzwanzig Jahren das erste Mal, und dann immer wieder, in der Rechtsmedizin mit entsprechenden Fragestellungen konfrontiert wurde, die ich in meinen Anfangsjahren, damals noch in Hamburg, gemeinsam mit einem Hamburger Tierarzt bearbeitete:
Von wem wurde das Reh mit einem Speerwurf getötet; gibt es vielleicht DNA-Spuren des Täters am Speer? Wurde der auf einem Bahndamm gefundene verbrannte Igel mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet oder Opfer eines Waldbrandes in der Nähe, von wo er sich noch wegschleppte? Hätte der von einem Polizeibeamten erschossene Bullterrier den ersten Schuss in sein linkes Vorderbein überlebt, wenn der Beamte nicht noch sechs weitere Schüsse auf den Kopf des nach dem ersten Schuss schon handlungsunfähigen Tieres abgefeuert hätte? Ist der Dackel erfroren oder eines natürlichen Todes gestorben, nachdem er von seinem überdrüssigen Besitzer bei Minusgraden an einer Landstraße ausgesetzt wurde?
Dass ich als Rechtsmediziner, dessen Profession es ist, unklare oder gewaltsame Todesfälle von Menschen aufzuklären, mit der Untersuchung von Tierkadavern beauftragt wurde, basierte damals offenbar auf der Unkenntnis meiner Auftraggeber über die Profession der Tierpathologen. Tierpathologen sind speziell ausgebildet für Tierkrankheiten, vergleichende Medizin zwischen den Arten und die besonderen Gesetzesvorschriften, die für die Bewertung von Gewalt an Tieren andere Regeln bereithalten als etwa die bei Gewalt am Menschen in Deutschland angewendete Strafprozessordnung.
Achim Gruber nimmt uns mit an die Schauplätze seiner Geschichten, wir blicken ihm im Sektionssaal über die Schulter und mit ihm gemeinsam durchs Mikroskop. Ich habe bei der Lektüre dieses Buches, aus der Perspektive des Tierpathologen und -forensikers, einen ganz neuen Blickwinkel auf Abgründe in unserer Gesellschaft kennengelernt, und ich habe viele Ähnlichkeiten bei der Arbeit und Vorgehensweise von Tierpathologen und Rechtsmedizinern erkennen können.
Auch der Tierpathologe schaut bei den Fragestellungen, die er bearbeitet, wie der Rechtsmediziner, ständig über den Tellerrand seiner Profession. Gruber sezierte 2011 im Team den über die Stadtgrenzen Berlins hinaus bekannten Eisbären Knut. Drei Jahre zuvor, 2008, obduzierte ich in der Berliner Rechtsmedizin seinen Pflegevater, den Tierpfleger, der das von seiner Mutter nach der Geburt verstoßene Eisbärbaby Knut von Hand aufzog. Der Mensch und das Tier. Beide verdienen eine Klärung ihrer Todesumstände und Todesursachen.
Achim Gruber erzählte mir in seinem Institut seine tierischen Erlebnisse und Projektionen auf die menschliche Gesellschaft in einer ihm eigenen, leichten und lockeren Art, die er auch in diesem Buch anschlägt und mit der er immer den richtigen Ton findet, auch wenn es um tragische, grausame und bestürzende Details seiner bewegenden Fälle geht. Aus jedem Kapitel in diesem Buch klingt ein sehr humaner Ansatz Grubers heraus, mit den animalischen Geschichten umzugehen. Und insofern glaubt man ihm sofort, wenn er zum Schluss seines Buches reflektiert, dass die Art, wie wir mit Tieren umgehen, den Grad unserer Humanität widerspiegelt. Wobei diese Aussage ohne Abstriche für unseren Umgang mit allen Schwachen und Schwächsten unserer Gesellschaft Gültigkeit hat – nicht nur im Tierreich.
Michael Tsokos
Eröffnung
»Du, der hat da doch was.«
»Was soll der haben?«
»Doch, fühl mal. Da ist doch ein Knubbel.«
»Hm. Stimmt. Seltsam, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dabei kraul ich ihn jeden Tag.«
»Das fühlt sich echt komisch an. Geh mal lieber zur Tierärztin.«
Wir lieben unsere Haustiere, aber weil wir Menschen sind, machen wir Fehler im Umgang mit ihnen. Manche Begleittiere erheben wir auf die Stufe von menschlichen Gefährten, wenngleich es für ihr Wohl oft besser wäre, sie ihrer tierischen Natur entsprechend zu behandeln. Das würde auch einige Krankheiten vermeiden, unter denen Haustiere heute leiden. Denn sie sind uns anvertraut und ausgeliefert, sie sind von uns abhängig – zuweilen auch vom Geldbeutel des Halters. Wir entscheiden über sie in der Hoffnung, das Beste für sie zu wählen. Dabei wissen wir häufig nicht gleich, was das Beste ist. Manchmal machen wir den Fehler, zu glauben, was für uns gut ist, was wir mögen, gefällt auch dem Tier. Und irren dabei. An Tierliebe und guter Absicht, auch Moral, mangelt es den meisten von uns nicht, eher an Wissen und konsequentem Handeln.
Unsere Beziehung zu und unser Umgang mit Tieren sind auch Spiegel unserer Gesellschaft und stehen – heute vielleicht mehr denn je – unter dem Einfluss des Zeiten- und Kulturwandels. Unsere freie Zeit, unser Wohlstand und unsere Bedürfnisse, die in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen nicht immer ganz erfüllt werden, haben unser Verhältnis zu unseren tierischen Freunden in den letzten Jahren und Jahrzehnten geprägt wie nie zuvor. In unserer modernen Gesellschaft haben wir für die Grundanstrengungen der Menschheit, die unsere Evolution und damit unsere Biologie und unser Verhalten bestimmten, den Autopiloten eingeschaltet. Nahrungsbeschaffung, Vermeidung von Krankheit und Schutz vor Gewalt dominieren unseren Alltag in der Regel nicht mehr. Die so verfügbar gewordene Zeit, auch wenn wir gern klagen, sie sei zu knapp, können wir mit angenehmeren Dingen verbringen: mit Kultur, Hobbys, Sport und natürlich mit unseren Tieren. Manchmal kommen sie im Alltagsstress zu kurz, manchmal erhalten sie zu viel Aufmerksamkeit. Ja, für einige Menschen sind ihre Haustiere die wichtigsten Geschöpfe auf Erden, ihre Lebensgefährten, und zuweilen sollen sie die Einsamkeit des Menschen lindern. Damit bürden wir unseren tierischen Freunden eine Last auf, weil sie ihrem Wesen nach nicht anstreben, partnerschaftlich auf gleicher Ebene mit Menschen zu leben. Partnerschaftlichkeit und Augenhöhe sind keine Generaltugenden, auch nicht im Wolfsrudel, dort geht es um Hierarchien, Beutegemeinschaft und Rollenverteilung. Hinzu kommt, dass Hund und Mensch recht unterschiedliche Vorstellungen von Höflichkeit haben. Im Umgang mit einem Hund empfiehlt sich Kürze und Klarheit – er wird uns dennoch nicht als verroht wahrnehmen. Im Gegenteil: Wenn wir ihm menschliche Verhaltensweisen entgegenbringen und im Gegenzug dieselben erwarten, säen wir Missverständnisse. Tiere sind keine Menschen – wobei sie den Platz auf dem Sofa natürlich nicht zurückweisen. Doch werden unsere Kuscheltiere zum Ersatz für fehlende Sozialpartner, so bekommt ihnen das nicht immer gut.
Als Tierpathologe bin ich auch Zeitzeuge einer Gesellschaft, in der das Spektrum von abgöttischer, oft blinder Tierliebe bis hin zur verabscheuungswürdigen Ausbeutung reicht. Als Leiter des Instituts für Tierpathologie an der Freien Universität Berlin blicke ich auf ein breites und vielfältiges Tätigkeitsfeld, und manchmal auch in Abgründe des Mensch-Tier-Verhältnisses. Von Fischen über Vögel zu Reptilien und Panzernashörnern; ich arbeite mit Zootieren, Exoten, Versuchstieren, landwirtschaftlichen Nutztieren und natürlich Haustieren, von denen ich in diesem Buch am meisten erzählen werde.
Warum gerade Haustiere? Das lässt sich leicht erklären. Nutztiere stehen in den letzten Jahren regelmäßig im Fokus der kritischen Berichterstattung und betreffen einen wichtigen Teil der Mensch-Tier-Beziehung, die sich ständig im Wandel befindet. Unsere Heimtiere aber, mit denen wir uns täglich umgeben, leiden ebenfalls unter uns, wenn auch oft im Verborgenen. In diesem Buch geht es um die Albträume bei uns zu Hause, nicht um das Leiden in Ställen oder Versuchstierhaltungen. Niemand bricht in ein Wohnzimmer ein und filmt Haustierelend. Auf dem Sektionstisch jedoch offenbaren sich Schicksale, die oft ungewollt oder fahrlässig, manchmal aber auch bewusst und absichtlich durch Menschenhand herbeigeführt wurden – Vernachlässigung, Qualzucht, Doping und Gewalt bis hin zur Sodomie.
Und ja, Tierpathologen lösen auch Kriminalfälle. Hat der Nachbar die Katze vergiftet, oder ist sie eines natürlichen Todes gestorben? Ist beim Tod des hoch lebensversicherten Zuchthengstes nachgeholfen worden? Hat der verstorbene Welpe seine tödliche Erkrankung vom Züchter mitgebracht oder sich erst bei seinen Besitzern angesteckt? Lag ein Behandlungsfehler der Tierärztin vor? In solchen und vielen anderen Streitigkeiten werde ich von Gerichten als Gutachter bestellt.
In fast jedem zweiten deutschen Haushalt lebt ein Haustier, Tendenz deutlich steigend. Wir halten rund 34 Millionen von ihnen, darunter fast 14 Millionen Katzen und mehr als 9 Millionen (steuerlich gemeldete) Hunde. Dazu zählen auch 6 Millionen zumeist in Kinderzimmern wohnende Kleintiere wie Kaninchen, Hamster, Chinchillas und Meerschweinchen sowie gut 5 Millionen Ziervögel. Rund eine Million Pferde kommen in Freizeit und Sport zum Einsatz. Darüber hinaus tummeln sich in 4 Millionen deutschen Aquarien, Terrarien und Teichen etwa 100 Millionen Fische und Reptilien. Alle diese Tiere stehen unter dem besonderen Schutz des Tierschutzgesetzes. Als Tierpathologe gehört es zu meinen Aufgaben, Missstände aufzudecken und Tierqualen auf die Spur zu kommen. Das ist nicht immer einfach, es erfordert manchmal auch detektivischen Spürsinn.
Aus Tieren als Subjekten der Natur haben wir über die letzten mehr als zwanzigtausend Jahre Objekte des Menschen gemacht. Tiere werden als Wirtschaftsgüter gehandelt, als Pelz getragen und verzehrt. Wilde Tiere leiden unter den Folgen der Globalisierung und des Klimawandels. Heute wie nie zuvor perfektionieren wir diese Prozesse auf allen Ebenen. Aus herrschaftlichen, freien Kreaturen wurden Untertanen. Wie heißt es in der Bibel: »Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: … Machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Getier, was auf Erden kriecht.« (1. Mose 1,28) Als Zeitzeuge am Obduktionstisch bekomme ich oft in erschreckender Weise zu sehen, was das heißen kann. Das Mikroskop des Tierpathologen ist auch ein Kaleidoskop in die Mensch-Tier-Beziehung.
Wir Obertanen entscheiden über unsere Untertanen. Bekommen sie eine Wurmtablette, eine neue Hüfte, oder müssen sie mit der alten kriechen, kriegen sie Zahnbehandlung, eine Chemotherapie oder Euthanasie? Wir schöpfen aber auch großen Wert aus diesen »Untertanen«, denn Tierhalter leben gesünder. Der Kontakt mit Haustieren wirkt sich günstig auf Blutdruck, Kreislauf und die Gemütslage aus, und wer einen Hund hält, wird sich öfter an der frischen Luft bewegen. Und Tiere halten ihr Fell für uns hin. Nicht nur auf dem Teller, in der Forschung und in Kriegen, sondern auch jeden Tag in unseren Wohnzimmern und Tierarztpraxen. Wären Tiere und Menschen wirklich gleichberechtigt, wie manche Tierrechtler fordern, müssten Tiere ganz anders behandelt werden.
Auch ich wünsche mir einen fairen Umgang mit unseren tierischen Freunden, doch dieser kennzeichnet ein Dilemma. Unsere heutige Gesellschaft bejaht das Leid der Tiere zum Nutzen der Menschen. Das Paradoxe ist, dass wir zwar Krankheiten bei Tieren heilen, dass wir Tiere aber oft auch krank machen, indem wir ihnen Gutes tun wollen oder nur an unser eigenes Wohl denken, indem wir uns Menschen als Krone der Schöpfung sehen. Während wir uns selbst in mancher Beziehung dem Status von Göttern annähern, erheben wir Tiere in den Menschenstand und fügen ihnen damit Leid zu. Der Untertan wird dann zum Obertan und sitzt neben Frauchen auf dem Sofa, bestimmt den Tagesablauf und teilt des Nachts das Bett – wenn auch heimlich. Denn wer gibt so was schon zu? Hunde gehören nicht in Menschenbetten, zumindest in der Theorie.
Manches »tierunliebe« Verhalten mag zwingend notwendig sein, anderes geschieht vielleicht nur aus Gewohnheit und vieles aus Unwissenheit. Aus Unwissenheit tun Menschen Tieren auch Schreckliches an. Manchmal, wenn ich an meinem Mikroskop sitze und schlechte Nachrichten für Patienten und Besitzer erspähe, frage ich mich, wie man dieses Leid durch frühzeitige Aufklärung hätte vermeiden können. Unwissenheit möchte ich, so gut ich kann, mit diesem Buch beseitigen und Ihnen den einen oder anderen Tipp an die Hand geben, wie Sie jeden Tag und besonders im Krankheitsfall mit Ihrem Tier fair, artgerecht und zum Wohle aller Beteiligten umgehen können.
Im Folgenden schildere ich beispielhafte Einzelschicksale meiner tierischen Helden. Aus der Perspektive des Pathologen mit Sezierbesteck und Mikroskop blicke ich auch auf die Hintergründe des Umgangs mit den Tieren, die wir als Haustiere in unsere Familien aufgenommen haben. Drei separate Themenbereiche spiegeln aus verschiedenen Blickwinkeln die dynamischen Veränderungen dieser Mensch-Haustier-Beziehung über die letzten Jahrzehnte.
Zunächst werden tierische Kriminalfälle dokumentiert, die ich als forensischer, also gerichtsmedizinischer Gutachter begleiten durfte. Das Spektrum reicht von mysteriösen Todesfällen über brutale Tierquälereien bis hin zu Kannibalismus, Mord und Totschlag.
Darauffolgend rücken uns Infektionskrankheiten auf den Pelz, die durch die immer engeren Kontakte zwischen Tier und Mensch zwischen den Arten übertragen werden. Manche tierischen Erreger befallen uns Menschen, und nicht weniger Killerkeime halten wir selbst für unsere Heimtiere bereit. Durch Globalisierung und Klimawandel importieren wir zusätzlich neue und tödliche Infektionen aus den entlegensten Regionen der Erde in unsere Wohn- und Kinderzimmer. Wie wir uns davor schützen können – auch das ist Thema dieses Buches, in dem es mir um das Tier- wie um das Menschenwohl geht.
Abschließend melden sich Opfer von falsch verstandener Züchtung zu Wort. Denn wir formen unsere Kuscheltiere, wie es uns gefällt, und übersehen das Leid, das wir ihnen damit antun – Liebe, die weh tut. Unsere Weste ist in Bezug auf unsere gezüchteten Familienmitglieder nicht so rein, wie wir es uns gern einreden. Hierfür möchte ich sensibilisieren, auch mit den Abbildungen.
Jeder kann in seinem Umgang mit Tieren, oft auch im Umgang mit dem scheinbar vertrauten Haustier, noch etwas besser machen. Für das Tier und damit irgendwie auch für uns, denn geht es dem Tier gut, freut sich der Mensch. Sie tun uns so gut, diese befellten oder geflügelten oder beflossten Geschöpfe! Obwohl sie scheinbar Zeit kosten in ihrer Hege und Pflege, schenken sie uns Zeit, weil die mit ihnen verbrachten Minuten und Stunden aus der Zeit fallen. Jeder Tierfreund kennt das. Man hat nichts gemacht, außer mit dem Hund, der Katze gespielt, das Pferd gestriegelt, die Fische beobachtet – und fühlt sich entspannt, bereichert, aufgetankt. Dieses Buch soll dazu beitragen, dass dies immer wieder sorglos geschehen kann.
Auf der Fährte des Tierpathologen
Wenn ein lieb gewonnenes Tier erkrankt, leiden wir mit ihm. Leiden wir dann wie das Tier oder wie ein Mensch? Leidet das Tier womöglich ohnehin genau wie ein Mensch? Und was ist mit den Wildtieren, die nicht in der Obhut eines Menschen stehen? Leiden sie weniger, wie oft behauptet wird? Oder nur unbemerkt? Sind unsere Haustiere etwa verweichlicht wie wir, degeneriert und naturentfremdet?
Trotz aller Forschung wissen wir nicht, wie Tiere Schmerz empfinden und ob sie anders damit umgehen als Menschen. Wir können lediglich jene Signale lesen, die wir mit unseren menscheneigenen Sinnen empfangen, und das sind nicht allzu viele, wie wir heute wissen. Verzieht jemand das Gesicht schmerzlich, tut ihm etwas weh, und wenn er Aua sagt oder vor Pein weint, sind wir sicher. Tiere sagen nicht Aua. Aber verbergen sie ihren Schmerz tatsächlich, um ihre Fraßfeinde nicht aufmerksam zu machen oder nicht vom Rudel verstoßen zu werden? Trotz aller Nähe tappen wir, was die Emotionen unserer tierischen Freunde betrifft, oft im Dunkeln.
»Aber ich spür doch, was mit meinem Tier los ist«, sagen viele Tierfreunde. Auch ich spüre im Umgang mit unseren tierischen Familienmitgliedern etwas. Doch als Wissenschaftler verlasse ich mich nicht aufs Spüren. Ich will wissen, um dann besser im Interesse des Tieres handeln zu können. Deshalb schaue ich durchs Mikroskop, und was ich dort erkenne, übersetzt das Befinden und Leid der Tiere präziser als mein vages Gespür. Meine mächtigste Waffe der Erkenntnis ist das Mikroskop, denn jede Krankheit hinterlässt ihren Fingerabdruck im Gewebe. Pathologen sind Spurensucher. Eine Tierärztin mag vermuten, bei einem Knötchen könnte es sich um Krebs handeln, und eine Gewebeprobe einschicken. Der Blick durch das Mikroskop auf die Biopsie des Knötchens verrät mir, ob es wirklich Krebs ist und wenn ja, welcher. Die rechtzeitige pathologische Diagnose ist eine Abkürzung; sie versetzt uns in die Lage, viel Leid, Aufwand und Kosten zu ersparen, und nicht selten ist sie lebensrettend. Nach der Diagnose des Tierpathologen schlägt die Tierärztin dem Tierhalter ein Maßnahmenspektrum mit möglichen Vorgehensweisen vor und kann Aussagen über den damit verbundenen Aufwand und die Kosten machen. Vor allem aber über die unterschiedlichen Konsequenzen, also Prognosen, für das Tier. Die Prognose ist der Blick in die Zukunft, die Glaskugel des Pathologen. Der Halter wägt schließlich ab und entscheidet, je nach seinen Möglichkeiten, moralischer Einstellung und Geldbeutel.
Leider erfolgen Biopsieuntersuchungen beim Pathologen oft erst nach einem regelrechten Tierarzt-Hopping, nicht selten mit viel Kummer, Ängsten, Frustration und Kosten, und dann ist es manchmal leider zu spät. Knötchen können völlig harmlos sein. Sie können aber auch wachsen, sich ausbreiten und eine Operation erfordern. Je mehr Zeit ein Tumor für sein Wachstum erhält, desto höher wird das Risiko eines schlechten Ausgangs für den Patienten. Das ist bei Menschen nicht anders. Deshalb wundere ich mich oft, warum Besitzer ihre Kaninchen, Katzen oder Hunde erst bei der Tierärztin vorstellen, wenn Tumoren bereits golf-, tennis- oder handballgroß sind. Ob die Operation klein, mit schmalen Rändern und Bikininarbe endet oder viel benachbartes Fleisch weggeschnitten werden muss, hängt wesentlich von der Diagnose des Pathologen ab. Ist der Tumor gutartig und oberflächlich, ist er in der Tiefe verwurzelt oder besteht das Risiko einer Metastasierung in andere Organe? Vielleicht muss auch ein Bein amputiert werden. Mit einer solchen Maßnahme stößt ein Tierhalter mancherorts auf wenig Verständnis. Ist doch nur ein Tier. Warum lässt du es nicht einschläfern? Nach meiner Erfahrung leiden Nachbarn und verständnislose Beobachter viel mehr unter einer Amputation als das betroffene Tier selbst und sein Besitzer.
Hat der Patient wirklich Glück gehabt, weil er noch am Leben ist, wenn auch auf drei Beinen? Wie ein Tierhalter mit einem Befund umgeht, reflektiert sein eigenes Mensch-Tier-Verhältnis. Das Tier, der Patient, um den sich alles dreht, hat kein Stimmrecht. Es muss schlucken, wofür sich Tierärztin, Frauchen und Herrchen entscheiden. Und auch seine Lebensumstände muss ein Tier hinnehmen. Es kann Glück haben oder Pech.
In den letzten Jahren hat die Medizin rasante Fortschritte gemacht. Die Verfahren zur Identifizierung des genetischen Codes und veränderter Moleküle bei Krankheit werden immer schneller und immer bezahlbarer. Wir wissen heute, dass Krebs nicht gleich Krebs ist. Wir können Hunderte von Arten unterscheiden, an denen wir erkranken können. Die Erkenntnisse der Humanmedizin schwappen mit einiger Verzögerung auch in die Tiermedizin, wo wir zunehmend ähnlich differenzieren. Man spricht beim Menschen von personalisierter Medizin oder Präzisionsmedizin, wenn der individuelle Patient mit seiner ihm ganz eigenen Krankheit diagnostiziert und therapiert wird. Medizinverständnis bis auf Molekülebene, modernste Diagnostik und innovative Medikamente haben zu vielen segensreichen Durchbrüchen in der Therapie beim Menschen geführt, und die Entwicklung schreitet auf allen Ebenen voran. Personalisierte Medizin und Präzisionsmedizin lösen grobes Schubladendenken ab und verbessern die Heilungschancen wesentlich, besonders auch bei früher tödlichen Krebserkrankungen. Die personalisierte Tiermedizin dagegen steckt noch in den Welpenschuhen, auch wenn der Trend dahin deutlich zu erkennen ist. Die Methoden dafür sind vorhanden oder können etabliert werden. In welchem Ausmaß allerdings Präzisionsmedizin auch für Tiere auf breiter Front bezahlbar wird und der Ethik der Patientenbesitzer entspricht, wird erst die Zukunft zeigen.
In der Praxis
Manchmal werde ich gefragt, ob ich schon als Kind aus Neugier gern tote Vögel und Regenwürmer seziert hätte. Die Antwort lautet: Nein. Meine Begeisterung galt stets den lebenden Tieren. Sie begleiten mich, meinen Eltern sei Dank, seit ich auf der Welt bin. Bei uns zu Hause gab es immer einen Hund, außerdem Schildkröten, Kaninchen, Wellensittiche, Nymphensittiche, Kanarienvögel. Bevor ich zum Gymnasium ging, war ich schon Aquarianer mit einer Handvoll Amazonasfischen. Gemeinsam mit meinen Geschwistern schaute ich unseren Mäuschen beim Tanzen zu. Diese Tanzmäuse waren damals »in«: possierliche, schwarz-weiße Tierchen, die sich den ganzen Tag im Kreis drehten und nur zum Schlafen und Fressen still hielten. Wie putzig. Nein, nicht putzig, wie ich heute weiß. Diese armen Kreaturen mussten tanzen, weil sie an einem Gendefekt litten. Auch der sogenannte Dancing Dobermann ist kein vierbeiniges Fred-Astaire-Talent, sondern ein Opfer von Züchtung. Seine Halter ahnen das vielleicht nicht. Man lacht, man führt ihn vor. Wie die Bodenpurzler-Tauben. Sie können kaum noch fliegen und nicht mehr richtig laufen, ihre reingezüchteten Bewegungsdefekte erquicken dennoch das Herz ihrer Züchter. Damals kümmerte das niemanden.
Als Schuljunge hatte ich genug Zeit für unsere Tiere; damals hatten Kinder ja allgemein viel Muße, ihren Interessen nachzugehen. Unser Langhaardackel Nicki lag mir besonders am Herzen. Oft streifte ich mit ihr durch Wald und Feld, und wenn ich mal groß sein würde, wollte ich Tierarzt werden. In der Pubertät war Nicki meine engste Vertraute. Mit ihr sinnierte ich über die wichtigen Themen und auch über meine erste Fünf in Latein. Und danach war die Welt wieder im Lot.
Die starke Prägung durch Tiere in meinem Umfeld und meine Faszination für das Spannungsfeld Mensch–Natur–Technik führten mich zum Studium der Tiermedizin in Hannover. Als Student arbeitete ich in Heimtierpraxen mit und verbrachte viel Zeit in der Kleintierklinik der Universität. So bereitete ich mich geradlinig auf meine eigene Praxis als Kleintierarzt vor. Die meisten Tierärzte spezialisieren sich: auf Kleintiere – Hund und kleiner –, Pferde oder landwirtschaftliche Nutztiere.
Die Tätigkeit in den Tierarztpraxen befriedigte mich aber nicht, denn sie ließ mir zu viele Fragen offen. Tiere erfolgreich zu behandeln war ein tolles Gefühl, doch das reichte mir nicht, wenn ich mir unklar darüber war, woran die Tiere wirklich litten und warum. Manche wurden gesund, andere nicht. Woran lag das? Ein Hund mit Durchfall wurde mir vorgestellt, ich verordnete ein Medikament, zwei Tage später war der Durchfall weg, die Halterin bedankte sich überschwänglich mit einer Flasche Wein. Das war mir unangenehm, denn ich wusste nicht, ob meine Therapie geholfen hatte oder ob der Hund auch ohne das Medikament gesund geworden wäre. Mein Lehrtierarzt meinte, ich solle mich an der Flasche Wein als Bestätigung meiner Arbeit freuen – gesundes Tier und glückliche Patientenbesitzerin, was will man mehr? Ja, das war in gewisser Weise das Ziel, doch ich hätte meinen Patienten manchmal gern besser geholfen, also gezielt, denn es gab ja auch schwierigere Fälle als Wald-und-Wiesen-Durchfall. Und natürlich wollte meine Forscherseele mehr wissen. Letztlich war ich für die Praxis einfach zu neugierig. So entschloss ich mich konsequent für die Tierpathologie, um den offenen Fragen auf den Grund gehen zu können.
Unsere zweibeinigen Kollegen, so nenne ich die Humanpathologen gern mit einem interdisziplinären Augenzwinkern, haben es nur mit einer einzigen Spezies zu tun, während bei meinen vierbeinigen Kollegen und mir gerade die vergleichende Pathologie, die Würdigung von Unterschieden zwischen den Arten, im Vordergrund steht. Unterschiede nicht nur in der Anatomie, dem Verhalten und den Körperfunktionen, viel mehr noch in den Krankheiten und Todesursachen. Ein kleiner Hund mag von Weitem aussehen wie eine Katze, er ist aber keine. Ein Hund kann an Krankheiten leiden, die bei einer Katze niemals auftreten würden – Staupe zum Beispiel. Tierärzte und Tierpathologen müssen prinzipiell alle Krankheiten aller Tiere kennen, ob Ratte oder Nilpferd. Nicht selten hilft auch der Blick über den Tellerrand auf die Krankheiten des Menschen, denn der Mensch ist für uns lediglich eine weitere Spezies. Diese tierartlich-vergleichende Perspektive hilft uns immer wieder bei scheinbar neuen Krankheiten oder besonders schwierigen oder seltenen Fällen. So war es neulich bei einem Hund, der uns nach seiner Euthanasie mit rätselhaftem Krankheitsbild zur Untersuchung gebracht wurde. Der Kopf des noch jungen Labradorwelpen war immer größer geworden, und keine Tierärztin wusste Rat. Erst hatte man es für einen Wespenstich gehalten, aber als der Schädel gigantische Ausmaße annahm, der Arme durch Gebissentstellung nicht mehr fressen konnte und auch das verzweifelte Tierarzthopping nicht half, entschied man sich für den letzten Weg (siehe Abb. 1).
Die Großkopfkrankheit, hier bei einem Labrador Retriever, kommt beim Hund seltener vor als beim Pferd, wo sie als Big Head Disease bekannt ist.
Den Patientenbesitzern ließ das unerklärliche Schicksal ihres jungen Hundes keine Ruhe. Hatten sie selbst vielleicht etwas falsch gemacht? Gab es eine Gefahrenquelle in ihrer Umgebung? Sie baten mich um Klärung der Todesursache, weil sie sich in absehbarer Zukunft wieder einen Hund anschaffen und einen möglichen Fehler vermeiden wollten. Der Obduktionsbefund erinnerte mich sofort an die Großkopfkrankheit der Pferde, und so fanden wir den Grund schnell und die Patientenbesitzer konnten trotz ihrer Trauer aufatmen: Es handelte sich um eine beim Junghund nur sehr selten vorkommende Entwicklungsstörung der Knochen als Zeichen einer schleichenden Phosphatvergiftung. Bei diesem Welpen war eine Nierenmissbildung die Ursache, fahrlässiges Verhalten oder gar eine Schuld der Besitzer waren auszuschließen. Auch bestand keine Gefahr für einen neuen Hund. Bei Pferden dagegen liegt oft ein Fütterungsfehler vor, also ein leicht abstellbarer Irrtum des Halters. Leicht abstellbar, wenn man die Zusammenhänge kennt.
Die Krankheiten der Tiere mit ihren oft entscheidenden Unterschieden zwischen den Spezies stellen die Kernkompetenz allein des Tierpathologen dar. Menschenpathologen – dies muss hier einmal betont werden – sind weder für Tierkrankheiten noch für Speziesunterschiede ausgebildet. Leider werde ich vereinzelt um eine Zweitmeinung gebeten bei fraglichen Diagnosen, die von zweibeinigen Pathologen zu vierbeinigen Gewebeproben gestellt wurden, oft mit fatalen Fehleinschätzungen, teils auch mit tödlichen Konsequenzen für die betroffenen Tiere. Dabei handelt es sich auch um ein förmliches Übernahmevergehen nach den Kammergesetzen. Andersherum weise ich Untersuchungen von Menschenproben zurück, die von Tierärztinnen schon mal von sich selbst, ihren Familienmitgliedern oder Freunden entnommen und mir anvertraut werden, weil sie meine tierischen Kompetenzen schätzen.
Aufschneider
Der Beruf des Tierarztes wird mit Augenzwinkern als der zweitälteste Beruf der Welt bezeichnet, weil Menschen mit Tieren schon sehr lange zusammenleben. Aufgrund gemeinsamer Bestattungsfunde von Menschen mit Hunden vor etwa 14000 Jahren datiert man erste Domestikationen in mindestens diesen Zeitraum, andere Schätzungen gehen von weit über 20000 Jahren aus. Da zu diesem Zeitpunkt auch die ersten Tiere in Menschenobhut gestorben sind, postuliere ich die Tierpathologie als drittältesten Beruf der Welt.
Der Ausbildungsweg zum Beruf des Tierpathologen ist lang. Das ist leicht erklärbar durch die große Stofffülle und den hohen Anspruch, prinzipiell über alle Krankheiten der Tiere Bescheid zu wissen. Von meinen Studierenden verlange ich: »Sie müssen alle wichtigen und häufigen Krankheiten der bei uns lebenden Tiere kennen, plus solche Krankheiten, die sozusagen vor der Tür stehen, wie Seuchen, die leicht eingeschleppt werden können, plus Tierkrankheiten, die auf den Menschen übertragen werden können und umgekehrt.« Damit ist der theoretische Anspruch umrissen. Zugegeben, ich selbst kenne auch nicht alle Blutgefäßparasitosen in Afrika. Aber das verrate ich niemandem.
Nach dem Tiermedizinstudium erfolgt eine Fachtierarztausbildung an einer der dafür zugelassenen Ausbildungsstellen, die ein möglichst breites Spektrum an Tierarten und Krankheiten bieten soll. Die Mindestdauer zum »Fachtierarzt für Pathologie« zählt mit fünf Jahren im Anschluss an das fünfeinhalbjährige Studium der Tiermedizin zu den längsten Spezialisierungen. Die Promotion zum Dr. med. vet. wird in der Regel darin abgeschlossen. Heute arbeiten in Deutschland etwa zweihundertfünfzig Fachtierärzte für Pathologie in Diagnostiklaboren, der Tierseuchenbekämpfung, Industrie, Forschung, an den Universitäten und ganz wenige auch als niedergelassene Tierpathologen.
»Wie können Sie als Tierfreund einen Beruf wählen, in dem man Tiere aufschneidet?«, werde ich gelegentlich gefragt. Ja, als »Aufschneider« werden Pathologen manchmal bezeichnet, es gibt sogar einen Film dieses Titels über meine zweibeinigen Kollegen. Aber um den lebenden Tieren und auch ihren Besitzern zu helfen, müssen wir zwangsläufig für den Laien völlig unzumutbare Tätigkeiten verrichten. Dies gilt jedoch, wenn auch in etwas milderer Form, für alle praktizierenden Tiermediziner, die in der kurativen Praxis zum Teil schlimme Anblicke aushalten müssen – entstellte Hunde nach schweren Autounfällen oder vom Pferderipper entsetzlich zugerichtete Stuten. Eine gewisse Abhärtung und sachliche Distanz sind nötig, um sich schnell auf die helfenden Handgriffe konzentrieren zu können. Zu starke eigene emotionale Betroffenheit kann den Blick und das Urteilsvermögen trüben. Tierärzte und viel mehr noch Pathologen sind also nicht abgebrüht, sondern gehen während ihrer Ausbildung durch eine lange, versachlichende Schule, die bereits im ersten Semester mit Anatomie-Präparierkursen beginnt. Gewöhnung stellt sich ein, zumeist jedoch keine Abstumpfung. Ich selbst würde nie ein eigenes Tier oder ein Tier, das ich zu Lebzeiten gut kannte, obduzieren. Falls dies einmal wirklich nötig sein sollte, würde ich Kollegen bitten und Distanz wahren. Umso mehr erstaunt es mich, wenn Studierende ab und zu ihre eigenen verstorbenen Lieblinge vorbeibringen und selbst bei uns obduzieren wollen, aus Neugier und mit unserer Hilfe. Auch hier erfahre ich immer wieder, wie unterschiedlich das Verhältnis von Menschen zu ihren Tieren sein kann und dass Tierliebe viele Gesichter hat.
Erweiterte Euthanasie
Der Leichnam eines vierundsiebzigjährigen Mannes wurde in einem Waldstück von Spaziergängern gefunden. Genauer gesagt: vom Hund eines Spaziergängers. Neben dem Leichnam lag ein Kadaver. Tote Menschen heißen Leichen, tote Tiere heißen Kadaver.
Die Umstände des Geschehens erschienen mysteriös. Die Staatsanwaltschaft beauftragte Humanforensiker, den Leichnam zu untersuchen, und wir Tierforensiker sollten uns dem Hund widmen. Zunächst war noch nicht erwiesen, ob es sich bei dem Tod des Mannes um Selbstmord handelte, eine Fremdeinwirkung mit Todesfolge für beide war ebenso vorstellbar. Auch suchte man nach dem Motiv für den Fall einer Selbsttötung. Konnten Hund und Mann oder nur der Mann, nur der Hund krank gewesen sein, und der Hundehalter wollte den Hund erlösen oder sich selbst töten und den Hund nicht zurücklassen, denn wer würde sich um ihn kümmern? Bei einem Menschen, der andere in den Tod »mitnimmt«, spricht man von einem erweiterten Suizid. Dieser kann auch mit Zustimmung der mitgenommenen Person erfolgen. Ein Tier kann nicht zustimmen. Auch bei der Euthanasie ist es seinem Halter ausgeliefert. Er bestimmt über Leben und Tod – üblicherweise nach tierärztlicher Beratung und unter Berücksichtigung des Tierschutzgesetzes. Handelte es sich hier um einen erweiterten Suizid mit dem primären Motiv der Selbsttötung und Mitnahme des Hundes, um ihn vor Umstellungen und Vernachlässigung zu schützen? Oder um eine erweiterte Euthanasie mit Mitnahme des Besitzers? Wollte er das Tier erlösen? Aber wovon? Mit dieser Fragestellung machte ich mich an die Obduktion des Hundes.
Die Schäferhündin war laut Impfpass acht Jahre alt. Die Zahnaltersbestimmung und der übrige Habitus waren damit vereinbar. Pflegezustand sehr gut. Äußere Besichtigung: Die Stirn wies ein neun Millimeter durchmessendes, kreisrundes Loch mit schwarzen, pulvrigen Schmauchspuren und einem schmalen Verbrennungsrand am Fell auf. Das Gehirn und die Schädelbasis waren vollständig fragmentiert, im Keilbein steckte ein neun mal neunzehn Millimeter großes Vollmantelgeschoss. Das Kaliber, so stellte sich wenig später heraus, stimmte mit dem Kaliber überein, das von meinen zweibeinigen Kollegen im Schädel des daneben liegenden Mannes gefunden wurde. Schwere Sickerblutungen fanden sich im angrenzenden Gewebe, durch die Trümmerfraktur des Keilbeins hindurch war geronnenes Blut auch im Rachenraum nachweisbar. Als Todesursache stand damit schnell ein Nahschuss fest, wahrscheinlich aus einem Revolver mit diesem Kaliber.
Die weitere Sektion lieferte jedoch zusätzliche Befunde von erheblicher Bedeutung: Bereits bei der äußeren Besichtigung fielen zwei jeweils etwa sechsundzwanzig Zentimeter lange Narben über den beiden vollständig fehlenden Milchleisten auf, etwa zwei bis drei Monate alt mit bereits fest verwachsenen Wundrändern, Nahtmaterial nicht nachweisbar. Die gesamte Milchdrüse und beide Leistenlymphknoten waren chirurgisch entfernt worden. Die Untersuchung der inneren Organe folgte dem Standardobduktionsgang für Hunde. Hauptbefund war eine über achtzigprozentige Durchwachsung der Lunge mit Metastasen eines Adenokarzinoms (Drüsenkrebs), das an den Krebsnabeln eindeutig erkannt werden konnte. Ähnliche Metastasen fanden sich in geringerer Zahl in der Leber, Milz, im Bauch- und Brustfell sowie im Markraum mehrerer langer Röhrenknochen. Die inneren Darmbeinlymphknoten und die Lungenlymphknoten wiesen bereits makroskopisch erkennbare Tumormetastasen auf. Der Magen war sehr gut gefüllt mit nur wenig zerkauten Wurststücken. Eine typische Henkersmahlzeit, die wir in dieser Form öfter sehen. Die mikroskopische Untersuchung identifizierte ein metastatisches Schauergeschehen in praktisch allen untersuchten Organen, wobei das Muster der Tumorzellen auf ein hochmalignes Adenokarzinom des Milchdrüsenepithels hinwies. Die Zerstörung der Lunge war so weit vorgeschritten, dass die Hündin sehr wahrscheinlich bereits unter schwerer Atemnot litt, zumindest bei Belastung. Metastasierender Milchdrüsenkrebs im Endstadium, ohne nachweisbare Milchdrüse.
Jeder dritte Hund stirbt infolge von Krebs, ganz ähnlich wie bei uns Menschen. Die Ursache bleibt auch bei unseren vierbeinigen Begleitern oft im Dunkeln. Manche Auslöser jedoch teilen sie mit uns, zum Beispiel das Passivrauchen. Wenn Frauchen oder Herrchen regelmäßig zur Zigarette greifen, erhöhen sie auch das Krebsrisiko ihres Tieres, oft ohne schlechtes Gewissen. Das Leiden kann schrecklich sein, doch bei Tieren bestimmen wir mit hoffentlich gutem Gewissen, wann die Zeit für eine möglichst schmerzfreie Erlösung gekommen ist. Ich stellte die Hypothese auf, dass der Besitzer seine Hündin mit seinem Revolver quasi euthanasiert hatte, um ihren Qualen ein Ende zu bereiten. Die offenbar kurz zuvor erfolgte Entfernung des Primärtumors in der Milchdrüse mit radikaler Mastektomie (Totaloperation) einschließlich Entfernung der Lymphknoten war zu spät erfolgt, der Tumor hatte bereits vor der OP in den Körper gestreut.
Tragisch an diesem Fall war, dass viele Arten von Brustkrebs bei Hunden, hier Milchdrüsenkrebs genannt, langsam entstehen. Es dauert, bis der Krebs bösartig wird, und es dauert noch einmal eine Weile, ehe er metastasiert. Das Muster des hier angetroffenen Adenokarzinoms entsprach einer Krebsart, die erst über sehr viele Monate bis Jahre bösartig wird. Wahrscheinlich wäre genug Zeit für eine Operation gewesen, mit hoher Heilungschance. Sobald Metastasen in die Lunge oder andere innere Organe gestreut haben, gibt es jedoch keine Hoffnung mehr. Viele Tumorarten wachsen zunächst langsam und streuen erst spät. Bei ihnen kann durch frühe Erkennung und frühes Eingreifen ein schlimmes Ende verhindert werden. Beim Tier wie beim Menschen, ähnlich einigen Brustkrebsarten der Frau oder Karzinomen von Prostata und Dickdarm.
Ich schätzte anhand der mikroskopischen Befunde aus dem Narbenbereich, dass die Operation der Schäferhündin vor etwa acht Wochen erfolgt war. Die Hündin musste in ihren letzten Lebenswochen und -tagen stark gehustet haben. Ein solcher Hundehusten klingt furchtbar. Sie muss am Ende sehr schwach gewesen sein. Womöglich hatte die Tierärztin die Hündin geröntgt und dem Besitzer dann das Todesurteil mitgeteilt: Infaust – eine schlechte Prognose, Chemotherapie oder Bestrahlung ausgeschlossen, Heilung unmöglich.
»Warum sind Sie denn nicht früher gekommen?«, hat sie dann vermutlich gefragt.
Vierundsiebzig Jahre alt der Hundehalter. Vielleicht selbst krank oder die Frau gestorben, vielleicht an Krebs, die Kinder weit weg, wenn er welche hatte. Geblieben ist ihm allein seine Hella. Und jetzt würde er sie auch noch verlieren. Dann hätte er niemanden mehr. Ohne Hella, das will er sich nicht mal vorstellen. Mit wem soll er dann noch reden? Wer würde ihm zuhören? Wer würde sich über ihn freuen? Ihm die Füße wärmen? Wer würde ihn anschauen? Und wer würde einfach da sein, an seiner Seite atmen, Tag und Nacht?
Ohne Hella will ich auch nicht mehr.
So etwas geht mir schon einmal durch den Kopf, wenn ich mehr als nur ein paar Knochenreste auf dem Obduktionstisch vor mir habe. Viele Menschen machen sich Vorwürfe, weil sie nicht rechtzeitig zum Tierarzt gegangen sind. Wenn ein Tier stirbt, das hätte gerettet werden können, ist das oft nur schwer zu verkraften. Oder wenn ein Bein amputiert werden muss, weil der Tumor bereits ein Gelenk zerstört hat, nachdem der Besitzer zu spät zur Tierärztin ging. Meistens kommuniziere ich mit Tierärzten, doch hin und wieder ruft mich auch ein Patientenbesitzer an und will wissen: »Herr Professor, hätte ich denn noch etwas tun können?«
Die Wahrheit wäre in vielen Fällen: ja. Ja, er hätte etwas tun können. Er hätte früh genug zur Tierärztin gehen können, und die Tierärztin hätte frühzeitig eine Gewebeprobe schicken sollen, dann hätte es eine reelle Chance gegeben. Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber soll ich einem trauernden Menschen jetzt auch noch Schuld aufbürden?
»Wie alt ist er denn geworden?«, frage ich dann, und wenn ich Glück habe, erreichte der Hund den zweistelligen Bereich. Dann kann ich sagen: »Das ist doch ein schönes Alter. Und bestimmt hat er es gut gehabt bei Ihnen. Mehr können Sie von einem Tierleben nicht erwarten.«
»Da können Sie sicher sein, Herr Professor, dass er es gut bei mir hatte.«
»Ja, das glaube ich. Und es ist nun einmal so: An irgendetwas sterben unsere Hunde im Alter.«
Wenn Tier und Mensch Tisch und Bett teilen
Die Vereinsamung nicht nur älterer Menschen ist ein großes und erschreckendes Thema unserer Zeit. Für immer mehr Menschen sind ihre Haustiere die einzigen Ansprechpartner. Und so werden Wellensittiche, Graupapageien, Hunde und Katzen in den Stand von Sozialpartnern erhoben. Sie sollen die Leere füllen, trösten, das Herz wärmen, die weggezogenen Kinder oder den verstorbenen Partner ersetzen und dem Leben einen Sinn geben. Wenn man für ein Tier sorgt, hat man eine Aufgabe. Früher war man für andere Menschen da. Nun wird das Tier zum Lebenspartner auf Augenhöhe.
Über dieses Phänomen der »aus der Art schlagenden« Mensch-Tier-Beziehung lässt sich vieles sagen, gerade auch in Bezug auf die Tierrechte, die beschädigt werden, wenn das Tier kein Tier mehr sein darf. Doch ich meine, dass wir die Einsamkeit eines Menschen mit berücksichtigen müssen, wenn wir über seinen Umgang mit einem Tier urteilen. Das Phänomen ist auch nicht neu. So teilte bereits Friedrich der Große Bett und Tisch mit seinen Windspielen, und in seinen letzten Lebensjahren zog er ihre Gesellschaft der seiner Mitmenschen vor. Zu jener Zeit lächelte man über das Privileg des schrägen Königs, heute ist es bei vielen der Normalzustand.
Der bekannte Hundetrainer Martin Rütter erzählte im Fernsehen einmal von einer alten Dame, die ihre Mahlzeiten gemeinsam mit ihrem Schoßhund auf dem Tisch und von einem Teller einnehme. Ich sah die beiden gleich bildhaft vor mir, die Dame mit dem bläulich schimmernden Lockenkopf und das Hündchen mit rosa Schleifchen, jeder auf seinem Sessel, das Hündchen auf zwei Kissen mit Hundemotiv. Ein Löffel für dich, ein Löffel für mich. Als Hygieniker würde mich als Erstes interessieren, ob der Hund richtig entwurmt ist. Als Tierarzt hoffe ich, der Hund bekommt keine Zwiebeln, keine Weintrauben, keine Rosinen, keine Schokolade und vor allem keinen Süßstoff mit Xylitol, denn daran könnte er sterben. Sicherer wäre es, die Dame würde Hundedosenfutter zu sich nehmen; nicht selten ist heutiges Heimtierfutter nahrhafter und ernährungsphysiologisch sinnvoller als manches, was wir in unseren eigenen Regalen finden.