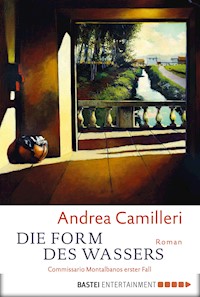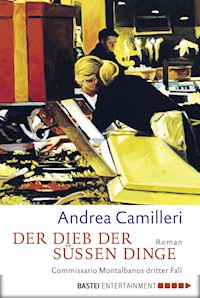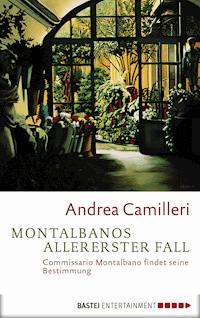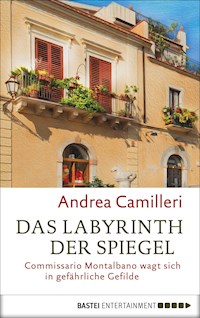
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Montalbano
- Sprache: Deutsch
Zwei mysteriöse Bombenattentate bereiten Commissario Montalbano ebenso Kopfzerbrechen wie seine neuen Nachbarn in Marinella: Liliana Lombardo kreuzt beinahe jeden seiner Wege, ihr Ehemann ist nie zu sehen. Weitere mafiöse Vorfälle und nächtliche Rendezvous der Signora mit dubiosen Galanen lassen einen Zusammenhang mit den Attentaten erahnen. Außerdem scheint jemand geschickt falsche Fährten zu legen, sodass Montalbano sich irgendwann an das mörderische Labyrinth in Orson Welles‘ Film Die Lady von Shanghai erinnert fühlt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Zwei mysteriöse Bombenattentate bereiten Commissario Montalbano ebenso Kopfzerbrechen wie seine neuen Nachbarn in Marinella: Liliana Lombardo kreuzt beinahe jeden seiner Wege, ihr Ehemann ist nie zu sehen. Weitere mafiöse Vorfälle und nächtliche Rendezvous der Signora mit dubiosen Galanen lassen einen Zusammenhang mit den Attentaten erahnen. Außerdem scheint jemand geschickt falsche Fährten zu legen, sodass Montalbano sich irgendwann an das mörderische Labyrinth in Orson Welles’ Film Die Lady von Shanghai erinnert fühlt …
Über den Autor
Andrea Camilleri, 1925 in dem sizilianischen Küstenstädtchen Porto Empedocle (Provinz Agrigento) geboren, arbeitete lange Jahre als Essayist, Drehbuchautor und Regisseur sowie als Dozent an der Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico in Rom. Dort lebt er mit seiner Frau Rosetta in dem Stadtteil Trastevere im Obergeschoss eines schmucken Palazzo, wobei er seinen Zweitwohnsitz in Porto Empedocle in Sizilien nie aufgegeben hat. Sein literarisches Werk, in dem er sich vornehmlich mit seiner Heimat Sizilien auseinandersetzt, umfasst mehrere historische Romane, darunter »La stagione della caccia«, 1992, »Il birraio di Preston«, 1995, und »La concessione del telefono«, 1998, sowie Kriminalromane. In seinem Heimatland Italien bricht er seit Jahren alle Verkaufsrekorde und hat auch bei uns ein begeistertes Publikum gefunden. Mit den Romanen um den Commissario Salvo Montalbano eroberte er auch die deutschen Leser im Sturm, und seine Hauptfigur gilt inzwischen weltweit als Inbegriff für sizilianische Lebensart, einfallsreiche Kriminalistik und südländischen Charme und Humor.
Andrea Camilleri
Das Labyrinth der Spiegel
Commissario Montalbanowagt sich in gefährliche Gefilde
Roman
Aus dem Italienischen von Rita Seußund Walter Kögler
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der italienischen Originalausgabe:
»Il gioco degli specchi«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by Sellerio editore, via Siracusa 50, Palermo
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Einband-/Umschlagmotiv: © shutterstock/Marcin Krzyzak
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-2307-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Eins
Seit über zwei Stunden saß er splitternackt, so wie Gott ihn geschaffen hatte, auf einem Gestell, das auf beängstigende Weise einem elektrischen Stuhl glich. Seine Hand- und Fußgelenke steckten in Metallfesseln, von denen zahlreiche Drähte zu einem Armaturenschrank führten. Dieser war mit allen möglichen Messgeräten bestückt, mit Manometern, Amperemetern und Barometern, sowie mit unaufhörlich blinkenden grünen, roten, gelben und blauen Lämpchen. Er selbst trug einen Helm ähnlich einer Trockenhaube beim Damenfriseur, nur dass diese Haube über ein dickes schwarzes Kabel, in dem Hunderte verschiedenfarbige Drähte zusammenliefen, mit dem Schrank verbunden war.
Der etwa fünfzigjährige Professor mit Pagenfrisur und Mittelscheitel, Ziegenbärtchen, Goldrandbrille und blütenweißem Kittel stellte eine unsympathische, arrogante Miene zur Schau und hatte ihn bereits mit tausend Fragen bombardiert:
»Wer war Abraham Lincoln?«
»Wer hat Amerika entdeckt?«
»Woran denken Sie, wenn Sie einen schönen Frauenhintern sehen?«
»Wie viel ist neun mal neun?«
»Wenn Sie die Wahl zwischen einem Eis in der Waffel und einem Stück schimmeligen Brot hätten, was würden Sie nehmen?«
»Wie viele waren die sieben Könige Roms?«
»Würden Sie sich lieber einen lustigen Film anschauen oder ein Feuerwerk?«
»Wenn Sie von einem Hund angegriffen werden, laufen Sie dann weg oder knurren Sie ihn an?«
Irgendwann verstummte der Professor unvermittelt, räusperte sich, ehm ehm, zupfte ein Fädchen vom Ärmel seines Kittels und fixierte Montalbano mit seinem Blick. Dann atmete er tief ein, schüttelte traurig den Kopf, atmete erneut tief ein, machte noch einmal ehm ehm und drückte dann einen Knopf, worauf die Metallfesseln aufsprangen und der Helm automatisch hochklappte.
»Die Untersuchung wäre damit beendet«, sagte er, setzte sich hinter seinen Schreibtisch in einer Ecke des Sprechzimmers und fing an, etwas in den Computer zu tippen.
Montalbano richtete sich auf und griff nach Unterhose und Hose, doch dann stutzte er plötzlich. Was bedeutete dieses »wäre«? War die Untersuchung, die ihm ungeheuer auf die Nerven ging, nun zu Ende oder nicht?
Eine Woche zuvor hatte er einen Brief mit der Unterschrift des Polizeipräsidenten erhalten, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er sich gemäß den neuen, vom Minister höchstselbst erlassenen Personalbestimmungen binnen zehn Tagen in der Maria-Vergine-Klinik in Montelusa einzufinden und sich einer Untersuchung zur Überprüfung seiner geistigen Gesundheit zu unterziehen habe.
Wie kann es sein, dass ein Minister die geistige Gesundheit eines Beamten, der Beamte aber nicht die geistige Gesundheit des Ministers überprüfen darf?, hatte er sich fluchend gefragt und sich beim Polizeipräsidenten beschwert.
»Was soll ich dazu sagen, Montalbano? Befehl von oben. Ihre Kollegen haben sich gefügt.«
Sich fügen, so lautete also die Parole. Wer sich nicht fügte, riskierte, als Pädophiler, Zuhälter oder Serienvergewaltiger von Nonnen verleumdet und zum Rücktritt gezwungen zu werden.
»Warum ziehen Sie sich denn nicht an?«, fragte der Professor.
»Weil ich nicht …«, nuschelte er auf der Suche nach einer Erklärung, während er in seine Unterhose schlüpfte. Doch dann geschah ein Malheur. Seine Hose passte ihm nicht mehr. Es war hundertprozentig dieselbe, in der er gekommen war, aber nun war sie ihm zu eng. So sehr er den Bauch einzog, so sehr er sich hineinzuzwängen versuchte, sie passte ihm einfach nicht mehr. Die Hose war ihm mindestens drei Nummern zu klein. Bei einem letzten verzweifelten Versuch hineinzuschlüpfen verlor er das Gleichgewicht. Er suchte Halt an einem Rollwagen mit einem geheimnisvollen Gerät darauf, aber der Wagen schoss los wie eine Rakete und krachte gegen den Schreibtisch des Professors, der erschrocken hochfuhr.
»Haben Sie den Verstand verloren?«
»Meine Ho… meine Hose passt mir nicht mehr«, stammelte der Commissario entschuldigend.
Da sprang der Professor wutentbrannt auf, packte die Hose am Bund und zog sie ihm hoch.
Sie saß wie maßgeschneidert.
Montalbano schämte sich wie ein kleiner Junge, der sich auf dem Klo beim Anziehen von der Kindergärtnerin helfen lassen muss.
»Ich hatte ohnedies bereits ernsthafte Zweifel«, sagte der Professor, setzte sich wieder und fuhr mit dem Tippen fort, »aber diese letzte Szene hier ist die endgültige Bestätigung.«
Was meinte er damit?
»Würden Sie mir das erklären?«
»Was soll ich Ihnen erklären? Es liegt doch auf der Hand. Ich frage Sie, woran Sie bei einem schönen Frauenhintern denken, und Sie antworten, an Abraham Lincoln!«
Der Commissario riss erstaunt die Augen auf.
»Wie bitte?! Das soll meine Antwort gewesen sein?«
»Wollen Sie etwa meine Aufzeichnungen infrage stellen?«
Da ging Montalbano ein Licht auf. Er war in eine Falle getappt!
»Das ist ein Komplott!«, schrie er. »Sie wollen mich für verrückt erklären!« Er zeterte immer weiter, bis die Tür aufgerissen wurde und zwei bullige Krankenpfleger hereinkamen, die ihn packten. Fluchend versuchte Montalbano sich aus der Umklammerung zu befreien, er stieß und boxte nach allen Seiten …
… und dann wachte er auf. Schweißgebadet, das Bettlaken verdreht und um den Körper gewickelt, sodass er sich nicht bewegen konnte. Wie eine Mumie.
Es gelang ihm erst nach zahlreichen Verrenkungen, sich zu befreien. Er schaute auf die Uhr. Sechs Uhr morgens.
Durch das offene Fenster strömte heiße Schirokkoluft ins Zimmer. Das Stück Himmel, das er vom Bett aus sehen konnte, zeigte einen milchigen Wolkenschleier. Er beschloss, noch zehn Minuten liegen zu bleiben.
Nein, der Traum, den er gerade gehabt hatte, war falsch. Er würde niemals verrückt werden, ganz bestimmt nicht. Allenfalls würde er in die Senilität abdriften, bis er sogar die Namen und Gesichter der Menschen vergaß, die ihm lieb und teuer waren, und in einen Zustand stumpfsinniger Einsamkeit verfiel.
Aber was waren das für anheimelnde Gedanken, die ihm da in aller Herrgottsfrühe durch den Kopf schwirrten! Dagegen half nur eins: sich aufrappeln und in der Küche den Espresso aufstellen.
Als er das Haus verlassen wollte, stellte er fest, dass es fürs Kommissariat noch viel zu früh war. Er öffnete die Verandatür und trat hinaus, setzte sich auf die Bank und rauchte eine Zigarette. Es war wirklich heiß. Er ging wieder ins Haus und räumte noch ein wenig auf.
Um acht stieg er ins Auto und nahm das kurze Sträßchen, das Marinella mit der Hauptstraße verband. Zweihundert Meter entfernt befand sich ein Haus, das fast identisch mit seinem war. Es hatte jahrelang leer gestanden und wurde seit nunmehr fünf Monaten von den Signori Lombardo bewohnt, einem kinderlosen Paar. Adriano, fünfundfünfzig Jahre alt, stattlich und elegant, war nach Auskunft von Fazio der Exklusivvertreter einer großen Computerfirma auf der Insel und daher oft unterwegs. Er fuhr einen schnellen Sportwagen. Seine Frau Liliana war eine brünette, eindrucksvolle Schönheit aus Turin und zehn Jahre jünger als ihr Mann. Sie war groß und durchtrainiert, mit langen, wohlgeformten Beinen. Wenn man hinter ihr ging, dachte man, selbst wenn man geisteskrank war, bestimmt nicht an Abraham Lincoln. Sie fuhr ein japanisches Stadtauto.
Montalbanos Beziehung zu den beiden beschränkte sich auf freundliches Grüßen, wenn sie einander im Auto auf dem Sträßchen begegneten, was selten vorkam, aber immer komplizierte Ausweichmanöver erforderte, da es für zwei Autos nebeneinander zu eng war.
An diesem Morgen sah der Commissario aus dem Augenwinkel den Wagen der Nachbarin. Die Motorhaube war offen, und die Signora hatte sich hinuntergebeugt und schaute hinein. Es gab offensichtlich ein Problem. Und weil Montalbano es nicht eilig hatte, lenkte er fast automatisch nach rechts und fuhr die zehn Meter bis zum Einfahrtstor. Ohne auszusteigen, rief er:
»Brauchen Sie Hilfe?«
Die Signora Liliana lächelte ihn dankbar an.
»Er springt nicht an!«
Montalbano stieg aus, blieb aber vor dem geöffneten Tor stehen.
»Wenn Sie in die Stadt müssen, kann ich Sie mitnehmen.«
»Danke. Ich bin spät dran. Würde es Ihnen etwas ausmachen, einen Blick auf den Motor zu werfen?«
»Ich verstehe absolut nichts von Autos, Signora, glauben Sie mir.«
»Na gut, dann fahre ich mit Ihnen.«
Sie klappte die Motorhaube zu, trat durch das Tor, ohne es zu schließen, und stieg in den Wagen des Commissario, der ihr die Beifahrertür aufhielt.
Sie fuhren los. Trotz der geöffneten Fenster war der Wagen bald von ihrem Parfüm erfüllt, ein Duft dezent und aufdringlich zugleich.
»Leider kenne ich keine Autowerkstatt. Und mein Mann kommt erst in vier Tagen zurück.«
»Sie könnten ihn ja anrufen.«
Die Signora schien seinen Vorschlag nicht gehört zu haben. »Können Sie mir nicht eine Werkstatt empfehlen?«
»Schon. Aber ich habe die Telefonnummer nicht dabei. Wenn Sie wollen, fahre ich Sie hin.«
»Das ist wirklich nett von Ihnen.«
Den Rest der Fahrt schwiegen sie. Montalbano wollte nicht neugierig erscheinen, sie wiederum war zwar höflich und freundlich, aber nicht allzu vertrauensselig. Er machte sie mit dem Automechaniker bekannt, die Signora bedankte sich, und damit endete die kurze Begegnung.
»Sind Augello und Fazio da?«
»Sie sind vor Ort, Dottori.«
»Dann sollen sie zu mir kommen.«
»Aber wie denn, Dottori?«, fragte Catarella verwirrt.
»Was soll das heißen, wie denn? Auf ihren Beinen!«
»Aber sie sind doch gar nicht hier, Dottori, sie sind vor Ort am Ort.«
»Und wo ist dieser Ort?«
»Moment mal, ich schau nach.«
Er nahm einen Zettel zur Hand.
»Hier steht Via Pissaviacane achtundzwanzig.«
»Bist du sicher, dass es Via Pissaviacane heißt?«
»Todsicher, Dottori.«
Montalbano hatte den Namen noch nie gehört.
»Ruf Fazio an und stell ihn zu mir durch.«
Das Telefon klingelte.
»Fazio, was ist passiert?«
»Heute früh, noch in der Dämmerung, ist vor einem Warenlager in der Via Pisacane ein Sprengsatz hochgegangen. Verletzte gab es keine, nur eine Riesenaufregung und ein paar zersprungene Fensterscheiben. Und das Rollgitter hat natürlich ein Loch.«
»Was war dort gelagert?«
»Nichts. Es stand seit fast einem Jahr leer.«
»Aha. Und der Besitzer?«
»Den hab ich vernommen. Ich erzähl Ihnen gleich alles, wir sind in spätestens einer Stunde zurück.«
Lustlos machte sich Montalbano daran, ein paar Dokumente zu unterschreiben, damit der gewaltige Stapel auf seinem Schreibtisch nicht mehr ganz so bedrohlich schwankte. Montalbano war schon seit Längerem überzeugt, die Erklärung für ein rätselhaftes Phänomen gefunden zu haben, hatte aber beschlossen, mit niemandem darüber zu sprechen, um nicht tatsächlich für verrückt erklärt zu werden. Er hatte sich schon seit einiger Zeit die Frage gestellt, warum sich die Akten über Nacht vermehrten. Wie konnte es sein, dass der Papierberg abends, wenn er nach Hause ging, einen Meter hoch und am nächsten Morgen bei seiner Ankunft auf einen Meter und zehn Zentimeter angewachsen war, ohne dass neue Briefe eingetroffen waren? Dafür gab es nur eine Erklärung: Wenn es dunkel wurde und niemand mehr im Büro war, verließen die Akten ihren Platz auf dem Schreibtisch, entledigten sich all ihrer Hüllen – der Mappen, Ordner und Schnellhefter –, verteilten sich über den ganzen Raum und paarten und begatteten sich in einer zügellosen Orgie, in endlosen Akten der Fortpflanzung. Und die Früchte dieser sündigen Nacht ließen Umfang und Höhe des Papierstapels anschwellen, den er am nächsten Morgen vorfand.
Das Telefon klingelte.
»Dottori, da wäre, dass Francischino in der Leitung ist, er will persönlich selber mit Ihnen sprechen.«
Wer mochte das sein? Am besten ließ er ihn sofort durchstellen, ohne sich lange mit Catarella aufzuhalten.
»Ja bitte, mit wem spreche ich?«
»Commissario, ich bin Francischino, der Automechaniker.«
»Ah, was gibt’s?«
»Ich rufe vom Haus der Signori Lombardo an. Irgendjemand hat den Motor demoliert. Was soll ich jetzt machen? Soll ich den Wagen in die Werkstatt abschleppen oder ihn stehen lassen?«
»Entschuldige, aber warum rufst du mich an?«
»Weil die Signora nicht an ihr Handy geht. Sie ist doch eine Freundin von Ihnen, und da dachte ich …«
»Sie ist keine Freundin, Francischì, sondern eine Bekannte. Und deshalb kann ich dir leider nicht helfen.«
»Na gut. Entschuldigen Sie bitte.«
Erst in diesem Moment wurde Montalbano bewusst, was der Automechaniker gesagt hatte.
»Was meinst du damit, dass jemand den Motor demoliert hat?«
»Genau das, was ich sage. Jemand hat die Motorhaube geöffnet und den Motor mutwillig zerstört.«
»Du meinst, absichtlich?«
»Ganz genau, Dottori.«
Wer um Himmels willen konnte etwas gegen die schöne Liliana Lombardo haben?
»Also, was ist das für eine Geschichte?«, fragte der Commissario, als Fazio und Augello vor seinem Schreibtisch Platz genommen hatten.
Es oblag Vizekommissar Domenico Augello, genannt Mimì, zu antworten.
»Meiner Ansicht nach hat da einer sein Schutzgeld nicht bezahlt. Fazio sieht das anders«.
»Erzähl du erst mal«, forderte Montalbano ihn auf.
»Das Warenlager gehört einem gewissen Angelino Arnone, der außerdem noch einen Lebensmittelladen, eine Bäckerei und ein Schuhgeschäft besitzt. Er muss also dreimal Schutzgeld bezahlen. Das hat er entweder vergessen, oder die Summe wurde erhöht, und er weigert sich zu zahlen. Also hat man ihm einen Denkzettel verpasst, um ihn zur Vernunft zu bringen. Das ist alles.«
»Und was sagt dieser Arnone dazu?«
»Den üblichen Schwachsinn, den wir schon hundertmal gehört haben. Dass er noch nie Schutzgeld bezahlt hat, weil noch nie jemand welches von ihm eingefordert hat. Dass er keine Feinde hat und keiner ihm etwas Böses will.«
»Und was hältst du von der Sache?«, wandte sich Montalbano an Fazio.
»Dottore, meiner Ansicht nach ist an der Geschichte etwas faul.«
»Warum?«
»Weil es das erste Mal wäre, dass jemand in einem leer stehenden Warenlager einen Sprengsatz hochgehen lässt. Wie groß war denn der Schaden? Ein altes Rollgitter ist demoliert, das für vier Euro repariert werden kann. Eigentlich hätten sie die Bombe vor dem Lebensmittelladen, der Bäckerei oder dem Schuhgeschäft zünden müssen. Dann hätte die Warnung einen Sinn gehabt!«
Der Commissario wusste nicht, was er antworten sollte. Fazios Bedenken waren nicht von der Hand zu weisen.
»Und warum haben sie sich deiner Ansicht nach diesmal nicht an die übliche Vorgehensweise gehalten?«
»Offen gestanden, weiß ich darauf auch keine Antwort. Aber wenn Sie es mir erlauben, würde ich versuchen, mehr über diesen Angelino Arnone in Erfahrung zu bringen.«
»Gut, erkundige dich und gib mir dann Bescheid. Ach so, was für ein Sprengsatz war es?«
»Der übliche. Mit Zeitzünder. Er lag in einem Pappkarton, der so aussah, als wäre er für die Müllabfuhr bestimmt.«
Mittags, auf dem Weg zu Enzos Trattoria, fiel ihm das Schild einer schmalen, kurzen Straße ins Auge, die er seit Jahren mindestens zweimal täglich passierte. Via Pisacane.
Der Name war ihm noch nie zuvor aufgefallen. Vor Hausnummer achtundzwanzig drosselte er das Tempo. Arnones Lager befand sich im Erdgeschoss eines Hauses zwischen einer Eisenwarenhandlung und der Eingangstür zum Nachbarhaus. Die Sprengladung war nicht genau in der Mitte des Rollgitters, sondern in der rechten Ecke platziert worden.
Bei Enzo schlug er sich den Bauch voll, mit mehreren Antipasti, Spaghetti mit Sepiatinte, einer kleinen Portion Pasta alle vongole und frischen gebratenen Streifenbarben (zwei große Portionen).
Der Spaziergang zur Mole bis zu dem flachen Felsen unter dem Leuchtturm war trotz der Hitze unerlässlich. Eine Stunde saß er dort, rauchte und ärgerte einen Krebs, bevor er ins Büro zurückkehrte.
Er parkte und stieg aus. Doch um ins Kommissariat zu gelangen, musste er erst ein großes Paket mit dem Fuß zur Seite schieben, das den Eingang versperrte.
Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf.
»Catarè, was ist das für ein Paket?«
»Ich bitte um Verschuldigung, Dottori, da kommt jetzt unverzüglich gleich jemand von der Verwaltung und holt es ab. Acht solche Pakete haben wir gekriegt. Lauter Formulare, Meldescheine und Vordrucke.«
Woher nahm das Ministerium bloß das Geld für diesen ganzen bürokratischen Humbug, während für den Sprit der Streifenwagen keines da war.
»Ist Fazio schon zurück?«
»Sissì.«
»Dann schick ihn zu mir.«
Fazio entschuldigte sich.
»Dottore, ich habe den ganzen Vormittag nicht eine Minute Zeit gehabt, mich mit Arnone zu beschäftigen.«
»Ich wollte dir etwas erzählen, setz dich. Heute habe ich rein zufällig entdeckt, dass die Via Pisacane eine der Straßen ist, die auf meinem Weg zur Trattoria liegen. Ich habe mich dort mal umgeschaut.«
Fazio sah ihn fragend an.
»Dem Radius der Explosion und dem Loch in dem Rollgitter nach zu urteilen, war der Sprengsatz auf der rechten Seite des Gitters platziert. Könnte das sein?«
»Ja.«
»Mit anderen Worten, näher an Hausnummer sechsundzwanzig, also an der Eingangstür des Wohnhauses. Richtig?«
»Richtig.«
»Und jetzt hör dir meine Vermutung an. Wenn ein Bewohner des Hauses frühmorgens rein- oder rausgeht und vor der Tür einen Pappkarton findet, was macht er dann?«
»Er schiebt ihn mit dem Fuß beiseite«, antwortete Fazio.
Und rief gleich darauf aus:
»Ach du Schande!«
»Genau. Es könnte sein, dass die Bombe gar keine Warnung an Arnone war, sondern einem der Hausbewohner galt.«
»Sie haben recht. Und das bedeutet, dass die Sache kniffliger wird.«
»Soll ich mit Dottor Augello sprechen?«
Fazio verzog das Gesicht. »Wenn ich Gallo mitnehmen könnte …«
»In Ordnung«, sagte der Commissario.
Eine halbe Stunde später kam Augello zu ihm.
»Hast du eine Minute Zeit?«
»So viel du willst, Mimì.«
»Ich habe über das nachgedacht, was Fazio heute Morgen über den Sprengsatz gesagt hat. Es ist tatsächlich ungewöhnlich. Und ich habe mich gefragt, warum er rechts von dem Rollgitter und nicht in der Mitte platziert wurde. Du musst wissen, Salvo, dass neben dem Lager der Eingang zu einem dreigeschossigen Wohnhaus liegt. Und jetzt meine Frage: Könnte es nicht sein, dass die Bombe für dieses Haus bestimmt war? Und dass ein Bewohner den Karton ein Stück zur Seite geschoben hat, ohne zu ahnen, dass eine Sprengladung drin ist?«
Der Commissario sah ihn begeistert an.
»Das ist wirklich eine großartige Idee, Mimì! Gratuliere. Ich werde sofort Fazio beauftragen, Erkundigungen über die Bewohner des Hauses einzuholen.«
Augello stand auf und kehrte zufrieden in sein Zimmer zurück.
Warum sollte er ihm die Illusion rauben? Der Jungpfadfinder Salvo Montalbano hatte seine gute Tat für diesen Tag vollbracht.
Zwei
Als er auf dem Heimweg nach Marinella am Haus der Lombardos vorbeifuhr, fiel ihm sofort auf, dass das Auto der Signora verschwunden war. Und ein Fenster auf der Rückseite des Hauses gab den Blick auf das hell erleuchtete Schlafzimmer frei, in dem die Signora Liliana vor einem offenen Kleiderschrank stand.
Kaum hatte er die Haustür hinter sich geschlossen, geriet er ins Grübeln. Wie sollte er sich der Nachbarin gegenüber verhalten? Francischino hatte ihr doch bestimmt gesagt, dass der Motor ihres Autos mutwillig zerstört worden war. War er als Polizeikommissar nicht verpflichtet, ihr bei der Suche nach dem Täter zu helfen und sie vor weiterem Schaden zu schützen? Oder sollte er, da sie keine Anzeige erstattet hatte, besser nichts sagen und sich heraushalten?
Aber was, wenn die Signora bisher nur noch keine Zeit gehabt hatte, Anzeige zu erstatten?
Während er noch um eine Antwort rang, wurde er von einer weiteren Frage gequält, die ihn persönlich auf den Prüfstand stellte. Würde er sich auch dann so fürsorglich um die Signora Liliana kümmern, wenn sie nicht eine attraktive Frau, sondern eine schielende, zahnlose und krummbeinige alte Vettel wäre?
Nein, solche Selbstzweifel waren ganz und gar nicht angebracht. Selbstverständlich würde er sich auch dann um sie kümmern.
Und deshalb beschloss er, unverzüglich hinüberzugehen und zu klingeln.
Das kurze Stück zwischen den beiden Häusern legte er zu Fuß zurück.
Signora Liliana schien hocherfreut, ihn zu sehen. Die Piemontesen, heißt es, seien höflich, aber falsch, doch Lilianas Freundlichkeit kam ihm keineswegs geheuchelt vor.
»Kommen Sie doch herein. Ich gehe voraus.«
Sie trug ein leichtes, kurzes Kleidchen, das sich wie eine zweite Haut an ihren Körper schmiegte. Montalbano folgte ihr wie ein Roboter, ganz im Bann der harmonisch wogenden Rundung ihres Gesäßes. Eine weitere Himmelssphäre, die es verdiente, von den Dichtern besungen zu werden.
»Gehen wir hinaus auf die Veranda?«
»Gern.«
Es war eine Veranda ähnlich der seinen, nur der Tisch und die Stühle waren moderner und eleganter.
»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«
»Danke, gern. Aber bitte keine Umstände.«
»Ich habe einen vorzüglichen Wodka, Commissario. Aber wenn Sie noch nichts zu Abend gegessen haben …«
»Danke, bei dieser Hitze ist etwas Kaltes genau das Richtige.«
»Ich hole ihn.«
Sie kam mit einer Flasche Wodka im Eiskübel, zwei langstieligen Gläsern und einem Aschenbecher zurück.
»Ich trinke auch ein Schlückchen, um Ihnen Gesellschaft zu leisten. Wenn Sie rauchen möchten …«
Drinnen klingelte ein Handy.
»Ach, so etwas Blödes! Entschuldigen Sie mich bitte. Bedienen Sie sich doch inzwischen.«
Sie verschwand im Haus. Offenbar telefonierte sie vom letzten Zimmer aus, dem Schlafzimmer, und zwar hinter verschlossener Tür, denn der Commissario hörte nicht einmal ein leises Murmeln.
Das Telefonat dauerte so lange, dass Montalbano ganz gemächlich eine Zigarette rauchen konnte.
Als die Signora Liliana zurückkehrte, war ihr Gesicht gerötet, und sie atmete schwer. Ihr Keuchen hatte jedoch den reizvollen Nebeneffekt, andere Himmelssphären in Bewegung zu bringen, denn sie trug sichtlich keinen Büstenhalter. Offenbar hatte sie eine erregte Diskussion geführt.
»Entschuldigen Sie bitte, das war Adriano, mein Mann, es gab ein unvorhergesehenes Problem. Aber Sie haben ja noch gar nichts getrunken! Ich schenke Ihnen ein.«
Sie goss zwei Fingerbreit Wodka in eines der Gläser und reichte es Montalbano. Sich selbst schenkte sie reichlich ein und leerte das Glas in einem Zug. Ein ziemlich großes Schlückchen!
»Und was verschafft mir das Vergnügen Ihres Besuchs, Commissario?«
»Ich weiß nicht, ob der Automechaniker Ihnen gesagt hat …«
»… dass der Motor aufwendig repariert werden muss? Ja, hat er, und deshalb habe ich ihn gebeten, den Wagen in seine Werkstatt abzuschleppen. Das Problem ist jetzt nur: Wie komme ich zu meiner Arbeit nach Montelusa? Es gibt natürlich einen Bus, aber der fährt so selten …«
»Ich fahre morgens gegen acht Uhr ins Büro. Wenn Sie möchten, kann ich Sie mitnehmen, zumindest auf dem Hinweg …«
»Oh, sehr gern. Ich werde morgen früh um acht bereitstehen.«
Montalbano kehrte zu dem Thema zurück, das ihn interessierte.
»Hat Ihnen der Automechaniker auch erklärt, warum der Motor kaputt ist?«
Sie lachte. Madonna mia, was für ein Lachen! Es ging ihm durch und durch. Ein Lachen wie ein Turteltäubchen.
»Das war gar nicht nötig. Ich bin eine schlechte Fahrerin und habe diesen armen Motor wohl dermaßen malträtiert, dass …«
»Das ist nicht der Grund.«
»Nein?«
»Nein. Der Motor Ihres Wagens wurde mutwillig zerstört. Mit Absicht.«
Sie wurde kreidebleich.
Montalbano fuhr fort: »Das meint der Automechaniker, und der versteht sein Handwerk.«
Liliana schenkte sich noch einen Wodka ein und stürzte ihn hinunter. Dann blickte sie schweigend aufs Meer hinaus.
»Waren Sie gestern mit dem Auto unterwegs, Signora?«
»Ja. Und bis abends, als ich hierher zurückgefahren bin, war alles in Ordnung.«
»Dann muss es letzte Nacht passiert sein. Jemand muss über den Zaun geklettert sein, die Motorhaube geöffnet und den Motor demoliert haben. Haben Sie denn nichts gehört?«
»Absolut nichts.«
»Obwohl das Auto fast direkt vor Ihrem Schlafzimmerfenster geparkt war.«
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nichts gehört habe.«
Montalbano ging über ihren ungehaltenen Ton hinweg. Er hatte A gesagt, jetzt musste er auch B sagen.
»Haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?«
»Nein.«
Doch dann schien sie sich eines Besseren zu besinnen.
Sie wandte sich Montalbano zu und sah ihm in die Augen.
»Wissen Sie, Commissario, ich bin oft und lange allein. Aber ich bin auch nicht ganz unattraktiv und … kurz gesagt, ich hatte gelegentlich Ärger. Stellen Sie sich vor, eines Nachts hat irgendein Idiot an mein Schlafzimmerfenster geklopft! Es kann also gut sein, dass irgendein Blödmann sich dafür rächen wollte, dass ich ihn nicht erhört habe …«
»Hat man Ihnen denn explizit Avancen gemacht?«
»Jede Menge.«
»Können Sie mir die Namen Ihrer – wie soll ich sagen – Verehrer nennen?«
»Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass ich nicht mal weiß, wie sie aussehen? Sie rufen an, sagen einen Namen, der natürlich ebenso gut erfunden sein kann, und dann geht es los mit den Obszönitäten.«
Montalbano zog einen Zettel aus der Tasche und schrieb etwas darauf. »Ich lasse Ihnen meine Telefonnummer da. Zögern Sie nicht, mich anzurufen.« Dann stand er auf und verabschiedete sich. Liliana begleitete ihn bis zum Tor.
»Ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihre Hilfsbereitschaft. Bis morgen.«
Er verdrückte einen Teller Pasta ’ncasciata und eine große Portion mit Parmesan überbackene Auberginen, die ihm seine Haushälterin Adelina gekocht hatte, und setzte sich dann auf die Veranda.
Der Himmel war mit Sternen übersät, die zum Greifen nahe schienen, und ein sanfter Wind strich zart über seine Haut. Doch nach fünf Minuten war Montalbano klar, dass er nicht hier sitzen bleiben konnte, sondern aufstehen und einen langen Verdauungsspaziergang am Meer machen musste.
Er ging zum Strand hinunter, aber statt wie sonst immer nach rechts, Richtung Scala dei Turchi, zu gehen, wandte er sich nach links, zur Stadt. Dabei musste er notgedrungen am Haus der Lombardos vorbei.
Das war eigentlich gar nicht seine Absicht gewesen, oder etwa doch?
Im Haus brannte kein Licht. Er konnte nicht sagen, ob die Verandatür offen oder geschlossen war. Vielleicht hatte Liliana zu Abend gegessen, noch ein paar Gläschen Wodka hinuntergekippt und sich dann schlafen gelegt.
In diesem Moment wendete oben auf der Hauptstraße ein Auto, dessen Scheinwerfer die Rückseite des Hauses abtasteten.
Montalbano hatte genügend Zeit, um zu erkennen, dass vor der Einfahrt ein Wagen stand.
Jetzt machte er sich wirklich Sorgen. Vielleicht war der unbekannte Vandale zurückgekehrt, um noch mehr zu zerstören. Und vielleicht hatte Liliana ihn, Montalbano, hilfesuchend angerufen, aber er hatte nichts gehört, weil er ja unten am Strand gewesen war.
Er machte kehrt und ging auf das Haus zu. Die Verandatür war von innen verschlossen. Vorsichtig begab er sich zur Rückseite des Hauses.
Ein grüner Volvo mit dem Kennzeichen XZ 452 BG stand mit der Schnauze vor der geschlossenen Einfahrt. Zwischen den Lamellen des heruntergelassenen Rollladens, der, wie Montalbano wusste, zum Schlafzimmerfenster gehörte, war ein Streifen Licht zu sehen. Das Fensterbrett befand sich in Augenhöhe.
Er näherte sich und hörte, wie Liliana stöhnte. Mit Sicherheit nicht vor Schmerzen.
Der Commissario entfernte sich rasch. Und um die Nervosität abzuschütteln, die ihn plötzlich erfasst hatte, setzte er seinen Spaziergang am Meer fort.
Die liebenswürdige und schöne Nachbarin hatte ihm also einen Sack voller Lügen aufgebunden. Schon vorhin bei seinem Besuch hatte er den Verdacht gehabt, dass sie ihm nicht die Wahrheit sagte. Und was sich in diesem Augenblick in ihrem Schlafzimmer abspielte, war der unumstößliche Beweis dafür.
Er legte seine Hand ins Feuer, dass der Anrufer nicht ihr Gatte, sondern ein anderer Mann gewesen war.
Auf die geniale Idee, den Motor zu demolieren, war wahrscheinlich ein Liebhaber gekommen, dem sie den Laufpass gegeben hatte, weil sein Nachfolger, der Volvo-Fahrer, schon bereitstand. Vielleicht war es auch zwischen ihr und dem Volvo-Fahrer zu einem Streit gekommen, der Volvo-Fahrer hatte die Nerven verloren und seine Wut an dem Wagen ausgelassen. Anschließend hatten sie sich wieder versöhnt, und den Soundtrack dieser Versöhnung hatte er soeben zu hören bekommen. Folglich kannte Liliana nicht nur Vor- und Zuname und die Adresse der Männer, die bei ihr anriefen, sondern auch sonst noch alles Mögliche aus ihrem Leben.
An diesem Punkt kam Montalbano zu dem Schluss, dass die ganze Geschichte eine Privatangelegenheit zwischen Liliana und ihren Liebhabern war und es für ihn keinen Grund gab, sich weiter damit zu beschäftigen.
Er rief wie immer Livia an, um ihr eine gute Nacht zu wünschen, wobei es wie so oft fast zum Streit gekommen wäre, und ging schlafen.
Am nächsten Morgen pünktlich um acht stand Liliana an dem Sträßchen und wartete auf ihn. Natürlich war kein Volvo mehr da, weder vor dem Tor noch sonst irgendwo in der Nähe. Es war extrem heiß, vielleicht trug sie deshalb ein Kleid wie am Vorabend, diesmal jedoch in Himmelblau. Es hatte denselben umwerfenden Effekt.
Liliana wirkte frisch und munter. Und sie war parfümiert.
»Alles in Ordnung?«, fragte der Commissario.
Es gelang ihm, keine Boshaftigkeit anklingen zu lassen.