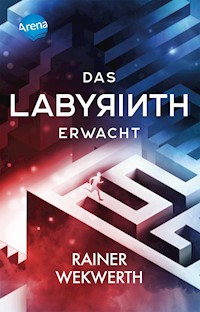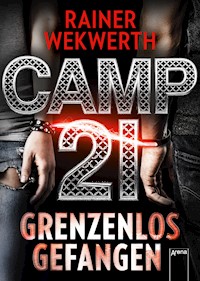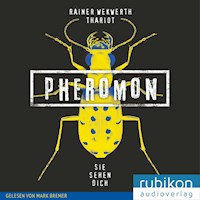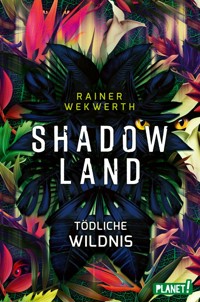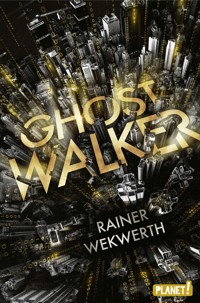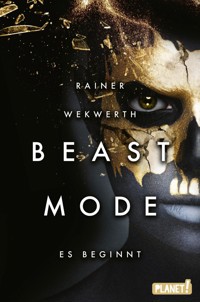4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Labyrinth-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Sie sind nur noch zu dritt und sie sind geschwächt. Aber sie wollen überleben - um jeden Preis. Zweifel überschatten den Kampf gegen das Labyrinth, das mit immer neuen Mysterien für die Jugendlichen aufwartet. Ihr mühsam erworbener Teamgeist scheint nicht zu brechen, doch lohnt sich für Jeb, Jenna und Mary der gemeinsame Kampf, wenn nur einer von ihnen überleben kann? Die entscheidende Frage aber wagt niemand zu stellen: Was erwartet den letzten Überlebenden hinter dem sechsten Tor? "Aus dem Labyrinth gibt es kein Entkommen, es hat mir den Schlaf geraubt. Spannender geht's nicht." Ursula Poznanski "Das Labyrinth erwacht" (Band 1 der Trilogie) wurde ausgezeichnet mit den Leserpreisen "Segeberger Feder" und "Ulmer Unke". Nominiert für die Leserpreise "Buxtehuder Bulle" und "Goldene Leslie". Alle Bände der Labyrinth-Tetralogie: Das Labyrinth erwacht (1) Das Labyrinth jagt dich (2) Das Labyrinth ist ohne Gnade (3) Das Labyrinth vergisst nicht (4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Rainer Wekwerth
Das Labyrinth ist ohne Gnade
Der 1. Band der Trilogie »Das Labyrinth erwacht« wurde mit derBad Segeberger Feder und der Ulmer Unke ausgezeichnet.
Rainer Wekwerth, 1959 in Esslingen am Neckar geboren, schreibt aus Leidenschaft. Er ist Autor erfolgreicher Bücher, die er teilweise unter Pseudonym veröffentlicht und für die er Preise gewonnen hat. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. Der Autor lebt im Stuttgarter Raum.www.wekwerth.com
Weitere Bücher von Rainer Wekwerth im Arena Verlag: Das Labyrinth erwacht Das Labyrinth jagt dich Damian. Die Stadt der gefallenen Engel Damian. Die Wiederkehr des gefallenen Engels
Für Anna
1. Auflage 2014 © 2014 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Ein Projekt der AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur (www.ava-international.de) Cover: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80194-0
www.wekwerth-labyrinth.dewww.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Buch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2. Buch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3. Buch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Epilog
Danksagungen
Prolog
Jenna schrie. Sie hatte den Mund weit aufgerissen, vor Schock, dass sie plötzlich durch die Luft geschleudert wurde.
Unter ihr erwartete sie eine stahlfarbene Oberfläche, und noch bevor Jenna begreifen konnte, wohin sie fiel, hatte sie Wasser geschluckt.
Um Jenna wurde es leicht, schwerelos. Dann war es schwarz.
Plötzlich, einen klammernden Druck auf ihrem Brustkorb lösend, strömte Luft in ihre Lunge. Gleichzeitig erbrach sie sich. Süße, frische Luft ließ ihren Brustkorb heben und senken. Sie atmete! Und musste gleich darauf husten. Trotzdem: Es war ein Gefühl, wie neu geboren zu werden.
Jenna hatte noch immer Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Sie befand sich im Wasser. Sie lebte. Da sah sie Jeb wohlauf vor sich und ein warmes Glücksgefühl durchströmte sie. Jeb, er lebte, aber warum sah er sie so sorgenvoll an?
Ein weiteres hartnäckiges Husten schüttelte sie. Als sie sich gefangen hatte, war ihre Stimme nur ein Krächzen. »Oh Gott. Was ist passiert?«
Da erst spürte sie die Umklammerung um ihre Brust. Panisch versuchte sie, sich aus dem Griff zu befreien, dann vernahm sie Marys Stimme hinter sich. Und begriff, dass es Mary war, die sie über Wasser hielt. Wasser, das sich links und rechts und in alle Richtungen um sie herum ausbreitete. Wo waren sie nur gelandet? Aber zumindest waren sie alle hier. Alle … die von ihnen übrig geblieben waren. Da war Jeb. Sein Lächeln beruhigte ihre angespannten Nerven. Und da war Mary, die ihr das Wasser aus der Lunge gepresst hatte. Die ihr das Leben gerettet hatte.
Wieder hustete Jenna heftig und sie war froh, dass Mary sie kräftig strampelnd unter den Armen hielt.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Mary, als Jenna sich gefangen hatte.
Jennas Blick suchte Jeb und er schwamm nun heran. Liebevoll sah er sie an. »Alles okay?«
Sie versuchte sich an einem Lächeln. »Na ja, meine Lunge brennt wie Feuer.«
»Weißt du, wo wir sind?«, fragte Mary nun Jeb.
»Ich sehe nur Wasser um uns herum. So weit das Auge blickt«, sagte er. »Wir müssen mitten in einem Ozean gelandet sein.«
»Dann sind wir verloren«, flüsterte Mary tonlos. Jenna bekam eine Gänsehaut, denn Mary hatte genau den Gedanken ausgesprochen, der auch ihr nicht aus dem Kopf gehen wollte.
Jeb jedoch, das sah Jenna in seinem Gesicht, war noch nicht bereit aufzugeben. Seine Augen hatten sich zu Schlitzen geformt und immerzu drehte er sich schwimmend um sich selbst und suchte, den Horizont ab. Jenna war ihm dankbar dafür und versuchte die Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit, die in ihr aufsteigen wollte, zu ersticken. Der Kloß in ihrem vom Salzwasser angerauten Hals brachte sie erneut zum Husten, und so hörte sie nur Jebs Worte, als er seinen Satz beinahe beendet hatte. »… kann es nicht enden. Es gibt einen Ausweg, eine Chance, die gab es bisher immer.« Er schaute Jenna und Mary eindringlich an, und sosehr Jenna an diese Chance glauben wollte, sie empfand genau das Gegenteil. Instinktiv wusste Jenna, dass sie eine mehr als miserable Schwimmerin war.
Ein Bild tauchte vor ihrem inneren Auge auf. Jeb. Er stand mit dem Rücken zum Meer. Die Arme weit ausgebreitet lachte er zum wolkenlosen Himmel. Er rief sie, aber das Rauschen der Wellen verschluckte seine Worte. Dann wandte er sich um, rannte los und stürzte sich mit einem Hechtsprung in die Wogen. Jenna beobachtete, wie er mit kräftigen Armzügen ins Meer hinausschwamm. Sie wäre ihm gern gefolgt, aber irgendetwas hielt sie zurück.
Angst.
Woher kommt dieses Bild? Warum ist es mir so vertraut? Ist das wirklich geschehen oder nur ein Traum? Warum bin ich ihm nicht nachgelaufen?
Und dann erinnerte sie sich an einen Badeunfall in ihrer Kindheit. Sommerferien an der Nordsee. Sie war noch klein gewesen, als sie von ihren Eltern unbeobachtet mit ihrem Sandeimer zum Wasser ging, in die Wellen hineinstapfte und umgerissen und dann unter die schaumige Oberfläche gezogen wurde. Die Hand ihres Vaters hatte sie hochgerissen und sie wusste noch, was er als Erstes zu ihr gesagt hatte. »Wenn wir daheim sind, lernst du schwimmen. Das passiert dir nie wieder.«
Aber sie hatte nie richtig schwimmen gelernt. Ihre Angst vor dem Wasser war zu groß gewesen. Es reichte, um sich eine Weile über Wasser zu halten, aber weite Strecken konnte sie schwimmend nicht zurücklegen.
Ihr Vater hatte gesagt, sie würde nie mehr in eine so hilflose Lage kommen.
Und nun war es doch passiert.
Das beklemmende Gefühl in Jennas Brust ließ sich nicht abschütteln. Sie mahnte sich zur Ruhe, dann schaute sie sich um. »Dann zeig sie mir, diese Chance.«
»Der Stern«, sagte Jeb. »Um Mitternacht wird er aufgehen. Bis dahin müssen wir durchhalten. Er wird uns den Weg weisen.«
Den Weg aus dieser Wasserwüste? Aus dem Nichts, in dem wir verloren sein werden, wenn wir nicht bald Land erreichen oder gefunden werden? Wie lange dauert es, bis wir zu erschöpft zum Schwimmen sind? »Aber wohin, Jeb? Wohin soll er uns führen? Da ist nichts. Nur Wasser und Leere.«
Da hörte sie erneut Marys Stimme hinter sich. »Kannst du schwimmen?«
Jenna hatte diese Frage befürchtet. Sie zögerte einen Moment, dann nickte sie. Sie hatte einen Entschluss gefasst: Sie würde hier so lange vor sich hin paddeln, bis es zu Ende ging. Sie durfte nicht aufgeben.
»Ich lasse dich jetzt los«, vernahm sie Marys leise Stimme. Dann schwebte Jenna und begann, Wasser zu treten.
»León ist tot«, sagte Mary da leise. »Ich hätte bei ihm bleiben sollen. Besser mit ihm sterben als das hier.«
Jenna schwieg und auch Jeb brachte kein Wort heraus. Er sah aus, als wäre er tief in Gedanken versunken. Und als würde auch er kämpfen. Darum, die Hoffnung nicht aufzugeben. Jenna wusste, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Es gab genau einen Grund. Und der war Jeb.
Wind war aufgekommen. Das Wasser begann, sich zu kräuseln, dann drängten leichte Wellen heran, die auf und ab stiegen. Ihre Körper schaukelten mit ihnen. Vom Himmel brannte die Sonne auf sie herab, das Wasser glitzerte. Am liebsten hätte Mary sich von dem funkelnden Schauspiel schläfrig werden lassen, irgendwann die Augen zugemacht … aber Mary spürte, wie die Angst langsam von ihr abfiel.
Wasser. Das war ihr Element.
Nirgends war Land zu sehen. Und doch beunruhigte Mary dies nicht. Wenn nur Jenna durchhielt. Mary hatte bemerkt, dass die andere, seit sie sie losgelassen hatte, sich mühsam über Wasser hielt. Immer wieder musste Jenna ihren Kopf weit über die Oberfläche recken, damit sie beim Wassertreten nicht unterging. Um Jeb machte sich Mary keine Sorgen. Er schwamm in kurzer Entfernung wiederholt um seine eigene Achse, hob den Oberkörper aus dem Wasser. Immer mit Blick auf den Horizont.
»Jenna, versuch, dich mit den Armen auszubalancieren und nicht nur mit den Beinen zu strampeln.« Mary wusste, dass Jenna dringend energiesparender schwimmen musste, wenn sie überleben wollte. Als sie sah, dass Jenna jetzt stabiler im Wasser stand, sagte sie: »Halte durch, Jenna. Das ist nicht das Ende.«
Jenna keuchte neben ihr auf. »Wieso denkst du das …«, sie spuckte Wasser aus. »Hier ist nichts, falls dir das noch nicht aufgefallen ist! Nichts, das uns retten könnte!«
Mary überlegte, ob sie Jenna von ihrer Ahnung erzählen sollte – aber welche Worte sollte sie dafür finden? Alles, was sie Jenna zum Trost sagen konnte, waren Floskeln. Vermutungen. Aber diese Vermutungen waren ihr so klar und deutlich vor Augen. Mary spürte, dass sie wahr werden würden. Sie kannte dieses Meer, diesen Ozean. Sie waren hier zwar nicht sicher. Aber ertrinken, nein, das wusste Mary, ertrinken würden sie nicht. Rettung würde kommen.
Gerade wollte sie ansetzen, Jenna ihre diffusen Gedanken zu schildern, als Mary etwas an ihren Beinen spürte. Instinktiv schaute sie unter sich, konnte aber nichts erkennen. Oder war die Bewegung von Jennas Beinschlag im Wasser gekommen?
Mary musste sich zusammenreißen, nichts zu sagen, um Jenna nicht noch zusätzlich zu verängstigen, wo diese doch gerade einen regelmäßigen Schwimmrhythmus gefunden hatte.
Da schrie das blonde Mädchen plötzlich neben ihr auf.
»Was ist?«, fragte Mary.
Jennas Stimme war laut und voller Angst. »Etwas … etwas hat mich am Bein berührt.«
Mary schluckte.
Jeb war nach Jennas Schrei zu ihnen geschwommen. Er sah sehr besorgt aus. Jenna blickte die beiden fragend an.
»Ich war es nicht, aber ich habe es auch gespürt – unter uns.« Marys Stimme zitterte und sie vergaß einen Moment, weiter auf der Stelle zu paddeln, um sich über Wasser zu halten. Sie tauchte kurz unter, doch sofort machte sie einen kräftigen Beinschlag und kam wieder nach oben. Sie schnappte beim Auftauchen nur ein Wort auf, das Jenna geradezu ungläubig aussprach: HAI.
Eben noch war sie fest davon überzeugt gewesen, alles würde gut werden.
Haie flößten Mary mehr Angst ein, als sie sich in diesem Moment eingestehen mochte. Scharfe Zähne, die starrenden Augen, die Erbarmungslosigkeit, die diese Tiere ausstrahlten. Dies war ihre Welt, hier waren sie die unangefochtenen Könige und ihr Hunger war grenzenlos. Bei der Vorstellung, unter ihr könnte so ein Tier lauern, wurde Mary beinahe übel.
Konzentriert starrte sie geradeaus. Nur nicht nach unten schauen. Sie hörte Jebs und Jennas Stimmen leise zu sich durchdringen, sie hörte, wie nervös Jenna klang, je einsilbiger Jeb wurde.
Mary drehte sich um ihre eigene Achse, beinahe hoffnungslos, aber bemüht, nicht zu verzweifeln. Noch nicht. Sie versuchte, sich in Erinnerung zu rufen, wie man sich in Gewässern, in denen sich Haie tummeln, verhalten sollte, um nicht wie Beute zu wirken. Jeb rief Jenna und Mary zusammen. Ja, sie mussten größer wirken. Ohne nachzudenken, schwamm sie auf die beiden zu. Doch Mary suchte noch immer das Wasser um sie herum ab.
Da …
Da schweifte ihr Blick über etwas, das zuvor noch nicht da gewesen war. Ein dunkler Punkt, nicht allzu weit entfernt. Die Wellen verdeckten ihn immer wieder, aber …
»Ich sehe da was«, rief Mary. Etwas trieb auf dem Wasser.
Die beiden anderen wandten sich erschrocken zu ihr um und folgten ihrem Blick.
»Seht ihr es?« Plötzlich verließ Mary alle Angst. Da war sie, die Rettung , von der sie geahnt hatte, dass sie kommen würde. »Was ist das?«, fragte Jeb atemlos.
Mary kniff die Augen zusammen. »Ich glaube, es ist ein Boot.«
»Ein Boot?«
Sie nickte. »Es liegt verkehrt herum im Wasser.« Sie wunderte sich darüber, woher sie diese Gewissheit nahm. Aber das Boot, das kieloben dort schwamm, sah sie nun klar vor sich. Wie in einer Erinnerung, die sich in ihr empordrängte … aber warum erinnerte sie sich an ein Boot?
Sie mussten sich beeilen, bevor der Hai neugierig wurde und sie attackierte. Mary überlegte, wie sie die geschwächte Jenna möglichst schnell dorthin bringen sollten, als sie eine weitere heftige Bewegung neben sich spürte. Mary schrie auf.
Marys Schrei gellte in Jebs Ohren.
»Er ist wieder da!«
»Ich habe ihn auch gespürt! Hast du ihn gesehen?«, fragte Jeb aufgeregt.
»Nein, aber ich spüre ihn. Immer noch. Das Wasser verschiebt sich unter meinem Körper. Es zieht an mir …«
Jeb tauchte kurzerhand unter, um die Lage einzuschätzen. Eine Minute lang versuchte er, mit brennenden Augen, den Hai zu entdecken. Prustend tauchte er wieder auf. »Nichts! Da ist nichts zu sehen!«
»Ich habe ihn gespürt«, beharrte Mary.
Jeb überlegte, wie er Jenna in Richtung des Bootes ziehen könnte, da hörte er, wie sie mit fester Stimme sagte: »Das Boot ist nicht mehr weit. Ich schaffe das.«
Langsam schwamm Jenna voraus. Und Jeb wusste, dass sie recht hatte: Sie mussten sich von hier fortbewegen, wenn sie ihre eine Chance wahrnehmen wollten.
Immerhin: Der Hai war nicht wieder aufgetaucht. Das gab ihm Hoffnung.
Jenna nahm Zug um Zug. Sie blickte nur selten auf. Und Schwimmzug für Schwimmzug, das wusste sie, näherte sie sich dem Boot. Sie musste nur durchhalten.
Die blaue unruhige Oberfläche vor ihr schien endlos.
Wenn sie an den Hai unter ihren Füßen dachte, verließ sie alle Kraft – und so lenkte sie ihre Gedanken auf das Boot und auf die Möglichkeit der Rettung.
Die nächsten Minuten sprach keiner von ihnen. Stumm schwammen sie durch das Auf und Ab der sanften Wellen. Die Sonne brannte auf sie hinab, aber Jenna fokussierte alles auf das Ziel, das so nah war und doch noch so fern. Sie ließ die Angst nicht zu, dass das Boot sich mit jedem Schwimmzug und mit jeder Welle wieder genau so weit entfernen konnte. Sie verschluckte sich, hustete, strampelte weiter … da berührten ihre Finger endlich etwas Hartes.
Sie hatte es geschafft. Das Boot trieb kieloben im Wasser und war aus braunem, hartem Kunststoff, dessen Rand weiß gefärbt war.
Jenna spürte die beiden anderen neben sich. Mit letzter Kraft krallte sie sich an dem Boot fest, vor Panik, es könnte gleich wieder davontreiben.
»Es ist größer, als ich dachte«, keuchte Jeb.
Größer bedeutet mehr Stabilität, dachte Jenna. Aber wie um Himmels willen sollten sie das Boot umkippen?
»Helft mir.« Jenna sah, wie Jeb zur Längsseite des Bootes schwamm. Sie bewunderte seine Kraft, die er aus scheinbar unerschöpflichen Reserven zu nehmen schien, seit sie aus dem weißen Labyrinth entkommen waren. Doch der erste Versuch, das Boot anzuheben, scheiterte.
»Alle zusammen«, sagte Mary.
Jenna bezog neben Jeb Stellung, Mary nahm den Bug des Bootes in Angriff. Erst nach drei kraftraubenden Versuchen gelang es ihnen, das Boot umzudrehen. Jennas Arme fühlten sich wie Pudding an, aber eine Welle der Erleichterung überrollte sie. Jeb und Mary neben ihr lächelten schnaufend.
Aber eine Frage blieb, wie sollten sie ins Boot gelangen, zumal mit geschwächten Armen?
Jeb stemmte sich am Bootsrand hoch, nahm Schwung – und stürzte zurück ins Wasser. Er war beinahe am Ende seiner Kräfte. Bei jedem Versuch schob er sich etwas weniger hoch aus dem Wasser. Er wusste, dass er mit jedem Versuch zumindest dazulernte, aus welcher Position und mit welcher Technik er am besten über den Rand gelangen konnte.
Wenn er sich nur nicht schon so müde und erschöpft fühlen würde. Doch er musste es schaffen, wenn nicht für ihn selbst, dann doch für die beiden Mädchen.
Er hielt sich einige Minuten still am Bootsrand fest. Er hatte herausgefunden, dass das Boot am Heck am wenigsten nachgab.
Dort würde er sich mit einem kraftvollen Beinstoß mit dem Oberkörper über den Rand hängen. Dann, in einem zweiten Ruck, Stück für Stück seinen Oberkörper und schließlich seine Beine in das Boot ziehen.
So viel zur Theorie.
Seine Hände waren inzwischen verkrampft von den unzähligen Versuchen, ins Boot zu gelangen. Diesmal würde er seinen Oberkörper als Gewicht einsetzen, um sich ins Boot zu hieven. Innerlich nahm er Anlauf. Eins … zwei …
Drei.
Mit einem tiefen Atemzug schnellte er, seine Beine schlagend, nach oben. Er hängte sich ächzend über den Rand. Zentimeter für Zentimeter schob er nun seinen Oberkörper nach, mit jedem Atemzug ein Stück weiter. Schließlich zog er ein Bein hinterher, legte es quer über das Heck des Bootes, ließ sich nach vorne fallen und rollte kopfüber ins Bootsinnere.
Geschafft. Er erlaubte sich, einen Moment zu verschnaufen, dann richtete er sich auf und mit wenigen Handgriffen, die nur aus der Verzweiflung geboren sein konnten, gelang es ihm, Jenna und dann Mary in das Boot hineinzuziehen.
Sofort, da außerhalb des kühlen Wassers, brannte die Hitze umso mehr auf ihn hinab und Jeb ließ sich erschöpft nach hinten fallen.
Als er sich ein wenig erholt hatte, blickte er zu den beiden Mädchen hinüber, die sichtlich ausgezehrt im schwankenden Boot hockten. Sie zitterten vor Anstrengung. Jeb hatte nicht mal genug Kraft, sich aufzurichten, sondern genoss für einige Momente die absolute Bewegungslosigkeit, die er seinem Körper nach stundenlangem Schwimmen nun gönnen konnte. Da hörte er, wie Jenna einen überraschten Schrei ausstieß.
»Was ist?«, fragte er erschrocken.
»Hier ist … Essen. Wasserflaschen. Plastikbeutel.« Sie wühlte die Sachen hervor. »Eine große Plastikplane und ich … ich habe …« Sie zögerte. »… das ist ein …«
Mary stand auf und kletterte über die Ruderbänke hinweg zu ihr.
»… Kompass«, vervollständigte sie den Satz. »Damit kann man die Himmelsrichtung bestimmen.«
»Manche von den Sachen sind beschriftet …«, dann schwieg Jenna plötzlich.
Jeb staunte von seinem Platz in der Mitte des Bootes nicht schlecht, als die beiden Mädchen nacheinander noch eine Sturmlampe, Verbandszeug und eine Leuchtpistole unter der Klappe am Heck hervorzogen.
All das bedeutete Leben. Überleben. Jeb traute der ganzen Sache insgeheim noch nicht: Hatte das Labyrinth nicht zwar immer dafür gesorgt, dass sie Essen, Kleidung und Ausrüstung hatten? Und hatte das Labyrinth nicht dennoch unerbittlich versucht, sie alle zu töten?
Galle stieg auf und hinterließ einen bitteren Geschmack im Mund.
Das Labyrinth hatte es wahrhaftig geschafft, dass sie mittlerweile nur noch zu dritt waren. Das alles hatte er während des Kampfs ums Überleben, den sie nun schon stunden-, nein, tagelang führten, nicht mehr an sich rangelassen. Jetzt, da er das erste Mal in Ruhe innehalten konnte und sich zumindest vorerst in Sicherheit fühlte – da brach diese Erkenntnis mit umso größerer Heftigkeit über ihn herein.
Sie waren sieben gewesen.
Nun waren sie nur noch zu dritt.
Und das Labyrinth war noch lange nicht mit ihnen fertig.
Mary beugte sich zu Jenna herüber, als diese ihr mit bedeutungsvollem und fragendem Blick das Verbandpäckchen hinhielt. Tatsächlich, dort stand ein Name. Nein, nicht irgendein Name.
Ihr Name. MARY
Aus irgendeinem Grund war sie nicht überrascht. Doch an den Reaktionen von Jeb und Jenna, die sie mit weit aufgerissenen Augen anstarrten, konnte sie die Unmöglichkeit dieses Zufalls ablesen.
Nein, ein Zufall war das sicher nicht.
Mary riss erschrocken die Augen auf, als sie begriff, was der Schriftzug in ihr wachrief.
Angst. Schande. Ausgeliefertsein.
Mehr aus einer Ahnung heraus als wirklich wissend, deutete sie mit der Hand nach vorne, zur Bugwand. »Hier steht etwas«, sagte sie leise. »Hier steht auch MARY. Mein Name. Was hat das zu bedeuten?«
Sie versuchte, die Erinnerung in ihrem Kopf zu fassen zu bekommen … »Ich … da ist ein Bild in meinem Kopf. Der Schriftzug, ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen.«
1. Buch
1.
Mary war in einer anderen Welt, die nur in ihrem Kopf existierte. In einer Welt aus Schatten, die zur Tür hereinfielen und das Zimmer eroberten, bevor ihnen der wahre Schrecken folgte.
Aber sie war nicht allein. Im Zimmer nebenan wimmerte leise ihr kleiner Bruder David.
Das Plätschern der Wellen gegen den Bootsrumpf verstummte und sie hörte die Schritte. Seine Schritte. Wie er vor der Tür auf und ab ging, so als denke er nach, so als bereue er, aber das waren nur Augenblicke, denn es geschah immer wieder. Es gab keine wahrhafte Reue, nur seinen schweren Atem, wenn er ihr ins Ohr flüsterte, dass sie Papas kleines Mädchen war.
Mary hörte, wie die Tür zum Zimmer ihres Bruders aufschwang, ein kaum vernehmbares Ächzen der Scharniere. Dann die flüsternde Stimme ihres Vaters.
Jetzt sagt er, dass David schlafen soll, alles in Ordnung ist, aber nichts ist in Ordnung. Niemals wieder. Nicht für David und auch nicht für mich.
Die Tür ächzte erneut, dann verschwanden die Schritte.
Zurück blieb Einsamkeit.
Tränen.
Und das Gefühl unendlicher Demütigung.
Leise schob sie die Bettdecke zurück und erhob sich. Der Boden war kalt unter ihren Füßen und sie fröstelte. Unsicher stand sie da.
Ich muss zu David. Ihn in den Arm nehmen, ihm vorlügen, alles wird gut werden. Seine Tränen werden mein Nachthemd durchnässen und ich werde mich schämen.
Doch Mary wagte es nicht, die Tür in ihrem Kopf aufzustoßen. Nicht mehr. Sie zählte von sieben rückwärts, damit die Angst sie nicht überrollen würde. Das würde sie nicht mehr zulassen. Sie würde …
Mary zählte.
Sieben.
Sechs.
In ihr stiegen weitere Erinnerungen hoch. Erinnerungen daran, auf einem knarzenden, ächzenden Schiff zu sein. Ein Schiff, das ihr Angst machte und …
Fünf.
… aber auch Geborgenheit verhieß. Geborgenheit? Kurz hielt Mary inne. Nein – da kamen nur Bilder …
Ich stehe an der Tür, wage nicht, sie zu öffnen und hinauszuhuschen. ER ist irgendwo da draußen, geht auf und ab wie ein Raubtier im Käfig. ER wird mich hören und dann.
Wird er zu mir kommen. Seinen alkoholschweren Atem über mein Gesicht wehen.
Mit Fragen wie:
»Hast du Papa lieb?«
Mary wand sich, nahm mehr wahr, wo sie sich befand. Hörte nur von fern die beiden Stimmen von Jeb und Jenna neben sich.
Hast du Papa lieb?
Der Anfang klingt richtig, aber das letzte Wort gehört nicht in diesen Satz.
Hasst du Papa?
Das war die Wahrheit. Die einzige. Vier. Drei.
Ich hasse dich. Ich wünsche dir die Wahrheit in den Augen der anderen, wenn sie dich ansehen, wissend, was du getan hast.
Aber das wird nicht geschehen.
Ich bin in einer anderen Welt.
Zwei.
Kämpfe um mein Überleben.
Aber irgendwie bist du ins Labyrinth geraten.
Zu mir.
Und jetzt wird deine kleine Mary dich finden.
Eins.
Jeb beobachtete Mary, die sich im Bug des Bootes hingesetzt hatte. Sie hatte gesagt, sie müsse nachdenken, und sich seitdem geweigert, von den Rationen zu essen. Nur eine kleine Flasche Wasser hatte sie getrunken.
Jenna und er hatten anfangs noch versucht, mit ihr zu reden, immerhin bestand die Möglichkeit, dass die Namensgleichheit ein Zufall war, aber Mary blieb stumm. Mit ausdruckslosem Gesicht und leerem Blick starrte sie schweigend vor sich hin.
Nachdenklich kaute Jeb auf einem Hartkeks herum. Neben ihm saß Jenna und schmierte sich das Gesicht mit der gefundenen Sonnenschutzcreme ein. Eine dicke weiße Schicht war auf ihrer Haut, die sie mit den Fingern verteilte.
Es ist, als hätte jemand dieses Boot für uns bereitgestellt und an alles gedacht, was wir brauchen.
Das Ruderboot schaukelte im Wasser. Um sie herum gab es keine Orientierungspunkte und so ließ sich schwer feststellen, ob sie sich überhaupt bewegten. Jeb schluckte den letzten Bissen Keks hinunter, dann wandte er sich an Jenna. »Was machen wir mit ihr?«
Jenna hielt inne. »Sie braucht Zeit, dann wird sie sich erinnern – vielleicht wissen wir dann mehr über diese Welt.«
»Sie hat nicht mal was gegessen.«
Jeb erntete einen kalten Blick von Jenna. »Verstehst du das etwa nicht?«
Der harte Ton in ihrer Stimme verwunderte ihn. Natürlich verstand er. Léon war tot und der Schock über die Entdeckung ihres Namens auf dem Boot hatte sie verstummen lassen, aber es gab doch Hoffnung. Oder? Sie hatten Vorräte, Wasser, Medizin, sie konnten eine Weile durchhalten. Vielleicht würde irgendwann ein Schiff am Horizont auftauchen und sie retten.
Die anderen sind gestorben, aber wir sind noch da. Wir haben es verdient zu leben.
Und dennoch war da der harte Klang in Jennas Stimme. Auch sie hatte sich verändert. Das Labyrinth hatte sie verändert. Jeb sah den bitteren Zug um ihre Mundwinkel, aber wie konnte es auch anders sein. All die Strapazen, die Ängste gruben sich in das Innerste ein, brachten Verborgenes zum Vorschein.
Bald würde sich der glühende Tag dem Ende neigen und die Sonne langsam am Horizont im Meer versinken. Jeb hoffte, dass die Nacht ihnen wieder den Stern zeigen würde, dann konnte ihre Reise weitergehen.
Immer dem Stern entgegen.
Jeb blickte Mary an. Die Arme um die Beine geschlungen, so klein zusammengerollt, als wolle sie sich vor der Welt verstecken. Sein Herz brannte, denn es gab nichts, was er für sie tun konnte.
León war tot.
Der letzte Satz war so schlicht und so wahr, dass er ihn fast überwältigte. León war tot. Nichts konnte etwas daran ändern. Er würde ihm nie wieder gegenüberstehen, seine Wildheit und seinen durch nichts zu erschütternden Kampfeswillen bewundern.
Compadre, du warst mein Gegner, aber auch mein Freund. Du hast mir immer die Hoffnung gegeben, dass es sich lohnt zu kämpfen, dass Aufgeben keine Option ist. Nun bin ich allein mit Jenna und Mary und weiß nicht, was ich tun soll.
Jenna soll leben. Heimkehren. Aber Mary hat es ebenso verdient. Sie ist so tapfer.
Doch Mary war nun innerlich zerbrochen. Alle Lebenskraft schien sie verlassen zu haben, so als wäre sie bereit zu sterben.
Kann ich damit leben? Kann ich Mary opfern, damit Jenna das letzte Tor erreicht? Wie sollen wir mit all dem nur fertigwerden? Jenna? Macht es nach all dem überhaupt Sinn, in die eigene Welt zurückzukehren, wenn so viele andere dafür draufgegangen sind?
Jeb wand sich aus seinen Gedanken. So weit wollte er noch nicht denken. Nur bis zur nächsten Stunde des Überlebens und zur nächsten. Was danach kam, würde sich entscheiden.
Neben ihm saß Jenna und starrte aufs Meer hinaus. Die Oberfläche glänzte und funkelte im Sonnenlicht, alles schien so unendlich friedlich zu sein. Die Stille war einzigartig.
Jeb dachte über das nach, über die Bruchstücke, die er mittlerweile von seinem Leben erfahren hatte. Über die Bilder, die er im weißen Labyrinth gesehen hatte.
Seinen Vater.
Seine Mutter.
Ihren Tod.
Danach nichts mehr. Nur noch vollkommene Schwärze. Als ob er aus diesem Nichts in seinem Kopf bestehen würde.
Wie bin ich hierhergekommen?
Die Fragen quälten ihn. Sein Kopf schmerzte im unbarmherzigen Licht der Sonne, die auf seine Schädeldecke brannte, so als versuche, sie einen Weg in seine Gedanken zu finden. Licht ins Dunkel.
Licht ins vollkommene Nichts.
Jeb zog sein T-Shirt aus, tauchte es ins Wasser und band es sich wie einen Turban um. Er spürte, dass Jenna ihn beobachtet und lächelte ihr zu. Er nahm ihre Hand. Sie sollte spüren, dass sie diese eine große Gewissheit war, die er noch hatte. Er liebte sie. Er würde sie retten um jeden Preis.
Jenna nickte mit einem zaghaften Lächeln, schwieg aber.
Auch sie braucht Zeit für ihre Gedanken. Still und endlos treiben sie dahin, wie der Ozean, der sich um uns herum ausbreitet.
Jeb atmete auf. Sein Turban brachte etwas Kühlung und die Schmerzen in seinem Schädel ließen nach. Er wurde schläfrig.
Jeb wusste nicht, wie lange er gedöst hatte, aber als er die Augen aufschlug, spürte er, dass sich etwas verändert hatte. Es dauerte einen Moment, bis er begriff, dass das Boot leicht schaukelte. Er blickte sich um, in alle Richtungen.
Das Meer lag ruhig vor ihm, keine Welle kräuselte seine Oberfläche und es gab auch keinen Wind, der über ihn hinwegstrich.
Und dennoch bewegte sich das Boot.
Seltsam.
Dann durchzuckte ihn ein Gedanke: Etwas unter ihnen hatte es ins Wanken gebracht.
Und plötzlich verstand Jeb.
Der Hai. Er war zurückgekehrt, zog seine Bahn unterhalb des Bootes.
So nahe, dass das Rettungsboot zu schaukeln begann.
Der Hai spürt, dass es hier etwas zu holen gibt. Wird er angreifen? Greifen Haie Boote an?
Jeb wusste es nicht, was nicht gerade dazu führte, dass er ruhiger wurde. Er spürte, dass sein Puls sich beschleunigte. Dieser neue Gegner war genauso unbarmherzig und er kannte keine Angst. Im Wasser, seinem Element, war er der ultimative Jäger.
Alles, was wir tun können, ist, uns ruhig zu verhalten.
Fünf Minuten vergingen, dann schwappte eine kleine Welle gegen das Boot. Ein dunkler Schatten schwamm unter dem Kiel hindurch und verschwand wieder in der Tiefe.
Verdammt! Das war nahe.
Sein Blick huschte zu Mary hinüber, die offensichtlich eingeschlafen war. Jenna hatte sich nach vorn gebeugt, die Hände im Nacken gefaltet. Ihre Augen waren geschlossen.
»Jenna«, raunte er leise.
Sie drehte den Kopf. Ihre blonden Haare glänzten im Sonnenlicht, aber sie selbst machte einen erschöpften Eindruck.
»Was ist?«, flüsterte sie.
»Der Hai ist wieder da.«
Jeb sah, wie sich Jennas Körper anspannte. Sie saß stocksteif da, wie versteinert, mit eingefrorenen Gesichtszügen.
Ihre Lippen bebten, als sie sagte: »Ich … ich habe Angst, Jeb.«
»Ja, ich weiß.«
Er konnte jetzt nicht aufstehen oder zu ihr rutschen, dadurch käme das ganze Boot ins Schaukeln. Mary würde vielleicht aufwachen, erschrecken und etwas Dummes tun. Nein, er musste bleiben, wo er war. Die Nerven behalten.
»Wo ist er?«, fragte Jenna.
»Zieht unter uns seine Kreise. Ich will nicht nachsehen, die Bewegung des Bootes könnte ihn neugierig machen.«
»Was tun wir jetzt? Warten?«
Jenna suchte das Bootsinnere ab, er wusste, was sie suchte: Paddel. Aber da war nichts.
Sie waren dem Ozean und seinen Launen, seinen Bewohnern und den Bewegungen der Wellen ausgeliefert. Da kam Jeb eine Idee. Vielleicht war es der blanke Wahnsinn. Vielleicht ging die Sache sogar buchstäblich nach hinten los, Jeb kannte sich da nicht so genau aus. Aber es war zumindest eine Möglichkeit, etwas anderes zu unternehmen, als bloß zu warten. »Ich brauche die Leuchtpistole.«
Jenna runzelte die Stirn. »Es ist heller Tag, wozu …«
»Vielleicht kann ich ihn abschrecken«, unterbrach sie Jeb.
»Blödsinn.«
Eine andere Möglichkeit haben wir aber nicht, dachte Jeb, sagte jedoch nichts dazu. »Gib sie mir.«
Jenna drehte sich vorsichtig um, öffnete die Klappe zu den Vorräten und zog die Leuchtpistole heraus, die sie Jeb reichte.
Jeb betrachtete den Gegenstand. Die Pistole war klobig und sah aus wie eine antike Waffe aus einem alten Westernfilm.
»Weißt du, wie das Ding funktioniert?«, fragte Jenna.
Er hatte keine Ahnung, aber so schwierig konnte es ja nicht sein. »Ich denke schon.«
Er klappte die Pistole auf. Eine dicke Patrone lag darin. Gut. Dann hob er die unhandliche Waffe an und zielte zur Probe. Das Ding war dafür gedacht, eine Leuchtpatrone direkt in den Himmel zu jagen, für gezieltes Schießen war es nicht geeignet, aber Jeb wusste, er musste den Hai sowieso nahe ans Boot heranlassen, bevor er die Pistole benutzen konnte. Immerhin hatte so eine Leuchtpistole eine große Reichweite, wenn man sie abschoss. Das hieß, sie besaß eine enorme Wucht. Er erwartete, dass die Patrone auf einer kurzen Strecke stark genug war, dass sie das Wasser durchstieß. Jeb hoffte, dass das Geschoss den Hai für einen Moment erschreckte und blendete, bevor die Patrone im Wasser erlosch. So viel zur Theorie. Wenn die Sache nicht funktionierte, waren sie dem Hai ausgeliefert. Mit einem Paddel hätten sie nicht nur rudern, sondern auch nach dem Vieh schlagen können. Er seufzte.
»Oh Mann, dass klappt niemals«, raunte Jenna.
»Wir müssen es versuchen.«
Jeb richtete sich auf und sondierte die Umgebung.
Das Meer lag wie ein Spiegel vor ihm.
Keine Bewegung auszumachen.
Minuten vergingen. Seine Augen begannen zu brennen. Wenn er noch weiter auf die funkelnde Oberfläche starrte, würde er blind werden.
Er wollte sich gerade abwenden, als er in etwa fünfzig Metern Entfernung eine dreieckige Flosse auftauchen sah. Der Hai war an die Oberfläche gestiegen. Langsam schwamm er auf das Boot zu. Unter der Flosse war sein mächtiger Körper nur zu erahnen, aber Jeb spürte die urtümliche Kraft dieses Tieres. Fast gemächlich hielt es auf das Boot zu, dann, zehn Meter vor dem Boot, tauchte der Hai unter dem Kiel durch.
Wieder schwappte eine kleine Welle gegen die Bordwand, aber ansonsten geschah nichts. Jeb stieß den angehaltenen Atem aus.
Neben ihm stöhnte Jenna auf. »Ich halte das nicht aus, Jeb.« Ihre Stimme zitterte. »Ich habe eine solche Angst. Erst das Wasser und jetzt das. Ich halte es nicht aus.«
»Psst. Versuch, dich zusammenzureißen, bitte«, beschwor er sie eindringlich. »Noch kann alles gut werden.«
»Was wird gut?«, erklang da eine Stimme in seinem Rücken. Mary war aufgewacht. Jeb drehte sich nach ihr um.
Er versuchte gar nicht erst, sie anzulügen. »Der Hai ist zurückgekommen. Er umkreist das Boot.«
Die ohnehin schon blasse Mary wurde noch weißer im Gesicht. »Meinst du, er greift uns an?«
Jeb zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, aber ich bin vorbereitet.« Er schwenkte die Leuchtpistole, damit Mary sie sehen konnte.
»Damit willst du ihn vertreiben?«, fragte das dunkelhaarige Mädchen.
»Es ist alles, was wir haben.«
Jeb wollte sich gerade wieder in Stellung bringen, als das Rettungsboot von einem heftigen Stoß erschüttert wurde. Die linke Seite hob sich fast einen Meter aus dem Wasser. Mary wurde nach hinten geworfen, Jeb hart auf die Knie geschleudert. Noch während er fiel, sah er, wie sich ein gigantischer Rachen mit mehreren Reihen rasiermesserscharfen Zähne öffnete und in die nach unten sackende Bordwand biss. Jeb sah für einen Moment einen riesigen Schlund und weiße Zacken, direkt vor sich, ein starres, kaltes Auge blickte ihn an. Das Auge eines Jägers, der seine Beute fest ins Visier genommen hatte.
Für einen Moment schien es so, als könne der Hai wirklich zubeißen, aber dann rutschte er mit dem Oberkiefer vom Bugrand ab.
Prompt wurde das Boot in die andere Richtung geschleudert und warf seine Insassen unkontrolliert von einer Bordwand zur anderen. Es drohte zu kentern. Mary schrie gellend auf. Von Jenna hörte Jeb nichts. Er richtete sich mit wackelnden Knien auf, versuchte, das Boot stehend wieder einigermaßen auszubalancieren, zog den Hahn der Leuchtpistole zurück und machte sich bereit, auf den Hai zu feuern. Doch das Tier hatte sich wieder in die Tiefe des Meeres zurückgezogen.
Der Hai war enorm gewesen. Riesenhaft, übernatürlich groß. Jebs Blick streifte die Bordwand, die der Hai fast zu packen bekommen hatte – dort waren mehrere tiefe Kerben im Hartplastik, wie mit messerscharfen Klingen geritzt.
Jeb bemühte sich, die Spuren des Angriffs mit seinem Körper zu verdecken, während er das Wasser rund um das Boot absuchte. »Alles in Ordnung?«, fragte er nach hinten.
Noch bevor eine Antwort kam, spürte Jeb es. Von einer schrecklichen Gewissheit erfüllt, warf er sich herum und brachte das Boot damit gefährlich zum Schaukeln.
Der Platz neben ihm – leer.
Jenna war über Bord gegangen.
Jeb brüllte auf. Schrie nach Jenna. Dann sah er sie. Nur wenige Meter entfernt durchstieß ihr Kopf die Oberfläche. Sie prustete Wasser aus, hustete.
Sein Blick jagte herum.
Da! Die dreieckige Flosse tauchte wieder auf. Offensichtlich war der Haifisch auf Jenna aufmerksam geworden.
Der Raubfisch spürte, dass etwas Lebendiges im Wasser war. Er wendete, schwamm aber nicht direkt auf das Boot zu, sondern zog einen großen Kreis darum, hielt lauernd auf seine wehrlose Beute zu.
»Jenna!«, rief Mary.
Jeb hingegen brachte kein Wort heraus. Jenna wandte sich ihm zu. Nur vier Meter trennten sie vom Boot.
Jenna wusste, dass sie in Gefahr war. Keine Frage, in ihrem Gesicht stand die nackte Angst. Sie wirbelte im Wasser um die eigene Achse, versuchte, den Hai auszumachen. Dann schien sie ihn entdeckt zu haben. Sie hielt sich stocksteif und still im Wasser. Sie sagte kein Wort, schrie nicht.
Langsam, als ob er wüsste, dass ihm nichts auf der Welt diese Beute würde streitig machen können, kam der Hai näher.
Jeb erwachte aus seiner Starre und blickte auf die Leuchtpistole in seiner Hand. Sein Kopf war wie leer gefegt.
Was tun? Auf den Hai schießen?
Es konnte sein, dass er ihn verfehlte und stattdessen Jenna traf.
Ins Wasser springen?
Bis er bei Jenna war, würde es schon zu spät sein.
Den Hai irgendwie ablenken?
Unmöglich, das Biest hatte sein Opfer fixiert. Da kam Jeb eine Idee, eine Idee, die ihm das Blut in den Adern erfrieren ließ, aber es war das Einzige, das ihm in diesem Moment einfiel.
»Jenna!«, brüllte er. »Schwimm zu uns!«
Jeb richtete sich zu voller Größe auf, brachte das Boot dadurch erneut ins Schwanken, aber davon ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen. Er blendete alles um sich herum aus, hörte nicht mehr Marys Rufe und Jennas Keuchen, während sie begann zu schwimmen.
Vollkommen auf den Hai fokussiert, riss Jeb die Leuchtpistole hoch und zielte. Er musste schießen, das Risiko, Jenna zu treffen, dabei eingehen.
Und dann spürte er es. Eine unbändige Klarheit erfüllte ihn. Er würde nicht danebenschießen. Er würde treffen.
Der Hai war groß. Er bot daher eine enorme Zielscheibe. Die Chance, dem Tier bei seinem ersten Angriff in den Schlund zu schießen, hatte Jeb verpasst.
Die nächste Gelegenheit würde er nutzen und der Schuss musste sicher treffen, sonst waren sie dem Hai endgültig schutzlos ausgeliefert und ihr Kampf im Labyrinth hätte an dieser Stelle ein völlig sinnloses Ende gefunden. Jeb blickte in den Himmel hinauf.
Sein Atem wurde ruhig.
Die Hände zitterten nicht mehr.
Jenna hatte das Boot erreicht, das sah er aus den Augenwinkeln. Jeb flehte stumm darum, dass sie nicht ans Boot fasste und es ins Schwanken brachte. Er konnte nicht zu ihr schauen, musste sich auf den Hai konzentrieren, der nur noch wenige Meter entfernt war. Jeb hoffte, dass Jenna instinktiv verstand, was er vorhatte. Für einen kurzen Moment, so hoffte er, würde sie die Beute abgeben. Den Köder.
Der Hai mit seinem mächtigen Körper durchschnitt die Wasseroberfläche. Er hatte es nicht eilig und schwamm langsam auf das Boot zu.
Er näherte sich auf drei Meter.
Der schwarze Rücken des Tieres und die messerscharf aussehende Rückenflosse wurden wie an einem unsichtbaren Faden auf das Boot zu gezogen.
Auf Jenna zu.
Der Hai machte Anstalten, aufzutauchen und Jenna anzugreifen. Er war nur noch zwei Meter entfernt, da riss Jeb den Abzug durch. Das Geschoss jagte auf Flammen aus dem Lauf. Durchbrach die Oberfläche an der Stelle, an der gerade der Hai mit seiner spitzen Schnauze auftauchte, und bohrte sich tief in das grimmig starrende linke Auge des Tieres.
Der Hai warf sich herum, schnellte aus dem Wasser, seine glänzende Schwanzflosse peitschte direkt neben Jennas Kopf auf das Wasser. Sein Schlag verfehlte sie nur um Haaresbreite, dann krachte er zurück auf die Oberfläche, verschwand zuckend und eine rote Spur hinterlassend in der Tiefe.
Mit einem Mal herrschte unnatürliche Stille. Nur das Klatschen des aufgewühlten Wassers an der Bootswand war zu hören.
Jeb erwachte aus seiner Anspannung, als Jenna unter ihm aufschluchzte. Ihre Hände lagen nun an der Bordwand, sie bebten und vermochten kaum, Jenna über Wasser zu halten, so zittrig waren sie. Jeb warf die Leuchtpistole achtlos beiseite, bückte sich und fasste nach Jenna. Dann zog er sie aus dem Wasser und drückte sie an sich. Er hielt sie fest, während sie am ganzen Körper zitterte. Er nahm ihren Kopf in beide Hände und kämmte ihr mit den Fingern die nassen Haare aus dem Gesicht. Ihr Gesicht war nass vor Tränen und vom Meerwasser, sie schluchzte und bibberte. Und Jeb hielt sie. Hielt sie einfach nur fest, so fest er konnte. Er küsste sie immer und immer wieder überall, auf die Augen, an der Schläfe, am Mundwinkel, auf die Stirn. Jennas Gesicht schmeckte salzig, aber es war warm.
Lange sagte keiner von ihnen ein Wort, bis auch Mary zu ihnen kam. »Es ist alles gut«, flüsterte sie und streichelte Jenna über den Rücken.
Jenna schlotterte in Jebs Umarmung, aber es schien, als würde sie sich langsam beruhigen. Ihre Lippen öffneten sich, aber es kam kein Wort heraus. Jeb ahnte, was sie sagen wollte.
Er sprach das aus, was sie hören wollte. »Er ist weg und kommt nicht wieder.«
Da ließ ihre Körperspannung nach, sie sackte regelrecht in sich zusammen. Jeb hielt sie weiterhin fest und bettete sie sanft im Heck des Bootes.
Jenna war stumm. Mary setzte sich zu ihr und zog Jennas Kopf in ihren Schoß. Sie strich über Jennas Haar. Dazu summte sie leise ein Lied.
Und schließlich wurde Jennas Atem ruhiger.
Sie schlief ein.
2.
Mary erwachte, ohne zu wissen, was sie geweckt hatte. Um sie herum herrschte fahle Dunkelheit, die von einer unsichtbaren Lichtquelle aufgelockert wurde, sodass Mary die Weite des Meeres um sich herum wahrnehmen konnte.
Jennas Kopf lag noch immer in ihrem Schoß und sie spürte, wie verspannt ihre Schultern waren. Sie war im Sitzen eingeschlafen und nun war es gnädige, kühlende Nacht geworden.
Mary suchte das Boot nach Jeb ab, der auf der Ruderbank in sich zusammengesackt war und offensichtlich schlief. Weder Jenna noch Jeb rührten sich.
Mary nahm vorsichtig Jennas Kopf in ihre Hände und wand sich unter ihr zur Seite, um sich aufzurichten. Sie streckte ihre Glieder und ächzte, als die steifen Muskeln in Bewegung kamen. In der Luft lag ein metallischer Geruch, den sie zunächst nicht einordnen konnte.
Aber dann erinnerte er sich an die erste Welt. In der Steppe hatte es damals kurz vor Ausbruch eines heftigen Gewitters ebenfalls so gerochen. Etwas beunruhigt spähte sie aufs Meer, aber sie konnte in der Dunkelheit nur wenig ausmachen. Der Seegang schien etwas rauer geworden zu sein, denn nun hoben und senkten Wellen das Boot in einem langsamen Rhythmus.
Trotzdem wirkten die Umgebung ruhig und das Meer nicht bedrohlich. Mary entspannte sich ein wenig. Sie überlegte, ob sie sich wieder hinlegen sollte, als eine etwas größere Welle das Boot einen halben Meter anhob und eine leichte Erschütterung den Rumpf erzittern ließ. Gleichzeitig gab es einen hohlen, dumpfen Klang. Mary erschrak und drehte sich hastig um. Zum ersten Mal seit sie erwacht war, sah sie nun, was hinter ihr lag, und zuckte zurück.
Vor ihr ragte eine schwarze Wand auf. Sie verdeckte den Himmel vollkommen, so schien es. Den Kopf in den Nacken gelegt, wanderte ihr Blick über das Hindernis, gegen das der Seegang das Boot getrieben hatte. Zunächst begriff sie nicht, was sie da sah, aber dann machte sich Hoffnung in Mary breit.
Es war ein Schiff! Das Schicksal hatte sie zu einem Schiff geführt, das, ohne Fahrt zu machen, im Wasser lag. Marys Augen flogen darüber, aber es gab keinen Zweifel, es war tatsächlich ein Schiff. Das war sie also, die Rettung, die Mary schon erahnt hatte. Wieso wollte sich dann keine Erleichterung bei ihr einstellen?
Mary suchte und fand die Sturmlampe, die zur Bootsausrüstung gehörte, schaltete sie ein und ließ den Strahl nach oben wandern.
Die Schiffswand war nachtschwarz gestrichen und ragte mindestens fünfzehn Meter vor ihr auf. Jenseits der schwarzen Fläche konnte Mary den Himmel nicht erkennen.
Seltsam. Wo war der Stern? Sie ließ ihren Blick schweifen, da entdeckte sie etwas Helles am oberen Bordrand. Die dunkle Fläche wurde dort von einem weißen Schriftzug mit riesigen Buchstaben durchbrochen, von denen Mary glaubte, sie stellten den Schiffsnamen dar, aber aus ihrer Position heraus gelang es ihr nicht, das Wort zu entziffern.
Während Mary mit klopfendem Herzen nach oben starrte, wurde das Ruderboot erneut von einer Welle angehoben und gegen das Schiff getrieben, von dem Mary glaubte, es könne ein Frachter sein.
Ein Frachter. Marys Kehle schnürte sich mit einem Mal zu. Und dann traf sie die Erkenntnis. Sie kannte dieses Schiff. Sie kannte es gut. Sie hatte einen Großteil ihrer Kindheit an Bord verbracht.
Jenna wurde von einem Zittern geweckt. Sie öffnete die Augen und war – allein. Es dauerte eine Weile, bis sie sich orientiert hatte. Dann erinnerte sie sich: Sie saßen zu dritt in einem Boot fest. Jeb hatte sie aus dem Wasser gezogen, der Hai war fort, sie war in Sicherheit. Der Raubfisch war nicht wiedergekommen … aber warum wackelte nun das Boot?
Jenna legte ihre Arme um die zur Brust gezogenen Beine und wagte nur, ihren Kopf vorsichtig zu heben, um mit Mary oder Jeb zu sprechen.
Da sah sie Mary. Sie hatte sich an die rechte Bugseite gestellt, hielt eine Lampe in der Hand und blickte hinaus in die Dunkelheit. Jeb hingegen lag etwas entfernt auf der Ruderbank … nun rührte auch er sich.
»Da draußen, da ist etwas, das ihr euch ansehen solltet«, hörte Jenna nun Marys zittrige Stimme.
Jeb war von einem Ruckeln aufgewacht. Als er nun Marys Stimme vernahm, stand er hastig auf. Er hatte nur einen Gedanken und er hoffte, dass sich seine dunkle Ahnung nicht bewahrheitete.
Mit dem Aufstehen brachte Jeb das Boot zum Schwanken. Er wartete einen Moment, bis er sich ausbalanciert hatte, dann stieg er über die Ruderbank hinweg und beugte sich zu Jenna hinunter, die stocksteif auf der Mittelplanke saß und zu Mary hinüberstarrte.
»Was ist?«, fragte er.
Jenna blickte auf. »Ich weiß nicht.«
Plötzlich hörte er ein Geräusch, das ihn vollkommen irritierte.
Klonk.
Und wieder Marys Stimme, die seiner Irritation Hoffnung verlieh. »Jeb, Jenna, da ist ein Schiff.«
Er schaute zu Mary hinüber, die mit der Sturmlampe in die Finsternis … nein. Dort war zwar etwas Dunkles, aber es lag direkt vor ihnen. Es war nicht undurchdringliche Schwärze. Nein. Es war nichts weniger eine metallene Wand, die direkt vor Mary aufragte. Nach oben hin schien sie kein Ende zu nehmen.
Jeb blinzelte verwirrt, dann hatte er sich orientiert.
Jenna sah ihn fragend an, immer noch schlaftrunken und offenbar mitgenommen von dem Erlebnis mit dem Hai.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte sie.
»Wir sind gerettet, Jenna.« Er deutete über das Boot hinaus und Jennas Augen wurden weit. »Ein Schiff«, sagte Jeb. »Das Schicksal hat uns ein Schiff geschickt.«
Er wusste nicht, warum er das sagte, schließlich war nicht mal klar, ob das Schiff sie tatsächlich retten würde.
Aber dennoch. In den Weiten des Meeres, das auf kurz oder lang ihren Tod bedeutet hätte, war dieses Schiff ihre einzige Hoffnung. Ein Anker und ein Ausweg.
Das Rettungsboot schwankte noch mehr, als sich nun auch Jenna aufrichtete. »Stimmt das, Mary?«
»Ich kenne dieses Schiff.«
»Wie meinst du das?«, fragte Jeb.
»Es ist so, wie ich es sage, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen.«
»Mary …« – »Später erkläre ich dir das, Jeb, aber nicht jetzt.«
Langsam stand Jenna auf und stakste zu Mary und Jeb hinüber, die beide auf die große Stahlwand vor sich starrten.