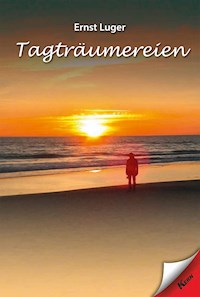Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kern
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Jeder von uns hatte ein mehr oder weniger großes Rucksäckchen aus der Vergangenheit bei sich“, stellt der Ich-Erzähler fest, als er aus der Hauptstadt Wien in das Dorf zurückkehrt, in dem er aufgewachsen war. Hinter dem Beziehungsgeflecht zu Familie, alten Freunden und neuen Bekanntschaften verbirgt sich Sinnlichkeit, Bitterkeit und Trauer sowie Harmonie, Heiterkeit und Lebensfreude. Überraschend liegt im vermeintlich Bekanntem ein Geheimnis. Eine Geschichte über Heimat und Familie, Beziehungen, Rollen und Identitäten. Und über die wahrlich große Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emst Luger
Das Leben ist nicht einfach,
um schön zu sein
Novelle
Bibliografische Informationen der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Dateien sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Impressum:
© Verlag Kern GmbH, Ilmenau
© Inhaltliche Rechte beim Autor
1. Auflage, Februar 2022
Autor: Ernst Luger
Layout/Satz: Brigitte Winkler, www.winkler-layout.de
Lektorat: Heike Funke
Sprache: deutsch
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
ISBN: 978-3-95716-347-9
ISBN E-Book: 978-3-95716-366-0
www.verlag-kern.de
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Übersetzung, Entnahme von Abbildungen, Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege, Speicherung in DV-Systemen oder auf elektronischen Datenträgern sowie die Bereitstellung der Inhalte im Internet oder anderen Kommunikationsträgern ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlags auch bei nur auszugsweiser Verwendung strafbar.
Kleine Inspiration
Langsam zieht sich die Dunkelheit hinter den Horizont zurück! Was wird der neue Tag wohl bringen, wohin wird er uns führen? Bringt er uns Zufriedenheit oder lässt er uns in der Dunkelheit zurück?
Nicht das fehlende Licht erzeugt die innere Dunkelheit, sondern die Unzufriedenheit. In der Finsternis sind wir blind, sehen weder, wo wir stehen, noch, wohin wir gehen. Der Tag soll nicht finster bleiben – lass uns zufrieden ans Tagwerk gehen, dann leuchtet auch für uns das Licht des Lebens.
(Ernst Luger)
I
Der Tag zog sich ewig dahin. Noch lagen einige Stunden vor mir, bis mein Zug vom Wiener Hauptbahnhof in Richtung Westen nach Feldkirch (Stadt in Vorarlberg) abfuhr. Als endlich der Taxifahrer an meiner Haustür läutete, erlöste er mich von der nervigen Warterei. Am Bahnhof war viel los, emsiges Treiben auf allen Gängen und Plattformen. Bahnsteig fünf war mein Ziel und der Zug ins „Ländle“ stand schon bereit. Zum Glück hatte ich einen Platz reserviert, denn ich hatte ganz vergessen, dass uns ein verlängertes Wochenende bevorstand, an dem verständlicherweise die meisten Studenten und Pendler nach Hause zu ihren Familien fahren. Endlich kündigte ein lauter Pfiff des Fahrdienstleiters die Abfahrt des Zuges an. Die Lokomotive nahm Fahrt auf und langsam beruhigte sich auch das Gewurle und Geplapper im Bahnabteil. Alle Passagiere hatten ihre Plätze bezogen, das Handgepäck verstaut und sich auf die mehr oder weniger längere Reise eingerichtet. Ich holte jenes Buch heraus, welches ich mir extra für die lange Fahrt mitgenommen hatte. Diesen „Schinken“ wollte ich schon seit einiger Zeit lesen, konnte aber keine Zeit dazu erübrigen. Der Zug schlängelte sich durch die Häuserzeilen der Vorstadt, da und dort sah man Leute in ihren Vorgärten am Herumwerkeln. Die Gegend rundum war topfeben, das fiel mir in diesem Moment richtig gravierend auf. Jeden Tag marschiere ich durch die Gassen der Bundeshauptstadt, aber diese fast unendliche Weite war mir niemals so intensiv aufgefallen wie gerade in diesem Moment. Muss wohl an den nebeneinanderstehenden Häusern liegen, die durch ihre Höhe den eigenen Sichthorizont einschränken. Ist das vielleicht Heimweh nach den Bergen, den Alpen, den Alpwiesen, dem Älpele? Der Gedanke ließ mich nicht mehr los und das extra mitgenommene Buch verschwand wieder in der Versenkung. Irgendetwas muss ich unternehmen, damit ich wieder auf andere Gedanken komme, sagte ich zu mir. Gleichschon machte ich mich auf den Weg ins gut besuchte Zugrestaurant. Zu meinem Glück saß ein Herr allein an einem Zweiertisch. Freundlich erkundigte ich mich, ob es gestattet sei, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Mit einer freundlichen Geste und den Worten „Jo, bittschön“ bot er mir den ihm gegenüberliegenden Platz an. Mit seiner Aussprache outete sich der Fremde mir gegenüber als original „Gsiberger“, wie wir Vorarlberger scherzhaft von den Wienern genannt werden. Gerne nahm ich das Angebot an. Gleichschon stand ein Kellner neben mir und erkundigte sich nach meinem Begehr. Was trinkt man in einem Zugrestaurant: Wein, Bier oder …? Am besten wird wohl ein Bier sein, dachte ich mir, denn da kann nicht viel schiefgehen. Bei Wein bin ich etwas heikel, weil ich von den billigen Weinen immer Sodbrennen bekomme, und das konnte ich in dem Moment schon gar nicht brauchen. Als der Kellner mir das Getränk servierte, staunte ich nicht schlecht, denn er reichte mir tatsächlich frisch gezapftes Bier aus meiner Heimat, und das in einem Zug, der von Wien aus quer durch das ganze Land fährt. Bis dahin schwieg mein Gegenüber, jedoch musste er mein Erstaunen in meinem Gesicht abgelesen haben und meinte daraufhin lakonisch: „Isch scho guat, odr?“ Erfreut entgegnete ich: „Ja, bin schon lange vom Ländle wegezogen, darum freut es mich jedes Mal, wenn mir ein Bier aus der Heimat serviert wird. Entschuldigung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, bin der Mathias Polder aus Wien, Beamter im Finanzministerium.“
„Freut mi, I bi dr Johannes Wiesmüller us Bludaz (Bludenz, Stadt in Vorarlberg), aber alle sägen zu mr Jokl. Dir seat ma sich’r oh net Mathias, eher Hias oder so?“
„Jo, na net. Zu Hause hat man mich Hiasl gerufen, aber die Wiener kennen den Hiasl net. Gerne kannst du Hiasl zu mir sagen. Warst du beruflich in Wien?“
„Jo, ka ma säga. I bi dr neue Finanzreferent im Rothus z’Bludaz und ha mie i eurem Ministerium vorgstellt. Woasch eh, Kontakte muass ma hega und pflega. Bisch du für’d Bundesländer zuständig?“
„Nein nein, mein Resort beschäftigt sich mit der Finanzierung von Straßen- und Tunnelbau.“
„Interessant, mir z’Bludaz hond oh a paar Stroßabauprojekte am Lofa. Guat, dass do bisch, kum lass üs grad drüb’r reda.“ Irgendwie entwickelte sich diese Unterhaltung nicht so ganz in die richtige Richtung. Ein zu vertrauliches Gespräch zwischen zwei Finanzlern kann im Nachhinein auch gerne mal falsch interpretiert werden. Zudem kennt die Finanz weder Freunde noch Bekannte noch Verwandte, hier walten Fakten, Zahlen, Paragrafen und Argumente. Da der Zug gerade aus dem Salzburger Hauptbahnhof abgefahren war, vertagte ich höflichst die Fortsetzung des Gesprächs: „Ich glaube, wir sollten hier abbrechen und unser Gespräch ein andermal fortsetzen“, und bevor mein Gegenüber noch antworten konnte, verabschiedete ich mich mit der Begründung, die Toilette aufsuchen zu müssen. Beim Verlassen des Zugrestaurants bezahlte ich noch meine Rechnung beim Kellner und kehrte in mein reserviertes Zugabteil zurück. Dort standen bereits zwei Sitze leer und ein neuer Fahrgast war zugestiegen. Notgedrungen widmete ich mich wieder jenem Buch, das ich extra für die Bahnfahrt mitgenommen hatte.
Ein plötzlicher Ruck ließ mich aus meinem Tiefschlaf hochschrecken. Der Zug stand, so viel konnte ich feststellen, doch was war passiert? Neugierig schaute ich aus dem Fenster. Wir standen im Landecker Bahnhof, aber warum hatte es plötzlich so einen Ruck gegeben? In dem Moment ging gerade der Schaffner an unserem Abteil vorbei und sogleich rief ich ihm nach. „Ist da was passiert? Oder was löste diesen gewaltigen Ruck aus?“
Der Schaffner blieb stehen und antwortete zu meiner Beruhigung: „Keine Panik, nur die Ruhe bewahren. Es hat lediglich eine zusätzliche Lokomotive an unseren Zug angedockt, damit wir die Steigung auf den Arlberg leichter schaffen.“
In dem Moment fiel es mir wieder ein. „Logisch, vielen Dank für die Info.“ Obwohl ich nicht zum ersten Mal auf dieser Strecke unterwegs war, hatte ich das ganz vergessen. Beruhigt versuchte ich, in meinem Buch weiterzulesen, doch die Vorfreude aufs Ländle ließ mich überwiegend in meiner Vergangenheit schwelgen, als mich auf den Text im Buch zu konzentrieren.
Es war bereits nach 18 Uhr, als unser Zug in den Feldkircher Bahnhof einfuhr. Meine Schwester Maria erwartete mich bereits. Nach einer liebevollen Begrüßung brachte sie mich mit dem Auto nach Nofels (siehe Anhang) und bezog im dortigen Gasthof mein Zimmer. Gleichschon ging’s weiter zu ihrer Familie, die ja nur zwei Straßen weiter wohnt. Meine zwei Nichten freuten sich sehr, mich wiederzusehen. Susanne, die ältere, hat sich mit ihren 16 Jahren bereits zu einem kleinen Fräulein entwickelt. Die jüngere Klara ist erst zwölf und noch recht verspielt. Mein Schwager, der Poldi, ein echter Wiener, begrüßte mich herzlich, und zum Empfang servierte er mir ein Vorarlberger Bier vom Feinsten. Irgendwie wollte er mir sicher beweisen, dass er im Ländle angekommen war. Es gab viel zu erzählen, denn die letzten Jahre hatte ich mir ehrlich gesagt nicht die Zeit genommen, um meine alte Heimat zu besuchen. Meine Schwester überraschte mich mit echten Vorarlberger „Käsknöpfle“ (siehe Anhang). Es war ewig her, als ich das letzte Mal eine meiner Leibspeisen serviert bekommen hatte. Ich hatte zwar mal in Wien in einem Restaurant, das Vorarlberger Spezialitäten anbot, welche bestellt, aber die waren so was von grässlich, dass ich fortan vermied, mich auf Speisekarten von irgendwelchen „Pseudo-Kässpätzle“ verlocken zu lassen.
Nach dem Nachtmahl, wie man im Ländle sagt, begleiteten mich meine Schwester und ihr Mann bei einem Abendspaziergang durch die Innenstadt von Feldkirch. Liebevolles mittelalterliches Montfortstädtle, viele alte, gut erhaltene und gepflegte Häuser, über denen die Schattenburg über ihre Bürger wacht. Die Hauptstraßen werden von Laubengängen gesäumt, unter denen viele kleine Geschäfte, Boutiquen, Cafés und Gasthäuser mit ihrem emsigen Treiben die Altstadt beleben.
Nach einem Rundgang durch die engen Gassen und Plätze führte unser Weg vorbei am einstigen Gymnasium, wo ich vor vielen Jahren maturiert hatte. Was nicht fehlen durfte, war ein Besuch im Dom St. Nikolaus. Damals, nach dem Umzug vom Dorf in die Stadt, ministrierte ich dort noch so lange, bis es mich nach Wien zog, um zu studieren.
Zum Ausklang des Abends lud uns mein Schwager noch zu einem Umtrunk in eines dieser kleinen Cafés ein. Schön, dass es genau das Lokal war, in dem wir uns damals als Jugendliche des Öfteren getroffen hatten, um die Welt zu verbessern – so glaubten wir in unserem jugendlichen Leichtsinn. Es freute mich sehr, dass es dieses Lokal noch gab. Alles in allem war dies ein schöner Abend mit viel schönen Erinnerungen, die mich wieder in meine Jugendzeit zurückversetzten. Auf die Frage meiner Schwester, was ich am morgigen Tag geplant hätte, antwortete ich ihr plötzlich im breiten Vorarlberger Dialekt: „Uffe uf’n Berg will i.“
Es ist der Weg, der zum Ziel führt, sagt man. Guter Spruch, jedoch war mein Weg an diesem Tag verdammt schweißtreibend, doch ich wollte unbedingt noch vor der Dunkelheit oben sein. Hatte mich wieder mal im Dorf unten versäumt, Bekannte von damals getroffen, und so habe ich mich viel später als geplant auf den Weg zur Alphütte gemacht. Soll ja ein neuer Senn „’s Älpele“ bewirtschaften, wurde mir gesagt. Hoffentlich bekomme ich oben noch einen Schlafplatz, dachte ich, denn nochmals absteigen ins Dorf passte nicht so ganz in meinen Plan, zudem wäre das in der Dunkelheit sicher nicht ungefährlich gewesen. Das letzte Mal, dass ich oben war, war schon sehr, sehr lange her. Damals war noch Jessika die Chefin des Rinderstalles, auch war sie die Käserin und stellte den besten Bergkäse weit und breit her. Klar, die Magerwiesen und die feinen Alpenkräuter taten sicher ihres dazu, aber Jessika hatte einfach ein feines Händchen zum Käsen. Doch eines Tages war sie plötzlich verschwunden, keiner hat sie mehr gesehen oder was von ihr gehört. Mehrere Jahre blieb’s Älpele unbestoßen, dann kam wie aus dem Nichts der neue Senn, und die Bauern waren froh, dass sie ihr Vieh wieder aufs Älpele treiben konnten. Zum einen tat es der Vegetation sicher gut, wenn sie sich mal zwischendurch in aller Ruhe erholen konnte. Im Gegenzug mussten dafür die steilen Hänge vor dem Herbst per Hand gemäht werden, und das gefiel den Bauern genauso wenig, wie sie ihr Vieh über den Sommer am eigenen Hof oder auf einer fremden Alpe unterbringen mussten. Da kam ihnen der Neue grad recht und seither läuft es auch wieder. Und im Herbst gibt’s wieder Bergkäse von der eigenen Alpe, den sie dann gemeinsam vermarkten.
Langsam näherte ich mich der großen Kehre, wo die Wiesen vom Älpele beginnen und der untere Viehgatter (Zaun) die Alpe begrenzt. Dort stand und steht immer noch der kleine hölzerne Brunnen, gespeist von einer Quelle, die gleich darüber aus dem Hang sprudelt. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeikomme, muss ich einen Schluck daraus trinken. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich wählen könnte zwischen einem kühlen Krug Bier und einem kleinen Schluck Wasser aus diesem Brunnen, würde ich das Wasser trinken. Noch wenige Schritte und schon stand ich vorm Viehgatter, öffnete ihn, ging hindurch und schloss ihn hinter mir wieder, damit das Alpvieh nicht auskommt. Voller Erwartung setzte ich mich an den Brunnenrand und trank einen riesigen Schluck direkt aus dem Wassereinlauf.
Der Weg bis zur Alphütte war nicht mehr weit, so ungefähr eine schwache halbe Stunde. Unterwegs kam ich am „Plätzle“ vorbei, dort, wo die meisten Wanderer Rast machen. Es blühten gerade die Alpenrosen und da und dort konnte man einen blauen Enzian erblicken. Oft bin ich hier als kleiner Bub im Gras gelegen und schaute den Wolken zu, wie sie am Firmament vorüberzogen. Gerne ordnete ich dabei die verschiedenen Wolkenformationen bestimmten Figuren zu. Nur kurz blieb ich stehen, gleichschon zog es mich weiter. Bald darauf erreichte ich schon das Plateau, auf dem die Alphütte steht. Nur noch wenige Gehminuten und dann werde ich nach so langer Zeit diese wundervolle Aussicht ins Tal hinab genießen können. Kurz bevor ich die Alphütte erreicht hatte, kam mir ein kleines Mädchen entgegengerannt. „Hallo, du bist spät dran, ist schon fast dunkel.“
„Ja, ist aber nicht schlimm. Wer bist denn du?“
„Ich bin die Jessi, eigentlich heiße ich Jessika, aber Papa ruft mich immer Jessi.“
„Ist eure Familie allein oder sind noch mehrere Wanderer in der Alphütte oben?“
„Na, nur der Papa und ich sind da, so wie immer. Seit der Wanderweg ins Tal hinein verschüttet wurde, kommen keine Fremden mehr.“
„Der Weg wurde verschüttet? Wann denn?“
„Weiß nicht so genau, musst den Papa fragen. Bleibst du bei uns?“
Das Mädchen lief hüpfend und Fragen stellend neben mir her und nach wenigen Schritten erreichten wir schon die Stallungen unter der Alphütte. Dort beim „Bänkle“ (Sitzbank) hat man den schönsten Ausblick ins Tal. Ich blieb einfach stehen und ließ dieses wundervolle Panorama auf mich wirken. Wie lange hatte ich darauf verzichten müssen! Ich fühlte richtig, wie meine Seele anfing zu tanzen. Ich glaube, ich habe damals mehr als eine Viertelstunde nur so in der Gegend herumgeglotzt und mich an ihr erfreut, als mich eine Stimme von der Alphütte her aus meinem rauschähnlichen Zustand holte. „Hallo, Sie da unten, es ist schon dunkel, kommen Sie doch herauf in unsere gute Stube.“
„Verdammt, ich habe gar nicht bemerkt, dass es zwischenzeitlich ganz dunkel geworden ist“, fluchte ich laut und drehte mich um, ging zur Hütte hoch, und da stand der Neue. Wieso der? „Jessika“ schoss es aus meinem Mund.
„Nein, Jessika ist meine Tochter, ich bin Peter, der neue Senn hier auf der Alpe. Bitte komm doch rein in unsere gute Stube.“
Ich tat, wie mir geheißen, und als ich eintrat, blendete mich das Licht so sehr, dass ich im ersten Moment nichts sehen konnte. Mit der Zeit gewöhnten sich meine Augen an den grellen Lichtschein und ich konnte mein Umfeld wieder wahrnehmen. Die Stube genau so wie damals, der hölzerne Tisch, die einfachen Stühle rundum, auf der hinteren Seite die offene Feuerstelle und anschließend die Türe, die in die Schlafkammer führt. Nichts hat sich verändert, alles sah gleich wie damals aus, als ich als kleiner Bub im Sommer jeden Sonntag mit meinem Vater hier hoch wanderte. Vater war Obmann der Alpwirtschaft vom Älpele und setzte sich sehr für den Fortbestand dieser Alpgenossenschaft ein. Leider verstarb er viel zu früh und ein anderer Bauer übernahm die Obmannschaft. Auch unsere eigene Landwirtschaft ging durch Vaters Tod in andere Hände über. Mein älterer Bruder Karl wollte Theologie studieren, studierte aber später Rohstoffverarbeitung in Leoben. Ich hatte auch andere Pläne für mein Leben, bin nach meinem Wirtschaftsstudium in Wien geblieben und in die Welt der Finanzen eingestiegen. Meine Schwester Maria hatte ebenfalls kein Interesse an einer landwirtschaftlichen Karriere und träumte von einem eigenen Frisiersalon. Mutter wollte den Hof nicht alleine bewirtschaften, verkaufte ihn und zog mit uns in eine Mietwohnung nach Feldkirch. Trotz aller Zukunftspläne konnte ich die Schulzeit oben im Dorf nicht vergessen, schon gar nicht Jessika, die Tochter unseres damaligen Nachbarn, dem Siedlerhof. Sie war der Magnet, der mich immer wieder in die alte Heimat zog.
Später dann, als Jessika die Alpwirtschaft hier oben übernommen hatte, kam ich viel öfters herauf – klar, Jessika war hier oben. Wann immer ich Zeit hatte, besuchte ich sie auf dem Älpele. Schon frühmorgens trug ich die volle Kanne mit Brunnenwasser vom Viehgatter mit hoch und half gleichschon Jessika beim Melken der Kühe. Bevor wir hinausgingen, um nach dem Galtvieh (Jungvieh) zu schauen, das die ganze Nacht draußen blieb, holten wir noch das frisch gebackene Brot aus dem Holzofen. Erst nach der Rückkehr von den Wiesen gab’s endlich das, worauf ich mich immer so freute: das Frühstück. Frühstück auf dem Älpele hat nichts mit Frühstück zu Hause oder gar in einem Hotel zu tun. Hier oben fängt der Arbeitstag schon sehr früh an und zieht sich meist bis zum Einbruch der Dunkelheit hin. Da hat man dann schon zum Frühstück, auch wenn der Tag erst angefangen hat, einen riesigen Hunger. Wer hart arbeitet, braucht etwas Deftiges zum Essen, darum gab’s damals jeden Morgen „Riebel“ (siehe Anhang). Schon am Vorabend verkochte Jessika Butter, Maisgrieß, etwas Salz und Milch zu einem dicken Brei, den sie am Morgen in reichlich flüssiger Butter am offenen Feuer abschmälzte. Zum Schluss streute Jessika noch ein, zwei Löffel Zucker über den frisch gestupften Riebel. Wir schöpften stets mit einem Löffel direkt aus der eisernen