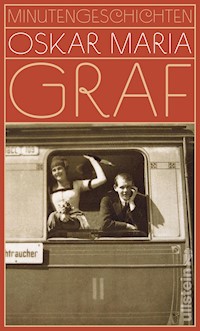11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Wenn all meine Bücher vergehn - des Buch bleibt«, sagte Oskar Maria Graf über seinen 1940 erschienenen Roman. Er sollte Recht behalten: Das liebevolle, eindringliche Porträt seiner Mutter, die mit ruhiger Kraft ihre Familie zusammenhielt, gilt heute als sein Meisterwerk. Geboren 1857, gestorben 1934. Ludwig II., Bismarck, Hitler, der Krieg 1870/71 und der 1. Weltkrieg, die industrielle Revolution und die Weimarer Republik - Resl Heimrath verbrachte ihr Leben in einer Zeit voller Umbrüche. Von Kindheit an war ihr Alltag harte Arbeit und Mühe. Das änderte sich nicht, als sie den Bauernhof ihrer Familie verließ und den Bäckermeister Max Graf heiratete. Sie bekam elf Kinder, von denen acht erwachsen wurden, und blieb trotz aller Ängste, die sie in Kriegs- und Gefahrenzeiten ausstand, der ruhende Pol des Bäckerhauses am Starnberger See. Oskar Maria Graf hat mit diesem Porträt seiner Mutter nicht nur eine Chronik dörflichen Lebens in Oberbayern geschaffen, sondern auch einen sozial- und zeitkritischen Roman von großer poetischer Kraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
Geboren 1857, gestorben 1934: Resl Heimrath verbrachte ihr Leben in einer Zeit voller Umbrüche. Sie wurde Zeitzeugin von Ludwig II., Bismarck, Hitler, dem Krieg 1870/71 und dem 1. Weltkrieg, der industriellen Revolution und der Weimarer Republik. Von Kindheit an war ihr Alltag vor allem harte Arbeit und Mühe. Das änderte sich nicht, als sie den Bauernhof ihrer Familie verließ und den Bäckermeister Max Graf heiratete. Sie bekam elf Kinder, von denen acht überlebten. Und trotz aller Ängste, die sie in Kriegs- und Gefahrenzeiten ausstand, blieb sie der ruhende Pol des großen Hauses am Starnberger See.
Es ist eines seiner schönsten und wichtigsten Bücher: Oskar Maria Graf hat mit diesem literarischen Porträt seiner Mutter nicht nur eine Chronik dörflichen Lebens in Oberbayern geschaffen, sondern auch einen sozial- und zeitkritischen Roman von großer poetischer Kraft.
Der Autor
Oskar Maria Graf wurde 1894 in Berg am Starnberger See geboren. Von 1911 an lebte er als Schriftsteller in München. Bereits in Wien im Exil, protestierte er 1933 mit seinem berühmten »Verbrennt mich!«-Aufruf gegen die Bücherverbrennung und gegen die Regierung der Nationalsozialisten. Ab 1938 lebte er in New York, wo er am 28. Juni 1967 starb.
In unserem Hause sind von Oskar Maria Graf bereits erschienen:
Das bayrische Dekameron · Bolwieser · Kalendergeschichten · Das Leben meiner Mutter · Unruhe um einen Friedfertigen · Die Weihnachtsgans und andere Wintergeschichten · Wir sind Gefangene
Oskar Maria Graf
Das Leben meiner Mutter
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0192-1
1. Auflage Juni 2009
3. Auflage 2011
© der deutschen Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009
Editorische Anmerkung:
Erstmals erschien das Buch 1940 im New Yorker Exil Oskar Maria Grafs bei Howell & Soskin unter dem Titel The Life of My Mother. A Biographical Novel.
Im Jahr 1946 brachte der Verlag Kurt Desch, München, das Werk in deutscher Sprache heraus; weitere Ausgaben folgten beim gleichen Verlag in den Jahren 1959, 1966 und 1974.
Unsere Ausgabe entspricht der ersten deutschen Ausgabe von 1946 und ist der von Wilfried F. Schoeller herausgegebenen ›Oskar Maria Graf Werkausgabe‹ im List Verlag, Band V, München 1994, entnommen.
Umschlaggestaltung: bürosüdº GmbH, München
Titelabbildung: © akg-images / J. P. Kugatsch / Bäuerin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Inhalt
Vorwort
Erster Teil
Menschen der Heimat
Verwickelte Fäden
Begebenheiten
Ein ungelöstes Rätsel
Schwere Zeiten
Veränderungen
Die Alten und die Jungen
Schmerzhafte Zwischenfälle
Das Alte stirbt
Ebbe und Flut
Der selige Wahn und die robuste Wirklichkeit
Einiges erregt Aufsehen
Verlust und Gewinn
Die Heirat
Nochmalige Beschwörung oder Die unbekannte Ursache und eine immerwährende Wirkung.
Die Geschichte macht einen Schlußstrich
Ende und Anfang
Zweiter Teil
Mutter und Sohn
Die Entdeckung der Mutter
Ein Mord, ein Zwerg und die Zigeuner
Der Dollar an der Wand oder Schatten der Vergangenheit
Alltag und Feste
Abschied vom Vater
Ein Soldat kehrt heim - ein Mann stirbt
Die Familie zerbricht
Leni, die Magd
Sinnlose Jahre
… und glauben, das wäre Größe!
Es knistert in der Stille
Der große Irrtum
Die Eindringlinge.
Schlechte Saat und bittere Ernte
Was bleibt? … Die Hühner
USA besucht uns
Ein Abschied
Epilog und Verklärung
Vorwort
In diesem Buch erzählt ein Sohn das einfache Leben seiner Mutter von ihrer Geburt bis zu ihrem Tode. Forschung und Erinnerung waren ihm dabei behilflich.
Der erste Band, ›Menschen der Heimat‹ hält sich an schriftliche und mündliche Überlieferung, der zweite, ›Mutter und Sohn‹, ist notgedrungen autobiographisch geworden.
In einer Zeit, da allenthalben versucht wird, durch alte und neue Schlagworte den gesunden Menschenverstand gleichsam epidemisch zu verwirren, spricht dieses Buch nur von jenen unbeachteten, natürlichen Dingen, die – mögen auch noch so scheinbar entscheidende historische Veränderungen dagegen wirken – einzig und allein das menschliche Leben auf der Welt erhalten und fortzeugend befruchten: von der stillen, unentwegten Arbeit, von der standhaften Geduld und der friedfertigen, gelassenen Liebe.
Mag sein, daß damit das Leben der Mütter in allen Ländern erzählt worden ist.
New York City, August 1940
Oskar Maria Graf
»Unser Leben währet siebenzig Jahre, und wenn es hoch kommt, so sind es achtzig Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen; denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon.«
Psalm 90, Vers 10
Therese Graf
Erster Teil
Menschen der Heimat
Verwickelte Fäden
Sie hieß Theres Heimrath oder vielmehr Resl, wie man sie in gewohntem Dialekt nannte, und war die vierte von neun Geschwistern. Zwei davon waren, kaum halbjährig, gestorben, bevor sie zur Welt gekommen war, und wiederum zwei, darunter der einzige Sohn, starben, als sie noch nicht zur Schule ging. Man schrieb den 1. November 1857. Am Nachmittag dieses Allerheiligentages, da die Leute nach altem Brauch im Gottesacker des nahen Pfarrdorfes Aufkirchen die Gräber ihrer Verstorbenen aufsuchten, erblickte sie das Licht des Tages. Ihre Mutter soll, so wird erzählt, schon in den Wehen gelegen haben, als der Bauer und die Dienstboten das Haus verließen. Die religiöse Pflicht erschien ihnen wichtiger als bedrängte Mutterschaft und Kindsgeburt. Niemand war in der Ehekammer als die einjährige Genovev, die plappernd auf dem Boden herumkroch, manchmal ans Bett der Mutter kam, deren heiße, verkrampfte Hände betastete, verwundert aufschaute, erschreckt von den wimmernden Wehlauten der Gebärenden, zu weinen anfing und wieder wegtappte. Zwischen Tod und Leben schwebend, betete die Heimrathin in ihrem Schmerz und überstand alles. Erst beim Hereinbruch der Dunkelheit kamen die Ihrigen zurück und fanden neben der erschöpften Mutter das neugeborene, schreiende Kind. Die kleine Genovev hatte sich unter einer Bettstatt verkrochen.
Vielleicht war die Nachwirkung all dieser Umstände der Grund, weshalb der Tod im Leben der Resl, wie im Leben aller durchaus gesunden Menschen, eine so beherrschende Rolle spielte. Sie fürchtete ihn als Kind ebenso wie als Greisin, und sie empfand ihn, wenn er nicht sie und die Ihren bedrohte, stets als den großen gerechten Ausgleicher, der den Armen auslöscht und auch nicht halt macht vor Glanz und Reichtum, vor Macht und Größe.
Nachdem mit der Zeit die Gesichtszüge des Kindes deutlicher geworden waren und insbesondere die breiten, stark hervortretenden Backenknochen mit den tief dahinterliegenden kleinen graugrünen Augen das Eigentümliche des Geschlechtes mehr und mehr sichtbar machten, meinte sein Vater mitunter, die Resl sei durch und durch eine echte Heimrathische. Er sagte es sicherlich nicht aus irgendeiner besonderen Hinneigung, denn mit den Kindern machte man beim Heimrath kein großes Aufheben. Jedes Jahr wurde eins geboren. Starb es, so war es schade darum, blieb es am Leben, war es gut. Wahrscheinlich erinnerte das Gesicht der Resl den Bauern an seine Väter und Urväter und heimelte ihn an.
Die Heimraths lebten seit Jahrhunderten auf dem einsamen Bauernhof in Aufhausen. Es gab dort nur noch das weit kleinere Lechnerhaus, und erst in den letzten Jahren nach dem Weltkrieg ist ein gräfliches Gut dazugekommen. Die alte, breite Fahrstraße, die vom hochgelegenen, weithin sichtbaren Aufkirchen in südöstlicher Richtung talabwärts läuft, führt am Hof vorbei, rinnt kurz darauf in einen weit ausgedehnten Fichtenwald und erreicht schließlich nach langen Windungen durch eine triste Moorgegend, in welcher nur wenige niedere, winklige Häuser armer Torfstecher stehen, den ansehnlichen Marktflecken Wolfratshausen. Aufhausen liegt in einer tellerflachen Mulde, die linkerseite sich aufschließt und schräg abfällt. Weite grüne Wiesen, fruchtbare Äcker und friedliche Wälder, die die fernen, leicht gewellten Hügel verdunkeln, breiten sich rundherum aus. Auf der einzigen Straße ächzen schwere Fuhrwerke dahin. Wandernde Zigeuner ziehen am Hof vorüber und kampieren mitunter einige Tage am Waldrand. Fremde städtische Menschen tauchen ganz selten auf. Gleichgültig schauen sie die paar Häuser an und gehen weiter. Es mag vorkommen, daß einmal ein Hausierer nach langem Gerede in Aufhausen etwas von seiner Ware absetzt. Hin und wieder kommt der Pfarrer, oder ein Bettelmönch tritt in die verrußte, geräumige Kuchl. Sie werden ehrfürchtig empfangen und in die nebenanliegende, helle, selten benützte gute Stube geführt.
Gleich und gleich blieben Zeit und Leben für Aufhausen. Deshalb sind auch die Überlieferungen der Heimraths ziemlich spärlich. Für sie muß es nie etwas anderes gegeben haben als Geborenwerden, Aufwachsen, unermüdliche Arbeit, demütige Gottesgläubigkeit und Sterben.
Während des Dreißigjährigen Krieges, in den Jahren 1632 und 34, verwüsteten die Schweden zweimal die Dörfer und Höfe der katholischen Pfarrei Aufkirchen. Die Wiesen waren erstmalig gemäht, die noch grünen Getreideäcker standen prall da und versprachen eine reiche Ernte. Die Bauern verließen Haus und Feld und flohen in die dichten Wälder. Der Pfarrer Georg Colonus irrte von einem Haufen Flüchtender ab und wurde von feindlichen Reitern ergriffen. Sie hieben erbarmungslos auf ihn ein, banden seinen blutig zerschundenen Körper an einen Strick, befestigten diesen am Sattelknopf und schleiften den unglücklichen Geistlichen so lange mit, bis er sich nicht mehr rührte. Kurz vor Aufhausen ließen sie ihn liegen. Er erwachte nach einiger Zeit, kroch mühsam weiter und fand schließlich die Seinigen im Wald. Wie durch ein Wunder blieb er am Leben und wurde wieder gesund. Nach dem ersten Abzug der Schweden zeichnete er gewissenhaft die Namen der 23 Bauern auf, die von den feindlichen Soldaten ermordet worden waren. Darunter befand sich auch der Lechner von Aufhausen. Die Heimraths waren davongekommen.
Zwei Jahre darauf, anno 34, ergriff Colonus beim Wiedereindringen der schwedischen Scharen in den Aufkirchner Gau die Flucht und blieb neun Wochen fort. Nach seiner Rückkehr legte er abermals eine genaue Liste der getöteten Pfarrangehörigen an. In diesen Aufzeichnungen sind auch alle Verwüstungen durch den Feind der Reihe nach angegeben. Das nahe Schloß in Bachhausen, das dem kaiserlich-bayrischen Generalkriegskommissar Graf von Rüpp gehörte, die meisten Dörfer und Einzelhöfe wurden schonungslos niedergebrannt. Die Heimraths mußten auch diese schreckliche Zeit ohne sonderlichen Schaden überlebt haben. Merkwürdig, ihr Hof – alleinstehend, ansehnlich, kaum eine Viertelstunde vom Pfarrdorf entfernt, an der Fahrstraße liegend – konnte den rachsüchtigen, beutegierigen Feinden doch nicht entgangen sein! Er war doch unmöglich zu übersehen!
Allem Anschein nach aber ist er verschont geblieben, denn Colonus berichtet nichts Gegenteiliges, ja, er erwähnt die Heimraths nicht einmal mit einem einzigen Wort. Wenngleich dies nun durch nichts belegt werden kann, bei einiger Verwegenheit der Vorstellung könnte man fast annehmen, der Aufhauser Bauer habe zur Rettung seines Hab und Gutes einen anderen Weg als die kopflose Flucht in die Wälder eingeschlagen. Vielleicht sagte er sich in stumpfer Gelassenheit: »Krieg ist eben Krieg, und alles hängt vom Zufall ab. Was hab’ ich schon davon, wenn ich davonlaufe und beim Zurückkommen statt meines schönen Hofes einen Aschenhaufen finde! Lieber gleich als Heimrathbauer sterben, bevor ich ein Leben lang als Bettler im ungewissen herumlaufe. Bleiben wir und schauen wir, was wird! Besser ist’s, einiges einzubüßen, als alles sinnlos zugrunde gehen zu lassen.«
Vielleicht ließ er Tür und Tor offen und empfing die rauhen Kriegsleute unerschrocken wie ein biederer Wirt, bot ihnen bereitwillig Speis und Trank an und ließ sie kaltblütig gewähren. Eine so abgebrühte, breit lachende, bezwingend-schlaue Bauernfreundlichkeit, die ein Heimrath dem anderen von Generation zu Generation vererbte, mag vielleicht auf die hitzigen Schweden derart verblüffend gewirkt haben, daß sie nach all dem wilden Fliehen und hilflos bittenden Jammern, das ihnen bis jetzt überall begegnet war, eine solche Einkehr als angenehme Abwechslung empfanden und schließlich abzogen. Demütig und gar nicht eitel darüber, daß sein kluger Einfall sie vor dem Schlimmsten bewahrt hatte, aber doch tief zufrieden, wird der Heimrath mit den Seinen dem Allmächtigen gedankt haben. Denn nichts vermochte der Mensch, alles stand in »Gottes Hand«.
Gewiß sind das nur Mutmaßungen, dennoch ist eine so kühne Schlußfolgerung, wenn man alles scharf überdenkt, nicht ganz von der Hand zu weisen.
In den darauffolgenden zwei Jahren raffte die Pest, die mit dem unseligen Krieg in die Gaue gekommen war, zahlreiche Familien dahin. Das pfarramtliche Totenregister enthält keinen Namen Heimrath. Zum ersten Male wird einer von ihnen im Zusammenhang mit einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1645 im sogenannten Mirakelbuch der Aufkirchner Pfarrchronik namentlich erwähnt. Es heißt da, einer seiner Knechte habe sich in der Christnacht noch einmal im Stall bei den Pferden zu schaffen gemacht und dabei durch ein Guckloch in den dunklen, rauhreifüberzogenen Obstgarten geschaut. Da sei »ein rotfeuriger böser Geist« durch dieses Loch gefahren, habe den Knecht gewaltmäßig gepackt, ihn hin und her geworfen, in den Garten hinausgezerrt und in den Brunnen werfen wollen. In seiner Not habe sich der Knecht der gnadenspendenden Gottesmutter von Aufkirchen »versprochen« und daraufhin sei der endlich vom Bösen losgelassen worden. Den Bauern aber – so dichteten fromme Leute dazu – wahrscheinlich, weil er zugelassen hatte, daß der Knecht in der hochheiligen Nacht noch etwas arbeiten wollte, soll später der Teufel geholt haben. Es ist anzunehmen, daß dieser Heimrath kein anderer gewesen ist als jener, der seinerzeit den letzten Schwedeneinfall unbetroffen überstanden hatte. Was aber nun die abträgliche Hinzufügung der Leute anlangt, die einer förmlichen Verfemung des Hofes gleichkam, so überzeugt sie auch dann noch nicht, wenn man den fanatisch übersteigerten katholischen Glaubenseifer, der die Aufkirchener Pfarrkinder in jener unduldsamen Kriegszeit ergriffen hatte, bei der Begründung zu Hilfe nimmt. Viel eher scheint einzuleuchten, daß böser Neid dabei eine bestimmte Rolle gespielt haben mag. Erst zwölf Jahre waren seit dem blinden Wüten der Schweden vergangen. Immer noch tobte der grausige Krieg an den Grenzen des Landes und konnte jederzeit wieder in die Gaue treiben. Viele waren damals umgekommen. Die Überlebenden waren tief verängstigt und litten noch schwer an vielfach erduldetem Unglück. Sicherlich wußte jeder genau, auf welche wenig gutzuheißende Weise sich der Heimrath damals der gefährlichen Feindesplage entledigt hatte. Alles war ihm geblieben. Er stand unangefochten und fest da wie sein uralter Hof. Wer weiß, am Ende spottete er sogar über die Hasenfüße, die einst so unbesonnen alles liegen und stehen gelassen und Reißaus genommen hatten. Das alles zusammengenommen kann ihm vielleicht zum Verhängnis geworden sein. Er starb, doch der Fluch lebte weiter. Das hatte eine düstere, bedrückende Wirkung. Nun nämlich zog, vermischt mit engem Aberglauben, eine scheue Bußfertigkeit ins Haus. Ein verzehrendes Schuldbewußtsein ergriff die Ersten und Letzten der Familie. Hilflos und ängstlich wurde jeder in religiösen Dingen, und die kranke Bigotterie wirkte noch weit hinein in die Reihen der Enkel. Etliche davon gingen ins Kloster, und ich kannte ein paar von ihnen, die nahe am Wahnsinn waren. In meiner Kinderzeit sah ich noch das ausgebröckelte Loch in der Stallmauer des Heimrath-Hofes, das seither gleichgelassen worden war. Jeder ging scheu und schnell daran vorüber und bekreuzigte sich stumm. Alljährlich am Tag der Heiligen Drei Könige kam der Pfarrer und weihte die Räume …
Noch einmal, ungefähr sechzig Jahre später, im österreichischen Erbfolgekrieg, wurde der Pfarrgau Aufkirchen von Mord und Plünderung, von Jammer und langem Elend heimgesucht. Wie zu jeder Zeit, so ging es auch damals nur um trübe Machtansprüche einiger besitzgieriger Herrscherhäuser, um weitabliegende Interessen und Dinge also, die den friedlich arbeitenden Völkern unbekannt und völlig gleichgültig waren: um einen freigewordenen Königsthron in Spanien, auf den die Habsburger einen Österreicher, Frankreich dagegen einen Bourbonen setzen wollten. Die großen Mächte suchten die kleinen für ihre Zwecke zu gewinnen und lockten sie mit glanzvollen Versprechungen. Redlichkeit ist bei einer solchen Handelschaft stets eine fremde Sache. Erfolg hat dabei immer nur derjenige, welcher am schnellsten handelt, über eine unverblüffbar gewissenlose Überredungskunst verfügt und das meiste bietet.
Der kriegsberühmte bayrische Kurfürst Max Emanuel war bis jetzt treu kaiserlich gewesen und hatte Österreich in den Türkenkriegen oftmals ausschlaggebenden Beistand geleistet, aber er war vom Kaiser schlecht entlohnt worden. Durch seine vielen kriegerischen Unternehmungen und seine ungemein verschwenderische Prachtliebe war er in hoffnungslose Verschuldung geraten und suchte vergeblich nach einem Ausweg. Das von ihm beherrschte bayrische Volk war bis an die Grenze des Möglichen ausgepreßt und gänzlich verarmt. Die Wiener Hofkanzlei, vom Kurfürsten schon öfter an die Einlösung der einstigen kaiserlichen Versprechungen erinnert, blieb taub oder vertröstete. In dieser kritischen Zeit bot König Ludwig XIV. dem bedrängten Max Emanuel, falls er mit Frankreich ein Bündnis schlösse, die Niederlande oder zum mindesten die erbliche Statthalterschaft über dieses reiche, ergiebige Land an. Das erschien dem Kurfürsten als glänzende, mühelose Rettung aus aller Not. Der Krieg begann, und er schlug sich auf Frankreichs Seite. Am Schellenberg bei Donauwörth lieferte er am 2. Juli 1704 der kaiserlichen Reichsarmee die erste und einzige Schlacht und verlor sie. Sechstausend Bayern gingen dabei mit gehorsam-stumpfer Standfestigkeit für eine fremde Sache in den Tod.
Ihr Kurfürst floh, wurde vom Kaiser geächtet, mußte das Land verlassen und verlebte als Statthalter von Brüssel viele Jahre ungemindert verschwendungssüchtig. Die wilden Regimenter der Panduren und Kroaten der kaiserlichen Reichsarmee überfluteten Südbayern und hausten grausamer und zügelloser als einst die Schweden. Bayern wurde zunächst als von Habsburg verwaltetes Reichsland erklärt. Die fremden Beamten erpreßten unmögliche Kontributionen und Steuern, die kriegerischen Eindringliche brandschatzten ganze Gegenden, nahmen Rekrutenaushebungen für die kaiserliche Armee vor und folterten oder füsilierten Widerspenstige zu Hunderten.
Seit jeder nur denkbaren Zeit war das überwiegend bäuerliche Volk dieser hart heimgesuchten Landschaften fast gleichgültig obrigkeitstreu gewesen. Das hatte seine Ursache darin, daß seinen Menschen der Gott der katholischen Kirche stets näher lag als irgendeine vergängliche weltliche Macht. Altgewohnt erfüllten sie die Pflichten, die ihnen ihr Glaube auferlegte. Religiöse Einrichtungen allein waren ihnen geläufig und wichtig. Den Namen des Bischofs und des jeweiligen Papstes wußten sie, den des Landesherrn nur in den seltensten Fällen. Mit friedlicher, geduldiger Ruhe hatten sie bis jetzt jede Herrschaft – ob sie nun ein Fremder oder ein Einheimischer ausübte, ob sie gut oder schlecht, ungerecht oder selbst grausam sein mochte – widerstandslos ertragen. Das Blutregiment der Kaiserlichen aber war ohnegleichen in ihren Erinnerungen. Das ertrugen auch sie nicht mehr. Etwas noch nie Dagewesenes ereignete sich: die gepeinigten Oberländer Bauern erhoben sich gegen ihre Unterdrücker!
Man weiß, daß ihr finsterer Heerbann – dreitausend zu allem entschlossene Männer – in der Christnacht anno 1705 gegen München zog, aber schon vorher von einem frommeifrigen Pfleger aus Starnberg verraten worden war und beim Dorfe Sendling vergeblich verblutete. Nach dem unbeschreiblichen Gemetzel durchstreiften berittene Panduren-Abteilungen in rachsüchtigem Blutdurst das umliegende Land und kamen auch in die Aufkirchener Gegend. Überall suchten sie nach Rebellen, denn es war ruchbar geworden, daß einige Überlebende der Schlacht elend fliehend durch die Gaue zogen und sich in Wäldern oder abgelegenen Heuhütten versteckt hielten. Es gab hochnotpeinliche Verhöre, gräßliche Schindereien, Häuser brannten nieder und Menschen wurden umgebracht.
Das schon erwähnte Aufkirchener Mirakelbuch gibt einige Namen von Flüchtlingen an, die nach vielem Schrekken mit dem nackten Leben davongekommen waren. Unter anderen wird – der damaligen Schreibweise entsprechend – ein Georg Heimbrath aus Beuerberg genannt, der im dortigen Kloster Bäcker gewesen sein soll. Viele Stunden hatte er sich, bis zum Halse in der eiskalten Jauchegrube stehend, immer wieder den Kopf untertauchend, verborgen gehalten.
Es ist höchst zweifelhaft, ob dieser aufrechte Mann mit dem Heimraths von Aufkirchen verwandt war. Soviel man auch forschen mag, nie findet man unter ihnen einen, der etwas anderes gewesen ist als Bauer, und nach ihrer durch Generationen verfolgbaren Veranlagung waren sie alle unkriegerisch, ganz und gar nicht rebellisch, stumpf obrigkeitsgetreu und gottergeben. Seitdem der Fluch auf ihrem Hause lastete, schien jener fein witternde, schlaue, sichere Instinkt, der ihren Vorfahr aus dem Dreißigjährigen Krieg ausgezeichnet hatte, in jedem von ihnen verweht zu sein. Wie angstvoll lammfromm und engstirnig untertänig sie sich in der Pandurenzeit verhielten, geht schon daraus hervor, daß die Heimraths als einzig sichere Leute vom Pfarrer dazu auserkoren wurden, mit ihrem Fuhrwerk das bedrohte Gnadenbild im Sommer 1704 in die Augustinerkirche nach München zu fahren, und am 24. März 1705 abermals den Auftrag erhielten, dieses heilige Bild von der Hauptstadt an der Spitze einer feierlichen Prozession zurückzubringen. Diese erste sichtbare Ehrung durch die Kirche blieb bei ihnen unvergessen, und der Vater der Resl, der jetzige Heimrath, der damals noch gar nicht zur Welt gekommen war, erinnerte sich noch genau an die Schilderung, die er als kleiner Knabe aus dem Munde seines eisgrauen Großvaters gehört hatte. So als sei er selbst leibhaftig dabei gewesen, berichtete er sie wieder seinen Kindern, und wie oft er es auch erzählen mochte, jedesmal wurde es fast feierlich still in der Kuchl. Die Kinder hatten große Augen und offene Mäuler, und schließlich wurde ein Vaterunser gebetet.
Wenn nun auch der jetzige Heimrath seinen Vorgängern ziemlich wesensgleich war, einige Eigentümlichkeiten unterschieden ihn doch deutlich von diesen. Vor allem war er ein heiterer, stets zu Späßen aufgelegter Mensch. Streit vermied er ängstlich. Er gab lieber nach. Bei aller eingewurzelten Frömmigkeit war er derb, schlau und keineswegs einfallslos, wenn es um seinen Vorteil ging. Er hatte eine etwas drastische Art, sich über Veranlagung und Fähigkeit anderer Menschen Gewißheit zu verschaffen. Wenn ein Knecht erstmalig bei ihm vorsprach – und er kümmerte sich nur um Knechte, die Mägde waren Sache der Bäuerin –, dann musterte er den mit freundlich-blinkenden Blicken von oben bis unten, von unten bis oben und lächelte die ganze Zeit überaus einnehmend. Er las die Zeugnisse genau und ließ den Bewerber ausführlich erzählen. Er unterbrach ihn höchstens einmal, indem er fast respektvoll lobend meinte: »Soso, beim Jani bist vier Jahr’ gewesen? … Jaja, da kennt man, was Arbeit ist.« Nachdem der Knecht endlich nichts mehr an sich zu rühmen wußte, sagte der Heimrath fast vertraulich: »Weißt du was? Geh mit mir in’n Obstgarten … Geh weiter! Aber recht schnell, ja?« Der fremde, verblüffte Mensch folgte, und sie schlichen durch den Stall hinten hinaus, ohne daß die Bäuerin etwas merkte. Im Obstgarten schlüpfte der Bauer aus seiner Joppe, warf sie ins Gras und sagte ganz gelassen: »Ich hab’ gar nichts auszusetzen an dir … nicht das allermindeste, aber bevor ich dich einstehn laß’, möcht’ ich doch deine Kraft ausprobieren.« Er machte sich bereit und der Knecht konnte nicht mehr anders. Sie rauften so lange miteinander, bis einer von ihnen endgültig überwunden auf dem Boden lag. War es der Bauer, dann sagte er unversteckt und arglos: »Jetzt, ich will dir was sagen, Hans – ich hab’ nicht gern einen Knecht, der mich wirft … Denn wenn ich regieren will, da zieh’ ich den kürzeren. Nichts für ungut, Hans, ja?«
Der Knecht mochte noch so beteuern und haufenweise reden, der Heimrath blieb dabei und nahm ihn nicht.
Raunzerische, eigensinnige Leute mochte der Bauer nicht. Kränkelnde oder wirklich kranke Menschen machten ihn hilflos. Vielleicht waren sie ihm sogar zuwider und unbequem. Bei seiner fast unglaublichen Gesundheit war er unempfindlich für eigenen und fremden Schmerz und kannte nichts als Arbeit, aber nie eine Müdigkeit. Er, die Bäuerin, die Dienstboten und die Kinder – wenn sie einmal acht oder neun Jahre alt waren – standen täglich um 2 Uhr in der Frühe auf. Gebetet wurde, dann die Mehlsuppe gegessen, und die einen gingen in den Stall oder aufs Feld zum Mähen. Außer den üblichen sehr einfachen Mahlzeiten gab es kein Rasten mehr bis tief in die Dunkelheit hinein. Das war im Sommer und im Winter so. Wenn rundum noch alles stumm und nachtschwarz war, in der beißend kalten Frühe, ging der Bauer mit einer Stall-Laterne auf die Tenne und hängte das trübe Licht an einen hohen Balken. Dann riß er das frostverkrustete mächtige zweiflügelige Tor auf. In dichten Schwaden strömte die kalte Luft in die dämpfige Tenne, vermischte sich mit dem Staub und wurde zu einem alles verhüllenden, dicken, nebligen Dunst, der beim Einatmen beständig zum Husten reizte. Laut und munter schrie der Bauer den Mägden und Kindern, und die mußten nun Tag für Tag mit Handflegeln das Getreide ausdreschen. Die Knechte fuhren Dünger und Jauche auf die Äcker und Wiesen, oder sie gingen mit den Bauern zum Ausholzen in die dichtverschneiten Wälder.
So verlief die erste Jugend der Resl. Zum Lernen war bei der vielen Arbeit freilich nur wenig Zeit, aber die Schule stellte auch nicht allzu große Ansprüche, und was man von den Dingen des Glaubens wissen mußte, bekamen die Kinder von Anbeginn mit auf die Welt. Aufhausen und die nächste Umgebung blieben für sie die Welt. Zum Schulbesuch, an den Sonn- und Feiertagen, bei Begräbnissen und sonstigen kirchlichen Anlässen kamen sie nach Aufkirchen. Die alljährlichen Bittgänge führten sie hin und wieder in entferntere Dörfer, es mochte auch vorkommen, daß sie einmal an einem sonnigen Nachmittag bis zum Seeufer gingen, doch alles erschien ihnen dort so ungewohnt fremd, daß sie sich fast davor fürchteten und ungesäumt den Heimweg antraten. Sie wurden erst wieder froh, wenn sie den Aufhauser Hof erreicht hatten.
Anfangs unterschied sich die Resl nicht sonderlich von ihren am Leben gebliebenen Schwestern Genovev, Marie und den Zwillingen Anna und Katharina, aber sie war die kräftigste und gesündeste von ihnen und darum vielleicht mochte sie der Heimrath gern. Die Genovev, die – nachdem der einzige Sohn mit kaum sieben Jahren gestorben war – als Älteste einmal den Hof bekommen sollte, war ihm zu mißlaunisch und bigott, die Marie zu einfältig, von den Zwillingen sagte er, die Anna sei zwar dürr, aber zäh, und wegen ihrer Kleinheit werde sie nie eine rechte Bäuerin, die schwerfällige Katharina glich wieder zu sehr der Genovev. Bei der Resl hingegen zeigte sich sehr bald, daß sie ganz ihrem Vater nachgeriet. Schon mit elf und zwölf Jahren mähte sie – wie man sich beim Heimrath ausdrückte – »jeden Knecht in Grund und Boden«, und sie war selbst nach der schwersten Arbeit noch ausgeglichen heiter wie am Anfang.
»Müllerisches hat sie gar nichts«, warf der Heimrath manchmal hin, denn seine Bäuerin war eine Tochter des Müllers März in Berg, einem kleinen Ort am weitbekannten Starnberger See, den man von Aufkirchen überschauen konnte. Glatt und ruhig lag er in einem weiten, langgezogenen Tal, und viele kleinere und größere Dörfer belebten seine leicht ansteigenden, waldreichen Uferhänge. Berg hatte einen besonderen Anziehungspunkt, der die Ortschaft über das rein Bäuerliche etwas hinaushob: ein königliches Schloß, das in früheren Zeiten den altbayerischen Geschlechtern der Hörwarth und Ligsalz gehört hatte und schließlich in den Besitz der Krone übergegangen war. Max II. hatte es renovieren und umbauen lassen, und seit seinem Tode wohnte sein Nachfolger, der blutjunge, überaus merkwürdige Ludwig II. oft wochenlang darin. Zu solchen »Königszeiten« herrschte regeres Leben in Berg. Staatliche Würdenträger, hohe Militärs und reiche Fremde verbrachten ihre Sommerfrische an den Ufern des Sees, und der König fuhr oft in seiner prunkvollen, von sechs blanken Schimmeln bespannten Karosse in schnellem Trab durch die Dörfer. In Aufhausen ließ er meistens halten und sich ein Glas Wasser reichen. Beim Heimrath schlugen sich die Knechte um diese Ehre, allerdings schien ihnen mehr an der Belohnung zu liegen, denn jedesmal gab es dafür einen Silbertaler.
Der Müller und der Huber waren die größten Bauern in Berg. Sonst gab es dort nur Häusler, einige Fischer, einen Schuster und Wagner und den sonderbaren Stellmacher Graf mit seinem schweigsamen Weib und sieben hungrigen Kindern. Darunter befand sich ein zurückgebliebener Zwerg, den die Stellmacherin durch einen Schreck zu früh geboren hatte. Der Graf machte hölzerne Heugabeln und Rechen für die Bauern und brachte sich kümmerlich fort. Vier seiner Geschwister hatten sich in ferneren Gegenden zerstreut. Sein Bruder Andreas, ein Mann voll witternder Unternehmungslust und Unrast, dem es gelungen war, eine gefährlich kränkelnde Bauerntochter zu heiraten, die bald darauf starb, hauste als Witwer auf seinem verwahrlosten Weiler »Maxhöhe«, und die lediggebliebene, stille Schwester Kreszenz, die als Weißnäherin in der Leinenkammer des königlichen Schlosses arbeitete, lebte daheim. Außerdem war beim Graf noch ein weit über sechzig Jahre alter Oheim, der einst Soldat Napoleons gewesen war und den russischen Feldzug anno 1812 mitgemacht hatte. Er hieß Peter und wurde wegen seines dichten, struppigen, noch kaum angegrauten Haares der »schwarze Peter« genannt. Quer über sein breites Gesicht lief eine tiefe Schramme, die von einem Säbelhieb stammte. Eingedrückt war die rote Nase, und ihre großen Löcher standen fast flach zwischen den vielbehaarten, äderigen Backen. Verwegen funkelten Peters dunkle, stechende Augen. Er war ein mächtig gebauter, schwerfälliger Mensch und strotzte vor Gesundheit. Hin und wieder machte er Botengänge. Dabei hielt er sich gern länger in den Häusern auf, bekam auch manchmal eine Scheibe Brot mit saurer Milch und erzählte den Kindern Kriegsgeschichten aus seiner bewegten Vergangenheit, wobei er französische Ausdrücke und fremdartige Redewendungen seltsam ineinander mischte. Zwar noch immer napoleonisch und antiösterreichisch gesinnt, begeisterte er sich seinerzeit am Krieg Österreichs und Bayerns gegen die »schandmäßig gottverfluchten Prussiens« und erklärte allen dessen Zweck und Strategie in seiner phantasievollen Art. Nach dem Frieden von 1866 sagte er giftig: »Ich hab’s immer gesagt, Bavarski und Austria taugt zu nichts! … Geflenn und Meßämter bringen diesen muschkotischen Prussien Bismarck nicht um!« In jenen Jahren nämlich beteten die Leute in allen bayrischen Kirchen, der Allmächtige möge ihr Land vor diesem »finsteren, grundfalschen, verderbten lutherischen Antichrist« gnädigst bewahren.
Die Urahnen der Grafs waren einst aus dem Salzburgischen nach Bayern eingewandert und hatten sich nach allerhand Irrfahrten am Seeufer seßhaft gemacht. Niemand wußte Genaueres über ihre Herkunft, doch noch jetzt galten sie nicht als rechtmäßige Einheimische. Sie wurden gemieden und waren verachtet wegen ihrer Armut. Beim Müller war zuerst der hämische Schimpf über sie aufgekommen: »Sie wimmeln wie die Wanzen und saugen sich, wenn man nicht acht gibt, an jedem fest.«
Die Müllerischen hatten seit jeher als grobschlächtig nüchtern, unbarmherzig bauernstolz und rechthaberisch gegolten. Sie waren im Gegensatz zu den breitschulterigen, gedrungenen Heimraths große, hagere, starkknochige Menschen mit humorlosen Gesichtern.
Der Heimrath ließ seine Bäuerin gern regieren, aber er machte im Grunde genommen doch stets, was er für gut hielt. Darum kamen die Eheleute gut miteinander aus.
»Man braucht ja nicht streiten«, sagte er listig, »man muß bloß nicht alles sagen und die anderen reden lassen.«
Er war der letzte männliche Heimrath, und wenn es wahr ist, daß oft nach Jahrhunderten in irgendeinem einzigen späten Nachkommen alles das, was das ganze Geschlecht ausgezeichnet hat, ungebrochen zum Vorschein kommt – von ihm hätte sich das sagen lassen. Die Resl hatte viel von ihm.
Begebenheiten
Zweifellos bleibt das Bild der Kindheit in einem Menschen bis zu seinem Tode gleichmäßig lebendig. Mag sein, daß mit der Ausgeglichenheit des Älterwerdens die Erlebnisse von damals, soweit sie scheinbar unvermerkt aus der täglichen Umgebung und Gewohnheit hervorgegangen sind, nun, da sie ihrer Bestimmung gemäß den Menschen geformt haben, die Kraft der Eindringlichkeit und das unmittelbar Überraschende ein wenig eingebüßt haben. Das Liebliche oder Drangvolle, ja sogar der Geruch der einstigen Empfindung sind dennoch geblieben. Der Schmerz ist verweht, und auch die Freude ist nur noch milde Erinnerung, aber nichts ist vergessen, die Farben auf dem Bild sind nur leicht verblaßt. Sie gewinnen sogleich wieder die ursprüngliche Leuchtkraft, wenn uns ein ähnlicher Schmerz überfällt oder eine gleichartige Freude beglückt. Um wieviel heftiger aber erst ergreift uns der unverlöschte Schauder von einst, wenn wir uns an ungewöhnliche Erlebnisse aus jener Zeit erinnern!
An einem verregneten Abend in der zweiten Hälfte des Septembers trugen die Heimrath-Zwillinge unausgesetzt das Werg des eben gebrochenen Flachses in die gute Stube. Die Haufen auf dem Boden wurden höher und höher und reichten zuletzt fast bis zur Decke. Die Spinnräder standen da. Nach der Stallarbeit, nach dem Nachtmahl und Gebet pflegten im Herbst und im Winter die Bäuerin und ihre zwei ältesten Töchter, die Genovev und die Resl, noch etliche Stunden zu spinnen. Wenngleich dadurch der Faden für das feste, grobe Leinen gewonnen wurde, das die Töchter später einmal in die Ehe mitbekommen sollten – diese beschauliche Beschäftigung, wobei man sitzen konnte, galt im Haus nicht viel. Man hielt sie für eine Art spielerisches Ausruhen.
Es wurde stockdunkle Nacht. Der Heimrath, die Knechte, die Mägde und die zwei jüngsten Kinder waren zu Bett gegangen. Der dichte Regen rauschte eintönig hernieder. Die dicken Tropfen trommelten sanft auf die Fensterscheiben. Die Petroleumlampe, in der Mitte der Stube hängend, verbreitete ein spärliches Licht. Die buntbemalte Uhr an der Wand tickte einschläfernd gemächlich, und hin und wieder bellte der Hund im Hof kurz auf, knurrte noch eine Weile und verstummte. Nur die Spinnräder surrten, und ab und zu quietschten sie auch leise.
»Morgen heißt’s früher raus!« sagte die Heimrathin einmal nebenher, befeuchtete die breiten Innenflächen ihres Daumens und Zeigefingers und zwirbelte damit den unregelmäßig gewordenen Faden glatt: »Die Aufhauser und Aufkirchener sind die ersten bei der ewigen Anbetung.« Einer alten kirchlichen Anordnung zufolge traten alljährlich am 20. September die Dörfer des Sprengels dem Alphabet nach in der mit Birkenzweigen geschmückten Pfarrkirche jeweils zu einem stundenlangen Litanei- und Rosenkranzbeten an. Genau genommen sollte diese »ewige Anbetung« eigentlich erst um zwölf Uhr mittags beginnen und abends um sieben Uhr enden, doch die Pfarrei mit ihren vielen Dörfern konnte eine solche Aufgabe nur dann bewältigen, wenn sie in der Frühe damit anfing.
Der müden Bäuerin fielen schon manchmal die Augen zu. Sie gähnte und ihr Spinnrad stockte.
»Voller Schlaf bin ich schon«, meinte sie wiederum und hielt inne.
»Geh nur ins Bett! Deinen Knäuel wickle ich dir schon auf«, sagte die Resl. Die Bäuerin stand auf und streckte ihren steifgewordenen Körper. »Jaja, ich geh«, gähnte sie abermals, nahm einen Spritzer Weihwasser an der Tür, bekreuzigte sich und verließ die Stube. Die beiden Mädchen hörten ihre dumpfen Schritte über die knarrende Holzstiege hinauf. »Ja, ich hab’s auch gleich«, sagte die flink hantierende Resl zur Genovev nach einiger Zeit und setzte dazu: »Morgen ist auch noch ein Tag.« Sie kniff endlich mit den Fingernägeln den Faden ab, und nachdem sie die Knäuel auf die Ofenbank gelegt hatte, ging auch sie zu Bett. Die Genovev werkelte mißmutig weiter. Durch ihre Langsamkeit war sie weit hinter den anderen zurückgeblieben und wollte aufholen. Sie saß da, hörte und sah nichts.
Draußen hatte sich ein Wind erhoben und rüttelte am Gartentor. Der Regen peitschte jetzt viel vernehmbarer auf die Fensterscheiben. Die Hängelampe schwankte ein ganz klein wenig hin und her. Eine dicke, schwarze Rußsäule stieg aus dem gläsernen Zylinder und das Licht verlosch. Die Genovev murrte kurz und tappte tastend durch die Dunkelheit. In der finsteren Kuchl fand sie einen dürren Span. Im Herd glommen noch einige Brocken unter der Asche. Sie blies und blies, ging schnell mit dem erflammten Span in die Stube und zündete die Lampe wieder an. Abermals trat sie das hölzerne Pedal ihres Spinnrades. Es quietschte und schnurrte. Ganz selbstvergessen zog und drehte die Genovev den dünnen Faden. Nach einer Weile verlosch das Licht wieder. Die Genovev wurde ganz ärgerlich, zündete es von neuem an, prüfte Zylinder und Docht und sah, daß noch reichlich Petroleum im runden Behälter war.
»Hm«, machte sie, schüttelte den Kopf und lauschte kurz. Der Wind trieb noch gleichermaßen den Regen hernieder. Die Genovev ging auf ihr Spinnrad zu, doch plötzlich wurde es wieder stockdunkel und jemand sagte: »Gehst du denn noch nicht ins Bett, wo morgen Anbetung ist?« Es war eine ganz gewöhnliche Stimme. Sie klang weder laut noch leise, weder unheimlich noch getragen. Das Mädchen aber war so erschrocken, daß es sich nicht rühren konnte. Ein rieselnder Schauer überlief seinen Körper.
Es blieb stumm und schwarz in der Stube. Etliche Dachschindeln, die der heftige Wind losgerissen hatte, flatterten durch den Regen, schlugen leicht klappernd an die Holzwand der gegenüberliegenden Wagenremise und fielen herab. Dadurch bellte der Hund wieder auf.
Die Genovev zuckte zusammen und spürte etwas wie Würgen an ihrem Hals. Sie wollte schreien und konnte nicht, gewann aber endlich die Herrschaft über ihre erlahmten Glieder, bekreuzigte sich geschwind und rannte, in einem fort die Worte »Jesus, Maria hilf« herausstoßend, hinauf in die Kammer der Resl. Sie schnaubte, wie vom Tode bedrängt, brach ins Knie und fing laut weinend zu beten an.
Nach und nach erwachten alle im Haus und gingen nicht mehr zu Bett. In der Kuchl wurden geweihte Wachsstöcke angezündet, rundherum knieten die Heimraths mit ihren Kindern, Knechten und Mägden und beteten einen Rosenkranz um den anderen, bis es Zeit war, zur Anbetung zu gehen. Ein peinigender Schrecken hielt sie alle nieder. Niemand versuchte sich den Vorfall zu erklären, und wahrscheinlich erinnerte sich jeder nur an das Loch in der Stallmauer, an Teufel und Fluch.
Am andern Tag mußte der Pfarrer ins Haus kommen. Unablässig das Weihrauchfaß schwingend und irgendwelche lateinischen Worte vor sich hinsummend, ging er mit den Heimraths durch Tenne und Stall, in den Keller und in die Kuchl, durch die Stube und in alle Kammern, zum Schlusse erteilte er der Familie den Segen. Die ängstlichen, zugleich aber auch vorsorglichen Eheleute blieben dennoch beunruhigt. Mißtrauisch und fast lästerlich zweifelnd sagten sie sich: »Für dieses eine Mal mag ja der Böse verscheucht sein, aber hat so eine kleine Weihe auch wirklich Kraft genug, ihn in Zukunft fernzuhalten?« So erwogen sie und gaben sich in ihrem frommen Eifer nicht zufrieden. Sie und ihre Kinder traten der Erzbruderschaft vom schwarzen, ledernen Gürtel der heiligen Monika unter dem Namen »Maria zum Troste« bei, und der Heimrath ließ in jenem Jahr die kleine Feldkapelle erbauen, die heute noch an der Straße zwischen Aufkirchen und Aufhausen steht. Ihrem Namen entsprechend verlangt die Gemeinschaft »Maria zum Troste« von jedem Mitglied, daß es zeitlebens einen geweihten, dünnen, schwarzledernen Gürtel um den bloßen Leib trage und sich streng an ihre religiösen Vorschriften halte. Am letzten Sonntag eines jeden Monats finden sich die Gürtelbrüder zu einem feierlichen Hochamt ein, gedenken im Gebet der in den letzten Jahren verstorbenen Mitglieder, und nachmittags findet eine Vesper mit einer Prozession an die Seitenaltäre der Pfarrkirche und in die Bruderschaftskapelle statt. Kein Heimrath hat, seit er den Gürtel trug, jemals gebadet.
Das darauffolgende Frühjahr brach mit Schnee und Regen herein. Die tieferliegenden Wiesen und Äcker standen größtenteils unter Wasser. Schon seit einer Woche war der Heimrath einsilbig und lachte selten. An einem Nachmittag kam er patschnaß und ein wenig schlotternd in die Kuchl.
»Der Hans fahrt für mich Mist«, sagte er und verzog sein Gesicht ein wenig. »Ich versteh’s nicht – mir ist die ganze Woche schon nicht wohl.« Er ging in die Stube, holte den Taubeerschnaps vom Ofenbrett, setzte sich hin und nahm einen starken Schluck. Die Bäuerin rief durch die halboffene Tür: »Zieh das nasse Zeug aus und hock dich zum warmen Herd her!«
Der Heimrath gab nicht an und nahm noch einmal einen Schluck. Die Hitze stieg ihm ins Gesicht, inwendig drückte das Blut gegen sein schwer arbeitendes Herz.
Er schnaubte hart.
»Geh weiter!« sagte die Bäuerin abermals, »so patschnaß dahocken kann doch auch nicht gut sein!«
Am runden eschernen Tisch in der Stube sitzend, schüttelte der Heimrath den Kopf, preßte ihn ein paarmal mit den groben Händen zusammen und versuchte, sich aufzurichten.
»Ja, was ist denn das bloß? Was ist denn das? … Herrgott, Herrgott!!« stieß er halblaut aus sich heraus und sackte wieder zusammen. Er hielt den Hals der dunklen Flasche fest umspannt, dennoch zitterte seine Hand. Dicke Schweißperlen standen auf seiner eckigen Stirn. Mit glasigen Augen schaute er geradeaus. Jedes Ding verschwamm ihm.
Die Bäuerin, die jetzt im Türrahmen auftauchte, blieb stehen, sah ihn leicht verwundert an und fragte: »Was fehlt dir denn?« Er aber machte nur eine schnelle, wegwerfende Handbewegung und gab keine Antwort. Hörbar knirschte er mit den Zähnen, raffte alle seine Kräfte zusammen und stand endlich. Ein ganz klein wenig wankte er.
»Hast am End’ zu schnell und zu viel eingenommen von dem Schnaps?« fragte die Bäuerin, er aber überhörte es und machte etliche steife Schritte.
»Ich glaub’, es ist besser, ich leg’ mich nieder«, brachte er ziemlich tonlos heraus, kam zur Tür, zog sie auf und wieder zu und torkelte unsicher wie ein Betrunkener die Stiege hinauf.
»Du wirst doch nicht krank werden«, meinte die hinter ihm dreingehende Heimrathin, und es klang leicht besorgt. Als sie in der Ehekammer angekommen waren, brach der Bauer auf sein Bett nieder, schwer und ganz hilflos. Er war nicht imstande, sich auszuziehen, ließ stumm mit sich geschehen und bekam mit der Zeit ein erschreckend abweisendes Geschau. Steif lag er zuletzt im Bett, mit fest aufeinandergepreßten Lippen. Er starrte zur Decke und schnaubte fast pfeifend. Die Heimrathin sah, wie seine Nasenflügel sich dabei dehnten. Sie besprenkelte ihn mit Weihwasser. Er zuckte mit keiner Wimper dabei.
»Brauchst was?« fragte sie bekümmert. Er rührte sich nicht.
Drunten knarrte die Kuchltür und fiel ins Schloß. Die Schulkinder waren heimgekommen und lärmten geschäftig. Auf der Straße fuhr der Knecht mit dem vollen Düngerwagen vorüber. Die Räder knirschten im aufgeweichten Sand.
Die Heimrathin ging zur Tür und rief den Kindern. Rumpelnd kamen sie daher und verstummten jäh, als sie ihnen sagte: »Der Vater ist krank.« Scheu, fast behutsam drückten sie sich in die Ehekammer, bekamen ernste Gesichter und große, erschreckte Augen. Sie blickten auf den reglos daliegenden Kranken, dessen Brust sich mühevoll hob und wieder senkte, und falteten benommen die Hände.
Seit sie Bäuerin von Aufhausen war, hatte die Heimrathin ihren Ferdinand, wie das allenthalben dem Brauch entsprach, »Bauer« genannt. Diese Bezeichnung war dem sich freiwillig unterordnenden Respekt gemäß. Jetzt ging sie zum Bett hin, beugte sich über den Kranken und sagte wie einst in ihrer Jugend, vor ihrer Verheiratung, aber ratlos schmerzlich: »Ferdl? … Wie geht’s dir denn, Ferdl?« Da geschah etwas unerwartet Schreckliches, und es geschah so überstürzt, daß die Kinder laut aufschreiend aus der Kammer liefen. Dem Heimrath brach der Mund knackend weit auf, blutvermischte Schaumblasen traten auf seine zuckenden Lippen, die kleinen Augen wurden kugelrund, verdrehten sich und drohten aus den Höhlen zu quellen, fingerdick schwollen seine Schläfenadern an, und der Bauer schrie furchtbar, grauenhaft, unausgesetzt. Es waren unregelmäßige, bald langgezogene, bald kurze, gurgelnde, gehemmte, gräßliche Schreie, die durch Mark und Bein gingen und sich anhörten wie das hilflose Brüllen eines verendenden Tieres. Der Kranke warf die zitternden Arme gegen die hölzerne Kopfwand des Bettes und umspannte deren Kanten krampfhaft. Brust und Bauch wölbten sich, der ganze kräftige Körper streckte sich konvulsivisch, und die versteiften Beine stießen derart hart auf die Endseite, daß das Bett krachend auseinandersplitterte. Schwer plumpste der dicke Strohsack mit seiner Last auf den quietschenden Boden, der brüllende Bauer schleuderte die zerbrochene Kopfwand gegen die Fensterseite der Kammer und schlug wie ein Rasender um sich.
In den ersten Augenblicken war die Heimrathin so fassungslos, daß sie wie gelähmt dastand. Ganz verstört sah ihr schreckensbleiches Gesicht aus. Endlich rang sie laut jammernd die Hände und rief zum Himmel auf: »Ja, um Gottes Himmels Christi willen! Ferdl! Mein Ferdl!« Mit blindem Mut versuchte sie ein paarmal die herausschlagenden Arme des Tobenden aufzufangen und festzuhalten, bekam aber dabei zwei oder drei so heftige Hiebe, daß sie taumelnd auf die Kammerwand zu sank und nur noch um Hilfe schreien konnte. Dickes Blut quoll aus ihrer Nase, die Haare hingen ihr ins Gesicht, ihre eine Wange schwoll an, und sie weinte zerstoßen, als der erste Knecht und zwei Mägde mit den angstverwirrten Kindern in die Kammer kamen.
»Den Pfarrer! Den Pfarrer!« schrie sie, »schnell den Pfarrer holen!« und kam wieder halbwegs zu sich. Der Heimrath lag, blau und rot angelaufen, mit steif verrenkten Gliedern auf dem zerwühlten, zerfetzten Strohsack und rührte sich nicht mehr. Aber er röchelte noch. Der Knecht bekreuzigte sich schnell und lief weg, um den Geistlichen zu holen, die Mägde und die Bäuerin fingen zu beten an, und die Kinder weinten zwischenhinein. Einmal noch gab es dem Kranken einen Ruck, alle verstummten, er rülpste, als müsse er sich erbrechen, sein Kopf zuckte und sank auf die entblößte, haarige Brust. Einen Augenblick lang überlegte die Heimrathin, seufzte schmerzhaft und wischte ihr Haar aus dem verweinten Gesicht, dann aber besprenkelte sie den Sterbenden wiederum nur mit Weihwasser und fuhr fort mit dem Gebet.
Als später der Pfarrer kam, wichen alle schweigend und scheu zur Seite. Der Knecht versuchte den verrenkten Bauer zurechtzulegen und merkte, daß er schon ganz erkaltet war. Trotzdem versah ihn der Geistliche mit der letzten Ölung, segnete ihn und sprach dabei die üblichen lateinischen Worte.
»Er ist schon verstorben«, lispelte er der Heimrathin zu, als er damit fertig war und blieb mit gefalteten Händen stehen. Alle hatten es gehört. Die Bäuerin weinte nicht mehr. Ihr Gesicht war wieder hart und geduldig gefaßt, und klanglos ruhig sagte sie: »Herr, gib ihm die ewige Ruhe!« – »Und das ewige Licht leuchte ihm«, fielen die anderen ebenso ein.
Erst spät am Nachmittag des anderen Tages kam der Doktor aus Wolfratshausen und bestätigte den Tod.
Im hohen Alter erzählte die Resl manchmal von diesem Sterben, wenn irgendein Ereignis sie darauf brachte. Es machte aber stets den Eindruck, als spräche sie nur ungern davon, als zittere immer noch ein nicht überwundener Schrecken in ihr.
»Geheißen hat’s, der Vater sei am hitzigen Gallfieber gestorben«, sagte sie dabei und setzte dazu: »Ich seh’s noch wie heute … Seine Hände sind noch dreckig vom Mistausfahren gewesen … Drei Finger der rechten Hand hat er ausgestreckt gehabt und an einem ist noch der Ehering zu sehen gewesen.«
Viel lieber redete sie von allgemeinen und am allerliebsten von lustigen Begebenheiten.
Nach dem Tode des Bauern war die Heimrathin gezwungen, einen Verwalter ins Haus zu nehmen, der die ganze Arbeit und alles, was damit zusammenhing, von Grund auf verstand und die Knechte regieren konnte. Einem alleinigen, verwitweten Weibsbild gegenüber hätten sie sich wahrscheinlich im Verlauf der Zeit nicht mit dem nötigen Respekt benommen. Unleugbar, das Müllerische lag der Heimrathbäuerin tief im Blut, grob und nüchtern war sie und wußte immer, was sie wollte. Sie konnte sich, wenn es galt, gegen jeden Widerstand durchsetzen. Um aber auf so einem großen Hof die rechte Ordnung aufrecht zu erhalten, dazu gehörten vier Augen und zwei Hirne. Ein Mann für den Stall und die Felder, ein Weib fürs Haus. Zudem waren fünf unmündige Töchter da, die sich zwar beständig besser einfügten und zunächst keine weiteren Sorgen machten, doch die meisten von ihnen waren, da sie ja durch ihre Arbeit fast stets mit ihm zu tun gehabt hatten, seit jeher mehr am Vater als an ihrer Mutter gehangen. Wie Wachs oder Teig ist ein junger Mensch. Geformt wird er von dem, der sich daran macht, ihn zurechtzukneten. Dazu hatte die Heimrathin weder Geduld noch Zeit.
Den Verwalter nannte man damals »Baumeister«. Es läßt sich denken, daß sich alle möglichen Männer aus der näheren und weiteren Umgebung um den Posten bewarben. Zum ersten Male kamen zum Teil gänzlich fremde Menschen auf den Hof, und die Kinder fanden eine solche Abwechslung unterhaltlich. Anfänglich musterten sie den Bewerber mit geschwinden, scheuen Blicken und grüßten kaum, nach und nach aber – insbesondere, wenn dieser sich allzu bieder und unterwürfig zeigte – schauten sie viel dreister drein, fanden im Benehmen des Fremden allerhand Komisches, gingen aus der Stube und ahmten unter lautem Gelächter seine Gesten und seine Stimme nach. So laut lärmten sie, daß der betroffene Bewerber nicht selten den übermütigen Spott vernehmen konnte und eine peinliche Miene bekam.
Der erste Baumeister, welcher der Heimrathin vom Pfarrer empfohlen wurde, war ein unverheirateter Bruder vom Jani-Bauern in Farchach. Dieses Dorf liegt östlich von Aufkirchen, in einem tiefen Kessel des Tales. Nur der spitze Kirchturm ragt daraus hervor. Noch jetzigerzeit sagt man von den Farchnern, sie seien uralt, denn nichts hat sie und ihr Dorf verändert. Wenn wirklich einmal ein Fremder dorthin kommt, so schauen ihn die Leute abweisend und ungut an, als wollten sie sagen: »Was suchst denn du bei uns? Haben wir dir vielleicht geschrien? Mach bloß, daß du weiterkommst!«
Der Jani-Hans war ein baumlanger, etwas linkischer Mensch mit glotzigen Augen und schon angegrauten, kurzen Stachelhaaren. Er mochte ungefähr fünfundvierzig Jahre alt sein. Überall kannte man ihn als einen ungewöhnlich bigotten Menschen, der – wie viele wissen wollten – das fromme Gelübde abgelegt hatte, nur dann zu heiraten, wenn seine Zukünftige sich bereit fände, mit ihm eine »Josephs-Ehe« zu schließen. Eine solche wie üblich von der Kirche geweihte Ehe unterscheidet sich von der gewöhnlichen dadurch, daß die beiden Gatten sich verpflichten, jeden Geschlechtsverkehr miteinander zu vermeiden. Mann und Weib haben sich meist schon vor Jahren mit einem oder einer Heiligen »verlobt«, und das Vermögen der beiden fällt nach ihrem Ableben der Kirche zu.
Der Jani-Hans kam in die Kuchl vom Heimrath, streckte den langen, dicken Finger seiner riesigen Hand bedächtig in das an der Wand hängende Weihwasserfäßchen, bekreuzigte sich stehenbleibend und sagte: »Gelobt sei Jesus Christus, Heimrathin! … Der hochwürdige Herr Pfarrer hat mich wissen lassen, ich soll bei dir Baumeister werden.« – »In Ewigkeit, Amen!« antwortete die Heimrathin, und es klang sehr spöttisch. Es lag ihr fern, fromme Ausdrücke frevelhaft herabzumindern, indessen Bigotterie, obendrein bei einem Mannsbild, war ihr zuwider. Außerdem brachte der Jani-Hans, den sie wohl schon öfter gesehen, aber nie näher kennengelernt hatte, alles so aufdringlich gottselig mit seiner hellen Weiberstimme hervor, daß sie – die lebhafte, handfeste, etwas rauhe Männer schätzte – schon ärgerlich war.
»Hock dich nur her!« forderte sie den zerschlissen grinsenden Jani-Hans auf, »zum Rosenkranzbeten ist Zeit, wenn wir handelseins sind.« Und als der baumlange Mensch nun langsam auf die Bank zuging und im Niedersitzen »Vergelt’s Gott, Heimrathin« herausplapperte, sagte sie ganz grob: »Mit’m Löffel hat man bei euch die Flinkheit kaum gefressen, was?«
Trotz alledem stellte sie den Hans ein, und es erwies sich, daß es kein Fehlgriff war. Der Baumeister war der erste in der Frühe und der letzte des Nachts, wenn die Arbeit getan war. Eine beharrliche, fast schleichende Umsicht zeichnete ihn aus. Keine Nachlässigkeit der Knechte und Mägde entging ihm, und merkwürdigerweise verstand er es, wenngleich es anfangs geschienen hatte, als nehme man nichts an ihm ernst, sich bei allen Autorität zu verschaffen. Er schimpfte nie, fluchen konnte er überhaupt nicht, er blieb immer gleich sanft und grinste gewöhnlich. Gewiß, er war ein wenig langsam, aber von einer fast unglaublichen Ausdauer, von einer Genauigkeit, die in Erstaunen setzte. Er war ein vorzüglicher Rechner und Abschätzer und verriet dabei einen Instinkt, der den Nutzen und Schaden einer Sache schon erkannte, ehe andere überlegen konnten. Er sparte mit dem, was ihm anvertraut worden war, als sei es seine eigene Sache, und blieb dabei fast gänzlich bedürfnislos für sich. Dadurch gab er allen, wenn auch kein bequemes, so doch ein gutes Beispiel. Er überhob sich über keinen, doch er blieb für sich. Auch das erwies sich als richtig. Wenn ihn auch die Knechte nicht sonderlich mochten und insgeheim viel über seine Bigotterie spotteten, sie gehorchten ihm doch, denn niemand konnte ihm je nachsagen, daß seine Arbeit darunter litt. Die Heimrathin war zufrieden mit ihm. Er hatte nur einen Fehler: er rauchte unausgesetzt Pfeife, und da ihm der Tabak zu teuer war, vermischte er ihn stets mit dürren, zerriebenen Blättern oder getrocknetem Pferdemist. Der Qualm davon stank unerträglich.
Der Sommer stieg herauf und reifte eine pralle Ernte. Jeden Tag hieß es: mähen, mähen, mähen! In der dunklen Frühe sangen die Sensen der Aufhauser immer zuerst in den Roggen- und Weizenfeldern. Rauschend sanken die gemähten Büschel zur Erde, sanken und sanken. Langsam wurde es rot über dem fernen Hügelkamm hinter Bachhausen und Farchach. Die Lerchen stiegen trillernd ins Hohe. Die Vögel fingen zu singen an. Der leichte Dunst über den Äckern verwich, und es wurde unbestimmt hell. Schließlich strahlte die aufgehende Sonne schief über die tauglitzernden, wogenden gelben Flächen.
Während des Mähens pflegte der Jani-Hans seine Pfeife an den Ackerrain zu legen, um sie bei der Brotzeit um neun Uhr gleich wieder bei der Hand zu haben.
»Resei«, wisperten einmal die Knechte der Resl zu: »Jetzt geh hin … Jetzt geht’s grad noch!« Sie kicherten, und die Resl kicherte. Sie stapfte über das mit hohen Büscheln bedeckte Stoppelfeld an den Rain, lugte ein paarmal wie zufällig herum und erwischte die noch warme Pfeife. Sie kicherte wieder und setzte sich darüber, den offenen Pfeifenkopf unter ihren breiten Rock haltend. Eine Weile blieb sie so geduckt hocken und konnte das Lachen kaum verhalten. Als sei nichts weiter gewesen, kam sie in die Reihe der Mähenden zurück und biß, den blinzelnden Knechten zunickend, fortwährend auf ihre Lippen. Die Sonne stieg höher und höher. Die Körper dampften.
Die Zwillinge kamen den Hang herab und brachten Milch und Brot. Erst nachdem sie den Ackerrain erreicht hatten, schrie der Jani-Hans »Brotzeit!« und alle hielten ein. Jeder schob die blinkende Klinge seiner Sense unter ein eben gemähtes Getreidebüschel, wischte sich veratmend mit der Hand den triefenden Schweiß vom Gesicht und ging hinter dem Baumeister drein. Der hatte es eilig, um zu seiner Pfeife zu kommen. Bei den großen, schnellen Schritten, die er mit seinen langen, stelzigen Beinen machte, war es kein Wunder, daß die anderen zurückblieben. Er hockte, während diese allmählich herankamen, schon eine Weile da, stocherte mit dem Finger im gefüllten Pfeifenkopf, zündete ein Schwefelhölzchen nach dem andern an und zog, zog und zog, was er nur konnte. Der feuchte Tabak wollte nicht brennen. So feucht war er, daß der Hans bei jedem Zug den gallebitteren Saft auf die Zunge bekam und ärgerlich ausspuckte. »Hmhm!« brummte er, »will und will nicht, hm!« Er drückte den Zeigefinger noch fester in den Pfeifenkopf, zündete den Tabak erneut an und zog und zog. Vergebens. Wieder spuckte er kräftig, schier angeekelt und verzog seinen breiten, lefzigen Mund. Sein Gesicht sah aus, als habe er auf einen bitteren Stechapfel gebissen. Er schluckte und zog wiederum. Die Herumsitzenden kauten an ihrem Brot, sagten kein Wort und grinsten einander unvermerkt an. Aufmerksam und unverdächtig verfolgten sie die Manipulationen des Rauchers, der immer unruhiger und eifervoller wurde.
»Tja, hm! … Jetzt kenn’ ich mich nicht mehr aus! … Hm, scheußlich! Was ist denn jetzt das?« fing der zu raunzen an, musterte seine Pfeife genauer, merkte, daß sie und daß seine Hände naß waren, schaute forschend auf den Platz, auf dem sie gelegen hatte, und rückte ein wenig zur Seite, indem er murrte: »Hm, alles ist patschnaß da, hm! Wo mag denn jetzt das herkommen?« Eine kleine Wasserlache glänzte auf dem Boden. Die Herumsitzenden hatten zu kauen aufgehört und würgten ihr Lachen hinunter. Der Hans glotzte immer noch auf die Wasserlache, schüttelte den Kopf, überlegte, roch an seinem Tabak und an seinen Händen und knurrte kurz. Da konnten die anderen sich nicht mehr zurückhalten und lachten gleicherzeit hellauf.
»Wa-was ist’s denn?« fragte der erstaunte Hans, hob das Gesicht und musterte die Runde leicht verärgert, »warum lacht ihr denn so saudumm?«
»No?« rief der erste Knecht übermütig und lachte den Hans dreist an: »No? Wie raucht er sich denn heut’, dein Tabak, Hans? … Muß doch einen besondern Geschmack haben? Er hat doch eine Jungfrauntauf’ kriegt!« Da wurde das Gelächter der Herumsitzenden zu einem Bellen. Jeder schüttelte sich, und der Hans, der nun endlich begriffen hatte, bekam eine recht blamierte Miene, wußte nicht gleich, wie er sich verhalten sollte, spuckte und spuckte und fing endlich selber zu grinsen an. Prasselnd überschüttete ihn eine Lachwelle um die andere.
»Hundsbande, windige!« brummte er und lachte schließlich halbwegs. »Malefizlumpen, elendige! Nichts als Dummheiten fallen euch ein!« Jeden und jede blickte er ratend an und sagte zum Schluß gutmütig polternd zur Resl, der vor Gelächter die Tränen über die braunen Backen rannen: »Das hast du wieder gemacht, Lausmadl! Wart, wart! Die Bäuerin wird dir die Leviten schon lesen!« Er wußte genau, daß er damit bei der Heimrathin kaum etwas auszurichten imstande war, denn niemand haßte dieses fortwährende stinkende Paffen so wie sie. Er hatte es auch gar nicht ernst gemeint. Die Resl jedenfalls verschluckte sich in diesem Augenblick und spie ihr ganzes zerkautes Brot in großem, auseinanderspritzenden Bogen aus sich heraus. Sie schien fast zu platzen, so ausgelassen lachte sie. Ihr Atem kam nicht mehr nach.
Der Hans trug ihr nichts nach. Er räumte nur in aller Eile seine Pfeife aus, wischte sie an die durchschwitzten Hosen, nahm ein Bündel Gras, trocknete das Innere des porzellanenen Pfeifenkopfes und füllte ihn neu. Er kam aber nur noch zu etlichen behaglichen Zügen. Von da ab steckte er vorsichtshalber seine Pfeife stets in den Hosensack.
Diese Geschichte erzählten die Leute im weiten Gau stets unter großem Gelächter, wenn die Rede auf die Heimrath-Resl kam, und sie lebte noch lange, lange fort. Jeder Mensch freute sich arglos über das »lustige Luder« unter den Aufhauser Töchtern, und es war bezeichnend für sie und ihre ganze Art, daß die Resl noch im hohen Alter, wenn sie eine geruhige Stunde hatte, den lustigen Streich stets mit der derbsten Eindringlichkeit und ungemein vergnügt zum besten gab. Der »schwarze Peter«, den der Stellmacher Graf einmal mit drei neuen Heurechen nach Aufhausen schickte, erfuhr als einer der ersten davon. Dröhnend lachte er darüber. Er lachte noch immer, als er in die Berger Stellmacherwerkstatt zurückgekehrt war. »Diable! Diable! Respekt!« schloß er seinen Bericht belustigt, schnalzte mit der Zunge und rühmte die Keckheit der Resl. »Respekt! Schon als Schulmädl kommt sie auf so brillante Ideen! Die kann was werden! Mit siebzehn, achtzehn Jahren hätt’ so eine gewitzte Weibsperson zu meiner Zeit schon zur Marketenderin avancieren können!«
Er übersah ganz und gar, daß sein Neffe, der Stellmacher, kaum das Gesicht verzogen hatte und einen Brief in der Hand hielt, dessen Inhalt ihn allem Anschein nach sehr ernsthaft beschäftigte. Der Andreas, der zufällig zu Besuch da war und auf einem Haufen unbearbeiteter Rechenstiele hockte, lachte auch nur halbwegs und brummte: »Wenn nur einer recht saftige Dummheiten macht, das freut dich! Weiter geniert dich überhaupt nichts!«
Den Peter ärgerte die Humorlosigkeit der beiden Neffen, und er fragte polternd: »Warum, ihr bocksteifen Holzköpfe? Was gibt’s denn schon wieder! Hat wieder einmal eine Nummer nicht gezogen?« Seit nämlich der Stellmacher gegen sein hoffnungsloses Elend so zäh und vergeblich ankämpfte, spielte er in der Lotterie. Wie alle Menschen in seiner Lage glaubte er nur noch an eine Rettung aus all dem Jammer durch ein jähes Glück, ein Wunder. Derart verbissen, ja besessen hing er an diesem peinigenden Glauben, daß ihn die zwingende Not seiner Familie gleichgültig ließ. Oft trieb er die hungrigen Kinder in aller Frühe bei kältestem Winter aus den Betten, gab ihnen die letzten Kreuzer und schickte sie zum Bezirksort Starnberg, um ein Los, dessen Nummer er geträumt hatte, zu holen. Er war abergläubisch und erbarmungslos und duldete keinen Widerspruch. Das Jammern der Seinen beirrte ihn nicht, es machte ihn nur gereizt. Sackgrob wurde er zuguterletzt, und sein Jähzorn war gefährlich.
»Ah! Red nicht! Was interessiert mich dein Unsinn!« fuhr der Stellmacher den Peter an und gab ihm den Brief. »Da, der Maxl schreibt: Krieg gibt’s! Er muß mit.« Auch der Andreas schaute wieder ernst drein.
»Krieg? Krieg?! Gegen wen? Gegen die Prussiens?! – Krieg?!!« schrie der Peter wie elektrisiert und las den Brief nicht. Im Nu war er verändert. »Krieg!!« schrie er erneut und wie beseligt. »Attacken und Bataillen gegen diese gottverfluchten Muschkotenschädel! Krieg! Grandios!« Seine Augen blitzten. Sein Gesicht wurde frischrot, als sei er zwanzig. Noch vor etlichen Jahren, anno 66, hatte er mitgewollt gegen die verhaßten Preußen. Er reckte sich.
»Revanche! Endlich Revanche diesen Kartoffelschädeln!« brüllte er, reckte die Fäuste, fuchtelte und machte einen kurzen Sprung. »Krieg! Krieg! … Endlich besinnt sich Bavarski! Krieg mit Feuer und Schwert gegen das Pack! Attacken! Bataillen! Bravo! Respekt! Respekt!« Mittenhinein aber sagte der Stellmacher trocken: »Nicht gegen die Preußen! Gegen die Franzosen soll’s gehen, verrückter Stier, verrückter!«
»Wa-was?« stockte der Peter und riß seine hitzigen Augen weit auf. »Wasss? Und …« – ». . . unser König macht mit«, ergänzte der Stellmacher und fuhr fort: »Er geht mit den Preußen … der Maxl schreibt’s.« Bleich, erregt und kopfschüttelnd begann der Peter den Brief zu lesen und bekam ein immer enttäuschteres Gesicht.
»Mon dieu! Mon dieu!« stotterte er schmerzlich aus sich heraus, wurde benommen und griff sich an den massigen Kopf. »Mon dieu! Verrückt, glatt verrückt ist die Welt! Wie kann einer mit den beschissenen Prussiens gegen die grande armée gehen! Mon dieu! Mon dieu, die macht doch heut noch mit allen tabula rasa, wenn’s sein muß! Mon dieu! Mon dieu!« Er hatte einen traurigen Blick. Da stand er wie ein Mensch, den man unverdienterweise schwer beleidigt hat und der nun nicht gleich weiß, was er tun soll.
»Die Welt ändert sich eben! Und was die Großen tun, muß uns recht sein!« warf der Andreas hin.
»Mon dieu! Mon dieu! Armer Maxl!« rief der Peter wehmütig. Er starrte abwesend in die Leere.
Der Maxl, der älteste der Stellmachersöhne, stand jetzt im vierundzwanzigsten Lebensjahr und war schon lange in der Fremde. In München hatte er das Bäckerhandwerk erlernt und sich als Gehilfe auf die Wanderschaft begeben. Manchmal schickte er ein wenig Geld. Sein Brief kam aus Germersheim, einer damals befestigten Stadt an der badisch-pfälzischen Grenze. Dort war er vor einiger Zeit zum Militär eingezogen worden.
»Heißen tut es, wir kommen bald fort. Sehen kann ich Euch nicht mehr, liebe Eltern und Geschwister, aber hoffen wir das beste«, lautete ein Satz in seinem Brief.
»Nicht einen Schuß ist dieser muschkotische Bismarck wert! Nicht einen!« stieß der schwarze Peter wütend heraus, als er gelesen hatte, und war immer noch fassungslos. »Die grande armée hat doch wieder einen Napoleon! Ach, ich seh’ schwarz! Hmhm, nicht zu verstehn ist dieses ganze Gevölke bei uns! Zuerst verdrischt sie dieser Bismarck nach Strich und Faden, dann seift er sie ein wie ein lumpiger Roßhändler! Und jetzt gehn sie für ihn in die Bataille! Pfui Teufel! Fi donc!« Er machte eine rasche Wendung, spuckte aus, schüttelte sich wie von einem Ekel erfaßt und stampfte aus der Werkstatt …