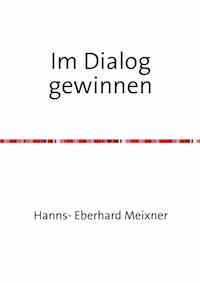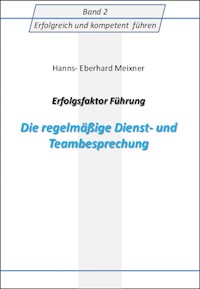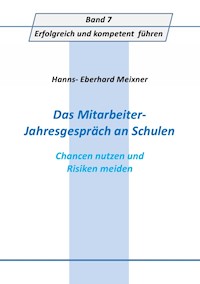
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Über das Buch: Ein formales Mitarbeiter- bzw. Jahresgespräch ist die logische Konsequenz auf ein geändertes Führungsfeld. Die rasanten technologischen und sozialen Veränderungen führen zu einer neuen Gewichtung der Führungsrolle. Führung wird heute stärker hinterfragt und statt formaler Autorität muss die Führung nunmehr als Partner, Coach, Gesundheitsmanager und Sozialingenieur überzeugen und sich hinterfragen lassen. Diese Entwicklung zeichnet sich auch im Bildungsbereich etwa an den Schulen und Gymnasien ab. Auch wenn Konzeption, Intention und Anliegen des Jahresgesprächs in alle Organisationsbereiche grundsätzlich vorbehaltlos übertragbar sind, so gibt es im Bildungssektor in Abhebung zur Verwaltung einige charakteristische Unterschiede. Diese Besonderheiten wie etwa die eher kollegiale Führungsstruktur, die Stellung der Schulleitung und das Selbstverständnis hochqualifizierter Kolleginnen und Kollegen, die Bewältigungsstrategien, denen sich Pädagoginnen täglich stellen müssen, fördern eine besondere Sensibilität für Fremd- und Selbstwahrnehmungs-prozesse, erfordern aber auch ergänzende Akzente. Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird das Anliegen und die Intention dieses Gesprächsformats im Führungsprozess anhand praktischer Fälle veranschaulicht. Die Transformation dieses Gesprächsformats in den organisatorischen Ablauf wird beispielhaft an den Regelungen und vorgeschriebenen Abläufen einer "Dienstvereinbarung" konkretisiert. Der zweite Teil dieses Buch konzentriert sich auf die praktische Umsetzung des Jahresgesprächs. Hier werden die vielen bedeutsamen Kleinigkeiten, deren Beachtung den Gewinn dieses Gesprächsformats ausmachen, herausgearbeitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanns-Eberhard Meixner
Das Mitarbeiter- Jahresgespräch an Schulen
Chancen nutzen und Risiken meiden
Impressum
Texte: © Copyright by Hanns-Eberhard MeixnerUmschlaggestaltung: © Copyright by Hanns-Eberhard Meixner
Verlag:Hanns- Eberhard MeixnerHohenzollernstraße 6253173 Bonnt
Vorwort
Das Jahres- bzw. Mitarbeitergespräch ist ein zentraler Baustein in der Führungskultur von Wirtschaft und Verwaltung und hat sich seit vielen Jahrzehnten als wirkmächtiges Führungsinstrument bewährt. In dieser Zeit entstanden meine ersten Artikel und Bücher zu dieser Thematik (Mitarbeitergespräch - Neue Wege der Personalentwicklung und Förderung, 1. Aufl. 1996, 3. Aufl. 2001; Im Dialog gewinnen - Das Mitarbeiter- und Jahresgespräch, 2005). In diesen Beiträgen galt es vor allem, für die Idee, das Anliegen und die Notwendigkeit dieses Gesprächsformats im Führungsprozess zu werben. Spätere Veröffentlichungen zum Jahresgespräch konzentrierten sich vor allem auf praktische Fragen des Gesprächsaufbaus und der Gesprächstechniken (Im Dialog gewinnen - Brücken bauen im Gespräch, 2014). Diesen Weg folgt das jetzt vorgelegte Buch mit einem Akzent auf den Bildungsbereich. Auch wenn Konzeption, Intention und Anliegen des Jahresgesprächs in alle Organisationsbereiche grundsätzlich vorbehaltlos übertragbar sind, so gibt es im Bildungssektor in Abhebung zur Verwaltung einige charakteristische Unterschiede.Diese Besonderheiten wie etwa die eher kollegiale Führungsstruktur, die Stellung der Schulleitung und das Selbstverständnis hochqualifizierter Kolleginnen und Kollegen unterschieden sich von den anderen für das Jahresgespräch vorgesehenen Arbeitsbereichen. Dieses hochkomplexe und zunehmend belastende Arbeitsfeld, denen sich Pädagoginnen täglich stellen müssen, erzwingt besondere Bewältigungsstrategien und fördert eine besondere Sensibilität für Fremd- und Selbstwahrnehmungsprozesse. Die besondere Belastungssituation erfordert zudem ergänzende Akzente. Ein besonderer Akzent ist beispielsweise bei der individuell ausgerichteten psychischen Gefährdungsbeurteilung zu setzen. Hier kommt dem Jahresgespräch ein wichtiger präventiver Part zu.
Das Jahresgespräch ist die logische Konsequenz auf ein geändertes Führungsfeld. Die rasanten technologischen und sozialen Veränderungen führen zu einer neuen Gewichtung der Führungsrolle. Führung wird heute stärker hinterfragt und statt formaler Autorität muss die Führung nunmehr als Partner, Coach, Gesundheitsmanager und Sozialingenieur überzeugen und sich hinterfragen lassen. Im Jahresgespräch geht es daher um das Aussteuern von Selbst- und Fremdbild und es geht um eine kritische Bestandsaufnahme des gemeinsamen Beziehungsgeflechtes. Das sind Fertigkeiten, die im Bildungsbereich auch ansonsten im besonderen Maß täglich gefordert werden. Insoweit bietet das Jahresgespräch die Chance, dass zwei gleichberechtigte Gesprächspartner über sich selbst und die Wirkung ihres Verhaltens reflektieren. Das gelingt, wenn ein Klima der Nähe, der Offenheit, des Vertrauens und des Vertraut-Sein zwischen den beiden Gesprächspartnern angestrebt wird oder bereits besteht. Diese Voraussetzungen stellen sich nicht zwangsläufig ein, sondern hierauf muss aktiv durch vertrauensbildende Aktionen eingewirkt werden.
Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird das Anliegen und die Intention dieses Gesprächsformats im Führungsprozess anhand praktischer Fälle veranschaulicht. Die Transformation dieses Gesprächsformats in den organisatorischen Ablauf wird beispielhaft an den Regelungen und vorgeschriebenen Abläufen einer „Dienstvereinbarung“ konkretisiert. Ein weiterer Abschnitt in diesem Teil befasst sich mit den Hilfen zur inhaltlichen Vorbereitung und Ausrichtung des Gesprächs. Neben einer methodisch didaktisch ausgerichteten Stichwortliste werden weitere Hilfen mit mehreren Varianten zur Vorbereitung auf das Gespräch aufgezeigt. Der erste Teil schließt mit einer Übersicht über die drei zentralen Phasen dieses Gesprächsformats: Der Gesprächsvorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung. Dieser Dreiklang erlaubt ein systematisches Lernen und eine kontinuierliche Verbesserung in der Anwendung dieses Führungsinstrumentes.
Der zweite Teil dieses Buch konzentriert sich auf die praktische Umsetzung des Jahresgesprächs. Hier werden die vielen bedeutsamen Kleinigkeiten, deren Beachtung den Gewinn dieses Gesprächsformats ausmachen, herausgearbeitet. Techniken zum Einstieg in das Gespräch, für die Wahl der Worte und die Regie zwischen Entspannung und Spannungsbögen werden diskutiert und an praktischen Beispielen entwickelt. Mit diesem Rüstzeug erweist sich das Jahresgespräch zu einem Kunstwerk, das Können und Intuition den Gesprächspartner*innen abverlangt und dies beginnt mit der mentalen Einstimmung auf das Gespräch. In 22 Merksätzen werden die Leitplanken für eine exzellentes Jahresgespräch zusammenfassend aufgezeigt.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch den zahlreichen Lesern, die mich mit ihren Anregungen und Diskussionen ermunterten, meinen Artikel „Mitarbeitergespräch in Schulen und Gymnasien“{1} in der jetzt vorliegenden Fassung weiter auszugestalten.
Bonn im März 2022
Hanns Eberhard Meixner
VORWORT
1. Was hat sich geändert?
2. Luft nach oben in der Kommunikation
3. Eine praktische Herausforderung an die Schulleitung
4. Die Schulleitung in einem komplexen Führungsfeld
4.1 DIEKNORRIGE EICHE
4.2 DIE VERUNSICHERTE: DIE VERSUCHS- IRRTUMS PHASE
4.3 DERKRÄNKELNDE KOLLEGE
4.4 DIE ÜBERMOTIVIERTEN
4.5 DIEVERPASSTE BEFÖRDERUNG
4.6 DIEGROßE MEHRHEITDER WILLIGEN
4.7 WASFOLGTAUSDIESEN BEISPIELEN
5. Braucht das Kollegium ein Jahres-/ Mitarbeiter- Gespräch mit der Schulleitung?
6. Spiegeln sich die Intentionen des Jahresgesprächs in den Dienstvereinbarungen wieder?
7. Stichwortlisten und weitere Hilfen zur inhaltlichen Ausrichtung und Strukturierung des Gesprächs
7.1 ALTERNATIVE A: DASOFFENE VERFAHREN
7.2 Alternative B: Vorgabe von Orientierungsfragen
A. VARIANTE 1 DER ALTERNATIVE
b. Variante 2 der Alternativen B
7.3 ALTERNATIVE C: STICHWORTLISTEN
A. VARIANTE 1 DER ALTERNATIVEN C: ALLGEMEINE VERWALTUNG
B. VARIANTE 2 DER ALTERNATIVEN C: BILDUNGSBEREICH
7.4 ALTERNATIVE D: LEITLINIENDER FÜHRUNGUND ZUSAMMENARBEIT
A. VARIANTE 1 ALTERNATIVEN D OHNE GEWICHTUNGSFAKTOR
B. VARIANTE 2 DER ALTERNATIVEN D MIT GEWICHTUNGSFAKTOR
8. Einstimmung und Vorbereitung des Kollegiums auf den Gesprächszyklus
8.1 WIESTIMMEICHALS SCHULLEITUNGDAS KOLLEGIUMAUFDAS MITARBEITER- GESPRÄCHEIN?
A. IM TEAMDIE CHANCENDES JAHRESGESPRÄCHSKOMMUNIZIEREN
B. DAS ZEITBUDGETFESTLEGEN
C. MITWEMBEGINNEICHDAS JAHRES- BZW. MITARBEITERGESPRÄCH?
D. SACHLICHKEITSTATT SYMPATHIEODER ANTIPATHIE
E. SICHIM TEAMAUF REGELNFÜRDEN GESPRÄCHSABLAUFVERSTÄNDIGEN
F. WARUMUNDWIEWERDENDIE GESPRÄCHSERGEBNISSEDOKUMENTIERT?
8.2 WIEBEREITEICHMICHALS SCHULLEITUNGDAS GESPRÄCHVOR?
A. WIESTELLEICHMICHALS SCHULLEITUNGSCHWIERIGEN GESPRÄCHEN?
B. WASBEDEUTETESINDER HIERARCHIE: GLEICHBERECHTIGTE GESPRÄCHSPARTNER
C. ESGEHTUMDIEGRUNDSÄTZLICHEN ANLIEGENUND INHALTE, NICHTUMDIEAKTUELLEN AUFREGER!
D. DIEDREI PHASENDES MITARBEITER- JAHRESGESPRÄCHS
E. DIEUNTERSCHIEDLICHEN ROLLENDER SCHULLEITUNG
F. VERSTEHEN, TEILNAHMEUND EMPATHIEFÜHRTZU VERSTÄNDNIS
G. WIEKANNMANINEINEM GESPRÄCH BRÜCKENBAUEN, STATT BARRIERENZUERRICHTEN?
H. DERROTE FADENIM GESPRÄCH
I. AUFDEN EINSTIEGUNDDIE HINFÜHRUNGKOMMTESAN!
9. Merksätze zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Gesprächs
9.1 PLANEN SIEFÜRWICHTIGE GESPRÄCHEGENÜGEND ZEITFÜREINESORGFÄLTIGE VOR- UND NACHBEREITUNGEIN. (3:2:1)
9.2 WASWIRDVONMIRALS SCHULLEITUNGBEIDEM „MITARBEITER- GESPRÄCH“ ERWARTET? (AUFTRAGS- UND ROLLENANALYSE)
9.3 BAUENSIEAUF ZIELEUNDSCHREIBEN SIEAUF, WAS SIEINDIESEM GESPRÄCHERREICHENWOLLEN. (ZIELANALYSE)
9.4 VERSETZEN SIESICHINDIE ROLLEUNDINDEN STANDPUNKT IHRES GESPRÄCHSPARTNERS. (ADRESSATENANALYSE)
9.5 STELLEN SIESICHAUF IHRENWUNDEN PUNKTEIN! (SELBSTREFLEKTION)
9.6 PRÜFEN SIE, WOUNDWANNDAS GESPRÄCHSTATTFINDENSOLLTE. (SITUATIONSANALYSE)
9.7 STIMMEN SIESICHAUFDAS GESPRÄCHEIN: GEHEN SIEPOSITIVANDAS GESPRÄCHHERAN
9.8 AUFEINETREFFENDEUNDSCHLÜSSIGE AUSWAHLDER INHALTEKOMMTESAN. (INHALTSANALYSE)
9.9 Gliedern Sie das Gespräch formal und logisch
9. 10 DIEEINE PERSPEKTIVE: WIEBETRETEICHEINENMIRFREMDEN RAUM?
9.11 DIEANDERE PERSPEKTIVE: WIEBEGRÜßEICHDIE GESPRÄCHSPARTNERINMEINEM REVIER?
9.12 AUFDIEERSTEN WORTEKOMMTESAN!
9.13 POSITIVE WORTESINDWIRKUNGSVOLLERALSNEGATIVE
9.14 AKTIVIEREN SIE IHRE GESPRÄCHSTEILNEHMERDURCH TEILNEHMERZENTRIERTE METHODEN
9.15 VISUALISIEREN SIEDURCH WORTBILDERODERDURCH VISUALISIERUNGSTECHNIKEN
9.16 SEIEN SIEGEDULDIGUNDHÖREN SIEAKTIVZU
9.17 VERMEIDEN SIEEINEZUHOHE INFORMATIONSDICHTE
9.18 APPELLEANDAS GEFÜHLSINDWIRKUNGSVOLL. ABER: „WASDAS HERZBEGEHRT, RECHTFERTIGTDER VERSTAND.“
9.19 HALTEN SIEFEST, WERWASWANNZUTUNHAT!
9.20 BEENDEN SIEDAS GESPRÄCHMITEINER PERSPEKTIVE, EINER AUFFORDERUNGZUM HANDELN
9.21 ZIEHEN SIEAUSDEM SOLL (ZIELPHASE) UNDDEM IST (DAS ERREICHTE/ KONTROLLPHASE) RÜCKSCHLÜSSEFÜRKÜNFTIGE GESPRÄCHE
LITERATURHINWEISE
1. Was hat sich geändert?
Das formal zu vereinbarende Mitarbeiter- bzw. Jahresgespräch (MG) ist die konsequente Antwort auf ein in Wirtschaft und Verwaltung verändertes Führungsfeld. Soziale und persönliche Befindlichkeiten werden ernster genommen und sie ergänzen die auf eine ökonomische Fixierung hin ausgerichtete Entscheidungsfindung. Der „homo oeconomicus“ mutiert zu einem sozialen Wesen in einer ansonsten auf Zweckrationalität hin ausgerichteten Organisation. Das Bedürfnis nach Respekt, Achtung, Wertschätzung und Dialog wird anerkannt und das soziale Miteinander mit seinen vielen emotionalen Überraschungen wird nicht mehr als soziales Klimbim abgetan. Entsprechend sind die Führungsmodelle heute stärker auf Unterstützung, Partizipation und Kommunikation hin ausgerichtet - allerdings bei einer gleichzeitigen Verdichtung der Arbeit. Das engt den zeitlichen Raum für den Austausch fachübergreifender Erlebnisbereiche deutlich ein. Was früher an persönlich verbindender Kommunikation über Weihnachtsfeiern, Betriebssportgruppen, Geselligkeiten u. ä. ablief, ist heute zu einem rationalisierungsbedingten Mangel geworden. Einige Verwaltungen haben zur Kompensation dieser fehlenden sozialen Bezüge bereits in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf ein formales und geregeltes Jahresgespräch gesetzt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Bereich von Bildung und Schule wider. Hier stabilisiert sich Autorität nicht im Frontalunterricht. Sie muss sich immer wieder aufs Neue in einer gemeinsamen und überzeugenden Kommunikation erweisen. Ohnehin ist das Rollenbild eines Pädagogen und einer Pädagogin facettenreicher und anspruchsvoller geworden. Die Erwartungen von Politik, Schulverwaltung, Eltern und Schülern sind hoch. Mitunter ist die Messlatte, die hier angelegt wird, eine Kompensation von Versäumnissen auf der anderen Seite. Diese Entwicklung greift tief in das Selbstverständnis und das Selbstbild der Lehrenden. Damit einher geht eine starke Belastung der Betroffenen. In diesem schwierigen und anspruchsvollen Feld hat das Mitarbeiter- bzw. Jahresgespräch eine kathartische, unterstützende, regulierende und steuernde Funktion, um den eigenen Standpunkt und eigenes Verhalten zu reflektieren.
Nicht jedem erschließt sich die Notwendigkeit eines formal angeordneten Gesprächs und einige zweifeln, ob diese bindende Vorgabe der richtige und effektive Weg ist. Wer sich allerdings auf dieses Gesprächsformat trotz all dieser Einwände vorbehaltlos einlässt, der ist, wenn die angestrebte offene und vertrauensvolle Interaktion gelingt, von den Möglichkeiten und Wirkungen dieses Führungsinstrumentes nachhaltig überzeugt
Inhaltlich geht es bei diesem Gespräch um das Aussteuern von Selbst- und Fremdbild, geht es um eine kritische Bestandsaufnahme des gemeinsamen Beziehungsgeflechtes, geht es um Verhaltens- und Entwicklungsziele. Insoweit bietet das Mitarbeiter- Gespräch (MG) die Chance, dass zwei gleichberechtigte Gesprächspartner über sich selbst und die Wirkung ihres Verhaltens gemeinsam reflektieren. Das funktioniert, wenn ein Klima der Nähe, der Offenheit, des Vertrauens und des Vertraut- Sein zwischen den beiden Gesprächspartnern besteht oder wenigstens nachhaltig und ernsthaft angestrebt wird.
Wer mit Worten Brücken bauen will, weiß, dass alles seine Zeit hat: Dabei geht es um die Wahl der Worte wie auch um die wohlüberlegte Abfolge der Argumente. Neben der Intuition ist daher auch Transpiration gefordert: Ohne Fleiß kein Preis. Eine erfolgreiche Kommunikation, die auf eine kontinuierliche Verbesserung setzt, baut auf den Säulen einer umfassenden Vorbereitung und Nachbereitung. „Der Erfolg“, so Charles de Secondat, (1689 - 1755) ein französischer Staatstheoretiker und Schriftsteller, „hängt oft davon ab, dass man weiß, wieviel Zeit für ihn nötig ist.“ Ein wirkungsvolles und gelungenes Gespräch baut daher auf drei zeitintensive Voraussetzungen: Es sind dies, eine gute Einstimmung auf den Gesprächsinhalt und die Gesprächspartner, ferner einem guten, lebendigen und verständnisbereiten Dialog zwischen den Gesprächspartnern sowie einer abschließenden Reflektion über Verlauf und Ergebnis dieses Gesprächs.
2. Luft nach oben in der Kommunikation
Auf die Frage eines neuen, aber bereits seit vielen Monaten an der Schule tätigen Kollegen an die Schulleitung, wie denn seine Leistungen gesehen und eingeschätzt werden, antwortete die Leitung leicht irritiert mit einem kurzen und knappen Hinweis: "Wenn ich mit Ihren Leistungen nicht zufrieden wäre, hätte ich Ihnen das bereits gesagt!" Eine verkürzte Interaktion, die viele Fragen offenlässt, aber großen Raum für subjektive Interpretationen öffnet. Diese unbedachte und reflexartige Botschaft kann je nach Temperament des Adressaten recht unterschiedlich gedeutet und empfunden werden. Das Spektrum der persönlichen Interpretationen und Empfindlichkeiten auf dieses vorschnelle und verkürzende Statement verdichtet sich häufig auf ein negatives Erlebnisfeld und wird als mangelnde Wertschätzung gedeutet.
Diese leicht dahingesagte Floskel der Schulleitung ist für die Adressaten daher meist desillusionierend und demotivierend. Dahinter werden Botschaften gedeutet wie: „Störe mich nicht, ich habe Wichtigeres zu tun als mich mit dieser Frage zu beschäftigen!“ „Du bist nicht wichtig, macht deine Arbeit!“ Ein Einzelfall? Wollen wir es gemeinsam hoffen! Auch wer sich etwas mehr Zeit als Leitung nimmt, um auf diese Frage die richtigen Worte zu finden, der übersieht bei solchen spontanen und mitunter zur Unzeit aufgezwungenen Tür- Angelgesprächen die damit einhergehenden möglichen Missverständnisse. Diese Konsequenzen werden meist von der so angesprochenen Schulleitung in der Hektik der vielfältigen Herausforderungen des Tagesgeschäftes übersehen und vor allem in ihrer Bedeutung für den Nachwuchs falsch gewichtet.
Das ist erstaunlich. Denn eigentlich gehört ein aufbauendes und motivierendes Feedback- Geben, aber auch ein Feedback-Annehmen zum Kerngeschäft eines Pädagogen. Von diesen Experten erwartet man Einfühlungsvermögen und ein kurzes Innehalten, bevor man bei grundlegenden Fragen mit einer schnellen und schnöden Antwort loslegt. Das ist sicherlich bei einem Tür- Angel- Gespräch nicht immer leicht zu bedenken. Das formalisierte und jährlichen Mitarbeiter- Gespräch (MG) setzt dagegen auf einen besonderen Qualitätsstandard. Hier geht es um das geordnete Aussteuern von Selbst- und Fremdbild – sowohl des Kollegen und der Kollegin, wie aber auch das der Schulleitung, kurzum: es geht um eine kritische Bestandsaufnahme des gemeinsamen Beziehungsgeflechtes, und es geht um individuelle Entwicklungsimpulse, um Rollensicherheit und um Verhaltenskorrektur durch Interaktion.{2} Insoweit bietet das Mitarbeiter- Gespräch die Chance, dass zwei gleichberechtigte Gesprächspartner über sich selbst und die Wirkung ihres Verhaltens in einem Schonraum fernab von der Hektik des Tagesgeschäfts reflektieren können. Das geht vor allem dann, wenn, wie bereits eingefordert, ein Klima der Nähe, der Offenheit, des Vertrauens und des Vertraut- Sein zwischen den beiden Gesprächspartnern angestrebt wird oder bereits besteht. Und eine weitere wichtige Voraussetzung muss gegeben sein: Es dürfen auch Gefühle gezeigt werden und es muss auch möglich sein, im Eifer einmal die falschen Worte zu wählen, allerdings mit der festen Absicht, den anderen nicht zu verletzen und aus dem Gespräch den größtmöglichen Nutzen für sich und den Gesprächspartner bzw. die Gesprächspartnerin zu ziehen. Die Programmierung heißt dann: „Was erfahre ich heute in dem Gespräch, was mich in meiner Entwicklung weiterbringt?“
Gefühle zu zeigen, ist auch eine Abkehr von der Devise „Indianer heulen nicht!“ oder Bagatellisierungen wie etwa die merkwürdigen Hinweise: „Warum klagen sie? Das gehört zum Berufsbild! Das hätten sie sich früher überlegen sollen!“ oder „Damit müssen sie klarkommen!“ oder „Nehmen sie diese Kritik nicht persönlich!“
Gefühle gehören zum Leben – und sie sollten daher in diesem Gespräch auch zugelassen werden und vor allem ernstgenommen werden. Das ist nicht leicht in einem Berufsfeld, in dem täglich gefordert wird, Gefühle unter Kontrolle zu halten. Selbstreflektion hat vor allem etwas mit sozialer Kompetenz zu tun. Soziale Kompetenz wird heute als Baustein einer überzeugenden Führung immer artikulierter eingefordert. Ohne soziale Kompetenz können indes komplexe soziale Systeme nicht funktionieren. Daher liegt die Vermutung nahe, dass soziale Kompetenz in Organisationen schon immer einen wichtigen Part gespielt hat. Offensichtlich hat sich das, was einmal selbstverständlich war, zu einem Mangel entwickelt und muss nun neu artikuliert werden. Soziale Kompetenz wird vor allem auch im Jahresgespräch gefordert und gefördert. Viele Schulleitungen wissen dies und handeln danach. So gesehen, bedarf es eigentlich keines angeordneten Jahresgespräches. Doch die tägliche Routine lässt manche Selbstverständlichkeit in den Hintergrund treten. Daher macht es Sinn, die Aufmerksamkeit durch die beiden Vorgaben (a) der „Jährlichkeit“ und (b) „formaler Ablauf“ auf dieses Instrument zu lenken. Doch was im Klassenraum so selbstverständlich erscheint, wird im Alltag des Miteinanderumgehens im Kollegium leicht zur Ausnahme. Allerdings gilt diese "Sprachlosigkeit" nicht nur im Berufsfeld! Auch Ehepartner leiden nicht selten an ,,Gesprächsmangel". Mit wenigen Minuten Austausch im Tagesschnitt - so das Ergebnis einer Umfrage - geben sich viele Paare im Alltag zufrieden. Das geht lange gut, bis der Urlaub oder die Weihnachtszeit naht. Dann schafft die erzwungene Nähe verbunden mit einer Zeit reduzierter Ablenkungen für viel Dynamik. Mitunter gerät dann außer Kontrolle, was ansonsten so „cool“ und „bedacht“ abläuft.{3} So weit sollte man es nicht kommen lassen. Konflikte lassen sich in kleinen und überschaubaren Portionen effektiver kontrollieren als aufgestauter und unterdrückter Ärger, der sich einem explodierenden Dampfkessel vergleichbar seine Bahn sucht. Hier liegt der eigentliche Sinn des Mitarbeitergesprächs. Es soll auf ein Gesprächsanliegen eingegangen werden, das ansonsten in der Hektik des täglichen Miteinanders durch Vordergründiges überlagert wird. Insoweit hat das Mitarbeitergespräch auch eine kathartische Wirkung. Es sollte an- und ausgesprochen werden, was unausgesprochen eine innere Dynamik auslöst und zu unkontrollierten, mitunter explosionsartigen Entladungen führen kann. Gerade heute aber gewinnt das Mitarbeiter- Gespräch gerade in Bereichen, die durch eine große Leitungs- bzw. Führungsspanne charakterisiert sind, an Bedeutung. Es ist ein Gebot der Fürsorge, auch dort als Schulleitung vermittelnd einzugreifen, wo sich im Beziehungsgeflecht gruppendynamische Konflikte aufbauen, eine Selbstausbeutung Platz greift und sich persönliche Konflikte auf das berufliche Umfeld auswirken. Jede Lehrkraft achtet in seinem Klassenverbund auf diese gruppendynamischen Zeichen, und es ist selbstverständlich, dass die Schulleitung hierauf auch bei den Kolleginnen und Kollegen{4} ein wachsames Auge haben sollte. Aber es geht nicht nur um dieses Krisenmanagement, es geht auch um partnerschaftliche Signale und Impulse, um das gemeinsame Ziel mit vollem Engagement zu erreichen. Wer sich als Schulleitung als erfahrener Partner und Teamplayer versteht, wirkt einer inneren Kündigung entgegen, vermeidet Burnout bei sich und anderen und deutet die vielen Impulse, um auf sein eigenes Führungsverhalten positiv einzuwirken.
Teil 1 Hintergrundinformationen
3. Eine praktische Herausforderung an die Schulleitung
Nicht immer läuft es im Schulbetrieb so, wie sich die Leitung eines Gymnasiums, die Kollegen, die Eltern und Schüler es wünschen. Das kann viele Ursachen haben. Aber eine bedeutsame und nicht immer leicht zu korrigierbare Quelle kann in der Person einer Kollegin oder eines Kollegen liegen. Das ist immer dann der Fall, wenn es allzu sehr „menschelt“. So kommt es etwa an einem Gymnasium wiederholt zu Beschwerden von Eltern– und Schülerschaft über einen Lehrer. Hart und unbarmherzig werden von dieser Lehrkraft auch kleinste Fehler und Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler in einer persönlich nur schwer akzeptablen Weise bloßgestellt und sanktioniert. Im Unterrichtsgeschehen ist bei dieser Lehrkraft klar definiert, wer das Sagen hat. Dieser lehrerzentrierte Unterricht lässt keine Meinungsvielfalt oder gar Pluralismus zu. Jeder kennt seinen Platz, jeder weiß, wie weit er sich in diesem engen Meinungskorsett bewegen kann. Dabei lässt sich eine Gerechtigkeitslücke ausmachen: Was bei einigen hingenommen wird, gilt bei anderen als unverzeihliches und zu sanktionierendes Fehlverhalten. Bei alledem ist eine gewisse, wenn auch problematische Verlässlichkeit im System erkennbar. Insgesamt sind die Regeln eng gezogen und in ihrer stringenten Einhaltung vermitteln sie einigen auch Halt und eine Portion Sicherheit. Alle wissen, was geht und wo man sich mitunter auch wider besseres Wissen zurückhält. In diesem Umfeld können sich Schülerinnen und Schüler allerdings kein „Schwächeln“ leisten. Schwächen werden gnadenlos aufgedeckt und insbesondere die etwas Sensibleren sind häufig die Betroffenen. Leichtgewichte und sensiblere Naturen haben in diesem Umfeld einen schweren Stand, der bei vielen Betroffenen zudem an ihrem Selbstverständnis nagt. Es herrscht ein Klima, das Mobbingattacken fördert. Der schroffe Ton engt den Raum für Diskussionen ein. Die Meinungen im Klassenverbund über dieses straffe, dominante und lehrerzentrierte Verhalten sind geteilt: Einige kommen mit diesem Unterrichtsstil insgesamt klar, andere drohen hoffnungslos unterzugehen und wiederum andere haben sich mit einem inneren Grollen den Gegebenheiten angepasst. Das Feedback der Elternschaft zu diesem Unterrichtstil fällt ähnlich differenziert aus. Das erschwert eine kritische Auseinandersetzung auf der Ebene der Klassenpflegschaft. In den Diskussionen an den Elternabenden wird das Problem weichgekocht und meist gibt es dann einen „lachenden Dritten“. Doch bei den meisten bleibt ein Unbehagen.
Verschärft werden die Probleme, da diese Lehrkraft nicht allein und abgegrenzt agiert, sondern in einem recht breit aufgestellten Team von Kolleginnen und Kollegen mit konträren Einstellungen und sich voneinander abhebenden Persönlichkeitsstrukturen tätig ist. So folgt eine junge Lehrkraft dieser Mittelstufen- Klasse einem entgegengesetzten pädagogischen Imperativ aus einem Gemisch mangelnder Erfahrung und wohl auch persönlicher Unsicherheit. Diese Lehrkraft setzt auf Wertschätzung, eigenverantwortliche Selbstverwirklichung und gegenseitigem Respekt. Doch vieles davon ist zwar theoretisch fundiert, aber noch nicht verhaltenswirksam internalisiert. Die fehlende Authentizität erschwert es der jungen Kraft, sich Gehör und Aufmerksamkeit im Klassenraum zu verschaffen. Die Schülerinnen und Schüler in diesem Klassenverbund erleben daher täglich einen Wechsel an extremen Gefühlen, wohl auch gepaart mit nachhaltigen Erfahrungen über schwierige Wechselbeziehungen. Da sich offensichtlich die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die Unterrichtsstunden des Kollegen ein Ventil suchen, um den in dieser Unterrichtssequenz aufgestauten Frust weitergeben zu können, hat es diese Kollegin schwer, ihren Unterrichtsstil zu finden, besonders dann, wenn sie im Wechsel des Stundenplans diesem Kollegen folgt. Zu allem Überdruss bringt ihre Zögerlichkeit und Unsicherheit ihr die handfeste Häme des Kollegen ein. Er sieht sich unangreifbar, überlegen und vor allem in seinem Unterrichtsstil bestätig. Mit großer Geste ermuntert er lautstark und unüberhörbar im Lehrerzimmer die Kollegin, doch einmal stärker „durchzuregieren“. Er lässt offen, was auch immer er damit meint. Dass er Teil ihrer Probleme sein könnte, kommt ihn dabei nicht in den Sinn, zumal einige Kolleginnen und Kollegen in der humorvollen Bissigkeit einen gewissen Unterhaltenswert ausmachen können.
Diese Gemengelage ist auch der Schulleitung sowie der Jahrgangsstufenleitung nicht verborgen geblieben. Nett und kollegial ermahnt die Schulleitung den Kollegen immer wieder, mehr Sensibilität für die zwischenmenschlichen Töne im Klassenraum, aber auch im Kollegium zu entwickeln. Das sind dann meist nette und als unverfänglich erlebte „Tür- Angel- Gespräche“, denen es daher auch an korrigierenden Tiefgang mangelt. In ihrer Not und Verunsicherung sucht die Kollegin häufig das Gespräch mit der Schulleitung. Doch die Unverbindlichkeit und flachen stereotypen Ratschläge, die sie in diesen Gesprächen zu hören bekommt, helfen ihr nicht weiter und verstärken bei ihr das Gefühl, alleingelassen mit diesen als ungerecht und als ausgrenzend empfundenen Herausforderungen fertig werden zu müssen.
Verschärft werden diese gruppendynamischen Herausforderungen durch einen Kollegen, der mit viel Geschick und großen Worten häufig vermeintlich krankheitsbedingt ausfällt, und das häufig nach Wochenenden, in den Sommermonaten mal kürzer, mal längerfristig. Das erhöht den Stress der Kolleginnen und Kollegen, die häufig als „Feuerwehr“ einspringen müssen. Sein ansonsten vitales Auftreten und die Bandbreite seiner Hobbies passt eigentlich nicht so recht zu seinen Krankheitsgeschichten. Zumindest aber begünstig sein Auftreten Zweifel an seinen Krankmeldungen. Bei alledem ist der Kollege beliebt und kompetent. Vor allem aber tritt er bestimmt und überzeugend auf und lässt die vorsichtig geäußerten Anspielungen auf seine Absentismus Quote locker an sich abperlen.
4. Die Schulleitung in einem komplexen Führungsfeld
Die aufgezeigten personellen Auffälligkeiten sind ein kleiner Ausschnitt im Führungsfeld einer Schulleitung. Bei einer Leitungs- bzw. Führungsspanne von 50 und deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen ist ein formales jährliches Mitarbeitergespräch schon wegen der beschränkten zeitlichen Ressourcen einer Schulleitung kaum vorstellbar. Auch ohne ein formalisiertes Jahresgespräch bleibt der Schulleitung nur wenig Zeit, um auf die individuellen Belange, sozialen Bezüge sowie auf die Stärken und Verbesserungspotentiale der zugeordneten Teams einzugeben. Vordringlich gilt für die Schulleitung: Der Laden muss laufen, möglichst störungsfrei und unauffällig. Daher werden im schulischen Alltag personelle Auffälligkeiten, wie sie hier beispielhaft aufgezeigt wurden, unmittelbar ohne große Vorbereitung und spontan mit eingeschränktem Zeitbudget, wenn nicht geklärt, so doch zumindest mit warmen Worten, mitunter aber auch mit einer klaren, dabei allerdings meist mit einer verkürzten emotional aufgeladenen Ansage angegangen. In diesem Arbeitsfeld sind zwar individuelle Regelverstöße und von der gewollten Norm abweichendes Verhalten ärgerliche Aufreger, doch diese Ärgernisse werden durch zahlreiche weitere wichtige und dringliche fachliche und organisatorische Aufgaben überlagert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen, das sind meist weit mehr als 80 Prozent des Kollegiums, unauffällig und selbstverantwortlich mit einem hohen Engagement ihre Aufgaben wahrnehmen. Aber selbst in der Gruppe der meist unauffälligen Kolleginnen und Kollegen gäbe es Anlass zur Sorge. Das wäre beispielsweise vor allem auch bei den hoch- bis übermotivierten und damit besonders engagierten Kolleginnen und Kollegen angezeigt. Sie fallen im Frühwarnsystem meist nicht als problematisch, wohl eher als leuchtende Beispiele aus der Sicht der Schulleitung auf. Demgegenüber fällt die Bewertung der etwas bequemeren Kolleginnen und Kollegen mit diesem Leuchtturm deutlich kritischer aus. Dann wird Fleiß und Engagement mit der Etikettierung „Streber“ herabgesetzt. Optimisten können dieser miesen Herabsetzung aber auch etwas Gutes abgewinnen. Man kann diesen Seitenhieb als Adressat dieser miesen Etikettierung auch zum Innehalten nutzen. Denn übersehen wird häufig, dass eine über die eigene Belastungsgrenze hinausgehende „Übermotivierung“ fatale Folgen haben kann. Gerade besonders engagierte Personen riskieren nämlich auf Dauer ihre Gesundheit. Häufig lässt sich zudem auch im Zeitablauf beobachten, dass dieser kräftezehrende Idealismus, mitunter gepaart mit wenig Sinn für die Realitäten, in eine innere Kündigung abzudriften droht. Was die Schulleitung übersehen könnte, wird dann über die Gruppendynamik, wenn auch anders als gedacht, zu einem persönlichen Thema mit korrigierendem Potenzial. Auf diese Gruppendynamik sollte man sicherlich nicht setzen. Die Schulleitung ist verantwortlich und trotz dieses erfreulichen Leistungsbildes gefordert, beizeiten bei den Übermotivierten aktiv und nachhaltig als Coach einzugreifen. Es ist ein Akt der Verantwortung und Fürsorge, auf einen gesunden Ausgleich zwischen Privatleben und Job hinzuwirken und gemeinsam auf Work-Life-Balance einzuwirken. Auch wenn es zunächst gegen die eigenen Interessen und Bequemlichkeiten spricht. Denn wenn das Kind durch mangelnde Fürsorge erst einmal in den Brunnen gefallen ist, ist es meist zu spät für einen fruchtbaren und nachhaltig wirksamen Dialog. Langfristig rechnen sich also auch dieser Einsatz für das System „Schule“.
All das spricht in diesem Fall wie auch bei den anderen Beispielen für ein formales Mitarbeitergespräch in regelmäßigen Abständen.
4.1 Die knorrige Eiche
Eine formales Mitarbeitergespräch der Schulleitung mit der „knorrigen Eiche“ erzwingt im Vorfeld des Gespräches eine sorgfältige Besinnung und Einstimmung auf den Gesprächspartner. Es hebt sich in seiner beabsichtigten Wirkung deutlich von der Alternative eines Tür-Angel- Gesprächs oder eines anlassbezogenen Motivations- und/ oder Kritik- Gesprächs ab. Denn die Konzeption und der Zielkorridor dieses Führungsgesprächs lenkt die selektive Wahrnehmung nicht nur auf aktuelle und punktuelle Aufreger, sondern hier konzentrieren sich zwei Gesprächspartner in einer möglichst angenehmen und von Vorwürfen freien Gesprächsatmosphäre auf die Suche nach Beweggründen auffälliger Verhaltensweisen und erzwingt so auch eine Reflektion über die Wirkung des eigenen Verhaltens auf andere. Gelingt diese Reflektion, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer erwünschten Verhaltenskorrektur. Solche Gespräche sind mehrdimensional angelegt und erfassen viele Ebenen der Person, bauen auf Gegenseitigkeit, entwickeln sich in einem von hierarchischem Gehabe freien Raum und brauchen daher einen langen Atem. Beide Gesprächspartner wissen, dass dieses Gespräch nicht in wenigen Minuten ein Ende finden kann. Auch findet dieses Gesprächsformat formal auf Augenhöhe statt. Voraussetzung und Erwartung sind leicht einzufordern, schwer in der Umsetzung und der erwartete Nutzen ist nicht immer auf Anhieb auszumachen. Doch der eigentliche Sinn und die Vorteile erschließen sich, wenn man nicht nur die konkreten Ergebnisse zusammenfasst, sondern auch die subtileren und nachhaltigen Änderungen im Auge hat. Nehmen wir den oben beschriebenen Kollegen, die knorrige Eiche.
Wie sich dieser Kollege aktuell gibt, hat häufig einen langen, mitunter dramatischen Vorlauf. Es ist mitunter das Ergebnis von tragischen Erlebnissen, vielleicht auch unverarbeiteter Verletzungen, gepaart mit dem Willen sich durchsetzen zu müssen, um Respekt und Anerkennung zu finden. In jedem Fall gilt: Wem sich als Gesprächspartner das „Warum“ des Verhaltens erschließt und die Zusammenhänge zuordnen kann, der wird bei dem Gesprächspartner*in besser auf Verhaltenskorrekturen einwirken können. Breits das Interesse an dem anderen schafft eine Atmosphäre der Offenheit, des Verständnisses und der Wertschätzung, Damit werden Widerstände abgebaut und das Gefühl gestärkt, wichtig zu sein und akzeptiert zu werden.
Diese Zusammenhänge wurden der Schulleitung klar, als der Kollege kurz vor der Pensionierung sich deutlich offener und kooperativer als in den vielen Gesprächen der Vergangenheit zeigte. Das Besondere an diesem Gesprächstermin war: Keiner der beiden Gesprächspartner, deren gemeinsame Wege sich bald pensionsbedingt trennen würden, erwartet etwas von dem anderem. Beide trafen sich nun frei von ihren Rollen und ihren Rollenerwartungen und ließen die Last der Vorurteile beiseite. Das schaffte Raum und Energie, um auf Entdeckertour zu gehen und eine andere unbekannte Seite des Gesprächspartners zu erleben. Dagegen hatte es in den vielen Jahren der Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und der „knorrigen Eiche“ viele verbale „Ringkämpfte“ gegeben. Auch wurde häufig mit harten Bandagen gefochten, gespickt mit gegenseitigen Vorwürfen und mitunter eskalierte das Gespräch trotz zunächst bester Absichten in eine hoch emotionale Sprachlosigkeit.