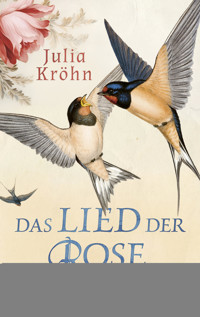2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hundert Jahre, drei Frauen und ein Traum - ein Traum von Samt und Seide, von Freiheit und Liebe.
Die goldenen Zwanziger, spektakuläre Modekollektionen und … Coco Chanel. Fanny hat genug von der altbackenen Mode im familieneigenen Imperium und will in Paris als Modeschöpferin durchstarten. Am Ende hat sie nur als Mannequin Erfolg, und auch dieser glitzernde Traum zerplatzt. 1946 kämpft Tochter Lisbeth im zerbombten Frankfurt ums nackte Überleben – und um das Modehaus ihrer Vorfahren. Erfindungsreich führt sie es in eine neue Zeit, zahlt dafür jedoch einen hohen Preis. 1971 ist Rieke die Liebe wichtiger als das Geschäft. Doch dann steht das Familienunternehmen vor dem Bankrott – und sie vor einer folgenschweren Entscheidung ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Die Goldenen Zwanziger, spektakuläre Modekollektionen und … Coco Chanel. Fanny hat genug von der altbackenen Mode im familieneigenen Imperium und will in Paris als Modeschöpferin durchstarten. Am Ende hat sie nur als Mannequin Erfolg, und auch dieser glitzernde Traum zerplatzt. 1946 kämpft Tochter Lisbeth im zerbombten Frankfurt ums nackte Überleben – und um das Modehaus ihrer Vorfahren. Erfindungsreich führt sie es in eine neue Zeit, zahlt dafür jedoch einen hohen Preis. 1971 ist Rieke die Liebe wichtiger als das Geschäft. Doch dann steht das Familienunternehmen vor dem Bankrott – und sie vor einer folgenschweren Entscheidung …
Autorin
Die große Leidenschaft von Julia Kröhn ist nicht nur das Erzählen von Geschichten, sondern auch die Beschäftigung mit der Geschichte: Die studierte Historikerin veröffentlichte – zum Teil auch unter Pseudonym – bislang über dreißig größtenteils historische Romane. Mit »Das Modehaus« wagt sie den Sprung vom Mittelalter ins 20. Jahrhundert – und hat dabei einen Heimvorteil: Seit 2001 lebt die gebürtige Österreicherin in Frankfurt am Main, dem Schauplatz des Romans.
Weitere Informationen unter: www.juliakroehn.at
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Julia Kröhn
DASMODEHAUS
Töchter der Freiheit
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Julia Kröhn
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
© 2019 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Covergestaltung und -motiv: Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com und Richard Jenkins Photography
KW · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-21963-5 V002
www.blanvalet.de
September 2000
Liebe Judy,
ich weiß nicht, ob es einen Begriff für das gibt, was wir füreinander sind. Freundinnen, Schwägerinnen oder Cousinen trifft es schon mal nicht. Vielleicht Schicksalsgenossinnen, aber das klingt pathetisch und zugleich so, als hätte das Schicksal uns besonders herausgefordert. In Wahrheit hat dieses Schicksal vor allem unsere Eltern geprüft, und deren Leben hat einen Schatten auf uns geworfen. Bis heute weiß ich nicht, wie dunkel dieser Schatten ist – ich bin mir nur sicher, dass auch in ihm etwas blühen kann.
Wie auch immer. Sie haben mich gebeten, Ihnen mehr von der großen Liebe meiner Mutter zu erzählen. Das will ich tun, aber wenn ich von ihrer Liebe berichten soll, muss ich von ihrem Leben sprechen, und wenn es um das Leben meiner Mutter geht, kann ich das meiner Großmutter ebenso wenig aussparen wie mein eigenes. Lassen Sie uns das Schicksal nicht mit einem Schatten werfenden Ungeheuer vergleichen, sondern lieber mit einem Kleid, dessen Fäden schon lange vor der Geburt meiner Mutter gesponnen wurden. Wobei man bei einem Kleid nie sicher sein kann, welche Naht als Erste angefertigt wurde, während es mir leichtfällt, den Augenblick zu bestimmen, in dem die Geschichte meiner Großmutter begann.
Meine Großmutter hieß Fanny, und als das Jahr 1900 anbrach, war sie bereits sechs Jahre alt. Dennoch behauptete sie später, dass der Anbruch des neuen Jahrhunderts in gewisser Weise ihre zweite Geburtsstunde gewesen sei. »Um ein Haar hätte mich das neue Jahrhundert nämlich getötet«, sagte sie oft.
Ich fand das merkwürdig. Ein Jahrhundert – ob nun ein neues und unschuldig reines oder eines, das aufgrund vieler Kriege frühzeitig ergraut ist – hat schließlich keine Hände, um jemanden zu erdrosseln, ihm ein Messer in die Brust zu rammen oder Gift einzuflößen. Doch wenn ich widersprach, zuckte Fanny nur mit den Schultern und blieb bei ihrer Wortwahl.
Jedenfalls war es am Silvesterabend 1899 das erste Mal, dass Fanny bis Mitternacht aufbleiben und bei den Frauen ihrer Familie sitzen durfte, die in Erwartung des Jahreswechsels immer das Gleiche taten: trinken und nähen. Das heißt, Fannys Großmutter Elise trank nur, sie nähte nicht. Sie behauptete, nicht mehr gut genug sehen zu können, um gleichmäßige Stiche zu machen. Allerdings war sie nicht zu blind, um aus Früchten und Kräutern Schnaps zu brennen. Zwölf Zutaten bedurfte es für ihr Spezialgebräu, Tausendgüldenkraut und Kirsche, Schafgarbe und ungeschwefelte Backpflaumen, Johanniskraut und Johannisbeeren – an die restlichen sechs konnte sich nach Elises Tod niemand mehr erinnern. Der Schnaps konnte auf jeden Fall Tote nicht nur wecken, er bewirkte, dass diese vor Schreck, wieder am Leben zu sein, sogar schluchzten und heulten. Von Toten wusste Fanny damals noch nichts, aber als sie sich einmal über ihr Glas beugte, schienen allein vom Geruch ihre Nasenhärchen zu versengen.
Fannys Mutter Hilde wiederum nähte eifrig – meist an einem Unterrock, denn sie trug stets mindesten sechs Unterröcke übereinander – , trank seit dem Tod von Fannys Vater jedoch keinen Schluck mehr. Hilde sagte, er sei ein guter Mann gewesen, Elise hingegen nannte ihn die »dumme Saufkrenke«, wobei sie durchaus Verständnis dafür zeigte, dass er manches Mal einen über den Durst getrunken hatte, dagegen nicht, dass er einmal im Vollrausch einen Becher Kali, eigentlich zum Färben von Kautschukmasse bestimmt, zu sich genommen hatte und ihm davon Kehle und Gesicht verätzt worden waren. »Was war es schwierig, ihn für die Beerdigung anständig herzurichten«, murmelte Hilde mehr als einmal. Es war das einzige Zugeständnis an seinen unrühmlichen Tod, ansonsten erwähnte sie die genauen Hintergründe nie.
Die Dritte im Bunde war Fannys Tante Alma, die in besagter Silvesternacht, statt zu nähen und zu trinken, ihrem neuesten Lieblingszeitvertreib nachging – der sogenannten Brandmalerei. Wie diese genau funktioniert, kann ich Ihnen, liebe Judy, nicht sagen. Jedenfalls war dafür ein Apparat mit Spiritusflamme, Gebläse und Gummischlauch erforderlich, mit dem man einen Stift bis zur Rotglut erhitzte. Mit diesem Stift wiederum wurden Arabesken, Landschaften und Figuren in Truhen, Schränke und Lederstühle eingebrannt – oder, wie an jenem Abend, das Wappen des Frauenvereins in den Deckel einer Holzkiste. Das Wappen bestand aus einem Kreuz, einem Lorbeerkranz und den Dornen einer Rose, doch nachdem Elise einen großen Schluck aus ihrem Schnapsglas genommen hatte, bemerkte sie trocken: »Deine Rose sieht wie ein Gänseblümchen aus. Und wenn Christus an diesem Kreuz gehangen hätte, wäre es zusammengekracht, ehe er seinen Geist hätte aushauchen können. Man stelle sich vor, wie der Holzbalken Maria Magdalena und die Gottesmutter erschlagen hätte.«
Hilde sog empört Luft ein, woraufhin sie prompt husten musste. Elise wiederum lachte, und dann hustete sie ebenfalls, sodass Hilde ihr auf den Rücken schlug.
»Lass mich nur husten, vielleicht habe ich Glück und ersticke.«
»Red keinen Unsinn!«
»Oder hau ein wenig fester zu, dann bersten womöglich meine Knochen.«
»Man muss für das Leben dankbar sein, ganz gleich, wie alt man ist«, sagte Hilde in demselben Tonfall, in dem sie Fanny immer befahl, ihren Grünkohl aufzuessen. »Bis zur Neige gilt es, den Krug zu leeren. So hat Gott es gewollt.«
»Na, einen Krug leeren, das kann ich«, erklärte Elise, hob ihr Glas und kippte dessen Inhalt in sich hinein.
Jetzt kam kein Husten mehr aus ihrem Mund, nur mehr ein Lallen. Hilde vermied es, noch einmal tief Luft zu holen, sondern rümpfte die Nase, woraufhin nun Alma schallend lachte.
»Ich verstehe nicht, warum ihr an einem Tag wie heute lachen könnt.« Hilde machte schnelle, zornige Stiche, mehrmals stieß die Nadel gegen ihren Fingerhut.
»Ein neues Jahrhundert beginnt«, rief Alma, »da kann man doch frohgemut sein.«
Hilde hielt kurz inne. »Hast du etwa vergessen, dass wir erst kürzlich unsere gute Cousine verloren haben?«
Fanny zuckte zusammen. Sie war vor dem Gestank der Spiritusflamme unter den Tisch geflohen und spielte dort mit dem Inhalt des Nähkastens ihrer Mutter. Die Fingerhüte benutzte sie als kleine Tassen für ihre Puppe, das Nadelkissen als Polster und das Nähgarn als Kette. Die Puppe war eigentlich nach der Kaiserin Auguste Victoria benannt worden, wurde aber von Elise als Schreckgespenst bezeichnet, seitdem sie eines ihrer Glasaugen verloren hatte. Aus unerfindlichem Grund war das merkwürdige Leinengebilde, das Hilde nachts um den Kopf trug, damit sie kein Doppelkinn bekam, ebenfalls in den Nähkasten geraten, und weil es zu groß für eine Augenbinde war, die aus dem Schreckgespenst eine Piratin gemacht hätte, beschloss Fanny, es als Puppenhängematte zu benutzen.
Jetzt war ihr Spiel jäh gestört worden, denn die tragische Geschichte ihrer Großcousine Martha machte ihr Angst und steckte außerdem voller Worte, die Fanny nicht verstand – zum Beispiel »Bordell« und »Verführer«. Zumindest bezeichnete Hilde den Mann, der Martha auf dem Gewissen hatte, stets als solchen. Alma sah das etwas anders. Sie und Hilde erzählten die Geschichte von Martha grundsätzlich in zwei Varianten, auch an jenem Abend.
»Sie war eine junge, abenteuerlustige Frau«, behauptete Alma.
»Sie war nicht mit dem ihr von Gott zugewiesenen Platz im Leben zufrieden«, tadelte Hilde.
»Sie hat von einem neuen Leben in Amerika geträumt«, konterte Alma.
»Wie kann man nur so dumm sein, in einem Land ohne Kaiser leben zu wollen«, schimpfte Hilde.
»Sie hat sich in einen Mann verliebt, der sie überredete, mit ihm auszuwandern«, fuhr Alma fort.
»Unsinn!«, rief Hilde. »Sie ist einem Mann auf den Leim gegangen, der aus ihren Träumen ihr Totentuch webte.«
Alma ließ den Spiritusbrenner sinken. »Seit wann bist du so poetisch?«
»Die Poesie ist nicht schuld daran, dass er sie nach Genua lockte und dort nicht auf ein Schiff brachte, nein, in eine finstere Hafenspelunke, die sich als Bordell herausstellte. Um dem schrecklichem Schicksal zu entgehen, das ihr drohte, ist sie aus dem Fenster gesprungen und hat sich beide Beine gebrochen.«
»Und daran ist sie gestorben?«, fragte Elise. Sie kannte die Geschichte zwar, hatte die Details aber wohl wieder vergessen.
Fanny lauschte zunächst wie erstarrt, dann kroch sie unter demTisch hervor und huschte zur Tür. Das Gerede von Amerika setzte ihr zwar nicht zu, umso mehr dagegen das von finsteren Spelunken. Als sie zum ersten Mal von den gebrochenen Beinen gehört hatte, hatte sie zwei Nächte lang schlecht geträumt. Und keinesfalls wollte sie ein weiteres Mal das Ende von Marthas Geschichte hören, die mit den gebrochenen Beinen in ein Krankenhaus eingeliefert worden und dort an Typhus gestorben war. Fanny wusste zwar nicht, ob man bei Typhus erst ein blaues und danach ein schwarzes Gesicht bekam, wie eine Freundin behauptet hatte, ob einem die Hände und Beine abstarben, was ein Dienstmädchen glaubte, oder ob man sich die Seele aus dem Leibe schiss, wie Großmutter Elise sich ausdrückte – eine schlimme Krankheit war es auf jeden Fall. Sie wollte weder sich selbst noch dem Schreckgespenst Einzelheiten zumuten.
Erst als sie schon aus dem Raum gehuscht war, fiel ihr ein, dass sie die Kinnbinde ihrer Mutter – oder vielmehr die Hängematte für die Puppe – unter dem Tisch vergessen hatte, und beschloss, das Schreckgespenst in einem selbst gebauten Bett schlafen zu lassen. Als Matratze wollte sie die Kokosfasern verwenden, mit denen die Schneiderpuppen im Geschäft ihrer Mutter Hilde ausgestopft waren. Eine dieser Schneiderpuppen befand sich gerade in deren Schlafzimmer, weil sie an der Seite aufgerissen war und ihre Mutter noch keine Zeit gefunden hatte, sie zu reparieren.
Fanny presste das Schreckgespenst an sich, betrat den unbeheizten Raum und blickte sich fröstelnd um. Da war das breite Himmelbett – auf jener Betthälfte, wo früher ihr Vater geschlafen hatte, lag jetzt ein Rosenkranz – , und da war eine Kommode, auf der ein Waschbecken aus Emaille und ein Zinnkrug standen. Erst am Morgen hatte sich Hilde wie immer am letzten Tag des Jahres darin ihre Haare gewaschen, indem sie diese mit zehn Eidottern und einem halben Glas Cognac eingeschäumt und danach ausgespült hatte.
Die Schneiderpuppe entdeckte Fanny jedenfalls nirgendwo. Sie wollte den Raum schon verlassen, als etwas anderes ihre Aufmerksamkeit auf sich zog: die Truhe aus dunklem, schwerem Eichenholz, deren mit Schnitzereien versehener Deckel überraschenderweise weit offen stand. Mutters heilige Stofftruhe. In der sich vielleicht etwas befand, aus dem sie dem Schreckgespenst zwar kein Bett bauen, aber ein Kleid nähen konnte.
Fanny trat näher, beugte sich über die Truhe und sah, dass sie leer war. Oder nicht ganz leer, auf dem Boden lag ein roter Seidenschal. Zumindest hätte sie schwören können, dass er rot war, obwohl das schummrige Licht vom Gang alles in Grautöne tauchte. Doch selbst wenn der Schal nicht rot gewesen wäre, weich war er auf jeden Fall und außerdem so breit, dass es für ein Ballkleid für das Schreckgespenst reichen würde.
Fanny beugte sich noch tiefer über die Truhe. Nicht dass sie sicher war, ob sie den Schal überhaupt nehmen und ein Puppenkleid daraus machen durfte. Allerdings bestärkte Elise sie gern darin, so gierig in den Apfel zu beißen, dass die Zähne gleich bis zum Kerngehäuse vordrangen. »Wenn du alles willst und das sofort, wirst du am Ende auch alles bekommen«, sagte sie stets.
Mit der einen Hand hielt sie die Puppe, die andere streckte sie nach dem Schal aus. Doch sie ertastete ihn nicht, denn sie war viel zu klein und die Truhe viel zu groß. Sie legte das Schreckgespenst aufs Bett – sicherheitshalber weit genug vom Rosenkranz entfernt – und beugte sich wieder vor, um den Schal mit nunmehr beiden Händen ergreifen zu können. Wieder kein Erfolg. Fanny atmete tief durch, stellte sich auf die Zehenspitzen, probierte es ein weiteres Mal – und dann ging alles ganz schnell: Kopfüber stürzte sie in die Truhe, konnte den Kopf zwar gerade noch zur Seite drehen, sodass sie nur mit der Schulter aufprallte, vernahm aber ein lautes Rums, als der Deckel zufiel. Und sogleich waren da keine Grautöne mehr zu sehen, nur ein Schwarz.
Kein gewöhnliches Schwarz, das von Sternen oder Gaslichtern durchlöchert wurde, ein tiefes, unendliches, erstickendes Schwarz. Ein Schwarz, in dem es kein Oben oder Unten mehr gab, keinen Anfang und kein Ende. Ein Schwarz, das sie ebenso verschluckte wie all ihre Wünsche und Sehnsüchte. Nur die Angst ließ es zurück, und diese Angst wuchs zur Panik. Fanny schrie, das Schwarz blieb. Sie tastete nach dem Truhendeckel, um ihn aufzustoßen, doch der war zu schwer. Sie legte sich auf den Rücken, trat mit beiden Füßen dagegen – auch so gelang es ihr nicht.
Sie holte wieder Luft, begann zu schreien, so laut dieses Mal, dass man sie im Wohnzimmer gewiss gehört hätte – vorausgesetzt, dass in diesem Augenblick nicht die Glocken von sämtlichen Kirchen Frankfurts begonnen hätten, das neue Jahrhundert einzuläuten.
»Hilfe! So helft mir doch!«, schrie sie, bekam aber keine Antwort.
Schon nach dem sechsten Glockenschlag schien die Luft knapp zu werden, beim achten wurde ihr schwindlig, beim zehnten sah sie Sternchen. Keine leuchtenden und hellen, nein, nur trostlose Löcher, die sich im Nichts ausbreiteten. Mit dem zwölften Schlag war Mitternacht erreicht, doch die Glocken verstummten nicht, sie begrüßten lautstark das neue Jahrhundert, während Fanny von ihrem Leben ganz leise Abschied nahm.
Das ist gar keine Stofftruhe, es ist ein Sarg, ging ihr durch den Kopf. Das Pochen ihres Herzens schmerzte, das Atmen schmerzte. Was, wenn die Luft nicht mehr reichte, wenn sie erstickte, ihr Kopf erst blau und sodann schwarz werden würde? Es war ja alles schwarz, selbst der Schal!
Der Schal!
Sie ließ die Hände sinken, ertastete den Stoff unter sich, so wunderbar weich und glatt. Eigentlich wollte sie gar kein Ballkleid für das Schreckgespenst daraus machen – Fanny wollte sich den Schal selbst um die Schultern legen und damit tanzen und Äpfel mitsamt ihren Kernen essen.
Der Gedanke daran gab ihr die unverhoffte Kraft, wieder mit beiden Füßen gegen den Deckel zu drücken, und dieses Mal gab er um ein Spaltbreit nach. Hastig steckte sie die Hand, die den roten Seidenschal fest umklammert hielt, hinein, presste das Gesicht an den Spalt, schrie wieder in der Hoffnung, gehört zu werden, steckte die zweite Hand in den Spalt und presste nun mit all der ihr verbliebenen Kraft den Kopf gegen den Deckel, und endlich gab er nach. Fanny glitt mit dem Oberkörper aus der Truhe, atmete begierig die kalte, frische Luft ein. Das einäugige Schreckgespenst starrte sie vom Bett aus an.
Als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte, war ihr Gesicht bleich und mit roten Flecken übersät, aber die Frauen bemerkten es nicht. Sie bemerkten auch nicht, dass sie sich einen roten Schal um die Schultern geschlungen hatte. Nachdem das Neujahrsgeläut verklungen war, stritten sie schon wieder oder immer noch über Martha.
»Das eigene Leben ist ein zu hoher Preis für die Ehre«, sagte Alma eben nüchtern.
»Unsere Cousine sehnte sich nun mal nach der Liebe und war bitter enttäuscht, dass sie betrogen wurde«, erklärte Hilde und verdrückte ein Tränchen. Ob über die Cousine oder im Gedenken an die dumme Saufkrenke, das wusste Fanny nicht. Fasziniert beobachtete sie, wie ihre Mutter sich das Tränchen mit dem Fingerhut von der Wange wischte.
»Von wegen«, sagte Alma. »Martha sehnte sich nach Freiheit.«
»Nun ja«, mischte sich Großmutter Elise ein und schenkte sich nach, »eins von beiden kann man haben, ohne dass man sich Magen und Seele verrenkt. Doch sowohl Liebe als auch Freiheit zu erlangen – das ist eine unmögliche Kunst.«
Fanny verkroch sich erneut unter dem Tisch und hustete leise. Mit dem Wort Liebe konnte sie wenig anfangen, Freiheit zu erlangen fühlte sich dagegen wohl genauso an, wie einer finsteren Truhe entkommen zu sein.
»Schenk mir was ein«, forderte Alma ihre Mutter auf, und nachdem sie einen Schluck Schnaps genommen hatte, erklärte sie: »Selbst wenn die Sehnsucht nach Liebe und Freiheit einen ins Unglück stürzt, sollte man dabei wenigstens ein schönes Kleid tragen.«
Oder einen schönen Schal, fügte Fanny in Gedanken hinzu.
So also, liebe Judy, beginnt die Geschichte, die Fannys Geschichte ist, und weil sie sich so entscheidend auf uns auswirkte, auch die meiner Mutter und meine.
Ich denke, für Fanny war die Freiheit stets wichtiger als die Liebe. Meine Mutter wiederum hat nicht immer die Freiheit gehabt, ihre Liebe zu leben. Und ich versuchte mich in jener unmöglichen Kunst, beides zu erlangen. Nur in einer Hinsicht glichen wir drei Frauen uns: Ob wir bekamen, was wir wollten, oder etwa verloren, was wir uns gar nicht gewünscht hatten, ob unser Herz gebrochen oder wieder heil wurde, oder ob wir uns den Kopf an sichtbaren oder unsichtbaren Truhendeckeln anstießen – wir wollten dabei immer gut gekleidet sein …
FANNY
1914
Am 28. Juni 1914 wurde Franz Ferdinand, der Kronprinz von Österreich-Ungarn, erschossen, und der Dackel vom deutschen Reichskanzler Theobald Theodor von Bethmann Hollweg litt an Blähungen.
Nun gut, die Blähungen des Dackels hatte Fanny später erfunden, sie wusste nicht einmal, ob Theobald Theodor von Bethmann Hollweg überhaupt einen Dackel hatte. Allerdings fand sie, dass man schreckliche Ereignisse der Weltgeschichte mit amüsanten Anekdoten würzen müsste, so wie sie die Strenge des kleinen Schwarzen gern mit einer Perlenkette auflockerte. Und allein dass jemand in direkter Folge Theobald und Theodor hieß, erschien ihr wie ein Witz.
Außerdem verliebte sich Fanny, die mittlerweile zwanzig Jahre alt war, an diesem Tag und das sogar gleich zweimal – zuerst in ein blassrotes Kleid, das in ihren Augen hervorragend zu ihrem roten Schal passte, das sie jedoch niemals trug, und später in einen jungen Mann, den sie heiratete.
»Besser es wäre umgekehrt gewesen«, sagte Fanny später. »Besser ich hätte das Kleid getragen, bis es mir in Fetzen vom Leib hing, mir jedoch nie einen Ehering an den Finger stecken lassen.«
Das Kleid hatte sie in jener Werkstatt genäht, die zum Miedersalon ihrer Mutter gehörte, in dem nicht nur Mieder, sondern auch Korsetts angefertigt wurden. Die Kalilösung, mit der sich die Saufkrenke vergiftet hatte, sollte jenen Kautschuk blau färben, der ein Bestandteil von diesen war. Es gab sehr viele Arten von Korsetts – für Sängerinnen und übergewichtige Damen, für Frauen mit Rückenleiden und solchen mit Verdauungsproblemen und natürlich für Schwangere – wobei Hilde über Schwangerschaften ebenso wenig sprach wie über die Todesursache ihres guten Mannes.
Eines hatten die Korsetts jedenfalls gemein: Sie schnürten den Leib ab und machten das Atmen schwer, was Fanny allerdings erst als junge Frau herausfand. Als Kind ließ die Berufsbezeichnung ihrer Mutter – Corsetière – sie an jenen goldenen Ballsaal denken, in dem Aschenputtel mit ihrem Prinzen tanzte. Großmutter Elise hatte ihr diese Geschichte manchmal aus dem Märchenbuch vorgelesen, und weil ihre Augen schon so schlecht und ihre Sinne häufig vom Schnaps umnebelt gewesen waren, hatte sie nicht alles richtig wiedergegeben. Am Ende opferten angeblich nicht Aschenputtels Stiefschwestern Zehen und Fersen, der Prinz tat es, weil er so dämlich gewesen war, Aschenputtel erst gar nicht und dann nur anhand des dummen Schuhs wiederzuerkennen.
Wie auch immer: Corsetière klang nach Licht, nach Duft, nach Musik, doch weder verhieß ein Korsett das alles, noch war dergleichen in Hilde Seidels Miedersalon in der Nähe der Frankfurter Hauptwache zu finden. Die Verkaufsräume befanden sich im Erdgeschoss, die Schneiderwerkstatt unter dem Dach. Richtig hell wurde es dort trotzdem nicht, weil die Fensterluken viel zu klein waren. Außerdem war es ein niedriger Raum, in dem groß gewachsene Frauen nicht aufrecht stehen, geschweige denn wie Aschenputtel und der Prinz tanzen konnten, und es duftete nicht, es roch ständig nach heißem Bügeleisen, Wasserdampf und Stärke.
Aus diesen Gründen hatte Fanny besagtes Kleid in einer Kammer hinter dem Verkaufsraum, der zur Anprobe diente, genäht, und zudem nicht aus Wahlknochen und Stahlblech und schwerem Stoff, sondern aus luftigem Leinen. Noch trug Fanny das Kleid nicht selbst, nur die Schneiderpuppe ohne Unterleib. Selbigen sollte nach Hildes Auffassung auch eine Frau aus Fleisch und Blut am besten nicht haben – und erst recht keine kreativen Gelüste.
»Was … soll … das … sein?«, herrschte sie Fanny an, als sie das Kleid entdeckte. Nun ja, richtig laut wurde sie nicht. Wenn nicht gerade Silvesternacht war, hatte sie immer Stecknadeln zwischen den Lippen. »Was … soll … das … sein?«, wiederholte sie.
»Ein Kleid.«
»Das ist kein Kleid, das ist unser Ruin. Herrgott, Kind! Seit dein guter Vater starb, habe ich es schwer genug. Aufgrund der vielen Korsettfabriken steht uns das Wasser bis zum Hals.« Fanny stellte sich vor, wie nur der Kopf ihrer Mutter mit all den Stecknadeln zwischen den Lippen aus einem dunklen Tümpel ragte, und musste lachen. »Was ist daran lustig?«, schimpfte, nein, nuschelte Hilde. »Vielleicht können wir uns noch eine Weile gegen die Konkurrenz behaupten. Aber falls solche Kleider in Mode kommen, müssen wir unser Geschäft schließen und werden des Hungertodes sterben. Dein guter Vater würde sich im Grabe umdrehen.«
Hilde musterte finster das Kleid, das keines sein durfte. Es fiel glatt am Körper herab, ohne Brust oder Taille oder Hüfte zu betonen. An den Schultern war es etwas gerafft, wodurch so schöne Falten erzeugt wurden wie bei der Toga antiker Statuen.
»Ich habe gehört, dass sich Leinen vorzüglich für Sportbekleidung eignet«, erklärte Fanny schnell.
»Sport?«
Hilde schien nicht zu wissen, was damit gemeint war. Fanny wusste es ja selbst nicht so genau. Jedenfalls hatte sie gehört, dass reiche Menschen gern Tennis spielten, und dabei ging es offenbar darum, mit einem Ding, das einer Bratpfanne glich, einen Ball so groß wie ein Hühnerei zu treffen. Sie hatte keine Ahnung, welchen Sinn das hatte, wusste jedoch, dass man gehörig dabei schwitzte.
Da es in Hildes Welt allerdings nicht vorgesehen war, dass Frauen schwitzten, ließ Fanny das lieber unerwähnt und sagte stattdessen: »Ich habe ein Kleid wie dieses in der Modewelt gesehen. Noch lieber würde ich ja französische Modezeitungen lesen, aber die sind hier in Frankfurt so schwer zu bekommen. Jedenfalls nennt man ein Kleid wie dieses Reformkleid, und damit kann man doch auch Geld verdienen.«
»Willst du behaupten, mehr als mit einem Korsett? Oh, deine arme Mutter opfert sich für dich auf, um dich vergessen zu lassen, dass dir dein armer Vater fehlt, und du lohnst es ihr so!« Fanny konnte nicht deuten, was schlimmer war – von Hilde als gut oder arm bezeichnet zu werden. Sie selbst war in ihren Augen jedenfalls weder das eine noch das andere. »Du bist immer schon aufrührerisch gewesen!«, schimpfte ihre Mutter weiter. »Wende ich dir den Rücken zu, vergeudest du Zeit und verschwendest Stoff. Wenigstens ein Nachthemd hättest du daraus nähen können oder eine neue Kinnbinde.«
Dieses Kinn zitterte, und die Lippen bebten nicht minder, als Hilde begann, das Kleid von der Schneiderpuppe zu zerren, nein, zu reißen. Wie der Anblick des zerrissenen Kleides schmerzte!
»Ich habe es angefertigt, und ich will es auch tragen!«, rief Fanny mit jenem Feuer, von dem ihre Großmutter Elise behauptete, es würde zwar so heiß brennen wie Flammen, die sich am Fichtenholz nährten, aber nicht lange genug, um so zu wärmen wie ein Feuer, das sich durch Buchenholz brannte.
Fanny hatte keine Ahnung von Holz, sie hatte indes eine genau Vorstellung davon, was Frauen stand … und was ihr selbst stehen würde – erst recht, wenn sie ihren roten Seidenschal nicht einfach um ihre Schultern schlang wie jetzt, sondern kunstvoll um den Kopf drapierte, wie sie es in einer Modezeitschrift gesehen hatte. Sie versuchte, ihrer Mutter das Kleid aus der Hand zu reißen, ehe es völlig ruiniert war, doch die hielt es so gnadenlos fest, dass es einen weiteren tiefen Riss bekam. Eine Nadel fiel ihr aus dem Mund – das Einzige, was bewies, dass ihre Kräfte nachließen.
Fanny konnte es trotzdem nicht mit ihr aufnehmen. Ob das Feuer in ihr heiß oder nur warm war, kurz oder lang brannte – die Mutter schaffte es immer, einen Kübel Wasser darüber auszuleeren.
Fanny ließ das Kleid los, drehte sich um und stürmte mit dem roten Seidenschal um ihren Schultern hinaus – unterwegs zu dem einen Ort, an dem sie wenigstens ein kleines bisschen frei sein konnte.
»Im Übrigen ist die durch Natur und Evangelium gebotene Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern die, dass der Mann für Kampf und Arbeit bestimmt ist, die Frau aber in der Pflege reiner, warmer und inniger Gefühle aufgeht. Dem Mann gebühren der Kampf und die Arbeit, das Weib wische den Schweiß von seiner Stirn.«
Als Fanny die Wohnung ihrer Tante Alma betrat, las diese die Worte gerade laut vor. Sie hatte nie Stecknadeln zwischen den Lippen, in diesem Augenblick klang es dennoch, als bohrte sich mindestens eine in ihre Zunge. Denn was Alma las, gab alles andere als ihre Meinung wieder.
Ihren Zeitvertreib, Wappen in Leder oder Holz zu brennen, hatte Alma aufgegeben, nachdem sie sich einmal den Daumen verbrannt hatte. Zwei andere Sachen hatten sich hingegen nicht verändert: Alma kämpfte entschlossen für die Rechte der Frau, sie trug dabei immer einen schönen Hut und war der Meinung, dass beides kein Widerspruch war, im Gegenteil. Schließlich war sie überzeugt, Frauen müssten immer ihre Stärken betonen, und was bei der einen ihr ausladendes Hinterteil und bei der anderen ihre Wespentaille war, war bei Alma nun mal der Kopf. Vorzugsweise setzte sie ihn mithilfe von Ungetümen aus Chiffon, Musselin-Rosen, Glasperlen und englischer Spitze in Szene.
Seit ein Frankfurter Anatomieprofessor kürzlich behauptet hatte, dass Schädel und Gehirn bei Frauen grundsätzlich kleiner als bei Männern seien, weswegen der Mann mehr Festigkeit besäße, mutig, kühn und entschlossen sei, die Frau hingegen von wechselnden Launen geplagt, geschwätzig, furchtsam und nachgiebig, trug Alma ihren Hut aus Protest sogar in ihrer Wohnung. Und als derselbe Professor überdies erklärt hatte, dass man Frauen nicht nur aufgrund ihres kleineren Gehirns, sondern wegen ihrer größeren Schamhaftigkeit nicht zum Medizinstudium zulassen dürfe – unmöglich sei ihnen eine Ausführung über die Geschlechtsorgane zuzumuten – , hatte Alma sogar ernsthaft überlegt, mit ihrem Hut eine dieser Vorlesungen zu besuchen, und zwar nur mit dem Hut. »Dem bringe ich Dinge über Geschlechtsorgane bei, von denen er selbst keine Ahnung hat!«, hatte sie kampfbereit gerufen.
Fanny wusste nicht, was Geschlechtsorgane genau waren. Dank der Ausführungen ihrer Tante Alma wusste sie immerhin, dass selbst Frauen wie ihre Mutter unterhalb der Taille Körperteile aus Fleisch und Blut und nicht aus Holz besaßen. »Frag alles, was du willst, Kind«, hatte Alma sie schon frühzeitig aufgefordert und Erklärungen auch dann gegeben, wenn Fanny überhaupt nichts wissen wollte.
An diesem Tag bemerkte Alma ihre Nichte gar nicht, was nicht nur daran lag, dass sie in ihre Lektüre vertieft war. Ein halbes Dutzend Frauen hielt sich in ihrem Salon auf und versperrte Fanny die Sicht. Sie sah von ihrer Tante nur den Hut.
»Die Forderung nach aktivem Wahlrecht steht im Widerspruch zu den tausendjährigen Einrichtungen aller Staaten und Völker«, fuhr Alma zu lesen fort, »so auch zu der Natur und Bestimmung des Weibes und den ewigen Gesetzen der göttlichen Weltordnung.«
Almas Stimme zitterte wie die Stoffrosen an ihrem Hut.
Als Fanny sich an den anderen Frauen vorbeidrängte, sah sie mehr von Alma als nur den Hut. Ihre Tante saß, nein, thronte an ihrem Schreibtisch, der sich dort befand, wo früher – als der Raum noch nicht als Salon, sondern als Esszimmer gedient hatte – eine lange Tafel gestanden hatte. Vor fünf Jahren hatte Alma verkündet, der Geist einer Frau habe hungriger zu sein als ihr Bauch, und die Tische austauschen lassen. Dies war die erste Tat gewesen, die sie nach dem Tod ihres Mannes beschlossen hatte.
Wie ihre Schwester Hilde bezeichnete sie ihren Verflossenen als guten Mann. In Almas Fall hatte das allerdings weniger mit Verklärung, vielmehr mit Dankbarkeit zu tun, weil er, der in ihrer Ehe so viel falsch gemacht hatte, zumindest eine Sache gut hinbekommen hatte – nämlich früh zu sterben. Er hatte ihr nicht nur diese Wohnung mit drei großen Räumen gegenüber der Katharinenkirche hinterlassen, sondern auch ein beträchtliches Barvermögen und sein Schreibwarengeschäft in der Hasengasse. Alma hatte alle Waren ausgeräumt und eine Druckerpresse aufgestellt, mit der sie fortan Streitschriften für den Zehnstundentag, Volksschulen und Mädchenbildung sowie den Zugang der Frauen zu Universitäten drucken ließ.
Fanny hatte mittlerweile den Schreibtisch erreicht und trat vor ihre Tante, die immer noch in ihre Lektüre vertieft war. »Tante Alma, ich brauche deine Hilfe.«
Alma hob den Kopf, sah jedoch statt Fanny die anderen Frauen an. Die einen trugen die breite blaue Leinenschürze der Arbeiterinnen, die anderen Kleider, die aus gleichem feinem Stoff gemacht waren wie die Rosen an Tante Almas Hut. So wie Alma laut forderte, dass Frauen selbst für ihr Leben aufkommen sollten, während sie selbst mit großer Selbstverständlichkeit vom Erbe ihres Manne lebte, hatte sie es auch geschafft, einen weiteren Gegensatz zu vereinen und sowohl Vertreterinnen der bürgerlichen als auch der proletarischen Frauenbewegung in ihrem Salon zu versammeln. Das allein war schon Kunst. Noch größer war die Herausforderung, dass ihre Gäste nicht zu streiten begannen. Einmal war aus einem Wortgefecht eine wüste Prügelei entstanden, bei der eine der Frauen der anderen in den Seidenhandschuh gebissen und diese ihr wiederum ein Büschel Haare ausgerissen hatte. »Auch deshalb trage ich immer meinen Hut«, hatte Alma damals lapidar gesagt und hinzugefügt, dass wo kein Streit, kein Feuer sei, und wo kein Feuer sei, niemand den Herrschaften, die Frauenhirne als zu klein erachteten, selbiges unter dem Arsch mache.
Nun fiel Almas Blick endlich auf ihre Nichte, aber bevor Fanny erneut ihr Anliegen hervorbringen konnte, kam jemand in die Wohnung gestürmt, deren Tür immer nur angelehnt war, wenn sich die Frauen trafen.
»Stellt euch vor«, rief ein junges Mädchen, »sie haben Klara Hartmann verhaftet …«
Es wurde gerade mal so lange still, dass das Mädchen fortfahren konnte. Klara Hartmann, so entnahm Fanny den aufgeregten Worten, war Anhängerin der Friedensbewegung und hatte sich als Zeichen des Protestes gegen den Militarismus im Allgemeinen und den drohenden Krieg im Besonderen an das schmiedeeiserne Tor der Polizeipräfektur gekettet.
»Und dann?«, fragte Alma.
»Man hat sie aufgefordert, sich wieder loszuschließen.«
»Und dann?«, fragten nun alle Frauen wie aus einem Mund.
»Dann hat sie offenbar den Schlüssel verschluckt, mit dem sich das Kettenschloss hätte öffnen lassen.«
»Tüchtig«, sagte Alma. »Und wie ging es weiter?«
»Man hat einen Schmied geholt, und der hat die Ketten zum Schmelzen gebracht.«
»Ich hoffe, er hat sich den Daumen so verbrannt wie ich einst mit dem Spiritusbrenner«, warf Alma spöttisch ein.
»Jedenfalls haben sie Klara Hartmann, sobald sie aus den Ketten befreit war, als Unruhestifterin verhaftet«, schloss das Mädchen.
Während die Frauen mit Blauschürzen und Seidenhandschuhen heftig diskutierten, ob Klara Hartmanns Verhalten eine ungeheuerliche Provokation oder ein berechtigter Protest gewesen war, fragte Fanny sich, wie groß der Schlüssel wohl war, den Klara Hartmann geschluckt hatte, und dass er sicher schlimme Bauchschmerzen verursachte.
Sie verschwendete aber nicht viele Gedanken daran, sondern nutzte die Gelegenheit, sich über Alma zu beugen und ihr zuzuraunen: »Mutter erlaubt nicht, dass ich ein Kleid ohne Mieder trage. Was … was soll ich bloß tun?«
Weiterhin diskutierten die anwesenden Damen lautstark darüber, wie man Klara Hartmann nun helfen könne, Alma hingegen stand auf und forderte Fanny mit einem Nicken auf, mit ihr zu kommen. Fanny folgte ihr aus dem Zimmer, allerdings nicht in den Raum nebenan, wo der alte Esstisch sich nun befand – mit der Platte auf dem Boden, um Platz zu sparen und um die Tischbeine als Hutständer zu nutzen – , sondern aus der Wohnung hinaus.
Ihre Tante hatte das Haus bereits schnellen Schritts verlassen, als Fanny sie einholte. »Wirst du mit Mutter reden?«, fragte sie keuchend.
»Ich werde mit einem Anwalt reden, damit er Klara Hartmann aus dem Gefängnis holt, und du kannst mich gern begleiten und was dabei lernen.«
»Was denn?«
»Nun ja …« Alma hielt inne und musterte ihre Nichte streng. »Egal, ob du ein bestimmtes Kleid tragen, Medizin studieren oder verkünden willst, dass Friede der Menschheit besser bekommt als Krieg: Wenn jemand einer Frau ein ›Geht nicht!‹ entgegenbellt, erklärt sie selbstbewusst: ›Geht doch!‹« Alma war gerade noch lange genug stehen geblieben, um diesen Satz zu Ende zu bringen, gleich danach hastete sie weiter. Mit ihrem festen Schuhwerk war das ein Leichtes, Fanny kam ihr kaum nach. »Meine Güte!«, rief ihre Tante spöttisch. »Was trippelst du wie ein Prinzesschen?«
»Mutter verlangt, dass ich Gummibänder um die Knie trage, damit ich nicht zu weit ausschreite. Eine Frau hat eben nur winzige Schritte zu machen.«
Alma kicherte. »Hi-Ha-Ho-Hu-Humpelrock«, witzelte sie. »Na, wenn du den gern trägst, bitte. Aber ist es nicht ein wenig kurios, dass du das Korsett ablegen willst und diese Gummibänder behältst?« Sie lachte und marschierte weiter.
»Tante Alma, so warte doch!«
»Leg diese dummen Dinger ab!«
Seufzend beschloss Fanny, den Befehl zu befolgen, was jedoch nicht gerade einfach werden würde. Der Drehorgelspieler mit dem keckernden Rhesusäffchen auf den Schultern sollte schließlich nicht ihre nackten Beine sehen. Kaum hatte sie diesen hinter sich gelassen, verlangte eine Frau, die einen breiten Kinderwagen schob, dass sie Platz machte. Und dann kam noch der Milchmann seines Weges und pries laut seine Milch, worauf prompt jemand brüllte: »Hast sie bestimmt wieder mit Kalkwasser gemischt!« Der Rhesusaffe keckerte noch lauter.
Endlich fand Fanny eine dunkle Ecke, zog sich die Gummibänder von den Beinen, stand nun aber vor einem neuen Problem: Unmöglich konnte sie mit Gummibändern in der Hand vor einem Anwalt erscheinen. Allerdings war ohnehin fraglich, ob sie diesen überhaupt jemals zu Gesicht bekommen würde. Alma war nämlich verschwunden.
»Tante Alma!«
Noch lauter als sie schrie der Milchmann, um die schiefen Klänge der Drehorgel zu übertönen, und so blieb Fanny nichts anderes übrig, als loszulaufen.
Sie war sich nicht sicher, wo sich die Kanzlei des Anwalts befand, vermutete indes, dass Almas Ziel der Römer, das Rathaus in Frankfurts Altstadt, war. Nicht dass es leicht war, in jenem Labyrinth aus Gässchen, in die kaum je die Sonne fiel, jemanden zu finden. Die Fachwerkhäuser standen so dicht nebeneinander, neigten sich oft sogar nach vorne, und spätestens an den Verkaufsständen, Schirn genannt, an denen überall Kräuter für die Grüne Soße und frisches Ochsenfleisch angepriesen wurden, musste man sich regelrecht vorbeizwängen.
»Tante Alma! Tante Alma!«
Kurz nachdem Fanny Kräuter samt Ochsenfleisch hinter sich gelassen hatte, sog sie den Duft von Bienenwachskerzen ein, von einer Frau gezogen, die gerüchteweise nicht sprach, sondern nur wie Bienen summte. Fanny wollte sie trotzdem fragen, ob sie Alma gesehen hätte – ihr Hut war schließlich sehr auffällig – , da passierte es. Den Blick beharrlich auf die Bienenwachskerzen gerichtet, prallte sie erst mit dem Kopf gegen einen Mann und dann, ob der Wucht des Zusammenstoßes stolpernd, mit den Knien auf die Pflastersteine. Ersteres tat nicht so weh, denn ihre Stirn hatte einen weichen Bart getroffen, eines der Knie aber war blutig geschrammt.
Hättest du bloß die Gummibänder getragen, hörte sie ihre Mutter schimpfen.
Fanny hob den Kopf und vernahm erst einmal gar nichts mehr, versank nur in dem Anblick, der sich ihr bot. Ein blonder gestutzter Schnurrbart, ein liebes Lächeln, das die strenge Wirkung des Bartes minderte, Haar, das in weichen Wellen in die hohe Stirn fiel, ohne dass der junge Mann zu weiblich wirkte, sondern vielmehr elegant. Der dunkle Anzug ließ Fanny an den Anwalt denken, zu dem Alma unterwegs war, die feinen Hände an einen Musiker.
Und in den eigenen Händen hielt sie immer noch die dummen Gummibänder, verdammt!
Allerdings schien der junge Mann diese gar nicht wahrzunehmen, war sein Blick doch ebenso starr auf Fannys Gesicht gerichtet wie ihrer auf seines, nahm wohl rosige Wangen wahr und blaue Augen, vor allem rotbraune Locken, die man mit dem heißesten Brenneisen nicht glätten konnte und die Fannys Mutter, wenn sie sie wieder einmal mit der Bürste bearbeitete, gern als Heiligenschein, der nicht von Gott, sondern vom Teufel kommt, bezeichnete.
»O nein, das wollte ich nicht!«
Der Blick des Fremden ging tiefer, ruhte nun auf ihrem blutigen Knie … dem nackten Knie. Eigentlich sollte ein Mann diesen Teil ihres Körpers nicht sehen dürfen, erst recht nicht berühren, und doch fuhr seine Hand unwillkürlich zu ihrer Wunde.
Eine Schulfreundin hatte Fanny gegenüber einmal behauptet, eine Frau würde ein Kind bekommen, wenn ein Mann ihre nackte Haut berührte.
»Unsinn«, hatte Fanny erwidert, »sie muss nach ihm auf demselben Stuhl sitzen, und zwar solange er noch warm ist.«
Mit der Zeit war sie sich dessen nicht mehr so sicher. Vermutlich musste man nicht nur auf dem Stuhl sitzen, sondern dabei obendrein nackt sein. Wer aber setzte sich schon ohne Kleider auf einen Stuhl? Und warum gab es trotzdem so viele Kinder auf der Welt?
Als die Fingerkuppen des Mannes über ihr nacktes Knie fuhren, kitzelte es jedenfalls, und dieses Kitzeln ließ den brennenden Schmerz vergessen, nicht allerdings die Verwirrung. Es kitzelte nun auch in Fannys Magen – ein wenig so, als hätte sie etwas Leichtes, Weiches verschluckt.
»Soll ich einen Arzt holen?«, fragte der junge Mann.
»Das … das ist nicht notwendig.«
Er zog die Hand zurück, das Kitzeln blieb. Fanny ließ die Gummibänder unauffällig in ihrer Kleidertasche verschwinden und zog sich den roten Seidenschal von den Schultern, um diesen um die Wunde zu wickeln. Obwohl ihre Hände kaum merklich zitterten, gelang es ihr, einen Knoten zu schlingen.
»Können Sie auftreten?«, fragte der junge Mann. Ehe sie bejahte, reichte er ihr schon den Arm, und sie stützte sich darauf. »Sie erlauben mir doch, Sie nach Hause zu geleiten?«
Fanny zögerte. »Eigentlich muss ich hier auf meine Tante warten. Wir haben uns vorhin aus den Augen verloren …«
»Dann würde ich gern mit Ihnen warten, aber das können wir auch in einem Café, nicht? Darf ich Sie auf eine heiße Schokolade einladen?«
Als er ihn aussprach, erschien der Vorschlag dem jungen Mann wohl selbst etwas verwegen, denn Röte schoss ihm ins Gesicht. Fanny lief ebenso glühend rot an. Es lag ihr schon auf der Zunge zu sagen: »Das geht auf keinen Fall!« Dann musste sie an Alma denken und an deren Lektion, dass eine Frau niemals Gummibänder tragen, aber dem Leben immer ein selbstbewusstes »Geht doch!« entgegenrufen sollte.
»Wenn … wenn Sie meinen«, stammelte sie.
Sie ließ seinen Arm nicht los, als er sie am Ochsenfleisch und den Kräutern für die Grüne Soße vorbei zu einem Café auf dem Liebfrauenberg führte.
Der Besitzer des Cafés am Liebfrauenberg behauptete, er sei Wiener, der Ober, der sie bediente, gab vor, Franzose zu sein. Ob es stimmte – sie wussten es nicht. Es war schon schwierig genug zu rätseln, was sich hinter den Namen all jener Kaffeespezialitäten verbarg, die auf der Karte aufgelistet waren. Fanny war erleichtert, darin versinken zu können, denn ihr Gespräch war bislang recht einsilbig verlaufen.
»Georg König«, hatte sich der junge Mann soeben vorgestellt.
»Und ich heiße Franziska Prinz«, hatte Fanny erwidert und gekichert. »Das war natürlich nur ein Spaß«, fügte sie ob seiner verdutzten Miene hinzu. »Franziska heiße ich wirklich, aber alle rufen mich Fanny, mein Nachname ist allerdings Seidel.«
»Fanny«, sagte er und sonst nichts.
Sie kicherte wieder, es klang noch alberner als zuvor in ihren Ohren – wahrscheinlich auch in seinen. Gott, wenn er längst bereute, sie eingeladen zu haben?
»Was … was ist eigentlich ein Biedermeier?«, fragte sie schnell.
»Wenn ich es recht im Kopf habe, wird dem Kaffee ein Schuss Marillenlikör zugefügt.«
»Und was ist eine Marille?«
Georg zuckte mit den Schultern. Fannys Großmutter Elise hätte es wahrscheinlich gewusst, nur war die einige Jahre zuvor gestorben. Außerdem hätte sie wohl nicht Kaffee mit etwas Likör, sondern lieber viel Likör ohne Kaffee getrunken.
»Eine Schale Braun wird jedenfalls aus einer Hälfte Kaffee und einer Hälfte Milch zubereitet«, sagte Georg schnell.
»Und er wird wirklich in einer Schale serviert?«
Er zuckte erneut mit den Schultern und lächelte. »In einem Suppenteller jedenfalls nicht.«
Ihr Kichern klang jetzt befreit. »Und der Fiaker heißt so, weil er während einer Kutschfahrt getrunken wird?«
»Jedenfalls ist das ein großer Mokka im Glas mit viel Zucker und einem Gläschen Sliwowitz.«
»Sliwowitz!« Sie lachte nun aus vollem Hals. »Was ist das denn?«
»Keine Ahnung. Schildkrötensuppe? Krokodilsgulasch? Schlangenauflauf?«
»Vorhin habe ich einen Leierspieler mit Rhesusäffchen gesehen. Ich hoffe, der Koch hat es nicht auf das Tierchen abgesehen.«
Er stimmte in ihr Lachen ein, woraufhin der französische Ober ihnen einen bösen Blick zuwarf.
»Er sieht so aus, als würde er Ihnen am liebsten Katerkaffee kredenzen wollen«, sagte Georg. »Das ist starker Mokka mit Zitronenschale.«
»Gott behüte!«, entfuhr es Fanny.
»Monsieur, Mademoiselle!«, der Ober kam näher, doch anstatt die Bestellung aufzugeben, beugte sich Georg vertraulich zu ihr rüber, sodass sie seinen warmen Atem fühlen konnte. »Er ist sicher kein Franzose, sondern Frankfurter oder Eschborner.«
»Wenn der Herr die Freundlichkeit hätte, auch mich seine Bestellung wissen zu lassen?«, näselte der Mann.
Georg blickte hoch, sein Gesichtsausdruck wurde geschäftsmännisch. »Si Monsieur avait l’amabilité de nous servir deux chocolats chauds.« Wenn der Herr die Freundlichkeit hätte, uns zweimal heiße Schokolade zu bringen.
Der Ober wurde eine Spur bleicher – ob vor Verlegenheit, Stolz oder Zorn wusste Fanny nicht. Die eigene Gemütslage konnte sie erst recht nicht beschreiben. Französisch! Georg sprach Französisch! Die Sprache der Mode. Die Sprache ihrer Träume.
Irgendetwas zwischen Rippen und Hüfte machte einen schmerzhaften Satz. Sie war nicht sicher, was es war – wahrscheinlich der Grund, aus dem Frauen wie ihre Mutter den Töchtern gern enge Korsetts anlegten – , sie wusste nur, dass er in diesem Augenblick restlos ihr Herz gewann.
»Sie beherrschen wirklich Französisch?«, rief sie, als der Ober sich von ihrem Tisch entfernt hatte.
»Mais oui!«
»Oh, Sie müssen es mir unbedingt beibringen. Ich habe versucht, es zu lernen, mit einem alten Wörterbuch meiner Tante. Aber es ist so schwer, sich die Vokabeln zu merken. Für ein Wort wie Seidenunterwäsche muss man sich ganze vier französische Wörter merken: sous-vêtements en soie.«
Zu spät biss sie sich auf die Lippen, war es doch gewiss nicht damenhaft, mit einem Mann über Unterwäsche zu reden, egal ob aus Seide oder nicht.
»Warum wollen Sie denn wissen, was Seidenunterwäsche heißt?«, fragte er dagegen ernsthaft und ohne erneut zu erröten.
»Nun, ich will mich über Mode unterhalten können. Eines Tages werde ich nämlich eine berühmte Modeschöpferin sein. Ich werde Kleider entwerfen und …« Als er sie mit einem Nicken aufforderte weiterzusprechen, konnte sie sich nicht mehr halten. Sie erzählte ihm von dem blassroten Kleid und von Hildes Reaktion, immer schneller nun, als gälte es, vor der eigenen Unbeholfenheit fortzulaufen, vor der hartnäckigen Stimme ihrer Mutter, die sie immer noch im Ohr hatte, vor all den Ängsten und Zweifeln, dass sie gar nicht so viele französische Wörter würde lernen können, um nicht eines Tages als Corsetière zu enden und den Lungen wie den Träumen von Frauen die Luft zum Atmen zu nehmen. »Ich finde, es ist wichtig, dass sich eine Frau frei bewegen kann«, endete sie schnell, »ganz gleich bei welcher Tätigkeit, auch bei diesem Sport zum Beispiel, den man Tennis nennt. Sie wissen vielleicht … Man schlägt mit zwei Bratpfannendingern auf einen Ball ein.«
Georg lachte. »Bratpfanne heißt auf Französisch übrigens poêle à frire.«
»Wie immer es heißt. Jedenfalls schwitzt man, weswegen man Kleidung aus leichtem Stoff tragen sollte, die nicht am Körper klebt und …«
Sie kam ins Stocken – nicht, weil über weiblichen Schweiß zu reden womöglich noch vertraulicher und deshalb verbotener war als über Seidenunterwäsche, sondern weil sie auf dem Liebfrauenberg ihre Mutter und Tante Alma erblickte. Vor ihrer Mutter hätte sie sich versteckt – notfalls hinter dem Ober, der nun die Tassen mit der heißen Schokolade brachte. Ihrer Tante Alma wollte sie allerdings keine Sorgen bereiten.
»Tut mir leid, ich muss …«, setzte sie an, sprang hoch, prallte fast mit dem Ober zusammen.
»Mademoiselle!«, rief der empört.
»Jetzt laufen Sie doch nicht davon!«, rief Georg und erhob sich. »Wenn es jemand mit der Bratpfanne auf Ihren Kopf abgesehen hätte, würde ich mich heldenhaft dazwischenwerfen.«
Fanny blieb stehen, aber da hatte ihre Mutter sie schon entdeckt, und als Hilde in das Café stürmte, beschränkte sich Georgs heldenhaftes Dazwischenwerfen darauf, vorzutreten und einen schüchternen Diener zu machen.
Hilde hatte ausnahmsweise mal keine Stecknadel zwischen den Lippen, was bedeutete, dass ihre Stimme noch schneidender war, als sie sie schalt, wo sie gewesen sei, wie sie fortlaufen könne, für ein Mädchen schicke sich das nicht. Dann glitt ihr Blick auf Georg, blieb an ihm hängen. Die Augen weiteten sich, die Lippen formten ein lautloses O.
Er verbeugte sich erneut. »Gestatten Sie mir, mich vorzustellen, Georg König ist mein Name, und es ist wahrhaft unverzeihlich, dass ich Ihre Tochter entführt habe. Allerdings hat sie einen kleinen Unfall erlitten und das durch meine Schuld, fürchte ich. Er hatte keine schlimmen Folgen, ich hielt es dennoch für meine Pflicht, mein Versehen mit einer Tasse Schokolade wiedergutzumachen. Kann ich Sie vielleicht dazu überreden, uns Gesellschaft zu leisten, gnädige Frau? Bei einem Tässchen Kaffee mit Sliwowitz?«
Fanny war überzeugt, dass ihre Mutter nun erklären würde, niemals Alkohol zu trinken, doch als sie endlich die Sprache wiederfand, brachte sie nur ein »Georg König?« hervor.
Er nickte unschlüssig, und Hilde riss die Augen noch weiter auf. Tante Alma hingegen drängte sich an ihr vorbei. »Ich nehme den Kaffee mit Sliwowitz gern, obwohl ich nicht weiß, was das ist. Es klingt auf jeden Fall interessant. Gerechterweise hat man Klara Hartmann übrigens wieder aus dem Gefängnis entlassen, obgleich mit der Auflage, ein Bußgeld zu zahlen.«
Fanny sah Georg an, dass er tausend Fragen hatte. Ihr lag auch eine auf der Zunge, nämlich die, was »Geht doch« auf Französisch hieß. Nun, notfalls würde sie es ihrer Mutter eben auf Deutsch sagen, wenn diese ihr verbieten würde, den fremden jungen Mann, dessen Verhalten mit ihrem blassroten Kleid etwas gemein hatte, nämlich gegen alle guten Sitten zu verstoßen, jemals wiederzusehen.
Hilde tat nichts desgleichen. Sie bedankte sich bei Georg, dass er auf ihre geliebte Fanny aufgepasst hatte, und das mit einem so süßen Ton, als hätte sie keine Stecknadel, sondern ein schokoladenüberzogenes Praliné verschluckt.
»Leider sind wir in Eile, aber allzu gern würde ich Sie am kommenden Sonntag in unser bescheidenes Heim zu unserer nachmittäglichen Teestunde einladen.«
Fanny wusste, dass die reichen Bürger Frankfurts sich gern ein Vorbild an den Engländern nahmen und regelmäßig Tee tranken, aber sie konnte sich nicht erinnern, dass bei ihnen zu Hause jemals vom Frühstück abgesehen Tee getrunken wurde. Bevor sie etwas dazu sagen konnte, zog Hilde sie wie erwartet am Arm, und um nicht zu stolpern und ein zweites Mal auf das blutende Knie zu fallen, folgte sie ihr widerwillig ins Freie.
Geht doch, geht doch, geht doch!, hämmerte es unaufhörlich in ihrem Kopf, doch auch auf der Straße lächelte ihre Mutter immer noch, und ihr Lächeln war zuckersüß.
»Was für ein Glück, dass du ausgerechnet diesem Mann vor die Füße gefallen bist«, sagte sie schwärmerisch.
Fanny war verwirrt. »Ich bin ihm nicht vor die Füße gefallen, ich bin mit ihm zusammengestoßen.«
»Was für ein Glück, dass du ihn regelrecht verzaubert hast«, fuhr Hilde fort.
Fanny musterte ihre Mutter ratlos, doch während diese sie losließ, erklärte Alma, die auf den Kaffee mit Sliwowitz verzichtet hatte und ihnen gefolgt war: »Georg König ist der Besitzer eines der großen Modehäuser Frankfurts. Sein Vater muss unermesslich reich gewesen sein – er hat sich seinerzeit mit fünfzehntausend Goldmark in das Unternehmen eingekauft. Vor zwei Jahren ist Georg König senior gestorben, ich glaube, nicht lange nach seiner Frau. Georg König junior ist sein Alleinerbe.«
»Es ist das modernste Geschäftshaus, das man sich denken kann!«, schwärmte Hilde. »Denk dir, nicht nur die Ladenräume werden elektrisch beleuchtet, auch die Schaufenster.«
Fanny konnte sich vage erinnern, sich an diesen Schaufenstern die Nase platt gepresst zu haben, um die französischen Kleider darin zu mustern. Zumindest war sie überzeugt gewesen, dass es französische waren, waren sie doch elegant und schick und außergewöhnlich. Extraordinaire.
O Gott, Georg konnte Französisch!
»Lässt du mich das blassrote Kleid tragen?«, fragte Fanny.
»Viel lieber wäre mir, du würdest bald ein weißes Kleid tragen«, sagte ihre Mutter und zwinkerte ihr vielsagend zu.
Fanny verstand kein Wort.
»Mittlerweile ist es ja modern geworden, in Weiß zu heiraten«, mischte sich Alma ein, »selbst für gewöhnliche Sterbende. Ich halte davon nicht viel. Unsere Mutter hat seinerzeit bei ihrer Hochzeit Rot getragen, weil sie immer schon exzentrisch war – ich glaube, der rote Schal, den du da trägst, war ihr Brautschleier. Und ich habe mich für Schwarz entschieden, weil ich mich mit den Bauersfrauen solidarisieren wollte.«
»Du hast wie eine Witwe ausgesehen«, sagte Hilde unerbittlich.
»Ein gutes Omen, wenn du mich fragst«, meinte Alma trocken.
Hilde blitzte sie wütend an, aber entschied anscheinend, sich nicht auf einen Zweikampf einzulassen, bei dem sie ja doch meist unterlag. Sie winkte Fanny, endlich mit ihr zurück in die Schneiderwerkstatt zu kommen, und Fanny folgte widerwillig, wenn auch nicht ohne sich noch einmal umzudrehen und nach Georg Ausschau zu halten. Durch die Caféhausfenster konnte sie erkennen, dass er eine Tasse Schokolade austrank, dann nahm er die zweite – vielleicht, weil er nichts verschwenden wollte, vielleicht, weil der strenge Ober ihn dazu zwang.
»Magst du ihn?«, fragte Alma mit rätselhafter Miene, während Hilde schon ungeduldig voranging.
»Er … er spricht Französisch«, gab Fanny zurück.
»Und seit wann ist das ein Grund, jemanden zu mögen oder nicht?« Fanny zuckte mit den Schultern. »Keine Angst«, sagte Alma da verschwörerisch grinsend. »Ich schreibe dir weder vor, was du tun noch was du fühlen sollst. Über dein Leben entscheidest du. Deine Mutter und ich, wir mischen uns da nicht ein. Und Französisch ist ja auch wirklich eine klanghafte Sprache. Ich finde trotzdem, eine Frau muss keinen Herrn König heiraten, um eine Königin zu sein.«
Fanny zuckte wieder mit den Schultern. »Wer denkt denn schon ans Heiraten?«
»Der Krieg beschleunigt die Dinge, die Liebe ebenso.«
Fanny hatte wenig Ahnung vom Krieg, aber genug, um ihrer Tante zu widersprechen: »Liebe und Krieg haben nichts miteinander gemein.«
»Freiheit und Liebe oft auch nicht«, sagte Alma und wurde ganz kurz ernst, ehe sie schelmisch hinzufügte: »Und jetzt sag, wie du diese grässlichen Gummibänder losgeworden bist.«
Erst jetzt fiel Fanny wieder ein, dass sie den roten Schal um das blutende Knie gewickelt hatte. Und da sie nun wusste, welche Bedeutung er einst für ihre Großmutter Elise gehabt hatte, tat ihr diese Gedankenlosigkeit leid.
Hoffentlich lassen sich die Blutflecke wieder auswaschen, dachte sie und erzählte Alma lieber nichts davon.
LISBETH
1944 – 1945
Als Fannys Liebesgeschichte begann, hatte diese keine Ahnung, was der Krieg, vor dem die Welt stand, bedeuten würde. Als die Liebesgeschichte meiner Mutter Lisbeth begann, wusste diese alles vom Krieg, der ihre Welt zerfetzt hatte, vor allem, dass er, selbst wenn er endete, doch nicht aufhörte, vor allem nicht in den Träumen. Nachts begann er von Neuem oder dauerte immer noch an, als wäre das Leben ein Grammofon und der Mensch eine Schellackplatte, die zerkratzt wurde, weil die Nadel stets an der gleichen Stelle hängen blieb. Bei Lisbeth war diese Stelle der 22. März 1944, ein Tag, der ihr Leben in zwei Teile hackte, in ein Davor und Danach.
An jenem Tag – manch einer nannte es Schicksal, dass es der 112. Todestag von Johann Wolfgang von Goethe, einem großen Sohn der Stadt, war – starb Frankfurts Altstadt. Bevor Lisbeth Zeugin dieses Todes wurde, hörte sie einen Clown lachen. Sie hatte sich überreden lassen, ins Kino zu gehen und sich den Zirkusfilm Akrobat, schö-ö-ö-n anzuschauen, in dem es nicht nur um besagten Clown ging, sondern auch um eine Tänzerin auf dem Weg zum Erfolg. Irgendwann hatte sie ihre Mutter Fanny einmal sagen hören, dass Clowns böse seien, aber kurz darauf war Fanny aus ihrem Leben verschwunden, und das bedeutete, dass sie böse war, dass nicht die Clowns es waren.
Lisbeth amüsierte sich jedenfalls prächtig und wollte ihren Kindern von dem Clown erzählen, doch als sie nach Hause kam, schliefen die beiden schon, und ihre Haushälterin Frieda, die sie gehütet hatte, hielt den Kopf so dicht übers Radio gebeugt, als wollte sie hineinkriechen.
»Kassel«, sagte sie nur, als Lisbeth eintrat, und ihre Stimme klang erleichtert.
»Kassel«, wiederholte Lisbeth, und ihre Stimme verriet Schuldgefühle. Weil sie im Kino gelacht hatte. Weil es eine andere Stadt, andere Menschen treffen würde.
»Froangfort werrn se schone, in Froangfort wolle se wohne«, fügte Frieda in ihrem südhessischen Singsang hinzu. Diese Worte fielen nicht zum ersten Mal, und mittlerweile zuckte Lisbeth nicht mehr zusammen, obwohl es Hochverrat war zu glauben, dass der Krieg verloren war. Frieda beugte sich wieder über das Radio. »Wärschd säje, alles wärd gud.« Lisbeth lugte ins Schlafzimmer, wo Martin und Rieke schliefen, ihre Händchen fest aneinandergeklammert. Womöglich würden sie nicht über den Clown lachen, wenn sie ihnen davon erzählte, sondern sich vor ihm fürchten.
Sie selbst packte auch die Angst, als Frieda plötzlich aufschrie.
»Kommen sie doch nach Frankfurt?«, fragte Lisbeth.
»Fraa Käthe is wegg!«
Frau Käthe war Friedas grau gefleckte Katze, die irgendwann mal so geheißen hatte wie alle von Friedas ehemaligen Katzen, nämlich Schnurrli. Aber sie hatte, indem sie selbstgefällig auf dem größten Stuhl am Esstisch thronte oder von Friedas Teller stibitzte, unmissverständlich klargemacht, dass sie als Mensch betrachtet, so behandelt und so genannt werden wollte.
Auf besagtem Stuhl hafteten nun weiße Haare, ansonsten war er leer. Es war einer der ersten lauen Abende des Jahres, Frieda hatte das Fenster einen Spaltbreit geöffnet, und Frau Käthe hatte die Gelegenheit hindurchzuschlüpfen nicht verstreichen lassen.
»Woann se werrer en Suppeknoche stiehlt wie leddschdes Mol, wärd mer se erschlage!«, rief Frieda verzweifelt.
»Ich gehe sie suchen«, sagte Lisbeth.
Das viele Wasser in den Beinen machte Frieda zu schaffen, und mehr noch die Angst vor der Dunkelheit, die sich eben über die Stadt senkte – nicht ohne dass die Sonne den nahen Main rötlich glühen ließ. Obwohl sich die Katze kaum hier herumtreiben würde, hatte es Lisbeth von der nahen Altstadt zuerst ans Ufer des Flusses gezogen. Dort verharrte sie eine Weile, genoss Licht und Wärme, hatte noch keine Ahnung, dass man den blutroten Fluss später als schreckliches Omen für das große Feuer deuten würde. Damals hatte sie das Lachen eines Clowns ja auch noch für ein Zeichen seiner Fröhlichkeit gehalten, nicht für seine tiefe Trauer.
»Frau Käthe!«, begann Lisbeth schließlich zu rufen. »Frau Käthe!«
Nirgendwo war eine grau gefleckte Katze zu sehen. Genau genommen war nach Einbruch der Nacht überhaupt nichts zu sehen, herrschte doch striktes Verdunkelungsgebot. Nur die Bordsteine, Treppen und Hausecken waren mit Leuchtfarbe bestrichen worden.
Sie gab trotzdem nicht auf, und eine halbe Stunde später – sie war wieder in die Nähe ihres Hauses auf dem Römerberg zurückgekehrt – vernahm sie ein Miauen. Und Sirenen.
Es ist nicht Kassel, es ist Frankfurt, schoss es ihr durch den Kopf, während die Katze auf sie zugerannt kam. Gewöhnlich war es schon eine große Gnade, sie überhaupt streicheln zu dürfen, jetzt ließ sich Frau Käthe sogar von ihr auf den Arm nehmen. Sie war fast so schwer wie Martin, in jedem Fall schwerer als Rieke, und sie hörte sie schnurren. Oder nein, sie konnte es nicht hören, die Sirenen waren zu laut, sie konnte es nur spüren. Vielleicht schnurrte Frau Käthe auch gar nicht, vielleicht zitterte sie nur. Sie selbst zitterte ja ebenso, konnte kaum einen Schritt geradeaus machen.
»Alles wird gut«, flüsterte sie dem Tier ins Ohr, weil sonst niemand da war, dem sie das einreden konnte, vor allem nicht die Kinder.
Himmel, die Kinder! Sie musste heim zu ihnen! Frieda würde mit dem Wasser in ihren Beinen ewig brauchen, sie in den Luftschutzkeller zu bringen. Trotz des Zitterns begann Lisbeth zu laufen, kam aber nur ein paar Schritte weit, ehe sie jemand am Arm packte.
»Runter!«, schrie ein Soldat, drängte sie und eine weitere Frau, die er mit der anderen Hand gepackt hielt, in ein Haus, um zu verhindern, dass die Bewohner der Altstadt einmal mehr Richtung Zeil, der großen Einkaufsstraße, deren Kaufhäuser bessere Luftschutzräume hatten, flohen. Lisbeth kämpfte gegen den Griff des Soldaten an, Frau Käthe nun gegen ihren. Sie spürte die Krallen, der Soldat schien nichts zu spüren. »Hierbleiben!«, bellte er.
Sein Griff lockerte sich, jedoch nur, weil er sie eine schiefe Treppe hinunterstieß. Lisbeth fand sich in einem der kalten, feuchten Löcher unter den Häusern der Altstadt wieder, die nicht einmal taugten, Keller genannt zu werden, geschweige denn Luftschutzraum. Eine Tür fiel zu, irgendwo schrie ein Säugling.
An alles, was danach geschah, konnte Lisbeth sich nicht mehr in der richtigen Reihenfolge erinnern. Dunkle Löcher klafften in ihrem Gedächtnis, als hätten die Bomben nicht nur ganze Häuser, sondern auch ihre Erinnerungen zerfetzt, nur zwischendrin leuchteten einzelne grelle Bilder auf. Wie sie Frau Käthe am Schwanz zu sich zog, als diese zu fliehen versuchte, die Katze sie wieder kratzte, sie sie aber trotzdem nicht losließ. Wie ihr gegenüber eine Frau saß und strickte und ständig murmelte: »Eine glatt, eine verkehrt.« Wie eine andere Frau sich verzweifelt an ein Gurkenglas klammerte und dass die Gurken mit einer dicken Schicht Schimmel bedeckt waren. Wie ein Mann mit Kopfverband stöhnte und die Frau mit dem Säugling einen Daumen in den Mund steckte und den anderen dem Mann. Lisbeth fühlte kein Schnurren, kein Zittern mehr. Da waren nur Druckwellen von den Einschlägen, die das Trommelfell zu zerreißen schienen. Rieke, Martin, sie musste zu ihnen … sie konnte nicht zu ihnen … der Soldat ließ niemanden aus dem Keller. Zumindest nicht als es anfing, erst als es vorbei war. Nein, es war nicht vorbei, aber die Luft war plötzlich nicht mehr feucht und kalt, sie war heiß.
»Raus!«, brüllte irgendjemand. »Raus! Sonst ersticken wir alle!«
Sie wusste nicht, wie sie die Treppe hochkam, nur dass der Soldat verschwunden war und sie Frau Käthe immer noch hielt. Nicht länger waren Einschläge zu hören, dafür ein Knistern und Brausen, das Geräusch von knackendem Holz und berstenden Balken. Lisbeth rührte sich nicht, Frau Käthe rührte sich nicht, irgendjemand versetzte ihr einen Stoß, und sie stolperte ins Freie, nein, nicht ins Freie, in ein Flammenmeer. Der Himmel war blutrot wie am Abend der Fluss, Funken tanzten greller als die Sterne, von den Dächern der Fachwerkbauten züngelten die Flammen hoch, verdichteten sich zu einer ins Riesenhafte anwachsenden Lohe. Selbst der Boden, obwohl gepflastert, schien zu brennen. Das Brausen schwoll an, als nahte ein Gewitter.
»Der Feuersturm!«, brüllte irgendwer. »Zum Main.«
Aber es gab in dieser Welt doch keinen Main, keine Abendsonne, deren Strahlen sich auf ihm brachen, keinen Mond. Wieder wurde sie von jemandem gepackt – dieses Mal war es die Frau, die das Gurkenglas hielt. Wieder wurde sie in einen Keller gestoßen, nur dass der kein Loch war, sondern seine Wände durchbrochen worden waren, um Teil von jenem unterirdischen Tunnelsystem zu werden, das beim Gerechtigkeitsbrunnen endete. Gleich neben diesem befanden sich riesige Löschwasserbecken, und manche sprangen hinein. Lisbeth nicht, Frau Käthe hasste Wasser. Ersparen konnte sie es ihr trotzdem nicht. Sie wurde weitergezogen in Richtung Main, es gab ja doch noch den Fluss, es gab auch noch die Feuerwehr, die dort wartete, die Menschen nass spritzte.
Als das kalte Wasser sie traf, begann Frau Käthe, sich zu winden. Ich darf sie nicht loslassen, dachte Lisbeth. Bloß nicht loslassen. Solange ich die Katze beschütze, beschützt Frieda Martin und Rieke.
Dies war der einzige Gedanke, der ihr durch den Kopf ging, lauter als das Knistern, lauter als das Geschrei, lauter als die letzten rasselnden Atemzüge einer sterbenden Stadt.
Ich darf sie nicht loslassen, ich darf sie nicht loslassen, ich darf sie nicht …
Sie ließ sie nicht los, nur irgendwann genügte es nicht, bloß die Katze zu retten. Mit nur mehr einer Hand hielt Lisbeth das Tier fest, mit der andern entriss sie der Frau das Gurkenglas, schüttete den verschimmelten Inhalt aus.
»Was tust du denn da?«, schrie die Frau und begann zu weinen.