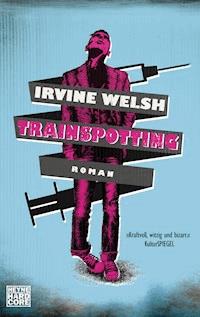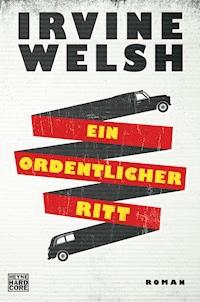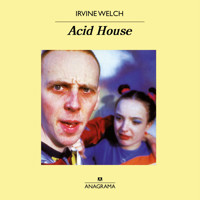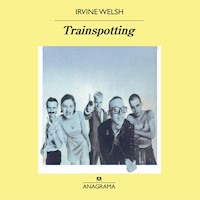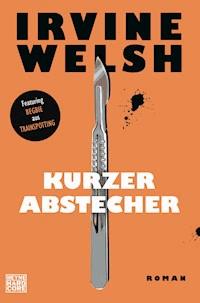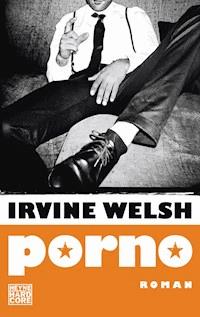8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie wir aussehen, wer wir sind
Lucy Brennan ist die härteste Fitnesstrainerin von Miami Beach – und ein Star: Seit sie dabei gefilmt wurde, wie sie per Frontkick einen Amokläufer zur Strecke brachte, kann sie sich vor Aufträgen kaum noch retten. Auch die Planungen für ihre eigene Reality-TV -Show machen Fortschritte. Doch dann meldet sich die unsichere, stark übergewichtige Künstlerin Lena Sorenson zum Personal Training bei ihr an; eine Frau, die all das verkörpert, was Lucy hasst. Langsam, aber unaufhaltsam gerät ihr erbitterter Kampf gegen die Fettleibigkeit außer Kontrolle …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
DAS BUCH
Lucy Brennan ist die härteste Fitnesstrainerin von Miami Beach – und ein Star: Seit sie dabei gefilmt wurde, wie sie per Frontkick einen Amokläufer zur Strecke brachte, kann sie sich vor Aufträgen kaum noch retten. Auch die Planungen für ihre eigene Reality-TV-Show machen Fortschritte. Doch dann meldet sich die unsichere und stark übergewichtige Künstlerin Lena Sorenson zum Personal Training an; eine Frau, die all das verkörpert, was Lucy hasst. Langsam, aber unaufhaltsam gerät ihr erbitterter Kampf gegen die Fettleibigkeit außer Kontrolle …
DER AUTOR
Irvine Welsh, geboren 1958 in Leith bei Edinburgh, schreibt Romane, Kurzgeschichten, Drehbücher und Theaterstücke. Vier seiner Romane wurden verfilmt. Welsh lebt in Chicago.
LIEFERBARE TITEL
Trainspotting
Skagboys
IRVINE WELSH
DASSEXLEBENSIAMESISCHERZWILLINGE
Roman
Aus dem Englischenvon Stephan Glietsch
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe
THE SEX LIVES OF SIAMESE TWINS
erschien 2014 bei Jonathan Cape, London
Unterwww.heyne-hardcore.de finden Sie daskomplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newslettersowie unser halbjährlich erscheinendes CORE-Magazinmit Themen rund um das Hardcore-Universum.
Weitere News unter facebook.com/heyne.hardcore
Copyright © 2014 by Irvine Welsh
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Thomas Brill
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München,
unter Verwendung einer Abbildung von © shutterstock.com
(SINANIMACION; Studio London)
Satz: Schaber Datentechnik, Wels
ISBN 978-3-641-15460-8V002
www.heyne-hardcore.de
Für Elizabeth (erneut)
Ich muss ein eigenes System erschaffenoder werde von dem eines anderen versklavt.
– William Blake
Inhalt
Erster Teil TRANSPLANTATE
1 Leprakolonie
2 Lenas Morgenseiten 1
3 Heldin
4 Kontakt 1
5 Ganzkörpergeschwabbel
6 Kontakt 2
7 Schurkin
8 Kontakt 3
9 Niedlicher geht’s nicht
10 Kontakt 4
11 Dämon
12 Der Mensch der Zukunft – Einführung
13 Kontakt 5
14 Lummus Park
15 Kontakt 6
16 Art Walk
17 Kontakt 7
18 Lenas Morgenseiten 2
19 Arsch-Assassine
20 Der Mensch der Zukunft – Der Prozess
21 Kontakt 8
22 Eine kontrollierte Umgebung
23 Der Mensch der Zukunft – Kritische und kommerzielle Reaktionen auf Lena Sorensons Werk im Vergleich
24 Kontakt 9
25 Heat
26 Kontakt 10
27 Lenas Morgenseiten 3
28 Kontakt 11
Zweiter Teil GEISELN
29 Kontakt 12
30 Der Barrakuda-Mann
31 Dringende Entscheidungen
32 Kontakt 13
33 Apartment
34 Kontakt 14
35 Ein Institut für Kunst
36 Hunde
37 Kontakt 15
38 Das Päckchen
39 Kontakt 16
40 West Loop Lena
41 Stockholm-Syndrom
42 Matt Flynn
43 Das Wahrheits-und-Versöhnungs-Komitee von Miami Beach
44 Kontakt 17
45 Florida vs. New York
46 Leere Handschellen
47 Kontakt 18
48 Auf die eine oder andere Weise
49 Fressen oder gefressen werden
Dritter Teil ÜBERGÄNGE
50 Ein gemeinsamer Traum
51 Thanksgiving
52 Kontakt 19
53 Die Razzia
Danksagung
ERSTER TEIL
TRANSPLANTATE
1 Leprakolonie
5-6-7-8, wer wird von uns plattgemacht?
Zahlen sind die große amerikanische Obsession. An welchen Zahlen lassen wir uns messen? Unsere bröckelnde Wirtschaft: an Wachstumsraten, Konsumausgaben, Industrieproduktion, BIP, BSP, dem Dow Jones. Unsere Gesellschaft: an Morden, Vergewaltigungen, Teenagerschwangerschaften, Kinderarmut, illegalen Einwanderern, Drogenabhängigen, registriert oder nicht. Wir als Individuen: an Größe, Gewicht, Hüft-, Taillen-, Brustumfang, BMI.
Doch am meisten Probleme verursacht die Zahl, die mir gerade im Kopf herumspukt: 2.
Der Streit mit Miles (1,86 m, 95 kg) war banal, schon klar. Dennoch besaß er genügend Zündstoff, um mich davon abzuhalten, die Nacht in seiner Wohnung in Midtown (= Geisterstadt) zu verbringen. Der Idiot hatte den ganzen Abend über seine Rückenschmerzen gejammert und sich mit dieser Heulsusen-Nummer um sein eigenes Vergnügen gebracht. Je feuchter seine Augen wurden, desto trockener wurde meine Möse. Während der letzten paar Minuten einer Episode von The Big Bang Theory zischte er mir dann ein »Psssst!« zu – echt jetzt, Alter, im Ernst? Und als Chico, sein Chihuahua, wieder mit diesem nervigen Gekläffe anfing, wollte er ihn partout nicht in ein anderes Zimmer stecken, sondern behauptete steif und fest, das glotzäugige kleine Mistviech würde sich gleich wieder beruhigen.
Tja, leck mich doch.
Als ich mich entschied, ihn zu verlassen, nahm er das nicht so gut auf: machte einen auf schmollendes Kleinkind, mit Schnuteziehen und Pflänzchen-rühr-mich-nicht-an-Pose. Mann, werd gefälligst mal erwachsen! Manche Typen sind einfach nicht cool genug, um angepisst zu sein. Selbst Chico, der dazu überging, mir aufs Knie zu springen, obwohl ich ihn jedes Mal wieder auf den Boden setzte, hat größere Eier.
Also mache ich mich wenige Minuten vor halb vier auf den Rückweg nach South Beach. Bis vor ein paar Stunden war es noch eine laue Nacht, ein tief hängender Mond und Unmengen von Sternen hatten den violetten Himmel mit Lichtsplittern übersät. Doch kaum lasse ich meinen röchelnden 1998er Cadillac DeVille an, den ich von meiner Mom übernommen habe, merke ich, wie das Wetter umschlägt. Ich mache mir keinen Kopf darüber, bis auf Höhe des Julia Tuttle Causeway – aus meinen Boxen scheppert Joan Jetts »I Hate Myself For Loving You« – plötzlich kräftige Windböen frontal gegen den Wagen drücken. Ich drossle das Tempo, weil der Regen auf die Windschutzscheibe prasselt und mich zwingt, durch die hektisch arbeitenden Scheibenwischer zu blinzeln.
Gerade als der Wolkenbruch überraschend nachlässt und die Tachonadel wieder Richtung fünfzig klettert, tauchen zwei Männer aus der jetzt sternenlosen, tiefschwarzen Dunkelheit auf, rennen mitten auf dem fast verlassenen Causeway auf mich zu und wedeln dabei mit den Armen. Die irren Augen des vorderen blitzen im weißen Schein der Straßenlaternen. Zuerst halte ich es für einen Scherz: besoffene Verbindungsstudenten oder durchgeknallte Drogenfreaks bei einer kranken Mutprobe. Doch dann, mit einem lautlosen Fluch auf den Lippen, kommt mir die Erkenntnis, dass es sich dabei um einen ausgeklügelten Raubüberfall handeln könnte, und ich sage mir: Halt jetzt nicht an, Lucy, sollen diese Arschlöcher doch zur Seite springen. Aber sie tun einen Teufel, und ich steige voll in die Eisen. Der Wagen gerät quietschend ins Schleudern, und ich klammere mich am Lenkrad fest. Es fühlt sich an, als würde ein Riese versuchen, es meinem Griff zu entreißen. Ein dumpfer Knall ertönt, gefolgt von einem rumpelnden Geräusch, und ich sehe, wie einer der Männer über meine Motorhaube stürzt. Weil der Motor aussetzt, kommt der Wagen abrupt zum Stehen. Ich werde zurück in den Sitz geworfen und die CD wird exakt in dem Moment abgewürgt, als Joan gerade loslegt, im Refrain alles in Grund und Boden zu rocken. Ich schaue mich um und versuche, aus der Situation schlau zu werden. Auf der Spur neben mir kann ein anderer Fahrer nicht so schnell reagieren: Der zweite Mann wird in die Luft katapultiert, dreht sich dort wie eine verrückte Ballerina und überschlägt sich mehrfach auf dem Highway. Der Fahrer macht keinerlei Anstalten zu halten, sondern rast unbeirrt weiter in die Nacht.
Dem seligen Arschloch unseres lieben Jesuskindes sei Dank, dass sonst niemand hinter uns ist.
Diese Typen sind keine Autodiebe, die haben weder genug Mumm noch genug Schiss für so ’ne Nummer. Der Kerl, den der andere Wagen angefahren hat, ein kleiner, bulliger Latino, kommt wie durch ein Wunder wieder auf die Beine. Die nackte Angst sickert ihm aus jeder Pore und scheint jeglichen Schmerz zu überlagern, den er empfinden müsste. Er vergeudet keinen Blick an den Arsch, der über mein Auto geflogen ist, sondern starrt panisch über seine Schulter in die trübe Nacht, während er sich weiterschleppt. Im Rückspiegel sehe ich den Kerl, den ich umgenietet habe. Auch er ist wieder auf den Beinen: Das blonde Haar in langen Strähnen mit Gel zurückgekämmt, hoppelt er wie eine halb verkrüppelte Spinne eilig auf die Büsche des Mittelstreifens zu, der die Fahrspuren Richtung Downtown von denen Richtung Küste trennt. Dann sehe ich, dass der Latino kehrtgemacht hat und auf mich zugehumpelt kommt. Er hämmert gegen mein Fenster, schreit: — Hilf mir!
Ich bin in meinem Sitz erstarrt, den verbrannten Geruch von Bremsklötzen und Gummi in der Nase, und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Plötzlich kommt ein dritter Mann aus der Dunkelheit und mit zügigen Schritten über den Highway auf uns zu. Der Schock des Latinos hat offenbar nachgelassen, denn er stößt einen jähen Schmerzensschrei aus, bevor er weiter am Auto entlanghumpelt und sich neben das hintere Seitenfenster kauert.
Ich öffne die Tür und steige aus, stehe mit wackeligen Beinen auf der Fahrbahn, mein Magen dumpf und leer, als ein Knall ertönt und etwas an meinem linken Ohr vorbeipfeift. Seltsam entrückt, als wäre ich gar nicht selbst betroffen, wird mir klar, dass es ein Schuss ist. Darauf komme ich, weil der dritte Mann, der sich aus dem scheckigen Dunkel schält, mit einem Gegenstand in seiner Hand auf mein Auto zeigt. Es muss eine Pistole sein. Er ist jetzt fast neben mir, alles um mich herum gefriert zum Standbild, ich kann die Waffe nun deutlich erkennen. So endet es also, denke ich, während ich spüre, wie sich in einem urtümlichen Flehen um Gnade meine Augenlider heben. Doch der Schütze geht an mir vorbei, als wäre ich unsichtbar, dabei bin ich ihm nah genug, um ihn zu berühren, um sein glasiges kleines Frettchen-Auge im Profil zu sehen und sogar einen Hauch seines muffigen Körpergeruchs wahrzunehmen. Aber der Mann hat bloß sein kauerndes Opfer im Sinn. — BITTE! BITTE! … NICHT …, bettelt der Latino neben meinem Auto hockend, die Augen geschlossen, den Kopf gesenkt, eine Handfläche zur Abwehr ausgestreckt.
Ganz langsam senkt der Schütze den Arm mit der Waffe, bis sie auf sein Opfer gerichtet ist. Von irgendeinem Instinkt getrieben, mache ich einen Satz, ziehe das Knie hoch und ramme dem Arschloch meinen Fuß direkt zwischen die Schulterblätter. Der dürre, schäbig aussehende Kerl stürzt mit dem Gesicht voran auf den Asphalt und verliert seine Waffe. Der Latino glotzt perplex und krabbelt dann auf die Pistole zu. Ich bin vor ihm da und befördere sie mit einem Tritt unter den Caddy. Den Mund zu einem O geöffnet, schaut er mich eine Sekunde lang an, bevor er aufsteht und eilig davonhumpelt. Ich werfe mich mit meinem ganzen Gewicht auf den Schützen, schürfe mit den nackten Knien über die Fahrbahndecke des verlassenen Highways, hocke mich rittlings auf ihn und lege beide Hände um seinen dürren Nacken. Er ist nicht kräftig (weiß, 1,65 m, 55 kg), aber er versucht noch nicht einmal, sich zu wehren, als ich ihn anbrülle: — DU DÄMLICHES ARSCHLOCH, WAS SOLL DER SCHEISS?
Ein paar heisere Baby-Schluchzer und dazwischen wehleidiges Gestammel: — Du verstehst das nicht … niemand versteht das … Ein weiteres Auto kommt herangeschlichen, beschleunigt und rast davon. Ich habe so eine Ahnung, dass der nächste Haufen Scheiße bereits auf mich herabsegelt. Ich blicke kurz auf und sehe, wie der Latino in Richtung der Büsche auf dem Mittelstreifen flieht, seinem weißen Compadre hinterher. Was für ein Glück, dass ich Turnschuhe anhabe, schießt es mir durch den Kopf, da ich eigentlich die Gladiator-Pumps favorisiert hatte, passend zu dem kurzen Jeansrock und der Bluse, mit denen ich Miles’ Schwanz in Stimmung bringen und ihn seinen Rücken vergessen machen wollte. Angesichts des hochgerutschten Rocks bin ich verdammt froh, an ein Höschen gedacht zu haben.
Wie aus dem Nichts quiekt mir eine hysterische Stimme ins Ohr: — Ich hab alles mit angesehen. Du bist eine Heldin! Ich habe den Notruf gewählt! Ich habe die Polizei informiert! Ich habe alles mit meinem iPhone gefilmt! Als Beweis!
Ich hebe den Blick und sehe eine kleine, dicke Tussi. Ein dichter, schwarzer Pony hängt ihr bis über die Augen. Sie ist 1,59 m, vielleicht 1,60 m groß und um die 100 kg schwer. Wie bei allen Übergewichtigen lässt sich ihr Alter nur schätzen, aber ich würde auf Ende zwanzig tippen.
— Ich hab die Polizei gerufen, wiederholt sie und wedelt mit ihrem Handy vor meiner Nase herum. — Hier ist alles drauf! Ich parke da drüben.
Ich drehe den Kopf in die Richtung, in die sie zeigt, und sehe ihr Auto im Licht der Straßenlaternen am äußersten Rand der Standspur stehen, schon fast im dichten Gestrüpp des Grünstreifens, dessen Büsche und Bäume Brücke und Bucht voneinander trennen. Sie mustert die zerschundene, bäuchlings unter mir ausgestreckte Gestalt und meine Schenkel, die den Hänfling in die Zange nehmen. Seine schmächtigen Schultern beben jetzt unter krampfartigen Schluchzern. — Weint der etwa? Weinen Sie, Mister?
— Das wird er gleich, knurre ich, als ein Polizeiwagen mit Sirenengeheul quietschend zum Stehen kommt und uns in flackerndes blaues und rotes Licht taucht. Mit einem Mal werde ich mir des widerlichen Uringestanks bewusst, der von dem Kerl unter mir ausgeht und die schwüle Luft verpestet.
— Igitt …, trötet die fette Schnepfe geistlos und rümpft die Nase. Es stinkt wie die abgestandene Säuferpisse eines Penners, der tagelang billigen Fusel gesoffen hat. Aber selbst als die warme Nässe über den Asphalt läuft und gegen meine aufgeschürften Knie schwappt, lockert sich der Griff meiner Schenkel um diesen winselnden Wichser keinen Millimeter. Der grelle Lichtstrahl einer Taschenlampe blendet mich, und eine herrische Stimme befiehlt mir, langsam aufzustehen. Ich blinzle und sehe, wie die fette Schnepfe von einem Cop weggezerrt wird. Ich versuche, dem Befehl Folge zu leisten, aber mein Körper fühlt sich an, als wäre er auf diesem pissenden Wicht eingerastet. Außerdem werde ich mir gerade der Tatsache bewusst, dass ich, umringt von Cops, im Minirock und mit gespreizten Beinen mitten auf dem Highway auf einem urinierenden Fremden knie und die Autos an mir vorbeizischen. Während noch immer das erstickte Heulen des Klappergestells am Boden zu hören ist, werde ich von zwei groben Händen gepackt. Ein zu kurz geratenes Latina-Mannweib in Uniform schiebt ihre fummelnden Griffel unter meine Achseln, zerrt an mir herum und keift mir barsch ins Gesicht: — Treten Sie jetzt gefälligst beiseite!
Als ich aufstehe, trample ich über den auf der Fahrbahn liegenden Typen hinweg. Das ist so verdammt peinlich. Meine Freundin Grace Carillo ist Cop in Miami. Ich könnte ja ihren Namen erwähnen, aber ich will nicht, dass sie oder sonst jemand, den ich kenne, mich so sieht. Mein knallenger, superkurzer Jeansrock ist so weit hochgerutscht, dass er nun wie ein dicker, zusammengerollter Gürtel um meine Taille liegt und meine Unterwäsche zu sehen ist. Jeansstoff rutscht nicht von allein wieder an seinen Platz, und weil die Bullenschlampe mich einfach nicht loslässt, kann ich meinen Rock nicht zurechtrücken. — Ich muss meinen Rock runterziehen, rufe ich.
— Treten Sie zur Seite!, brüllt die Schlampe mich abermals an. Ich blicke in die erstarrten, wächsernen Gesichter der Cops, die mich im Licht der Straßenlaternen inspizieren, als ich von dem hosenpissenden Wichser zurücktrete.
Endlich gelingt es mir, den Rock runterzuziehen und glatt zu streichen. Ich verspüre das Bedürfnis, der Schlampe ein zweites Arschloch zu verpassen, bevor ich mich an Grace’ Mahnung erinnere, dass es niemals klug ist, sich mit einem Cop des Miami-Dade Police Department anzulegen. Diese Typen werden geschult, davon auszugehen, dass jeder eine Schusswaffe bei sich trägt. Die beiden anderen Cops, zwei Männer, einer schwarz, einer weiß, legen dem schluchzenden Schützen Handschellen an und zerren ihn auf die Beine. Sein Gesicht ist blass, der Blick seiner tränennassen Augen zu Boden gerichtet. Ich erkenne, dass er noch ein halbes Kind ist, höchstens Anfang zwanzig. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht?
— Diese Frau ist eine Heldin, höre ich die aufgeschwemmte Tussi mit überdrehtem Quieken bekunden. — Sie hat den Kerl da entwaffnet. Anklagend zeigt sie auf den Jungen in Handschellen, der sich vom eiskalten Killer in ein bemitleidenswertes Würstchen mit einem großen feuchten Fleck im Schritt verwandelt hat. Ich fühle die eklige Nässe auf meinen zerschrammten Knien. — Er hat auf diese zwei Männer geschossen, fügt die Tussi hinzu und zeigt hinüber zum Rand der Brücke.
Die zwei Krüppel stehen jetzt nebeneinander und beobachten das Geschehen. Der Latino will sich offenbar verkrümeln, während der weiße Kerl die Augen mit der Hand vor dem grellen Licht der Straßenlaterne abschirmt. Zwei Cops gehen zu ihnen hinüber. Die fette, kleine Trulla redet immer noch ohne Luft zu holen auf die Latina-Polizistin ein. — Sie hat ihm die Knarre weggenommen und sie unter das Auto getreten, ihr pummeliger Finger zeigt auf die Stelle. Sie streicht sich den verschwitzten Pony aus den Augen und schwenkt das Telefon in der anderen Hand. — Ist alles hier drauf!
— Was hat Sie denn veranlasst, da drüben zu halten?, fragt der schwarze Cop, während ich mitbekomme, wie der andere, ein Weißer, meinen Cadillac mustert und dann irritiert zu mir hinübersieht.
— Mir ist beim Fahren schlecht geworden, erklärt die Dicke, — ich musste rechts ranfahren. Schätze, ich hab was Falsches gegessen. Aber ich hab alles gesehen. Sie spielt den Cops das Video auf ihrem iPhone vor. — Ein anderes Auto hat einen der Männer da angefahren, aber der Fahrer hat nicht einmal gehalten!
Obwohl der Trommelschlag meines Herzens lauter hämmert als nach dem Cardio-Training, komme ich nicht umhin festzustellen, dass die Haut dieser Frau im pulsierenden roten Licht des Polizeiwagens beinahe exakt den Farbton des grauenhaften pinkfarbenen T-Shirts trifft, das sie zu ihrer sackartigen Jeans trägt.
— Ehrlich, er hat einfach auf uns gefeuert. Der weiße Kerl mit dem zerschmetterten Bein hat sich zurück über die Straße geschleppt. Flankiert von einem Cop und das faltige Ledergesicht vor Schmerz verzerrt, zeigt er auf diesen miesen Arsch von Killer, der gerade auf den Rücksitz eines Streifenwagens gestoßen wird. — Diese Lady hat mir das Leben gerettet!
Meine Hände zittern. Ich wünsche mir inständig, ich wäre bei Miles geblieben. Sogar dieser rückenkranke Schlappschwanz wäre besser gewesen, als in dieser Scheiße zu stecken. Die bullige Beamtin, die mich jetzt zu einem anderen Streifenwagen eskortiert, hat so einen starken Latino-Akzent, dass ich sie kaum verstehe, als sie beruhigend auf mich einredet. Offenbar wollen sie den Cadillac mitnehmen. Ich murmle, dass die Schlüssel vermutlich noch im Zündschloss stecken und meine Freundin Grace Carillo beim Miami-Dade Police Department in Hialeah arbeitet. Unser Wagen fährt los. Die fette Schnepfe quasselt wie ein Wasserfall, reckt ihren wabbeligen Hals hin und her und redet mit einem breiten Akzent, der verdammt nach Mittlerem Westen klingt, auf mich und die Kampflesbe in Uniform ein. — Das war das Mutigste, was ich je erlebt habe!
Ich fühle mich kein bisschen mutig. Ich zittere, denke: Was zum Teufel hat mich nur geritten, die Autotür zu öffnen?, und bin dann eine kleine Weile weggetreten, mit den Gedanken woanders oder was auch immer. Als mir bewusst wird, wo wir sind, biegen wir gerade in die Tiefgarage der Polizeistation von Miami Beach Ecke Washington und 11th Street ein. Ein Kamerateam der Lokalnachrichten ist bereits dort und macht uns Platz, während wir den Schlagbaum passieren. — Diese Arschlöcher werden auch immer schneller, sagt die lesbische Latina am Steuer, aber mehr so als bloße Beobachtung, nicht wirklich verärgert. Wie aufs Stichwort habe ich, kaum dass ich das Gesicht zum Seitenfenster drehe, ein Kameraobjektiv vor der Nase. Die fette Tussi in Pink – ihre glasigen Augen flitzen hektisch zwischen mir und dem Reporter hin und her – brüllt fast schon vorwurfsvoll: — Sie war’s! Sie war’s! Sie ist eine Heldin! Und mein Spiegelbild, das mir aus der Kameralinse entgegenblickt, sagt mir, dass ich gerade ziemlich baff aus der Wäsche glotze.
Mir wird klar, dass es allmählich Zeit ist, mich am Riemen zu reißen. Und als Schweinchen Pinkie zum x-ten Mal in diesem einfältigen, euphorischen Ton sagt: — Wahnsinn, du bist echt eine richtige Heldin, fühle ich, wie ein kleines Lächeln meine Lippen umspielt, und ich denke mir: Scheiße, Mann, vielleicht bin ich das ja wirklich.
2 Lenas Morgenseiten 1
Ich probiere alles mal aus, habe ich zu Kim gesagt, als sie mir erzählte, dass es ihr total viel bringen würde, diese sogenannten Morgenseiten zu schreiben. Dabei assoziiert man einfach frei und notiert, was einem so durch den Kopf schwirrt. Tja, letzte Nacht hab ich ausnahmsweise richtig was erlebt. Also lege ich doch einfach mal los:
Ich hatte auf dem Seitenstreifen des Causeway gehalten, bin raus aus dem Auto, in die stickige, regennasse Luft, stützte mich mit beiden Händen auf die Leitplanke, blickte hinaus über die Biscayne Bay und starrte auf das schwarze, aufgewühlte Wasser. Dann hörte der heftige Regen schlagartig auf, und im selben Augenblick durchschnitt wütendes Hupen die Nacht, gefolgt vom lauten Quietschen von Bremsen. Dann tauchten sie aus der Dunkelheit auf. Die Autos. Die Männer. Und sie. Gebrüll, Schreie, dann ein schrilles Pfeifen, das, wie ich von den Jagdausflügen mit meinem Vater wusste, ein Schuss war. Ich hätte sofort zurück ins Auto steigen und abhauen sollen, aber aus irgendeinem Grund, den ich mir selbst immer noch genauso wenig erklären kann wie diesen verdammt hartnäckigen Polizisten, tat ich es nicht. Stattdessen wagte ich mich ein paar Schritte auf die Straße hinaus und begann, mit meinem iPhone zu filmen. Ich bin nicht blöd. Das habe ich auch den Polizeibeamten gesagt. Denn so abschätzig, wie die mich ansahen, war klar, dass sie mich nicht ernst nahmen. War vermutlich meine eigene Schuld. Ich wollte die Situation erklären, war aber so aufgeregt, dass ich aus lauter Unsicherheit und Nervosität viel zu viel geredet habe. – Das ist sie, rief ich und zeigte auf das Mädchen, die Frau, die gerade den Schützen überwältigt hatte.
Dann zeigte ich ihnen das Handy. Zuerst, als sie den Schützen zu Boden trat, war das Bild sehr dunkel, aber es wurde besser, als ich näher heranging. Sie kniete auf ihm und hielt ihn fest.
Es war offensichtlich, dass selbst die Polizeibeamten voller Bewunderung für diese Lucy Brennan waren, nachdem sie meinen Film gesehen hatten. Sie machte aber auch eine super Figur: In ihr langes braunes Haar hatte die Sonne Floridas honigfarbene Strähnchen gemalt. Ihre dichten Augenbrauen betonten die großen, stechenden, mandelförmigen Augen, und sie hatte eine scharf definierte, trapezförmige Kieferpartie. Im Kontrast zu dieser amazonenhaften Härte stand ihre zierliche Stupsnase, die ihr eine verblüffende Niedlichkeit verlieh. Sie trug einen kurzen Jeansrock, eine weiße Bluse und weiße Ballerina-Sneakers. Eines ihrer Knie war aufgeschürft, was wahrscheinlich passiert ist, als sie den Schützen zwischen ihren wohlgeformten, muskulösen Schenkeln am Boden gehalten hatte.
Sie nahmen uns alle (mich im selben Wagen wie die Heldin, den Täter und sein Opfer in einem anderen) nach South Beach auf die Wache mit. Dann trennten sie mich von Lucy Brennan. Ich wurde in einen Verhörraum mit nackten grauen Wänden geführt, in dem es bloß einen Tisch, mehrere harte Stühle und eine schmerzhaft grelle Beleuchtung gab. Sie schalteten ein Aufnahmegerät ein und stellten mir alle möglichen Fragen. Immer wieder löcherten sie mich: Wohin ich unterwegs war? Wo ich zuvor gewesen bin?
Als hätte ich etwas verbrochen, nur weil ich auf der Brücke angehalten habe und aus dem Auto gestiegen bin, um frische Luft zu schnappen!
Was soll man da sagen? Ich habe ihnen die simple Wahrheit erzählt: dass ich schlecht drauf war wegen der E-Mail von meiner Mom, durch den Wind wegen der Sache mit Jerry, frustriert von meiner Arbeit, und dass ich ein schlechtes Gewissen wegen der Tiere hatte, weil ich ihre Knochen verarbeite. Dass es mir einfach richtig beschissen ging. Ich spürte eine Migräne kommen, also hielt ich an – bloß um Luft zu schnappen, sonst nichts. Sie hörten zu, dann fragte eine Polizistin, die Latina, die als Erste vor Ort gewesen war, mich erneut: – Was passierte als Nächstes, Ms. Sorenson?
– Das ist alles auf dem Handy zu sehen, sagte ich ihr. Ich hatte ihnen das Video bereits weitergeleitet.
– Wir müssen es auch in Ihren eigenen Worten hören, erklärte sie.
Also kaute ich alles noch einmal durch.
Lucy Brennan. Im Warteraum der Wache erzählte sie mir, dass sie Trainerin ist, also Fitnesstrainerin. Was Sinn ergibt: Sie strotzte vor Gesundheit, Kraft und Selbstbewusstsein. Ihre Haut schimmerte, ihr Haar glänzte, und ihre Augen strahlten.
Und so erschöpft ich auch war, versetzte mich ihre bloße Gegenwart in fiebrige Aufregung. Denn ich spürte, dass jemand wie Lucy mir helfen konnte. Als die Polizei mit mir fertig war und sie mir eine Pfandmarke für die Schlüssel meines Wagens in der Tiefgarage gegeben hatten (sie bestanden darauf, dass ich ihn nicht selbst nach Hause fahren konnte), blieb ich noch ein wenig und hielt nach ihr Ausschau, doch sie war schon weg. Ich fragte einen Polizisten am Empfang, ob ich wohl irgendwie mit ihr in Kontakt treten könnte. Er blickte mich bloß streng an und sagte: – Das ist keine gute Idee.
Ich fühlte mich wie ein getadeltes Kind. Als der Kerl von den Lokalnachrichten mich vor der Tür sehr nett und höflich ansprach, gab ich ihm also gerne ein Interview und schickte ihm mein Handy-Video.
Das sind also meine Morgenseiten. Ich schreibe eine E-Mail an Kim, in der ich ihr dasselbe berichte, aber nicht an Mom, denn sie und Dad machen sich schon genug Sorgen, weil ich in Miami bin. Als ich zu Hause ankam, war ich – obwohl fix und fertig – immer noch ganz aufgekratzt. Also ging ich ins Arbeitszimmer und machte eine Zeichnung. Ich bin kein Porträtzeichner, aber ich musste einfach versuchen, Lucys goldbraune Mähne festzuhalten. Ich kann an nichts anderes mehr denken, als zum Telefon zu greifen und sie anzurufen.
Aber wie zum Teufel stelle ich das an?
3 Heldin
Konnte nicht schlafen. Hab’s nicht mal probiert. Bei Sonnenaufgang wärme ich mich im Flamingo Park mit Dehnübungen für meinen allmorgendlichen Lauf auf. Schließlich kann ich nicht zulassen, dass Miles, ein Autounfall, so ein herumballerndes Arschloch oder meinetwegen selbst das komplette Miami-Dade Police Department mir meinen geregelten Tagesablauf durcheinanderbringen. Mit lockeren 12 km/h trabe ich über die 11th Street Richtung Meer. Latino-Straßenarbeiter richten umgekippte Palmen auf und stabilisieren sie mit hölzernen Stützen. Die Bäume rascheln und wedeln dankbar in der kühlen Brise.
Als ich in meinem zweiten Highschool-Jahr als aufmüpfiger Teenager zum ersten Mal hierherkam, erklärte mir Lieb, Moms Lover, dass Palmen flacher wurzeln als die meisten anderen Bäume, weshalb sie bei einem Hurrikan oder Sturm zwar leicht umgeblasen werden, aber nicht so große Schäden davontragen. Ich weiß noch, wie sehr ich damals Boston vermisste, weshalb ich bloß patzig erwiderte, offenbar seien in Miami sogar die Baumwurzeln oberflächlich. Aber ich schenkte den Palmen damals eh kaum Beachtung, da ich meinen angeekelten Blick nicht von dem roten Fleck auf Liebs kahl werdendem Schädel abwenden konnte. Einige Monate danach, als sich herausstellte, dass es sich dabei um eine aggressive Form von Hautkrebs handelte (der später Gott sei Dank erfolgreich entfernt wurde), hatte ich ein schlechtes Gewissen deswegen.
Als ich die Washington Avenue erreiche, verlangsame ich das Tempo für ein paar Blocks auf 7 km/h, um die schäbige Anhäufung von Tätowierstudios, Sportbars, Nachtclubs und Geschäften für geschmacklose Strandkleidung zu betrachten. Selbst so früh am Tag treiben sich hier ein paar Grüppchen angetrunkener Jugendlicher herum und amüsieren sich beim Schaufensterbummel. Kichernde Mädchen quieken beim Anblick von Tangas mit Schriftzügen wie SEI KEINE PUSSY, LECK LIEBER EINE entzückt auf, während die Jungs sich mit grölendem Gelächter über T-Shirts mit der Silhouette einer nackten Striptänzerin und dem Spruch ICH UNTERSTÜTZE ALLEINSTEHENDE MÜTTER freuen. Von plüschigen Cocktail-Lounges über stillose Pubs bis hin zu heruntergekommenen Spelunken findet man in South Beach geeignete Etablissements für Vertreter sämtlicher gesellschaftlicher Schichten. Das Einzige, was sie zusammenhält, ist ihre Leidenschaft für lupenreinen, unverfälschten Schund. Cabrios rollen vorbei, die dudelnden Stereoanlagen häufig teurer als das Auto selbst, und protzen vor dem Pöbel, weil sich auf dem Ocean Drive oder der Collins Avenue niemand für sie interessiert, sondern alle mit ihren eigenen narzisstischen Angelegenheiten beschäftigt sind. Ein Trio zitternder Junkies teilt sich einen Joint in einem Hauseingang. Etwas weiter unten liegen zwei Gestalten unbestimmten Geschlechts unter einem Haufen schmutziger Wäsche.
Ich hab die Schnauze voll von diesem Elend: Vorbei an einem torkelnden Besoffenen, der irgendwelchen Schwachsinn brabbelt, biege ich ab in Richtung Collins und Ocean, Strand und Meer. Ohne diesen Kickstart in meinen Tag wäre ich verloren. Ein Tag ohne Morgenlauf ist ein Tag, durch den man sich durchwurstelt, statt ihn anzugreifen.
Ich lege einen Zahn zu und laufe mit rund 16 km/h über den asphaltierten Fußweg am Strand bis nach South Pointe. Auf dem Rückweg ziehe ich das Tempo noch einmal an. Ich fliege jetzt an allen vorbei, meine Laufschuhe klatschen rhythmisch auf den Boden, mein Atem geht gleichmäßig und kontrolliert. So fühlt es sich an, wenn man weiß, dass man zu den Göttern gehört. Alle anderen, diese dahinwatschelnden Sterblichen, sind nichts als Loser: so langsam, so beschränkt. Ich nehme wieder ein wenig Tempo raus, und mit 12 km/h überquere ich den Ocean Drive, ohne die schlafwandelnden Autos groß zu beachten. Ich laufe die 9th Street entlang und biege schließlich in die Lenox Avenue ein. Auf der Straße vor meinem Apartment sehe ich eine Menschenansammlung. Wie viele andere in dieser Gegend hat auch unser Haus eine Art-déco-Fassade. Es ist lavendelfarben und pistaziengrün gestrichen, mit einem abstrakten geometrischen Muster, das an die Streifen und Bullaugen eines Ozeanriesen angelehnt ist. Aber warum sind da Typen mit Kameras und schießen Fotos von der Umgebung des Gebäudes? Schlagartig befällt mich die Sorge, es könnte vielleicht ein Feuer ausgebrochen sein. Aber als ich näher komme, wird mir klar: Der Aufstand gilt mir!
Schnell mache ich kehrt und laufe auf der 9th Street zurück Richtung Hintereingang. Doch eins dieser Arschlöcher hat mich bemerkt und brüllt: — LUCY! EINEN MOMENT, BITTE!
Eine Stampede von Paparazzi: eine Herde rotgesichtiger, krankhaft adipöser Schnaufer und dürrer Vampir-Alkoholiker, die in die Sonne blinzeln, während sie Witterung aufnehmen und sich dann auf mich stürzen. So schnell gebe ich mich allerdings nicht geschlagen. Ich reiße die Schlüssel aus der Tasche und öffne die vergitterte Metalltür zur Hintertreppe, schlüpfe hindurch und knalle sie gerade noch rechtzeitig hinter mir zu, sodass das geifernde Pack sich gegen das Gitter und ineinanderschiebt. Ich steige die Treppe hinauf und ignoriere ihr lärmendes Gezeter.
Im Apartment stürze ich zum offenen Hinterfenster – die hereinströmende kühle Morgenluft ist süß wie Quellwasser – und warte, bis Puls und Atmung sich normalisieren. Immer wieder ertönt der Türsummer, bis ich schließlich nachgebe und den Hörer der Gegensprechanlage an mein Ohr presse. — Lucy, Live!-Magazin, wir würden wirklich gerne mit Ihnen über ein Exklusiv-Interview sprechen!
— Kommt nicht in die Tüte! Verpisst euch! Hört auf, hier zu klingeln, oder ich rufe die Polizei! Ich hämmere den Hörer zurück in die Wandhalterung. Ein düsterer Instinkt lässt mich zum Küchenschrank gehen, wo ich meine .22er Luftpistole aufbewahre. Ich habe sie mir letzten Sommer gekauft, als sich irgend so ein Spinner hier herumdrückte. Irgendwie verschaffte er sich Zutritt zum Haus und belästigte ein Mädchen, das im Erdgeschoss wohnte. Ich kannte sie nicht, obwohl ich ihr natürlich gelegentlich über den Weg lief. Ich weiß nicht genau, was vorgefallen ist, in der Presse wurde nicht darüber berichtet, aber man hört halt, was im Haus so geredet wird. Manche sagen, das Arschloch habe sie vergewaltigt, andere, er habe sie bloß mit Klebeband gefesselt und auf sie ejakuliert. Was auch immer passiert ist, der Typ war ein kranker Wichser.
Meine »Pistole« ist keine scharfe Waffe: Sie verschießt bloß Bleikugeln mit Luftdruck. Ich mag keine Schusswaffen. Unsere Gefängnisse und Leichenhallen sind voll mit schwachköpfigen Witzbolden, die der Meinung waren, eine Knarre würde ihnen Respekt verschaffen. Allerdings hatte mir der Vorfall einen gehörigen Schrecken eingejagt, weshalb ich ihn zum Anlass nahm, einen Selbstverteidigungskurs für Frauen ins Leben zu rufen.
Ich checke mein Handy: Die Geschichte scheint bereits im Fernsehen zu sein, angesichts all der verpassten Anrufe, der wohlmeinenden Sprach- und Textnachrichten von Mom, Dad, meiner Schwester Jocelyn (ein leidenschaftsloses »Alle Achtung, gut gemacht« in ihrer tiefen, kehligen Stimme), Grace Carillo vom MDPD (die mit mir die Selbstverteidigungskurse leitet), Jon Pallota, dem nie anwesenden Besitzer von Bodysculpt (eins von zwei Studios, in denen ich arbeite, eine Witznummer), Emilio von Miami Mixed Martial Arts (das andere, ernst zu nehmende Studio), Freunden wie Chefkoch Dominic und einer Schar alter College-Kumpels sowie ehemaligen und aktuellen Klienten.
Das hebt meine Stimmung, und ich nehme eine ausgiebige Dusche. Obwohl ich den Kaltwasserhahn voll aufgedreht habe, fühlt es sich auf meiner glühenden Haut lauwarm an. Nachdem ich fertig bin, spähe ich durch die Schlitze meiner Jalousien. Der Menschenauflauf scheint sich zerstreut zu haben, aber es könnten immer noch irgendwo Nachzügler herumschleichen. Erneut ertönt der Türsummer. Jetzt so richtig in der Stimmung, einem dieser Schwanzlutscher den Kopf abzureißen, brülle ich: — JA!!?
Aber diesmal ist es eine Frauenstimme, ihr Tonfall honigsüß und beschwichtigend. — Mein Name ist Thelma Templeton, von VH1. Ich bin keine Paparazza und auch nicht von den Lokalnachrichten. Ich will keine Fotos und kein Interview. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie mich reinlassen, komme ich ganz allein zu Ihnen rauf. Ich möchte mit Ihnen über eine Fitness-Querstrich-Lifestyle-Sendung reden.
Scheiße, ja! Sofort betätige ich den elektrischen Türöffner. Dann fällt mir ein, dass sie mir möglicherweise Mist erzählt und mich für dumm verkauft hat. Also öffne ich die Wohnungstür und spähe ins Treppenhaus hinab, jederzeit bereit, mich zurückzuziehen und sie wieder zuzuschlagen, sollten irgendwelche Arschlöcher auftauchen. Nach kurzer Zeit höre ich das beruhigende Geräusch hochhackiger Schuhe, und eine Frau erscheint auf der Treppe zu meiner Etage. Kein Anzeichen, dass sie eine Kamera dabeihat. Sie ist um die vierzig, nervtötend langsam, hat einen leicht o-beinigen Gang, glattes blondes Haar mit aufgehellten Strähnchen, ein mit Botox behandeltes Gesicht und trägt ein dunkles Kostüm. Ich rühre mich nicht vom Fleck, und als sie näher kommt, platzt es aus ihr heraus: — Lucy, sie schüttelt meine Hand und tritt in mein beengtes Apartment. — Das ist aber gemütlich. Sie lächelt, nimmt auf meine Einladung hin auf der kleinen Couch Platz und sagt Ja, als ich ihr einen grünen Tee anbiete.
Man sieht ihr das Fitnessstudio an, von Cellulite oder Fettdellen keine Spur. Bei Thelmas Angebot geht es um eine Makeover-Show: Ich soll mich irgendeiner übergewichtigen, von Minderwertigkeitskomplexen geplagten Schwabbeltrulla annehmen, die in diesem Jahrhundert noch kein Rendezvous hatte oder von ihrem Ehemann seit Jahren nicht mehr gevögelt wurde, dafür sorgen, dass sie Gewicht verliert, und so ihr Selbstvertrauen stärken. Wenn ich sie in Form gebracht habe, reiche ich sie an irgendeine Designer-Schwuchtel weiter, die Phase 2 beaufsichtigt, den Schmink- und Klamotten-Teil. — Wir haben diverse Konzepte. Aber dieses hier ist die stärkste und einfachste Variante. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die Idee, drehen die Pilotfolge, und wenn die Zahlen stimmen, legen wir sofort mit der ersten Staffel los, erklärt sie, bevor sie weiter ins Detail geht. Als sie fertig ist, steht sie auf und fragt: — Von wem werden Sie vertreten?
— Ich, ähm, bin noch mit verschiedenen Agenten im Gespräch, lüge ich.
— Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit damit. Schmieden Sie das Eisen, solange es noch heiß ist, empfiehlt sie nachdrücklich. — Es gibt ein paar gute Leute, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Wenn Sie wollen, kann ich Ihre Kontaktdaten an sie weiterreichen. Ich will Sie nicht unter Druck setzen, schließlich müssen Sie selbst herausfinden, wer für Sie der Beste ist, aber ich kenne eine Frau, die Sie wirklich mal treffen sollten. Sie heißt Valerie Mercando. Ich glaube, Sie beide würden sich blendend verstehen!
— Großartig!
Sie reicht mir ihre Visitenkarte, und ich gebe ihr eins von den total abgefahrenen Teilen mit dem Prägedruck, die Jon Pallota für mich gemacht hat:
LUCY BRENNAN
HARDASS TRAINING
Keine faulen Ausreden, nur knallharte Ergebnisse!
Hol das Beste aus dir raus!
Sie nimmt meine Karte in ihre perfekt manikürte Hand. — Wow! Das ist ja so beeindruckend, Sie haben wirklich diese unverblümte, kompromisslose Art, die wir uns erträumt haben. Jemand, der Amerika aus seiner Selbstzufriedenheit holt. Jemand, der sogar noch härter drauf ist als Jillian Michaels!
— Ich würde es jederzeit mit ihr aufnehmen, auf dem Laufband, der Hantelbank oder im Ring, sage ich und merke, wie sich mein Kinn trotzig vorreckt.
— Ich bezweifle, dass das nötig sein wird, lacht Thelma, — aber man kann ja nie wissen.
Ich begleite sie zur Wohnungstür hinaus und über den Flur zur Vordertreppe. — Ehrlich, ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich eine eigene Fernsehshow bekomme!
— Lassen Sie uns nichts überstürzen. Thelma tätschelt wie zum Schutz vor einer nicht existenten Windböe ihre Haare, bevor sie zur Haustür geht. Ich trete an die Scheibe, um zu sehen, ob die Luft rein ist. Offenbar ja. Ihre Hand greift nach der Tür, und sie blinzelt ins Sonnenlicht. — Erst eine Pilotfolge, dann schauen wir, ob die Zahlen stimmen, sagt sie fröhlich. — Alles hängt von den Zahlen ab. Sie holt eine Sonnenbrille aus ihrer Handtasche und setzt sie auf. — Bis bald, Lucy!
— Tschüs. Meine Stimme klingt gedämpft und skeptisch, als ich die Tür zufallen lasse. Ein merkwürdiger Schauder aus Furcht und Aufregung überkommt mich. Durch die Glastür winke ich Thelma hinterher, dann sprinte ich die Treppe hinauf, zurück zu meiner Tasse grünem Tee.
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die von Zahlen und Maßen besessen ist. Mein Dad, der – abgesehen von einer unspektakulären Dienstzeit beim Boston Police Department – die meiste Zeit als Sportlehrer gearbeitet hat, nahm mich regelmäßig ins Fenway Park Stadion mit, um mich mit den Statistiken jedes einzelnen Baseballspielers zu bombardieren. Wenn eine Leistung, egal ob schwach oder respektabel, eine der Hypothesen bestätigte, die er aufgrund dieser Zahlen aufgestellt hatte, beugte er sich zu mir hinüber und raunte vielsagend: »Die Zahlen lügen nie.« Oder: »Vertraue niemals der menschlichen Subjektivität, Mathematik ist ein Gottesgeschenk … halt die Statistik im Auge, Essiggürkchen, halt die Statistik im Auge.«
Zu den Zahlen, die meine Jugend bestimmten, gehörten meine Testergebnisse und mein Notendurchschnitt. So hoch die Erwartung meiner Mutter war, so wenig wurde ich ihr gerecht. Das machte mich für meine Mom zum Mysterium: Sie wurde einfach nicht schlau aus mir. In ihren Augen war dieses Defizit einzig durch meinen Charakter zu erklären. Beziehungsweise meinen Mangel daran. Meinem Dad dagegen konnten meine Noten kaum gleichgültiger sein, dennoch war er sich mit meiner Mom einig, was die Charakterfrage betraf. Nur dass sie für ihn dadurch beantwortet wurde, dass ich im Sport seiner Meinung nach hinter meinen Möglichkeiten zurückblieb.
Unser Zuhause war das im Speckgürtel Bostons gelegene Städtchen Weymouth in Massachusetts, das zum South Shore gehört, der sogenannten Irischen Riviera. Jocelyn, meine achtzehn Monate jüngere Schwester, war damals eher der intellektuelle Typ und hoffnungslos unsportlich. Dad gab sich alle Mühe mit ihr, doch selbst er musste sich geschlagen geben, worauf er mehr oder weniger das Interesse an ihr verlor. Stattdessen setzte er künftig alles daran, mir solche Schwächen wie Passivität oder Faulheit abzutrainieren. Er bläute mir ein, diese Eigenschaften zutiefst zu verabscheuen und mit Händen und Füßen gegen sie anzukämpfen. Dafür, und ganz allein dafür, bin ich ihm bis heute dankbar. Jocelyn, die Zuckerschnute zu meinem Essiggürkchen, wurde Moms gehätschelter Liebling. Schwer zu sagen, wer von uns beiden das härtere Los gezogen hat.
Ich trinke meinen Tee aus. Ein Gähnen überfällt mich, und ich breche zum ersten Kundentermin des Tages auf. Vor der Haustür bleibt alles still, als ich einen Blick in den Briefkasten werfe. Eine Karte informiert mich, dass ich den Caddy vom Parkplatz des MDPD abholen kann. Die Polizei hat ihn dabehalten, um den Schaden an der Motorhaube zu begutachten.
Ein kurzer Fußweg bringt mich zu Bodysculpt, einem von zwei Fitnessclubs in South Beach, in denen ich meine Termine mache. Auftritt Marge Falconetti: Direktorengattin, eine 1,70 m große und 130 kg schwere Specklawine. Titten, Taille oder Arsch sucht man bei ihr vergeblich – sie ist bloß ein einziger riesiger Fleischklops. Nach ein paar Aufwärmübungen lasse ich sie eine 5-kg-Kugelhantel stemmen.
— Ganz durchstrecken, Marge, so ist’s richtig, bearbeite ich das alte Mädchen und lasse es erst einmal langsam angehen, während ich gegen die Müdigkeit und die merkwürdige schleichende Stille an diesem Ort ankämpfe, die für ein Fitnessstudio völlig untypisch und heute sogar schlimmer als üblich ist. Marge strengt sich richtiggehend an, aber sie schielt die ganze Zeit andachtsvoll zu mir rüber und dann in schierer Ehrfurcht über mich hinweg. Ich folge dem Blick ihrer Telleraugen zu einem der zahllosen Fernsehgeräte, die an sämtlichen Wänden hängen, und sehe – o Graus – einen lokalen Nachrichtensender und nebenan gleich noch einen. Beide wiederholen die Topnachricht von gestern Abend – mit mir in der Hauptrolle. Als ich auf dem Bildschirm erscheine und wie ein Weichei in die Kamera blinzle, bricht Lester, einer der anderen Trainer, in lauten Jubel aus und animiert damit die anderen zum Klatschen.
— Das zeigen die ständig, alle halbe Stunde, grinst er.
— Du bist ja so mutig, lächelt Marge gequält. Ich sehe sie scharf an, um ihr deutlich zu machen, dass sie von mir keine Schonung zu erwarten hat, bloß weil sie mir Zucker in den Arsch bläst, dann drehe ich den Kopf wieder zum Fernseher.
Und da bin ich, wie ich diesen bewaffneten Hosenpisser zu Boden trete. Es ist ein recht eindrucksvoller Frontkick: Mein Fußballen trifft ihn mit Schmackes zwischen den Schulterblättern, und zwar weiter oben, als ich dachte. Als die Kamera näher kommt, sitze ich schon auf seinem Rücken. Da, wo mir der Rock hochgerutscht ist, sind Arsch und Höschen gepixelt. Ich sehe mir selbst dabei zu, wie ich dem Typ ein paar Haken in die Seiten verpasse, an die ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnere. Seine Passivität wirkt gruselig, als würde ich auf einer Leiche hocken. Eine Stimme kreischt: — Ich habe die Polizei gerufen, als das Bild plötzlich verwackelt. Dann sehe ich mich selbst in der Halbnahen, und der Asphalt färbt sich dunkel vom Urin des Schützen. Schließlich folgt eine etwas professionellere Einstellung von mir durch die Scheibe des Polizeiwagens.
Heilige Scheiße, ich kann sogar mit den beiden fünfzehnjährigen siamesischen Zwillingen aus Arkansas mithalten. Die Mädchen haben sich in die Haare bekommen, weil eine von ihnen auf ein Date mit ihrem Freund besteht, sodass die andere, die körperlich schwächere der beiden, sprichwörtlich mitgeschleift wird, ob sie will oder nicht. Ich male mir aus, wie es wohl wäre, mit Jocelyn verwachsen zu sein, sie zu jedem Mist, den ich tue, mitschleppen zu müssen oder – schlimmer noch – zu allem, was sie macht, mitgeschleppt zu werden. Um nichts in der Welt!
Ganz Amerika ergötzt sich an der sogenannten Moralfrage, dabei handelt es sich doch eigentlich um den feuchten Traum jedes degenerierten Arschlochs. Zwischen den Zeilen gelesen will die eine es mit ihrem Freund treiben, worauf ihr die andere mit dieser religiösen Scheiße kommt. Diese Mädchen haben die Nation in zwei Lager gespalten. Ein bisschen davon habe ich gestern Abend mit Miles zu schmecken bekommen, bevor wir uns wegen seiner Warmduscher-Rückenwirbel gezofft haben. Jungs wie er halten die knospende Schönheit Annabel, eine der beiden Schwestern, für eine durchtriebene, aber vom Glück verwöhnte kleine Schlampe. Ich weiß noch, wie die Jungs in meiner Highschool die Zwillingsschwestern aus einer anderen Klasse zu einem Dreier überreden wollten und sich dann aufrichtig wunderten, warum diese Mädchen von ihnen angewidert waren. Würde etwa irgendeiner dieser Hirnamputierten seinen eigenen Bruder vögeln wollen? Das nennt man Einfühlungsvermögen, aber selbst ein so essenzielles Gefühl ist bei Miles allenfalls ein Lippenbekenntnis. Egal, im Fernsehen sagt so ein geschniegeltes Muttersöhnchen namens Stephen Abbot, gegen den Justin Bieber wie der Bastard aus einer Affäre zwischen Iggy Pop und Amy Winehouse wirkt, gerade schmollend: — Ich kenne die Mädchen schon was länger und hab Annabel echt gern. Is’ ja nich’ so, dass ich ein Perverser bin. Ich geh halt bloß mal gern mit ihr ins Kino, ’ne Limo trinken und vielleicht was zum Naschen kaufen. Aber manche Leute haben ’ne schmutzige Fantasie, und es wird immer jemand versuchen, da was draus zu drehen, was es nich’ is’.
— Als Annabel nickt, unterbricht ihn der andere Zwilling, Amy, und sagt: — Das ist ja nicht alles. Sie knutschen andauernd, und das ist eklig!
Ich reiße den Blick vom Bildschirm los und sehe zu, wie Marge sich grunzend durchs letzte Set rackert. Dann ist es Zeit, ihren massigen Leib aufs Laufband zu wuchten. Ich stelle es auf 5,5 km/h ein, um sie auf Trab zu bringen, und beschleunige dann auf 8 km/h, ein solides Trotten. — Na los, Marge, rufe ich, als sie widerstrebend draufloswalzt.
— Mannomann, sagt Lester (1,80 m, 84 kg), der immer noch auf den Bildschirm schaut, zu seiner Klientin, einer hübschen, motivierten College-Professorin, die auf dem benachbarten Laufband zügig und gleichmäßig vor sich hin läuft, — die Mädels haben’s nicht leicht, so viel steht mal fest.
Drauf geschissen. Sollen die anderen doch die philosophischen Probleme debattieren. Ich schraube die ächzende Marge auf 10 km/h hoch und grüble derweil über eine weitere Zahl nach: Letzte Woche war mein 33. Geburtstag. 33 – das Alter, in dem die meisten echten Athleten steif werden. Spätestens dann weiß man, dass jemand ernsthaft Sport treibt und nicht nur spielt: Wenn er mit 34 am Ende ist. Man sagt ja, die mittleren Jahre fangen mit 35 an, aber das ist eine Überzeugung, die ich mir nicht leisten kann. Ein Teil von mir jubelt, wenn Gangmitglieder oder Fettärsche wie die schwitzende Marge hier vor ihrer Zeit ins Gras beißen. Kugeln oder Kuchen – ist mir scheißegal, wie sie draufgehen, solange die Statistiken für diejenigen von uns sprechen, die sich bemühen, ein vorzeitiges Ableben zu vermeiden. Marge protestiert gotterbärmlich, als ich das Laufband auf 11 km/h beschleunige: — Aber …
— Du packst das, meine Liebe, das packst du schon, girre ich.
— Uff … uff … uff …
Ich bin in einem Alter, in dem man von einer Frau bestimmte Dinge erwartet: einen Mann, vielleicht ein Kind oder auch zwei, ein Eigenheim und einen Berg Schulden. Zumindest was Letzteres betrifft, habe ich es dank Studienbeihilfen und Kreditkarten immerhin auf 32000 Dollar gebracht. Keine Hypothekenzahlungen, bloß tausend Mäuse Miete im Monat für eine beschissene Einzimmerwohnung in Strandnähe. Ich betrachte die Galerie mit den gerahmten Trainerfotos: Lester, Mona, Jon Pallota, der das Studio eröffnet hat, und ich. Jon sieht gebräunt und fit aus, mit seinem welligen Haar, und so werde ich ihn immer in Erinnerung behalten. Aber das war vor seinem Unfall. Das Leben kann sich so schnell ändern: Wenn du das Miststück nicht bei den Hörnern packst, entgleitet es dir.
— OH … OH … OH …, Marge ist starr vor Angst, nur ihr Arsch schwingt hin und her wie ein Sattelschlepper, der quer über einen dreispurigen Highway schlingert.
— Du hast es fast geschafft, meine Liebe, und FÜNF … und VIER … und DREI … und ZWEI … und EINS. Zum Runterkommen schalte ich die Maschine zurück auf 5,5 km/h. Marge umklammert mit letzter Kraft die Handgriffe und benetzt das Laufband mit spermadickem Schweiß. — Gut gemacht, Mädchen!
— Oh … oh mein Gott …
Ich haue auf den roten Stopp-Knopf. — In Ordnung, komm da runter, schnapp dir noch mal die Kugelhantel und gib mir einen beidarmigen Swing mit zwanzig Wiederholungen!
Oh, da ist er ja endlich, dieser entsetzte Gesichtsausdruck, der mich ungläubig zu fragen scheint, ob ich gerade wirklich ihr Erstgeborenes als rituelles Opfer dargebracht habe.
— Jetzt mach schon!
Während sich Marge schwitzend in ihr Schicksal fügt, überlege ich, welche Zahlen für mich noch von Bedeutung sind. Größe: 1,70 m. Gewicht: 51 kg. Anzahl der Stammkunden: 11. Anzahl der Studios, in denen ich arbeite: 2. Eltern: 2 (geschieden). Geschwister: 1, weiblich, spielt in Indien, Afrika oder sonst einem Drecksloch die beschissene Heilige. Oh ja, Jocelyn versucht im Auftrag irgendeiner wohltätigen Organisation, den armen, farbigen Kindern in der Dritten Welt zu helfen, vermutlich um Dads erzkonservative Einstellung in Rassenfragen zu kompensieren.
Marge lässt sich hängen. — Geh in die Knie, streck den Hintern raus! BRUST RAUS, SCHULTERN NACH HINTEN! NICHT UNTERHALB DER KNIE! Besser! So ist’s richtig! Gut!
Als wir noch Kinder waren, zogen wir von Southie nach Weymouth. Es war ein schönes geräumiges Haus mit hohen Decken und einem großen Garten. Jocelyn und ich hatten unsere eigenen Zimmer. Ich hegte schon damals so eine Ahnung, dass Mom und Dad nicht glücklich waren, und als ich älter wurde, schien ihr latenter Rassismus das Einzige zu sein, was sie noch verband. Dad stöhnte permanent über den »Dorchester-Zustrom« nach Weymouth (mir war klar, dass er damit die Schwarzen meinte – er behauptete, dass wir nur hierhergezogen waren, um sie nicht mehr vor der Nase zu haben, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass unser altes Viertel das weißeste und irischste der ganzen Stadt war), was Mom in der Regel mit einem theatralischen Nicken bekräftigte und mit einem Kommentar über die »fallenden Immobilienpreise« quittierte.
— Das ist es, meine Liebe, feuere ich Marge an, — schön den Hintern rausstrecken! Ganz weit raus!
Aber kommen wir noch mal zurück auf die 33. Das ist ein übles Alter für eine alleinstehende Frau und ein beschissenes für eine Fitnesstrainerin. Gott sei Dank macht das hier niemand zum Thema. Nur die scheinheilige Mona – acht Jahre jünger als ich, 1,79 m, blond, 90-60-90 und die zweitälteste Trainerin bei Bodysculpt – nennt mich hin und wieder mit schleimiger, aufgesetzter Hochachtung ihre »erfahrenste« Kollegin. Bei dieser falschen Schlange sind sogar die Pralinen mit Säure gefüllt.
— In Ordnung, Marge, gib mir einen Slingshot, von links nach rechts, immer schön rund um die Körpermitte … gut … gut. Und versuch, die Höhe zu halten, fordere ich sie auf. Das geht bei so einem Cellulite-Bomber richtig ans Eingemachte. — Besser …
Seit Jon nicht mehr auftaucht, ist Lester der einzige Mensch, mit dem ich mich hier wirklich verstehe. Deshalb arbeite ich sehr viel lieber bei Miami Mixed Martial Arts, einem amtlichen Laden auf der 5th Street, der von einem Exboxer namens Emilio betrieben wird. Die Kunden dort nehmen ihre Fitness und ihre Ziele ernst. Bodysculpt, ein durchkommerzialisierter Yuppie-Schuppen mit viel Glas und schniekem Pinienparkett, erinnert dagegen eher an eine beknackte Lounge Bar. Die haben hier sogar feste DJs – wie diesen abscheulichen Tobi, der heute Gott sei dank durch Abwesenheit glänzt –, die sogenannte Workout-Musik spielen. Für gewöhnlich ist das fader Ambient-Dreck für faule, mit Prozac bedröhnte, Cocktails schlürfende Festlandwale, die glauben, sie wären hier in einem beschissenen Spa. Der Großteil der Kundschaft ist weiblich: Die fetten Hausfrauen, mit denen ich mich üblicherweise rumschlage, trainieren verschüchtert zwischen klapperdürren Hochglanz-Models und toughen Geschäftsfrauen, die den Großteil ihrer Zeit damit verbringen, bei irgendeinem lahmarschigen Crosstrainer-Scheiß in ihre Handys zu quatschen. Die wenigen Kerle im Studio scheinen alle vom gleichen Schlag zu sein: Früher hegten sie vielleicht mal ziemlich weit gediehene Pläne, die Highschool hinzuschmeißen, aber dann zogen sie in allerletzter Minute den Schwanz ein, weil sie zu der Ansicht gelangt waren, ein Jurastudium zwecks Betätigung als Anwalt sei der bessere Weg, dem örtlichen Gemeinwesen zu schaden. Womit sie vermutlich sogar recht haben.
Marge beendet ihr Set, und ich demonstriere ihr das Kreuzheben an einer besonders schweren Kugelhantel. — Wenn du in die Knie gehst, spannst du die Bauchmuskeln an, erkläre ich ihr, — kneifst die Gesäßmuskeln zusammen und verteilst das Körpergewicht gleichmäßig auf die Fersen.
Ein klaffendes schwarzes Loch und zwei schockierte Augen starren mir aus einem schwitzenden roten Dampfkessel entgegen.
— Jetzt leg schon los!
Marge schafft es bis fünf und hisst dann die weiße Fahne. — Kann ich jetzt aufhören?, bettelt die Memme.
Die Hände in die Hüften gestemmt, atme ich einmal tief durch. — Nur Versager geben auf! Gewinner halten durch! Noch fünf Stück, Marge. Sei ein braves Mädchen. Komm schon, Süße, du schaffst das!
— Ich kann nicht …
— Keine Chance! Gib mir fünf mehr, und wir machen Schluss, ködere ich sie, als sie vornüberklappt und nach Luft schnappt. — Reiß dich zusammen!
Die blöde Kuh sieht mich an, als hätte ich ihr eine geknallt, fügt sich aber in ihr Schicksal.
— VIER!
Diese beschissenen Zeiträuber wollen sich gar nicht ändern: Alles, was sie wollen, ist Zustimmung. Man muss sie wachrütteln. Muss es ihnen in die fetten, blöden Fressen reiben, bis sie quieken.
— DREI!
Muss ihnen klarmachen, dass man ihnen diesen Ganzkörperanzug wabbeliger Schwäche von ihren unförmigen Leibern schälen und sie wieder in etwas Menschliches verwandeln wird. Und, ja, sie werden dich dafür hassen.
— ZWEI!
Ich blase ihnen keinen Zucker in ihre fetten Ärsche, sondern lege die Karten offen auf den Tisch. Ich erkläre ihnen, dass es wie eine Wiedergeburt ist, allerdings in Zeitlupe – und man erinnert sich dabei an jedes schwitzende, grunzende, schmerzhafte, brutale Detail. Dafür bekommt man einen Körper und einen Geist, die den Anforderungen des Lebens in dieser Welt gewachsen sind. Marge kämpft mit letzter Kraft gegen das Gewicht …
— EINS! UUUUNNND PAUSE!
Die Kugelhantel entgleitet ihrem Griff und knallt auf den Gummiboden. Sie bückt sich, stützt die Hände auf die Knie und schnappt nach Luft. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute Gewichte fallen lassen, also brülle ich sie an: — Du bist der Hammer, Marge! Gib mir fünf. So zwinge ich sie dazu, sich widerstrebend halb aufzurichten, um meine Hand abzuklatschen, bevor sie wieder zusammensackt und ihre Hände erneut die Knie umklammern. Schwer atmend hebt sie den Blick und glotzt mich an wie ein Gnu, das so gerade eben noch den Pranken eines Löwen entkommen ist, seine Flucht allerdings damit bezahlen musste, dass ihm ein Stück vom Arsch herausgerissen wurde. Träum weiter, du fette Kuh! Oh ja, im Augenblick hasst sie mich aus tiefstem Herzen. Aber sobald der Endorphinschub einsetzt, wird sie sich Hals über Kopf in mich verlieben. Dann wird sie ins Sonnenlicht hinaustreten, die schlanken, gebräunten South-Beach-Körper sehen und sich sagen: Ich muss noch härter an mir arbeiten.
Scheiße, ja, und ob du das musst.
Als Marge und Lesters College-Professorin ihr Training beenden und unter die Dusche verschwinden, machen wir eine Pause und warten auf unsere nächsten Klienten. Das Studio hat zwar ein Büro, aber das wird hauptsächlich für die Lohnbuchhaltung und Geschäftsführung des Ladens benutzt. Wir Trainer ziehen es vor, an der Saftbar rumzuhängen und uns im Sonnenlicht zu aalen, das durch das abgeschrägte Glasdach hineinfällt. Ein Trainer, der etwas auf sich hält, zeigt sich. Auch dann, wenn er gerade weder selbst Sport treibt noch jemanden trainiert.
Lester nippt an einem schwarzen Kaffee, während ich bei meinem grünen Tee bleibe. Ich mag Lester, jetzt wo er sich mit seinen South-Bronx-Ghettogeschichten etwas zurückhält, die mich immer zu Tode langweilen. Als er neu in der Stadt war, strahlte er noch diese typische New Yorker Arroganz aus, diese ermüdende Überzeugung, dass dort und nur dort ausschließlich interessante, krasse, verrückte Sachen passieren. Aber Florida hat ihn chillen lassen. Außerdem hat er gelernt, seine Ghetto-Storys gezielt einzusetzen: Was bei Box- und Selbstverteidigungskursen super funktioniert, taugt bei Einzelstunden mit betuchten, weißen Klienten eher weniger. Mona kommt herein und gesellt sich zu uns. Sie legt ihr Klatsch-Magazin mit dem William-&-Kate-Titel zur Seite und geht zur Espressomaschine. Im Fernsehen geifert Sarah Palin gegen zu laxe Einwanderungsgesetze, und Lester wird munter. — Straffere Einwanderungskontrolle? Scheiße, was die braucht, ist ’ne straffere Arschkontrolle, kichert er.
— Genug Sexismus für heute, Les, sage ich, kann mir aber ein Grinsen nicht verkneifen. Ich sollte ihn nicht auch noch ermutigen. Doch ich tue es trotzdem, weil ich weiß, dass es Mona ärgert, die längst wieder in ihre Zeitschrift vertieft ist. — Stellt euch das mal vor, jeder Tag eures Lebens wäre ein wahr gewordener Traum, staunt sie flüsternd.
— Palins Hintern ist doch völlig aus der Form geraten, erklärt Lester. — Vergleich den mal mit 2008. Als wenn Tina Fey sich diese Kuh heute noch vorknöpfen würde. Da kann die Alte doch nur noch von träumen. Dieser vernachlässigte Breitarsch ist der wahre Grund dafür, dass die Republikaner sie 2012 nicht mehr nominiert haben. Wie tief werden ihre Mäusetittchen wohl erst 2016 hängen? Lester verdreht die Augen. — Wenn diese notgeilen Säcke bei ihrem Anblick keinen Ständer mehr kriegen, wird auch keiner von ihnen seinen traurigen Arsch in die Wahlkabine schleppen und ein Kreuz hinter ihrem Namen machen. Gebt ihren Hintern für sechs Monate in meine Hände, und ich werd schon dafür sorgen, dass er wieder so hart und glatt wie zwei Strandkiesel wird!
Lester quatscht ständig über seine Liste von Fantasie-Klienten und was er für sie tun könnte. Justin Bieber müsste Eisen und Steroide pumpen, bis er aussehen würde wie Stallone. Roseanne Barr würde gnadenlos bis auf Lara-Flynn-Boyle-Format eingedampft. Aber seine Beobachtungen haben Mona noch nie beeindruckt. — Das ist so was von frauenfeindlich, Les, greint sie, als sie von ihrer Zeitschrift aufblickt, wobei der Ton ihrer Stimme eine Abscheu erkennen lässt, die ein vom Haaransatz bis zum Kiefer mit Botulinumtoxin gelähmtes Gesicht einfach nicht auszudrücken vermag. — Ich finde, sie ist eine sehr inspirierende Person.
— So gern ich mich hier als Frau solidarisch zeigen würde, werfe ich ein, — aber Les hat leider recht: Ihr Hängearsch kostet die Palin locker zwei Millionen Wählerstimmen. Ich schätze, dass bei Politikerinnen jedes Pfund zu viel einen Nettoverlust von hunderttausend Stimmen bedeutet. Zehn Pfund rauf oder runter bringen also mehr als bloß ein paar Swing States ins Spiel, beende ich meine Argumentation, nehme mir einen Apfel aus dem Obstkorb und beiße herzhaft hinein.
— Verdammt richtig, sagt Les und klatscht mich ab. — 2016 könnte für sie und Hillary eine echte Hängepartie werden.
— Nun, mir gefällt, was sie sagt, gesteht Mona säuerlich. — Sie ist eine äußerst beeindruckende Lady.
— Mit dem Mediendruck wird sie ja spielend fertig. Grinsend schaue ich zum Bildschirm und beobachte, wie Monas Pupillen meinem Blick folgen. Ich flimmere schon wieder über die Mattscheibe. Scheiße, wenn das mal kein verdammter Killer-Frontkick war.
Lesters Gesichtszüge verziehen sich zu einem noch breiteren Grinsen. — Jon hätte sicher Gefallen daran, dich als unseren neuen Medien-Star zu sehen. Das würde ihn aus der Schusslinie holen. Vielleicht würde er sogar sein Gesicht wieder hier zeigen!
— Das hoffe ich, stimme ich ihm zu. Jon ist der Besitzer des Bodysculpt, aber seit sein Unfall in den Medien breitgetreten wurde, betreut er keine Klienten mehr und kommt nur noch selten vorbei. Eine echte Schande, denn er war einer der besten Trainer weit und breit.
Ich ziehe mein iPhone aus der Tasche. Darauf verwalte ich sämtliche Daten und Trainingsprogramme meiner Klienten. Ich tippe weitere 65 Kalorien für den kleinen Apfel in meine Lifemap-App ein. An dem Tag, an dem ich Lifemap™ für mich entdeckte, wurde ich endgültig zur eingefleischten Zahlenfetischistin.
Lifemap™ ist nicht bloß eine Website, eine Smartphone-App, ein Kalorien-Zähler, ein Trainings-, Gewichts- und BMI-Monitor, sondern all das in einem. Lifemap™ ist ein unentbehrliches Werkzeug. Es ist sehr viel mehr als nur ein Programm, das alles dokumentiert, was du isst, all das, was du dir in dieses Loch im Gesicht stopfst, oder das jede körperliche Betätigung erfasst, die du absolvierst – vom Gang zum örtlichen Einkaufszentrum bis zum Marathonlauf. Es ist ein Lebensentwurf – und es ist die Erfindung, die Amerika und die ganze Welt retten wird. Es wurde von einer Software-Schmiede entwickelt, aber das Gesicht von Lifemap™ ist der ehemalige Basketballprofi Russell Coombes (drei NBA-Championship-Ringe; 1136 Liga-Spiele für Chicago, San Antonio und Atlanta. Berühmt für die Zahl seiner Steals pro Spiel: 1,97. Karriereende mit zweiunddreißig …)
… Mist.
Meine dreiunddreißig Jahre sind deshalb so relevant, weil sie hier im modebewussten Miami Beach für meinen Kundenstamm der entscheidende Faktor sind. Kein halbwegs vernünftiger Mensch will einen Fitnesstrainer, der älter ist als man selbst. Niemand will einen, der scheiße aussieht, auch wenn er ansonsten dieselben Qualitäten hat (was nur selten der Fall ist, aber was soll’s). Und je älter man wird, desto beschissener sieht man nun einmal aus. Natürlich gibt es Ausnahmen, allen voran die Promi-Trainer: Trendnutten wie die J-Micks, Harpers, Warners und Parishes dieser Welt. Aber in der Regel heißt das: Ich kriege fette, nicht mehr zu rettende Mittvierziger ab, die sich erhoffen, wie ich auszusehen, wohingegen Mona die nur leicht aus der Form geratenen Mittdreißiger bekommt, die wie sie aussehen wollen, und außerdem einen prallen Terminkalender voller Heroin-Models, die mal was anderes machen wollen, als mit dem Finger im Hals herumzusitzen und darauf zu warten, dass die Condé-Nast-Hotline klingelt.
Nicht alle von denen sind pure Zeitverschwendung. Das obercoole Studio-Häschen Annette Cushing kommt mit einem Strahlen auf dem Gesicht hereinmarschiert und steuert selbstbewusst auf die Saftbar zu. Obwohl sie eine von Monas Klientinnen ist, ignoriert sie ihre Trainerin, zieht ihre Stupsnase kraus und richtet ihre schwarzen Knopfaugen auf mich. — Gratuliere, Lucy! Das war soooo mutig. Was hat dich denn da geritten?
— Mir blieb einfach keine Zeit nachzudenken, sage ich und merke, wie Mona mich mit offenem Mund anstarrt. Meine Heldentat ist der egozentrischen Zicke offenbar völlig entgangen. — Ich habe einfach so reagiert, wie ich es im Training gelernt habe.
— Dieser Tritt, der, den die Kamera eingefangen hat …
— Was ist das denn?, fragt Mona. Lester zeigt auf den Bildschirm: Es läuft eine weitere Wiederholung des Berichts. — OH MEIN GOTT!, kreischt Mona aufgekratzt und trippelt in Richtung Fernseher, um besser hören zu können.
— Eine einfache Kickbox-Technik. So eine Art Fußstoß vorwärts …, erkläre ich Annette und strecke das Bein aus, um es ihr zu demonstrieren.
— Du hast kein Wort davon erzählt …, nörgelt Mona regelrecht vorwurfsvoll. Dann klappt ihr das Kinn auf die Brust, als Annette mich fragt: — Meinst du, ich könnte ein paar dieser Techniken mit dir trainieren?
— Klar, ich zeige auf unseren Visitenkarten-Stapel. — Ruf mich einfach an. Allerdings müssten wir dann zu Miami Mixed Martial Arts gehen. Ich werfe Mona einen verstohlenen Blick zu: Daran wird die blöde Kuh länger zu schlucken haben als an einem Tausend-Kalorien-Stück Limettenkuchen!
— Super, ich bin bereit, mir die Hände schmutzig zu machen, grinst Annette und verschwindet mit einer verunsicherten Mona ins blitzblanke Pilates-Studio. Die doofe Ziege – beziehungsweise einer ihrer Sugardaddys – hat acht Riesen für ihre beschissene Trainerlizenz und das Equipment hingeblättert.