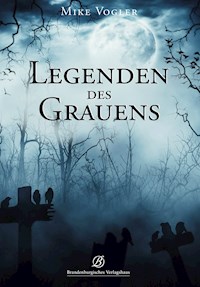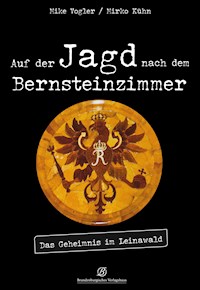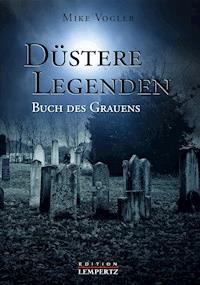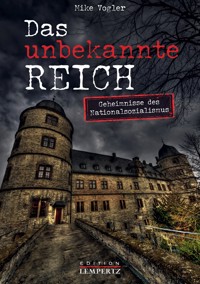
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandenburgisches Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Buch veröffentlicht Mike Vogler eine möglichst objektive Betrachtung der historischen Geschehnisse, die dem interessierten Lesepublikum spannende Einblicke in die Abgründe des Nationalsozialismus geben. Auf zahlreichen Recherchereisen, in Originalquellen und anderen Schriften machte er sich ein detailliertes Bild von den historischen Gegebenheiten der NS-Zeit. Begonnen mit den bekanntesten Konzentrationslagern der Geschichte über die grausame Klinik Pirna-Sonnenstein bis hin zur sagenumwobenen Wewelsburg erkundete Mike Vogler die bedeutsamsten Denkmäler und Mahnmale des Dritten Reichs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IMPRESSUM
Brandenburgisches Verlagshaus
Math. Lempertz GmbH
Hauptstr. 354
53639 Königswinter
Tel.: 02223-900036
Fax: 02223-900038
www.edition-lempertz.de
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus zu vervielfältigen oder auf Datenträger aufzuzeichnen.
1. Auflage – April 2021
© 2021 Math. Lempertz GmbH
ISBN: 978-3-96058-489-6
Text: Mike Vogler
Umschlaggestaltung: xxx
Satz: Hilga Pauli
Lektorat: Edition Lempertz
Titelbild: xxxx
Bildnachweise:
Fotos: © Mike Vogler
Außer: S. 13: Adobe Stock, malaha, S. 32: Shutterstock, Fulcanelli, S. 84: bpk, Atelier Bieber/Nather, S. 98: Adobe Stock, Schmutzler-Schaub, S. 102: Shutterstock, robin.ph, S. 121: Alamy Stock IanDagnall Computing, o. Ang., S. 127: bpk, Heinrich Hoffmann, S. 156: Bundesarchiv, o.Ang., S. 186: bpk, Holzschnitt v. Dietrich Eckart in „Deutschland erwache!“, S. 200: Bundesarchiv, Hoffmann
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Aktion 1005
Adolf Haas – der unbekannte Kommandant
Beton für die Ewigkeit
Das Massaker von Gardelegen
Reserve-Polizeibataillon 101
Karl Maria Wiligut – Himmlers Weisthor
Wewelsburg
Sachsen im Nationalsozialismus
Braune Karrieren
Der Untergang von Lidice
Jürgen Stroop – der Schlächter von Warschau
Tod an der Ostsee
Hitlers geistiger Vater – Dietrich Eckart
Der verlorene Zug
Hitlers bester Freund – der „Ehrenarier“ Emil Maurice
Literatur- und Quellenverzeichnis
Fußnoten
Vorwort des Verlags
Der langjährige Autor Mike Vogler erforschte für dieses neue Buchhistorische Zusammenhänge akribisch und besuchte die präsentierten Orte persönlich. Auf zahlreichen Recherchereisen, in Originalquellen und anderen Schriften machte er sich ein detailliertes Bild von den historischen Gegebenheiten der NS-Zeit. Begonnen mit den bekanntesten Konzentrationslagern der Geschichte über die grausame Klinik Pirna-Sonnenstein bis hin zur sagenumwobenen Wewelsburg erkundete Mike Vogler die bedeutsamsten Denkmäler und Mahnmale des Dritten Reichs.
Auf den folgenden Seiten soll eine möglichst objektive Betrachtung der historischen Geschehnisse Raum finden und dem interessierten Lesepublikum spannende Einblicke liefern. Dabei vereint dieses Werk die unterschiedlichsten Themen, Persönlichkeiten und Schauplätze im Augenschein und Fokus, den Mike Vogler ganz bewusst ansetzt: Was also verbindet diese ganz unterschiedlichen Kapitel miteinander und wie kam es zu dieser vielfältigen Themenauswahl? Der rote Faden dieses Buches ist wortwörtlich die Blutspur bisher kaum bekannter, grausamer Details aus der Zeit des Nationalsozialismus unter Adolf Hitler und mächtiger SS-Funktionäre. Von Mord und Folter bis hin zum verzweifelten Suizid folgt Mike Vogler der Fährte des Erforschbaren. Immer wieder stößt er auf ideologische Kuriositäten, erbarmungslose Machtstrukturen und die Abgründe der Menschlichkeit.
Welches Gedankengut vertraten NS-Größen wie der Mythenforscher Karl Maria Wiligut? Wer war Hitlers bester Freund und in welcher merkwürdigen Dreiecksbeziehung standen die beiden Männner mit Hitlers Nichte Angela Raubal? Was geschah in der abgelegenen Schlucht von Babyn Jar und wer trug die Verantwortung für die Gräueltaten? Diesen und vielen weiteren Fragen stellt sich das Buch.
Wir folgen Mike Vogler auf der Spurensuche durch die düsteren Kapitel unserer Geschichte. Sie werden auf Erschreckendes und Geheimnisvolles stoßen, das in den Geschichtsbüchern vielfach ausgespart ist. Unter Fachkundigen sind diese Inhalte teils nur wenig bekannt oder stehen im Zentrum kontroverser Diskussion. Hierbei möchte der Autor einen Grundstein legen, sodass der aufmerksame Leser sich eine eigene Meinung schaffen kann. Dafür trug Mike Vogler alle relevanten Aspekte zusammen. Weil unser Verlagshaus seit Jahren auf die Kompetenz des erfahrenen Autors bauen kann, steht dieses Werk in einer bereits längeren Reihe themenverwandter Bücher. Für die Gewährleistung inhaltlicher Richtigkeit steht der Autor, der sich bei seinen Lesern eine namhafte Expertise in diesem Gebiet erarbeitet hat, persönlich ein.
Den Themen rund um den Nationalsozialismus begegnet er, wie gewohnt, mit regem, umfangreichem Interesse und Neutralität. Mit fester Feder, klarer Sprache und souveränem Duktus zeichnet Vogler lebhafte Bilder und Szenen der Verbrechen, die im Dritten Reich tatsächlich geschahen – auch hinter den Kulissen. Er beleuchtet die Lebensläufe entscheidender Figuren und nimmt uns mit auf seinen Streifzug durch menschenverlassene Orte, an denen heute nur noch stumme Mahnmale an das Unvorstellbare erinnern.
Aktion 1005
Die Bezeichnung Aktion 1005 war der Tarnname für einen streng geheimen Auftrag, der in den von Deutschland besetzten Ostgebieten in den Jahren 1942 bis 1944 durchgeführt wurde. Die zuständigen Einheiten wurden als Sonderkommando 1005 bezeichnet. Die Zahl 1005 war das Aktenzeichen, unter dem die sogenannten „Enterdungen“ unter strengster Geheimhaltung verwaltet wurden. Die Aktion 1005 bestand aus der akribischen Spurenbeseitigung aller in den Ostgebieten verübten Verbrechen der Waffen-SS und der Wehrmacht. Ziel war es, alle Massengräber aufzufinden, die darin befindlichen Leichen zu beseitigen und die Areale landschaftlich zu tarnen, so dass keine Hinweise auf die verübten Verbrechen mehr zu finden waren. Am Ende der Aktion 1005 sollte es keine Gräber, keine Leichen und keine Zeugen der NS-Vernichtungspolitik im Osten Europas mehr geben. Das schloss auch die Ermordung der zu den Arbeiten gezwungenen KZ-Häftlinge und Kriegsgefangenen mit ein.
In den vielen im besetzten Polen verteilten Konzentrationslagern war es in den Anfangsjahren übliche Praxis gewesen, die Toten in unkenntlichen Massengräbern zu verscharren. Im Rahmen der Aktion 1005 mussten die Häftlinge diese Gräber wieder öffnen, die Leichen „enterden“ und verbrennen. In den Konzentrationslagern war die logistische Arbeit des Sonderkommandos 1005 relativ einfach, da die Lage der Massengräber bekannt war. Auf dem Gebiet der Sowjetunion war die Aktion 1005 mit größeren Schwierigkeiten verbunden. Während der Zeit des ungehinderten Vordringens auf russischem Gebiet war es für die zuständigen Stellen unerheblich, was mit den Leichen geschah, welche die Erschießungskommandos hinterlassen hatten. Notdürftig verscharrt, wurden die Massengräber weder gekennzeichnet, noch ihre genaue Lage dokumentiert. Erst als sich das Kriegsglück zu wenden begann und die deutschen Truppen auf dem Rückzug waren, stellte sich die Frage, was mit den Leichen geschehen sollte. Schließlich sollte die Weltöffentlichkeit nichts von den Vernichtungsaktionen erfahren.
Für den Überfall auf die Sowjetunion waren spezielle Einsatzgruppen gegründet worden. Die vier Einsatzgruppen A bis D sollten in den eroberten Gebieten zunächst die sogenannte jüdisch-bolschewistische Intelligenz beseitigen. Schnell wurde dieser Personenkreis auf Politfunktionäre, Beamte, Partisanen und schließlich alle Juden in den besetzten Gebieten ausgeweitet. Die vier Einsatzgruppen wurden in der Grenzpolizeischule Pretzsch sowie den umliegenden Orten Bad Düben und Bad Schmiedeberg aufgestellt und umfassten jeweils etwa 1.000 Mann. Die Einsatzgruppen setzten sich zu einem Drittel aus Soldaten der Waffen-SS sowie Personen der Geheimen Staatspolizei (Gestapo), des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS (SD) und Beamten der Ordnungs- und Kriminalpolizei zusammen.
Obwohl die Einsatzgruppen bei ihrem Vordringen im feindlichen Gebiet „ganze Arbeit“ geleistet hatten, war speziell bei der Spurenbeseitigung ihrer Verbrechen einiges schiefgelaufen. Zwar hatte es diesbezüglich eindeutige Befehle gegeben, aber in der Euphorie der schnellen Eroberung der Sowjetunion war man bei der Tarnung der Tatorte recht oberflächlich vorgegangen.
Für die Leitung der großangelegten Vertuschungsaktion der deutschen Verbrechen in den besetzten Ostgebieten hatte die von höchster Stelle beauftragte SS-Führung einen ganz besonderen Mann ausgesucht: SS-Standartenführer Paul Blobel hatte bereits aktiv an der Ermordung von Juden und Politfunktionären in der Sowjetunion teilgenommen. So hatte er als Kommandant des Sonderkommando 4a, einer Untereinheit der Einsatzgruppe C, die Ermordung der Kiewer Juden in der berühmt-berüchtigten Schlucht Babyn Jar befehligt.
Ende März 1942 wurde Blobel zu einer Besprechung mit SS-Obergruppenführer Rainhard Heydrich, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, nach Warschau beordert, wo er über die geplante Vertuschungsaktion informiert wurde. Über das Treffen ist aus Gründen der strengen Geheimhaltung nur sehr wenig bekannt. Laut Aussage von Julius Bauer, Blobels Fahrer, hatte jener Anweisung gegeben, das Gästehaus der Sicherheitspolizei in Warschau anzusteuern. Nachdem Blobel und Bauer das Haus betreten hatten, verschwand der Standartenführer in einem der Besprechungsräume. Bauer ging wieder nach draußen, um im Wagen auf seinen Chef zu warten. Einige Zeit später, verließen Heydrich, dessen Adjutant und Blobel das Gebäude. Blobel setzte sich wieder in seinen Wagen und wies Bauer an, loszufahren. Dieser vermutet, dass es sich um ein Treffen von aller höchster Wichtigkeit gehandelt haben muss, wenn sich der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes höchstselbst die Ehre gab. Bauer und Blobel verbrachten die Nacht in Warschau, wobei der Standartenführer seinen Fahrer zunächst über den Gegenstand seiner geheimen Besprechung mit Heydrich im Unklaren ließ. Am nächsten Morgen wies Blobel seinen Fahrer an, die Reise Richtung Berlin fortzusetzen. Während der langen Fahrt deutete Blobel geheimnisvoll an, dass Heydrich ihn mit einer streng geheimen Aufgabe betraut hatte, deren Befehl direkt von Hitler kam. Zudem erwähnte er, dass man nun in Zukunft im Rahmen dieses streng geheimen Auftrages gemeinsam mit dem Dienstwagen weite Strecken zurücklegen würde.
In Berlin traf Blobel mit dem Chef der Gestapo, SS-Gruppenführer Heinrich Müller, zusammen. Müller enthüllte Blobel nun endlich nähere Details zu seinem streng geheimen Auftrag. Danach wurde dem zukünftigen Leiter der Aktion 1005 zunächst erst einmal Urlaub gewährt, worauf dieser seinen Fahrer Julius Bauer ebenfalls in den Urlaub schickte. Vorher informierte Blobel Bauer jedoch über die genauen Umstände des erteilten Auftrages. Mit erstauntem Gesicht vernahm Bauer, dass man seinen Chef angewiesen hatte, alle in den besetzten Ostgebieten befindlichen Massengräber ausfindig zu machen, die darin befindlichen Leichen restlos zu vernichten und jegliche Spuren der begangenen Verbrechen zu beseitigen. Aus Gründen der Geheimhaltung sollte das zu bildende Sonderkommando 1005 nur aus einem kleinen Stab verlässlicher Männer bestehen. Zusätzliche Kräfte würden jeweils vor Ort aus der Waffen-SS und der Ordnungspolizei rekrutiert werden. Die eigentliche körperliche Arbeit mussten Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge übernehmen.
In Vorbereitung auf die Aktion 1005 informierte sich Blobel in Berlin bei SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, Leiter der Gestapo-Dienststelle „Judenreferat“, umfassend über den Stand der Arbeit der Einsatzgruppen in der Sowjetunion sowie der Größe der in den Konzentrationslagern zu bewältigenden Aufgaben. Die detaillierten Informationen, die Blobel von Eichmann erhielt, machten ihn erst jetzt klar, welche Größenordnung die geplante Aktion 1005 tatsächlich hatte.
Auf Anraten von Eichmann sollte sich Blobel als Erstes der Leichenbeseitigung im Konzentrationslager Kulmhof widmen, wo es anscheinend akute Probleme gab. Dort waren die Leichen größtenteils nur notdürftig verscharrt worden, zudem waren die Körper vor dem Zuschütten der Gräber nicht mit Kalk bestreut worden, wie es in anderen Lagern aus Gründen der Desinfektion Praxis war. Starke Regenfälle hatten die zum Teil nur wenige Zentimeter dicke Erdschicht weggeschwemmt, so dass Leichenteile aus dem Erdreich ragten. Die einsetzende Verwesung hätte dann zu Seuchen führen können, welche die Lagerleitung natürlich unter allen Umständen verhindern wollte. In Kulmhof bestand also dringend Handlungsbedarf, doch an eine eigenständige Beseitigung der verwesenden Leichen war nicht zu denken. Die Massengräber befanden sich außerhalb des Lagers und für die Bewachung der dort arbeitenden Häftlinge wäre die Wachmannschaft personell nicht ausgerüstet gewesen. Da die Lagerleitung von Kulmhof schon mehrfach bei den zuständigen Stellen um Hilfe gebeten hatte, schickten diese SS-Standartenführer Paul Blobel, um sich der Angelegenheit anzunehmen. Es war mittlerweile Sommer geworden und in weitem Umkreis um die Massengräber herrschte aufgrund der sich fortsetzenden Verwesung ein bestialischer Gestank. Blobel und der Kommandant, Hauptsturmführer Hans Bothmann, berieten über das Vorgehen, wobei Bothmann anregte, die Leichen diesmal tiefer zu begraben und mit entsprechenden Desinfektionsmitteln zu bestreuen. Blobel setzte ihn jedoch davon in Kenntnis, dass sein Auftrag die restlose Beseitigung der Leichen sowie die Tarnung der ehemaligen Gräber beinhaltete.
Da die Zeit drängte, stellte Lagerkommandant Bothmann entsprechende Arbeitskommandos aus Häftlingen zusammen, zu deren Bewachung Blobel 70 Schutzpolizisten aus Litzmannstadt rekrutierte. Zunächst wurden einige Gräberfelder freigelegt, wobei die Häftlinge die obere Erdschicht abtragen mussten. Was sich dabei Ekelerregendes ereignete, gab 1961 der ehemalige Schutzpolizist Franz Schalling zu Protokoll:
„Etwa im Sommer 1942 begann man damit, die Gräber zu öffnen und die Leichen zu verbrennen. In diesem Zusammenhang möchte ich eine Wahrnehmung schildern, die ich in den Sommermonaten des Jahres 1942 an einem der Massengräber während eines Bewachungseinsatzes machte. An mehreren Stellen dieses Grabes sprudelte förmlich in dicken Strahlen Blut oder eine blutähnliche Flüssigkeit hervor und bildete in der Nähe des Grabes große Lachen. Wodurch dies geschah, entzieht sich meiner Kenntnis.“ 1
Ohne pietätlos erscheinen zu wollen, muss an dieser Stelle gesagt werden, dass hier tatsächlich etwas getan werden musste, um Seuchen zu verhindern, welchen die anderen Häftlinge im Lager dann zum Opfer gefallen wären.
Nachdem die Häftlinge die Gräber freigelegt hatten, versuchten Blobels Männer, die schon stark verwesten Leichen gleich in ihren Gräbern zu verbrennen. Dazu hatte man drei Flammenwerfer, einen Flammenwerfer-Füllwagen und spezielle Schutzkleidung besorgt. Die Versuche mit den Flammenwerfern brachten jedoch nicht die von Blobel gewünschten Erfolge, so dass diese Art der Leichenbeseitigung wieder verworfen wurde. Danach experimentierten die Männer des Sonderkommandos 1005 mit sogenannten Thermit-Bomben, deren hohe Brenntemperaturen in den Leichengruben das Verbrennen beschleunigen sollten. Auch diese Versuche brachten nicht den gewünschten Erfolg, vielmehr verursachten die noch unausgereiften Brandsätze einen Waldbrand.
Nun beauftragte Blobel den Polizeiwachtmeister Runge, der zum Lagerpersonal von Kulmhof gehörte, sich der technischen Möglichkeiten der anzunehmen. Jener war bereits für Leichenverbrennung im Lager zuständig und hatte einen provisorischen Verbrennungsofen entworfen. Diese Gerätschaft schien für Blobels Aufgabe tatsächlich geeignet zu sein. Der gemauerte Ofen wurde tief in die Erde eingelassen. Zur Steuerung der Luftzufuhr ließ man einen Belüftungsschacht mit der Verbrennungsanlage verbinden. Als Rost dienten Eisenbahnschienen, zur Befeuerung wurden Holz und Reisigbündel verwendet. Mit diesem primitiven Verbrennungsofen konnten etwa 100 Leichen gleichzeitig verbrannt werden. Ein erster Test brachte Ergebnisse, welche Blobel für seine Zwecke als geeignet und effektiv ansah. Der Wachmann Karl Heinl sagte 1961 zur Leichenverbrennung in Kulmhof Folgendes aus:
„Ich habe wohl gehört, dass Runge im Waldlager einen Verbrennungsofen gebaut hat, in welchem nach einigen Monaten die Leichen der jüdischen Menschen verbrannt wurden. Vom Waldrand aus habe ich auch gesehen, wie von einem jüdischen Arbeitskommando Leichen in einen Verbrennungsofen geworfen wurden. Auch habe ich gesehen, dass das jüdische Arbeitskommando Leichen aus einem Massengrab ausgrub und in den Verbrennungsofen warf. Eines Nachts habe ich mir den Verbrennungsofen angesehen und festgestellt, dass es sich um eine große Grube handelte, welche ausgemauert war. Es waren noch Holzrückstände zu sehen, jedoch habe ich keine Leichenrückstände erkennen können. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch mit einer Taschenlampe in ein Massengrab geleuchtet und darin Leichen gesehen. Das Massengrab war ca. 20 m lang, 3 m breit und 2,5 bis 3 m tief. Es war aufgedeckt und etwa 1 m hoch mit Leichen gefüllt. Weitere Massengräber habe ich nicht gesehen, jedoch sollen nach Angaben der Posten weitere vorhanden gewesen sein.“ 2
Entgegen der Aussage von Karl Heinl blieben nach der Verbrennung der Leichen Rückstände zurück. Zwar verbrannte das Fleisch restlos, doch die Knochen verkohlten und zerbrachen und ließen sich auch mit dem provisorischen Verbrennungsofen nicht gänzlich vernichten. Die Zähne der Ofer verbrannten gar nicht. Aus diesem Grund ließ Blobel eine Knochenmühle besorgen. Solche Geräte wurden ursprünglich zur Zerkleinerung von Tierknochen verwendet, wobei das entstandene Knochenmehl dann als Dünger verwendet wurde.
Blobel entwickelte ein regelrechtes Arbeitsteilungssystem und teilte die Häftlinge des Arbeitskommandos in vier Gruppen ein. Gruppe 1 öffnete die Gräber. Gruppe 2 holte die schon stark verwesten Leichen aus den Gräbern. Gruppe 3 legte die Leichen auf den Rost des Verbrennungsofens und überwachte die Verbrennung. Gruppe 4 bediente die Knochenmühle und musste übrig gebliebene Knochenreste mit Handwerkzeugen zu Pulver zermahlen.
Die im Konzentrationslager Kulmhof gesammelten Erfahrungen sowie Gerätschaften wie Verbrennungsofen und Knochenmühle ließ Blobel nun bei allen weiteren Einsätzen des Sonderkommandos 1005 verwenden. Im Folgenden sollen an einem anschaulichen Beispiel die weiterführenden Aktivitäten im Rahmen der Aktion 1005 geschildert werden.
Babyn Jar
Am 19. September 1941 nahm die deutsche Wehrmacht im Zuge des „Unternehmens Barbarossa“, also dem Überfall auf die Sowjetunion, die ukrainische Stadt Kiew ein. Mit der Wehrmacht rückte auch das Sonderkommando 4a ein, ein Teilkommando der Einsatzgruppe C.
Da Kiew eine besonders große jüdische Gemeinde beherbergte, war deren restlose Beseitigung das vorrangige Ziel des Sonderkommandos 4a. Kommandant SS-Standartenführer Paul Blobel begann sofort nach Einmarsch in Kiew mit der Planung für dieses Vorhaben. Da die etwa 30.000 Menschen umfassende jüdische Gemeinde die Größe der üblichen Vernichtungsaktionen bei Weitem überschritt, wurden noch Kräfte des Polizei-Bataillons 303, einer militärischen Einheit der Ordnungspolizei, sowie einheimische Polizisten eingesetzt.
Nach umfangreicher Überprüfung aller Einwohner auf die Zugehörigkeit zur jüdischen Volksgruppe wurde Ende September 1941 öffentlich die „Umsiedlung“ aller Juden von Kiew in ein nicht näher bezeichnetes Gebiet befohlen. Um die Betroffenen in trügerischer Sicherheit zu wiegen, wurde ihnen befohlen, Papiere, Geld, Wertsachen sowie warme Kleidung mitzubringen.
Am 29. und 30. September 1941 wurden die Kiewer Juden an Sammelplätzen zusammengetrieben und in Marschkolonnen aus der Stadt geführt. Ziel war die nahe der Stadt gelegene Schlucht Babyn Jar. Dieses etwa 2,5 km lange und stellenweise bis zu 30 m tiefe Tal schien SS-Standartenführer Paul Blobel ideal für die geplante Vernichtungsaktion. Am Rande von Babyn Jar angekommen, wurden die Juden registriert und danach aufgefordert, sich vollständig zu entkleiden. Danach wurden die völlig verstörten Menschen in Gruppen in die Schlucht geführt und dort erschossen.
Kurt Werner, Mitglied des Sonderkommandos 4a und am Massaker von Babyn Jar beteiligt, äußerste sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wie folgt zu den grauenhaften Ereignissen:
„Gleich nach meiner Ankunft im Exekutionsgelände musste ich mich zusammen mit anderen Kameraden nach unten in diese Mulde begeben. Es dauerte nicht lange, und es wurden uns schon die ersten Juden über die Schluchtabhänge zugeführt. Die Juden mussten sich mit dem Gesicht zur Erde an die Muldenwände hinlegen. In der Mulde befanden sich drei Gruppen mit Schützen, mit insgesamt etwa zwölf Schützen. ... Die Schützen standen jeweils hinter den Juden und haben diese mit Genickschüssen getötet.“ 3
Babyn Jar
Um ihr mörderisches Vorhaben extra effizient zu gestalten, hatte das Sonderkommando 4a ein besonders grausames Vorgehen beschlossen. Sie nötigten die neu in die Schlucht getriebenen Juden, sich auf die Leichen der zuvor Erschossenen zu legen. Danach erfolgten die Todesschüsse. Dina Pronitschewa, die das Massaker von Babyn Jar überlebte, bestätigte dieses Vorgehen in einem erschütternden Bericht über die Ereignisse vom 29. und 30. September 1941:
„Sie mussten sich bäuchlings auf die Leichen der schon Ermordeten legen und auf die Schüsse warten, die von oben kamen. Dann kam die nächste Gruppe. 36 Stunden lang kamen Juden und starben. Vielleicht waren die Menschen im Sterben und im Tod gleich, aber jeder war anders bis zum letzten Moment, jeder hatte andere Gedanken und Vorahnungen, bis alles klar war, und dann wurde alles schwarz. Manche Menschen starben mit dem Gedanken an andere, wie die Mutter der schönen fünfzehnjährigen Sara, die bat, gemeinsam mit ihrer Tochter erschossen zu werden.“ 4
Auch der bereits erwähnte Kurt Werner bestätigte das grausame Vorgehen des Sonderkommandos 4a: „Mir ist heute noch in Erinnerung, in welches Entsetzen die Juden kamen, die oben am Grubenrand zum ersten Mal auf die Leichen in der Grube hinunterblicken konnten. Viele Juden haben vor Schreck laut aufgeschrien.“ 5
Laut der Ereignismeldung der Einsatzgruppe C an das Reichssicherheitshauptamt in Berlin vom 2. Oktober 1941 ermordete das Sonderkommando 4a innerhalb von 36 Stunden 33.771 jüdische Männer Frauen und Kinder. Obwohl das Sonderkommando 4a laut Einsatzbefehl bei seinen Aktionen um absolute Geheimhaltung bemüht war, ließ sich das Massaker von Babyn Jar nicht gänzlich verheimlichen. Den beteiligten ukrainischen Polizeikräften war zwar völliges Stillschweigen verordnet worden, einige der Beteiligten versuchten jedoch, ihr Gewissen zu beruhigen und erzählten Familie und Freunden von den unfassbaren Ereignissen in der Schlucht. Bald machten entsprechende Gerüchte die Runde in der Stadt. Zudem waren Kleidungstücke der Opfer an Volksleute und Bedürftige verteilt worden, was die Gerüchte anheizte.
Auch in der Wehrmacht gab es in der Folgezeit Gerüchte, im September 1941 sei in Kiew ganz Ungeheuerliches geschehen. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Alliierten vom Verbrechen von Babyn Jar erfuhren, wenn auch keine genaueren Einzelheiten bekannt waren. Zu Propagandazwecken veröffentlichten sowjetische und US-amerikanische Nachrichtenagenturen Berichte mit fiktiven Opferzahlen, welche von bis zu 62.000 Ermordeten sprachen.
Mitte 1942 machte es die sich abzeichnende Kriegslage nötig, die Vertuschung der deutschen Vernichtungspolitik in den besetzten Gebieten zu intensivieren. Reichsführer-SS Heinrich Himmler machte seinem Gestapo-Chef Heinrich Müller unmissverständlich klar, wie umfassend diese Spurenbeseitigung zu verstehen sei. Müller instruierte wiederum den mittlerweile für die Aktion 1005 zuständigen SS-Standartenführer Paul Blobel, der zunächst die Vertuschung der Verbrechen im noch besetzten Teil der Sowjetunion anging.
Eine der vorrangigen Aufgaben von Blobels Sonderkommando 1005 war die Spurenbeseitigung des Massakers von Babyn Jar mit mehr als 30.000 Opfern. Im September 1942 reiste Blobel selbst nach Kiew, um sich mit den aktuellen örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Er kannte zwar die Schlucht Babyn Jar bestens, hatte er doch als Kommandant des Sonderkommando 4a das Massaker befehligt, wollte jedoch bei dessen Vertuschung keinerlei Fehler machen.
Blobel erkannte schnell, dass er hier in Kiew vor größeren Problemen stand als bei den bisherigen Vertuschungsaktionen seines Sonderkommandos 1005. Er brauchte bei dieser Aufgabe mehr Arbeitskräfte, mehr Männer zu deren Bewachung und späteren Liquidierung, zudem spezielles Arbeitsgerät, um die enormen Erdmassen zu bewegen. Durch die Absprengung der Schluchtwände hatte das Sonderkommando 4a Babyn Jar in einen regelrechten Sarkophag verwandelt. Blobel gelang es mit einiger Mühe, mehrere Bagger aus Warschau und Lemberg für diese Aufgabe zu besorgen. Des Weiteren wurde diesmal bedeutend mehr Benzin und Brennmaterial als bei den anderen Vertuschungsaktionen benötigt. Schlussendlich spielte auch die Witterung eine entscheidende Rolle. Der Winter nahte und im gefrierenden Boden wäre es fast unmöglich gewesen, alle Leichen in Babyn Jar ausfindig zu machen. Aus diesen Gründen wurde die Vertuschungsaktion auf das Frühjahr 1943 verlegt.
Da das Sonderkommando 1005 personell nur relativ dünn besetzt war, stellte Blobel für die Aufgabe in Kiew einen vergrößerten Führungsstab auf. Mit dessen Leitung beauftragte er SS-Sturmbahnführer Hans Sohns, langjähriges Mitglied der Waffen-SS und bekannt für sein rücksichtsloses Vorgehen gegen die ukrainische und jüdische Bevölkerung. Sohns erhielt von Blobel die Weisung, ein entsprechendes Wachkommando für die „Enterdungsaktion“ in Babyn Jar zusammenzustellen. Dieser rekrutierte aus Waffen-SS, Gestapo und Schutzpolizei eine 70 Mann starke Gruppe aus verlässlichen Männern.
Als Nächstes wurden die genauen Positionen der Gräberfelder bestimmt, um unnötige Erdarbeiten zu vermeiden. Das war aufgrund der Größe der Schlucht keine einfache Aufgabe. Obwohl Blobel als Leiter des Sonderkommandos 4a die Erschießungen in Babyn Jar befehligt hatte, konnte er sich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. So mussten in der Schlucht Probegrabungen vorgenommen werden, um die Massengräber zu finden. Anschließend sperrte das Sonderkommando 1005 die Schlucht weiträumig ab, stellte Verbotsschilder auf und errichte Reisig- und Palisadenzäune als Sichtschutz. Das Gelände wurde gegen Fliegerangriffe getarnt und eine eigene Zufahrtsstraße eingerichtet. Ganz in der Nähe der Massengräber installierte das Sonderkommando 1005 mehrere Verbrennungsöfen und Knochenmühlen. Für die eigentlichen Arbeiten wurden Häftlinge aus dem Konzentrationslager Syrez ausgesucht, das nur wenige hundert Meter von Babyn Jar entfernt lag. Das Arbeitskommando bestand zunächst aus 300 Häftlingen, etwa zu gleichen Teilen aus russischen Kriegsgefangenen und Juden.
Mit einiger Verzögerung begannen die Arbeiten in Babyn Jar am 18. August 1943. Nach der „Enterdung“ wurden bis zu 2.000 Leichen auf einen der gigantischen Öfen gestapelt, mit Teerbrandöl begossen und angezündet. Die Feuer in Babyn Jar sollten möglichst 24 Stunden am Tag brennen und die Leichen rückstandslos verbrennen, da die Arbeit mit den Knochenmühlen mühsam und zeitaufwändig war. Der größte Teil der Zeit wurde jedoch für die eigentlichen Erdarbeiten benötigt. Durch das Absprengen der Schluchtwände lagen die Leichen zum Teil unter einer 20 m hohen Erdschicht, die nur mit schwerem Gerät zu beseitigen waren. Über die Arbeiten in der Schlucht liefert uns der beteiligte Häftling Jakow Kaper einen eindrucksvollen Bericht:
„Vor dem Abtransport in den Babyn Jar bemerkten wir, daß etwa 50 Meter entfernt gegenüber dem Ausgangstor des Syrezker Konzentrationslagers an der Babyn Jar-Trasse ein hoher, langer Zaun gewachsen war. Was für eine Tarnung? Wir hatten zunächst nichts begriffen. Sobald wir ans Lagertor gekommen waren, ließ man uns stehenbleiben und unsere Schuhe ausziehen. Wir dachten, das ist wohl unser letzter Weg. Dabei waren hier nicht einmal solche Deutsche und Polizisten, wie wir sie aus den Lagern kannten. Das waren Menschen-Unmenschen, einfach Tiere mit schrecklichen Verbrecheraugen. Es war uns aber schon einerlei. Endlich wurde das Kommando gegeben, das Tor aufzuschließen, und wir gingen hinaus. Von beiden Seiten begleiteten uns Maschinenpistolenschützen, obwohl wir nicht weit zu gehen hatten. Wir gingen die Straße entlang und gelangten an einen Erdwall. Abseits erblickte ich ein Holzhäuschen, eine Bude. An der Eingangstür waren ein Schädel und zweigekreuzte Knochen angebracht. Es handelte sich aber nicht um eine Zeichnung, wie man sie gewöhnlich an Transformatorenhäuschen sieht, sondern um einen echten Menschenschädel und echte Knochen. Es wurde uns klar: von hier aus gibt es kein Zurück mehr. Wir wurden weitergeführt und gerieten in eine Schlucht, worin es einen ebenen Platz gab; ich konnte nicht sofort begreifen, wie man bis dorthin anfuhr, es war aber zu sehen, daß es eine Trasse gab, daß Wagen, Gaswagen hineinfuhren. Man ließ uns auf den Boden setzen. Hinter der Schlucht hörte man Lärm und Geschrei. Was dort vor sich ging, wußten wir nicht. Endlich erschien ein junger Offizier, man sah ihm an, daß er ein großer Vorgesetzter war. Er schrie mehr als die anderen und ließ je fünf Mann abführen. Dann kam einer dieser Verbrecher, ein Deutscher, zu uns, ließ fünf Mann aufstehen und führte sie sogleich hinter die aus Ruten grünen Zweigen errichtete Umzäunung. Was hinter diesem Tarnzaun geschah, wußten wir nicht. Uns beruhigte aber, daß kein Schießen zu hören war. Das bedeutete, daß nicht erschossen würde … Tötete man im Gaswagen alle auf einmal, so nähme man alle auf einmal mit. Die Lage war also durchaus nicht klar. Bald kam dieser Faschist wieder und nahm weitere fünf Menschen mit. Ich saß vorläufig, wußte nicht, was zu denken war, und hörte überhaupt auf zu denken. Es gab nichts Schlimmeres als den Tod, was aber kommen soll, wird sowieso kommen. Nicht zum erstenmal war ich in einer so bösen Lage. Endlich war ich an der Reihe. Man führte mich ab. Sobald ich hinter den Tarnwall geraten war, eröffnete sich mir ein Panorama, das ich bis zum Lebensende nicht vergessen werde. Dort waren akkurat Leichen gelegt (später erfuhr ich, daß bereits Öfen zur Verbrennung dieser Leichen bereitstanden). Unwillkürlich schrie ich ‚Genug, ich will nicht mehr leben! Schießen Sie mich tot. Dann kam ein Deutscher zu mir gelaufen, der wichtigste Vorgesetzte. Wie ich später erfuhr, hieß er Topheide. Mit voller Wucht schlug er auf mich ein, so daß er mir den Unterkiefer verrenkte. Ich konnte weder schreien, noch sprechen. Einer der Deutschen stieß mich zu einem anderen, der auf einem Schemel saß. Neben ihm lagen Ketten und eine Schiene. Der Deutsche legte mir Schellen um die Knöchel, legte eine eiserne Kette unter, schlug eine Niete ein, Vernietete sie auf der Schiene. Dann ließ er mich dort Platz nehmen, wo alle anderen saßen, denen man schon Fesseln angelegt hatte. Ich begriff bereits, wohin wir gebracht worden waren und was wir machen sollten. Inzwischen strömte mir das Blut aus dem Mund, ich fühlte meine Zähne nicht, konnte meine Zunge nicht bewegen und versuchte, meinen Kiefer mit den Händen einzurenken. Es schien mir, daß unten in der Schlucht unsere Kameraden arbeiteten, die einige Tage früher fortgebracht worden waren: Ostrowskij, Wilkes, Trubakow und andere.“ 6
Den Häftlingen des Arbeitskommandos wurden wie schon erwähnt, Eisenfesseln angelegt, um sie an der Flucht zu hindern. Mit den Fesseln konnten sie zwar laufen, aber nicht rennen, so dass eine Flucht aussichtslos war. Gearbeitet wurde in Schichten rund um die Uhr. Unentwegt brannten die Feuer. Die zum Sonderkommando 1005 hinzugezogenen Ordnungspolizisten, die zur Bewachung der Schlucht dienten, hatten strenge Anweisungen bekommen, keinen Unbeteiligten “lebend rein oder raus“ zu lassen. Zudem seien die Häftlinge nicht als Menschen, sondern als „Figuren“ zu betrachten, bei denen jegliches Mitleid fehl am Platze sei. Man kann sich nur schwer vorstellen, was die Häftlinge des Arbeitskommandos zu erdulden hatten. Viele der Häftlinge verfielen aufgrund der entsetzlichen Arbeit, die sie verrichten mussten, in eine Art geistige Starre, waren daher nicht mehr zu gebrauchen und wurden gnadenlos erschossen. Die ganze Scheußlichkeit der Arbeiten in Babyn Jar schilderte der bereits zu Wort gekommene Häftling Jakow Kaper mit folgenden Sätzen:
„Unten aber lagen umschlungen ganze Familien, die 1941 erschossen worden waren; die einen hatte die Kugel getroffen, die anderen nur gestreift. Sie lagen alle zusammen, und es war fast unmöglich, eine Leiche herauszuziehen. Es kam des öfteren vor, daß sie in zwei Stücke zerrissen wurden, darum zog man sie mit großen Hakenstöcken heraus. Man gab sich Mühe, den Haken unter die Rippen zu schlagen, dann zogen einige Männer die Leiche gemeinsam heraus. Danach schleppte man die Leiche mit kleineren Haken zum Ofen, dort wurde sie vom Sonderkommando der ‚Goldsucher‘ untersucht. Goldene Zähne, Ringe, Ohrringe und andere Wertsachen wurden entnommen und die Leichen auf den Ofen gelegt. Die ganze Arbeit wurde unter strenger Aufsicht der Deutschen durchgeführt. Da wir nackt und barfuß waren, nahmen wir einige Sachen – eine Jacke oder Schuhe – und zogen sie an. Man konnte diese Sachen ein wenig trocknen und dann anziehen. Wir achteten nicht darauf, daß alles einen abscheulichen Geruch hatte. Mit welchen schmutzigen Händen haben wir gegessen, all die lange Zeit haben wir unsere Hände keinmal gewaschen! Arbeit vom Morgen bis zum Dunkelwerden und nur eine Mittagspause zum sogenannten Mittagessen. Jedes Vergehen wurde mit Erschießen bestraft, und sofort ins Feuer! Man mußte arbeiten, ohne mit jemandem ein paar Worte zu wechseln. Bemerkte man, daß jemand sprach, erschoß man ihn auf der Stelle.“ 7
In Kiew kursierten mittlerweile die wildesten Gerüchte über die Dinge, die in der Schlucht Babyn Jar vor sich gingen. Vorwitzige Bewohner hatten sich heimlich den Absperrungen genähert und ausgemergelte Gestalten gesehen, die große und sichtlich schwere Körbe trugen. Es hieß, aus diesen Körben hätten menschliche Körperteile geragt. Eines Nachts rückte die Kiewer Feuerwehr aus, um einen vermeintlichen Großbrand zu löschen. In der Nähe der Schlucht wurde die Feuerwehr jedoch von SS-Wachmannschaften aufgehalten und wieder weggeschickt. In jener Nacht hatten die Feuer der Verbrennungsöfen besonders hoch gelodert und besorgte Kiewer Bürger hatten ein Feuer gemeldet.
Die Arbeiten in Babyn Jar liefen auf vollen Touren, doch Blobel ging es nicht schnell genug. Daher ließ er eine an anderer Stelle arbeitende Abteilung des Sonderkommandos 1005 personell aufstocken und nach Kiew beordern. Außerdem wurde das Arbeitskommando mit zusätzlichen Häftlingen versehen. Im Zuge der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Kriegsverbrechen gab Franz Löbbert, einer der beteiligten Schutzpolizisten, folgende Aussage zu Protokoll:
Wir hatten die Bezeichnung Sonderkommando 1005 b, wenn ich mich recht erinnere. Wir erfuhren sie aber erst, nachdem wir von der Kaserne in Kiew nach einer Holzbaracke außerhalb der Stadt verlegt worden waren. Dort erschien eines Tages ein Gendarmerie-Hauptmann. Er war ein ganz patenter Mann und angenehmer Vorgesetzter. Er sagte in ganz legerem Ton zu uns, er würde uns nun einmal hinführen, wo unser Aufgabengebiet für die nächste Zeit sei. Wir sollten uns die Nase zuhalten, dort riecht es nach Käse. Er führte uns dann in ein Gelände, in dem es mehrere Schluchten gab, das Gelände war in der Nähe unserer Unterkunft, wir mußten 5 bis 6 Minuten laufen. Die Unterkunft lag bei einem jüdischen Friedhof. Bei den Schluchten sahen wir, wie ein Greifbagger Leichen aus der Erde herausholte. Uns allen wurde übel, es war ein fürchterlicher Gestank dort. Wir blieben in ziemlich weiter Entfernung von diesem Bagger stehen. Wir konnten nur den Arm des Baggers aus der Grube herausragen sehen. Wir bildeten um Hanisch herum einen Kreis, so hieß der Gendamerie-Hauptmann, Leutnant Winter müßte eigentlich auch dabei gewesen sein. Hauptmann Hanisch sagte etwa sinngemäß: Also was ihr hier seht, ist nicht euer Aufgabengebiet. Mit den Arbeiten habt ihr hier nichts zu tun, ihr sperrt nur das Gelände im weiten Umkreis ab, so daß niemand herein oder heraus kommt, nachts bewacht ihr die Gefangenen, die dort arbeiten. Außerdem erzählte er, daß an der Arbeitsstelle die Leichen der Massengräber exhumiert und verbrannt würden, um die Entstehung einer Epidemie zu verhindern. Die Arbeiten würden ausschließlich vom SD ausgeführt und geleitet. Er sagte, daß die Tätigkeit eine geheime Reichssache wäre, wir dürften nicht über die Angelegenheit reden. 8
Ende September 1943 galt Babyn Jar als „bereinigt“. Nun begann das Sonderkommando 1005 mit der Liquidierung der unliebsamen Mitwisser. Man zwang die Häftlinge sich in Gruppen von 10 bis 20 Personen vor den letzten zur Verbrennung aufgeschichteten Leichen aufzustellen und erschoss sie. Von der unmenschlichen Arbeit erschöpft, ausgehungert und ohne Aussicht auf Flucht, ergaben sich die Männer willenlos ihrem Schicksal. Etwa die Hälfte der Häftlinge wurde an einem Tag erschossen. Am 29. September 1943 gelang den restlichen Häftlingen zunächst eine Massenflucht, welche die Wachmannschaften jedoch schnell bemerkte. Der Großteil der Geflohenen wurde gestellt und an Ort und Stelle erschossen. Nur 14 Männern gelang die Flucht. Von ihnen erfuhr die Weltöffentlichkeit, was bei der Vertuschungsaktion in Babyn Jar vor sich gegangen war. Die Aussagen der ehemaligen Häftlinge führten nach dem Krieg letztendlich zur Festnahme und Verurteilung von Mitgliedern des Sonderkommandos 1005.
Durch die strenge Geheimhaltung konnten die alliierten Ermittler zunächst nur wenige Informationen über die Aktion 1005 in Erfahrung bringen. Bekannt war, dass eher unterrangige SS-Führer die Leitung der jeweiligen „Enterdungsaktionen“ leiteten. Von jenen war meist nicht einmal der Name bekannt. SS-Standartenführer Paul Blobel selbst wurde in einem der Nürnberger Nachfolgeprozesse für die begangenen Verbrechen der Einsatzgruppen zum Tode verurteilt.
Fast schien es, als ob die Angehörigen des Sonderkommandos 1005 ihrer Bestrafung entgehen sollten.
Im Dezember 1958 ging jedoch bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg ein anonymes Schreiben ein, in dem der pensionierte Polizeikommissar Otto Goldapp als NS-Kriegsverbrecher beschuldigt wurde. Jener bestritt jegliche Beteiligung an Kriegsverbrechen, es wurde jedoch weiter gegen ihn ermittelt. Im Zuge dieser Ermittlungen stießen die zuständigen Beamten auf den bereits verurteilten ehemaligen SS-Hauptscharführer Adolf Rübe, der im Ghetto Minsk zahllose Verbrechen begangen hatte. Später war Rübe auch bei den Vertuschungsaktionen des Sonderkommandos 1005 eingesetzt worden. Um sich Hafterleichterungen zu verschaffen, gab Rübe den Ermittlern alle ihm bekannten Informationen zur Aktion 1005 preis. In der Folgezeit konnten immer mehr Beteiligte und deren begangene Verbrechen ermittelt werden. Die Ermittlungen zur Aktion 1005 zogen sich fast zehn Jahre hin. Im Januar 1968 begann in Hamburg der Prozess gegen ehemalige Mitglieder des Sonderkommandos 1005. Nach 37 Verhandlungstagen wurden mehrere der Angeklagten zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt, darunter auch Hans Sohns, der Verantwortliche für die Vertuschungsaktion in der Schlucht Babyn Jar.
Es hatte über zwanzig Jahre gedauert, ehe die deutschen Behörden die Verantwortlichen der Aktion 1005 ermitteln konnten. Letztendlich erhielten diese jedoch ihre gerechten Strafen.
Adolf Haas – der unbekannte Kommandant
Wenn du mich schneidest, schieße ich dir eine Kugel durch den Kopf,“ sagte der stiernackige Mann mit dem Hitlerbärtchen zu dem Häftling in der gestreiften Lagerkleidung, der ihm gerade das Gesicht zur Rasur einseifte. Die Rangabzeichen der achtlos auf einen Stuhl geworfenen Uniformjacke wies den Mann als SS-Obersturmbannführer aus. Gekonnt rasierte der Häftling den SS-Führer und gönnte ihm auf Anweisung sogar noch eine kurze Gesichtsmassage. Danach fragte der SS-Mann den Häftling, ob er denn keine Angst gehabt hätte. Max Hollweg, so hieß der Gefragte, antwortete mit einem zaghaften Lächeln: „Nein, Herr Obersturmbannführer, wenn ich Sie geschnitten hätte – hätten Sie nicht mehr geschossen!“ Der SS-Führer lachte ein kurzes grimmiges Lachen und entließ den Häftling mit einer Handbewegung. Dieser ging erleichtert zurück in seine Baracke im Konzentrationslager Niederhagen. 9
Wer war dieser scheinbar gnädige SS-Obersturmbannführer, der so gelassen auf eine Antwort reagierte, für die ein anderer SS-Führer den Häftling mit Sicherheit verprügelt oder gar erschossen hätte?
Adolf Haas wurde am 14. November 1893 in Siegen im geschichtsträchtigen Westfalen geboren. Etwa anderthalb Jahre nach der Geburt ihres Sohnes zogen die Eltern Helene und Adolf Haas in die Nachbarstadt Hachenburg, wo sie das Hotelrestaurant „Westend“ übernahmen. Hierher lud der Vater gern seine Kameraden vom „Kriegerverein Hachenburg-Altstadt“ ein. Just am 4. Geburtstag von Söhnchen Adolf fand eine große Feier statt, in deren Rahmen der königliche Landrat einen neuen Fahnenschleier übergab, den Kaiser Wilhelm II. dem traditionsreichen Verein gestiftet hatte. Der Junge wuchs in einer derart militär- und kriegsverherrlichenden Umgebung auf, dass sein künftiger Lebensweg praktisch schon vorgezeichnet war. Zunächst erlernte Adolf Haas jedoch nach Abschluss der Volksschule den Beruf des Konditors und arbeitete nach erfolgreicher Ausbildung in Marmen, Bad Kreuznach und Mannheim.
Im Alter von 19 Jahren meldete sich Adolf Haas dann freiwillig beim Militär, was sein Vater mit Begeisterung begrüßte. Inwieweit er seinen Sohn bei dieser Entscheidung beeinflusste, ist nicht bekannt. Seine Ausbildung absolvierte Adolf Haas von Oktober 1913 bis Januar 1914 bei der „Stammabteilung der Marineartillerie-Abteilung Kiautschou“ in Cuxhaven. Während der gesamten Ausbildung galt Haas als mustergültiger Soldat. Seine späteren Vorgesetzten bei der SS lobten in ihren Beurteilungen immer wieder sein soldatisches Verhalten, priesen speziell seine Fähigkeiten in Bezug auf Kommandosprache und Exerzieren.
Nach seiner Ausbildung wurde Haas zum Hauptstützpunkt des kaiserlichen Ostasiengeschwaders im chinesischen Tsingtau versetzt, wo er am 22. Februar 1914 eintraf. Im Zuge des 1. Weltkrieges kam es zu einer Seeblockade des Hafens von Tsingtau durch britische und japanische Kriegsschiffe. Obwohl heute ein nur wenig bekannter Nebenkriegsschauplatz, kam es in Tsingtau zu einem erbitterten militärischen Ringen um die Vorherrschaft in China. Ende September 1914 schlossen japanische und britische Truppen den Belagerungsring und Tsingtau geriet unter ein Dauerbombardement von Land, Luft und Meer. Der von seinen Vorgesetzten geschätzte „Mustersoldat“ Adolf Haas wurde von einer Artilleriestellung zur nächsten geschickt, doch auch ein Kämpfer wie er wurde nach wochenlangem Einsatz kriegsmüde. In seinem Tagebuch notierte Haas Anfang November: „Gestern u. heute nichts zu essen bekommen u. ein paar Tage nicht geschlafen. Da ist man besser aufgehoben, wenn man erschossen wird. Mir ist es egal.“ 10
Am 7. November 1914 wurde Haas bei der Verteidigung der letzten Kampflinie durch ein Schrapnell leicht verwundet. Kurz darauf brachen die Japaner durch und die deutschen Truppen kapitulierten. Haas notierte in seinem Tagebuch: „Wir haben geweint wie die Kinder aber was half es, es mußte so sein.“ 11
Die überlebenden Verteidiger von Tsingtau kamen in Gefangenschaft und Haas wurde mit weiteren 466 Kameraden in einem notdürftig eingerichteten Kriegsgefangenenlager nahe Osaka untergebracht. Unterkunft und Verpflegung waren mehr als schlecht, Haas notierte in seinem Tagebuch: „Das Leben dort war miserabel. In den erdgestrichenen Bretterhütten war es sehr kalt und auch das essen war nichts wert und stets zu wenig. Japaner kochten. Es gab meistens Reis mit Zwiebeln u. ein Stück Fisch mit 3 Kartoffeln.“ 12