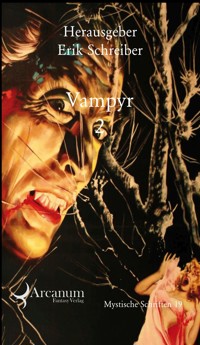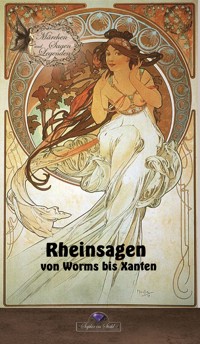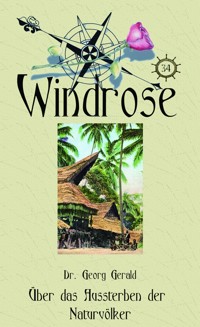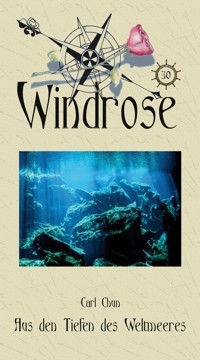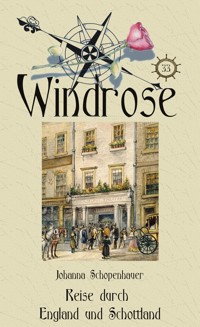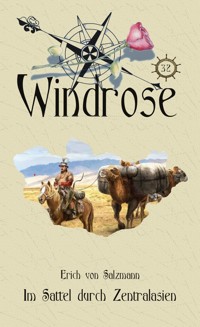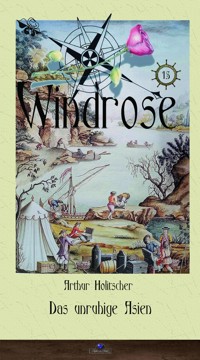
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Windrose
- Sprache: Deutsch
Arthur Holitscher. Geboren am 22.8.1869 in Budapest; gestorben am 14.10.1941 in Genf. Der Sproß einer Budapester großbürgerlichen jüdischen Kaufmannsfamilie war nach dem Abitur sechs Jahre lang Bankangestellter in Budapest, Fiume und Wien. 1895 ging er als freier Autor nach Paris; 1897 wurde er Redakteur des »Simplicissimus« in München. Nach Jahren eines unsteten Reiselebens zwischen Paris, Budapest, Brüssel, Rom, Neapel und München übersiedelte er 1907 nach Berlin, wo er Lektor von Cassirer wurde. Als Reiseschriftsteller besuchte er die USA, die UdSSR, Indien, China, Japan. 1933 wurden seine Bücher von den Nationalsozialisten verbrannt, er nahm seinen Wohnsitz in Paris, Ascona und zuletzt in Genf, wo er 1941 verarmt, verlassen und fast erblindet starb.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 15
Reiseerzählungen
Arthur Holitscher
Das unruhige Asien
Reise durch Indien - China - Japan
Saphir im Stahl
Windrose - Reiserzählungen 15
e-book 232
Arthur Holitscher - Das unruhige Asien (1926)
Erscheinungstermin 01.11.2023
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild:Viagem Filosófica pelas Capitanias do Grão-Pará.
Lektorat Peter Heller
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 15
Reiseerzählungen
Arthur Holitscher
Das unruhige Asien
Reise durch Indien - China - Japan
Saphir im Stahl
INHALT
ÄGYPTEN UND PALÄSTINA
Der Friseur auf der „Helouan“
Esbekieh Karakol
Stadt bei der Wüste
Siebzehn Pyramiden am Horizont
Sekte der Schlangenfresser
Talare vor dem Toten Meer
Ostern beim Gdud in Tel Awiw
Emek
Die Anzündung des heiligen Feuers
„Imponderabilien“
Die beiden Bäumchen
Stop
CEYLON
INDIEN
Madura, das dunkle
Adyar, das lichte
Leben, Tod und Auferstehung in Indien
1. Bombay
2. Die Türme
3. Dies ist die Stadt der Maya
4. „... des heil'gen Stromes Wellen ...“
Besuch bei Gandhi
Ahimsa oder: Himmlische und irdische Liebe
Der andere große Mann Indiens
Donnerkeilsland
CHINA
Erster zauberhafter Tag in China
Ein Nachmittag in Macao
Rote Parade in Canton
Schamien
Die Russen in Canton
Panorama der Stadt Canton
Schanghai und die Probleme der Revolution
Chikago des Ostens
Das Jahr des Tigers beginnt (Peking)
„Lest we forget“
Kuli Nr. 204
Blick auf China
Die chinesische Hydra
JAPAN
Blick aus dem Hotelfenster
Erdbeben-Land
Hifukuscho
Tokyo
Haikara
Die heiligen Stätten
Tempel
Nô
Kono Hana Odori
Geisha
Yoshiwara
Nichts mehr von Politik!
Theater
Sayónara
ÄGYPTEN UND PALÄSTINA
Der Friseur auf der „Helouan“
Der 8. März 1925 ist ein Sonntag („Reminiscere“). Selig schwimmt die „Helouan“ auf etwas bewegten Wellen an Kreta vorüber. Dem braunen Tigerrücken verbrennt die Nachmittagssonne in breiten Streifen den Pelz. Unten in der zweiten Klasse hat sich die Reling entlang ein munterer Korso entwickelt. Jugend stolziert, froh und laut, drängt sich aneinander vorbei, jedes sein Tempo wahrend. Es ist beschwingt, dieses Tempo, denn die „Helouan“ zieht der Küste Ägyptens entgegen, morgen ist man im Heiligen Land. Nur ein paar Alte stehen still auf dem hinteren Deck. Gestern war Sabbat, sie haben noch nicht genug vom Beten, scheint's. Ihre Megillen liegen aufgeklappt auf den großen Kisten, die fast das ganze hintere Deck einnehmen. Diese Kisten tragen in Schablonenschrift das magische Wort FORD aufgepinselt. Die Alten wackeln mit steifen Beinen beim Lesen. Die Autos in den Kisten rühren sich nicht.
Hinter mir, im Musiksaal erster Klasse, sitzt ein „Blauweißer“ am Flügel und übt mit einem Finger die Hatikwah, die Hoffnungshymne der Zionisten. Einen Ossendowskiband unterm Arm, stehe ich und höre gerührt zu. In drei Wochen werden wir nach der Eröffnungsfeier der Universität auf dem Skopus ob Jeruschalajim die Hatikwah singen. Meine Hoffnung berührt aber nur flüchtig den Skopus; sie fliegt nach Osten, Bagdad, Indien, Ceylon, denn diesmal geht es weiter, weiter, nach China, nach der Mandschurei, über sieben unerhörte Monate hinüber in die Ferne ... Die Sonne sprenkelt das Tigerfell mit grünen Lichtern; es zuckt über Kreta, dem alten Berg dort drüben auf — dir scheint ja das Fell zu jucken, alter Kamerad, hallo!! Ich habe in dem verdammten Ossendowski gerade das Kapitel von der Erledigung der Roten Partisanen gelesen. Von der Durchquerung des eisigen Flusses. Von der Bestechung des Tibetaners mittels eines mitgebrachten goldenen Eheringes. Auf einmal entdeckt der erschöpfte Reisende eine ganze Hausapotheke in seiner Satteltasche, voll der bezauberndsten Elixiere, mit denen er irgendeine augenkranke Fürstin magisch heilt ..., wenn das nicht geflunkert ist! Ich beschließe, in China ein parodistisches Kapitel über ähnliche mirakulöse Rettungen aus Todesgefahr zu fabrizieren. Warum nicht gleich? Hier auf der „Helouan“? Auf der Stelle? Ich will jetzt weiß Gott meine Schreibmappe aus der Kajüte holen, mich ins Schreibzimmer begeben, noch vor dem Abendessen wird das Kapitel fertig sein! Das Schiff zittert, es schaukelt, schwebt leise vorwärts; die Alten vor den Fordaltären haben ihre Megillen eingesteckt und sind verschwunden. An die Reling gelehnt, flirtet ein Chaluz mit einer dunklen Schönheit aus Kowno. Er zupft mit einem Taschenkamm an seinen aufgezwirbelten Haaren, daweil die Dunkle mit allzu roten Lippen gegenflirtet. Ich werde ein gutes Kapitel im renommistischen Stil des Ossendowski schreiben, Kapitel 31 vor Kapitel 1, in den Fingerspitzen juckt's mich schon! Gestern waren wir in Brindisi ... Jedes zweite Haus trug in Schablonenmalerei die sinistre Fratze des „Duce“, das heißt Mussolinis — besonders auf neugestrichene Fassaden hatten es die Burschen abgesehen — darunter den Wahlspruch: „A Noiü Per Forzaü!“. Und die überall herumpatrouillierenden Schwarzhemden mit Troddelmütze und Patronentaschen um ihre verwegenen Hüften! Ich sehe nicht ein, warum ich nicht ein paar solcher Operettengestalten in das Chinakapitel hineinpraktizieren soll? Und das Pärchen von der Reling mit hinein, warum nicht auch den Hatikwahspieler? Treibe ich nicht dem phantastischen Osten entgegen, dem unkontrollierbaren Asien, Bagdad, Engeddi, dem Persischen Golf, Singapore, Canton ...
Ein paar Minuten später sitze ich beim Friseur und lasse mir ein bißchen den Kopf waschen. Champoon von außen, während im Schädel das Ossendowskikapitel schäumt und Blasen wirft. Draußen vor der Friseurkabine spaziert Kowno, Wilna vorüber, Warschau, die Nalefki, leise schaukelnd im zunehmenden Abendwind, von der glorreichen Sonne rötlich beschienen. Der Friseur, ein flinker Dalmatiner, erzählt mir in seinem putzigen Italienisch von vielfachen Fahrten, jahrelang auf den Ostindiendampfern des Triester Lloyd. Jetzt pendelt er auf dem Luxusschiff rastlos zwischen Triest und Alexandrien hin und her. Ich mache ihn auf die Eleganz draußen aufmerksam, auf den Korso von Kowno, Wilna, der Nalefki, denke bei mir, während mir zehn Finger in den Haaren wühlen, daß es vor drei Jahren, als ich zum erstenmal dahinüber und dann weiter nach dem Heiligen Lande fuhr, doch eine andere Menschensorte war, hier unten auf den unteren, den hinteren Decken — junge prachtvolle robuste Arbeiter, ganz still und unelegant. So, nun bin ich entlassen. Der Friseur öffnet mir die Tür zum inneren Korridor — ich aber ziehe es vor, draußen mich unter den Korso zu mengen, mitten in die Eleganz der neuen palästinensischen Einwanderung auf Deck C der „Helouan“, angesichts des Tigerrückens, der weiter und weiter achterbord im rosafarbigen Abend bläulich, unirdisch transparent verschwebt, bis von seinen Schneebergen nur ein Schimmer, wie eine unbewegliche Wolke, am Firmament sich auflöst. Stark, duftig wie Wein, beglückend und voll strömt mir die Seeluft durch Mund, Nase, alle Poren, in Lunge, Hirn und Herz; ganz offen bin ich, der Seewind pfeift, singt, orgelt durch mich hindurch, als war' ich ein Instrument, ein Glockenspiel, Harfe, Posaune ... Die Schiffsglocke schlägt an, hart, fünfmal, sechsmal: Ablösung! Jetzt will ich hinauf, ins Schreibzimmer, auf Deck A, trete über die Schwelle ins Schiffsinnere, der Metallrand der hohen Schwelle hält meinen Stiefelabsatz zurück, Leute eilen auf mich zu, wollen mich auffangen, schon bin ich hingestürzt, das Buch flog weit von mir weg, nach vorn, ich werde in die Höhe gezogen, blicke in erschrockene Gesichter, versuche die Hand zu bewegen — mein Arm ist gebrochen, mein rechter Arm ist gebrochen, mein rechter Arm ist gebrochen ...
Die Arztkabine mündet auf den Korridor, den inneren Korridor von Deck C. Im Vorübergehen sehe ich noch die Tür der Friseurkabine offen stehen, die der Friseur mir geöffnet hatte, vor kaum zwei Minuten, und durch die ich nicht gegangen bin. Während ich auf das weißüberzogene Sofa in der Arztkajüte gestreckt werde, Kognak zu trinken bekomme, der Heilgehilfe ein Brett für den Arm, Verbandzeug, Watte vorbereitet, erzähle ich dem Arzt: eine Woche erst unterwegs — nach Ägypten, Palästina, Bagdad, China, die Mandschurei ... Der Arzt hat wasserblaue Augen, das typische starre Gesicht des Seemenschen, es fährt mir durch das Gehirn: so blicken Menschen ohne Hoffnung, welch ein Dasein, zwischen Triest und Alexandrien, hin und her, hin und her, jahrelang, jahrzehntelang. Der Arzt sieht mich an: jawohl, der Arm, hier und hier, er zeigt auf Stellen unter dem Gelenk der steifen, leblosen Hand. Gebrochen. Er hat die Korridortüre zugezogen, der Champoongeruch aus der Barbierstube sitzt jetzt ganz über meinem Kopf, um mich aber ziehen Jodgerüche, Karbol, ein unbestimmbarer Duft auch, von irgendeinem Frauenparfüm, vielleicht wurde der Arzt aus einer Kabine geholt ... Zehn Minuten später — es ist, als habe der Verstand es noch nicht recht erfaßt, was das heißen will: am Anfang einer Weltreise dieses Unglück! —, zehn Minuten später etwa gehe ich wieder Deck C entlang, inmitten des Korsos von Kowno, Wilna, der Nalefki. Dieselben Pärchen, Gruppen, jungen Eleganten stehen da, an die Reling gelehnt, auf demselben Fleck die meisten noch wie vor einer Viertelstunde, als ich, statt durch den inneren Korridor zu gehen, aus der Barbierstube hier heraus auf das Deck trat. Sie schauen mich an, sehen mit Erstaunen meinen Arm in der Binde, meinen steifen Armin der breiten weißen Binde an, blicken mir nach, sprechen mich an, ich antworte ... wildfremde Menschen reden zu mir, seit Triest habe ich mit niemandem an Bord gesprochen, jetzt habe ich im Handumdrehen hundert Bekannte, teilnehmende Freunde! Ich denke bei mir: Wochen, Monate, Jahre, ein ganzes Leben lang magst du mit einer zerbrochenen, in Splitter zerschlagenen Seele durch die Menschen gehen — keiner wird dich daraufhin ansprechen, und wenn dein Unglück faustdick aus den Augen starrt —, aber wenn du dir einen Finger verstaucht hast und einen Wattebausch drumgewickelt trägst, werden sie dich ihrer Teilnahme versichern, dir ihr Mitgefühl kundgeben, stehenbleiben, dich anreden, fragen, deine Einsamkeit von dir nehmen ... Der Friseur kommt aus seiner Koje gelaufen: „Ma, Signor, che cosa? Che mai ... vor zehn Minuten waren Sie doch noch bei mir drinnen!“
„Arm gebrochen! Auf einer Stufe!“
„Und ich habe Ihnen die Tür zum Korridor geöffnet! Wären Sie dorthinaus gegangen, dort ist keine Stufe ...“, er blickt mich mit erschrockenen Augen an, schweigt einen Augenblick, macht dann eine italienische Gebärde: „... aber, aber ... es ist alles Schicksal! Man kann nichts machen, Signor! E destino! E destino!“
Die Nacht über liege ich in Kleidern in meiner Kabine. Die See geht scharf, das Schiff kracht, ächzt, steigt in die Höhe, fällt senkrecht nieder, stockwerketief. Draußen klatschen die Wellen bis ans festgeschraubte Fenster herauf, rinnen über die Planken, die Brettwand, die mein Bett vom Wasser trennt. Rhythmisch, da nutzt kein Widerstemmen, rhythmisch wird mein kranker Arm gegen den Bettrand geschleudert. Das Licht brennt. Ich sehe meinen Verband. Habe genug betäubende Arznei bekommen, um einen Schiffbruch durchzuschlafen. Finde keinen Schlaf. Versuche Ossendowski weiterzulesen. Mit einemmal schrecke ich auf wie aus Halbschlaf — eine Erinnerung ist plötzlich wie aus einer Fuge der Seele herausgefallen ... liegt vor mir: Madame de Thebes ... wann war es doch? Januar 1897 hat sie mir's vorausgesagt: „Un accident en mer, mefiez-vous !“ ... auf einer Seefahrt, durch einen Sturz werde ich ein verhängnisvolles Unglück erleiden ... Fast dreißig Jahre sind es her. Gewiß habe ich während dieser dreißig Jahre nicht zweimal an diese Prophezeiung gedacht, obzwar ich sie, mit anderen merkwürdigen, merkwürdigen Voraussagen dieser außerordentlichen Frau, umständlich in mein Tagebuch notiert habe. Jetzt auf einmal ist es da, das Wort. Ich höre den Tonfall der Stimme, sehe den kleinen Tisch mit dem von dem niedern grünen Lampenschirm grell beleuchteten runden Lichtfleck, in dessen Mitte meine Hand liegt, während mein Gesicht im Dunkel bleibt; neben meiner Hand liegt die mit einem dreifach stufenförmigen, breiten goldenen Ring geschmückte Hand der Hellseherin ... ein Sturz, auf hoher See ... Nach einer Weile, wie lange, eine Minute, eine Stunde? repliziert die Seele. Sie entgegnet Zwiefaches. Ein kleiner Schritt, eine Stufe zu kurz genommen, und das ganze Leben hat ein anderes Gesicht bekommen — und dabei, ich weiß es genau, ich habe die Stufe gesehen, den Fuß gehörig gehoben, Gott ist mein Zeuge, ich habe den Fuß, wie sich's gehört, zur Höhe der Stufe gehoben! Es geht nicht mit rechten Dingen zu! Was war es, das mir die Ferse, den Stiefelabsatz auf den Metallrand niederpreßte, daß ich stürzen mußte, am Anfang einer Reise wie dieser — aber gleich darauf: Und was ist dabei? Das wird auskuriert! Eine Verzögerung von drei, von vier Wochen, und ich fahre weiter. Die Reise wird fortgesetzt, nach Ceylon, China, der Mandschurei. Verhängnis? Ach! Und ich schlage den Ossendowski auf, dort, wo ich zu lesen aufgehört hatte.
Esbekieh Karakol
Vierundzwanzig Stunden später sitze ich im Zuge, der von Alexandrien nach Kairo fährt. Es dunkelt schon, und von der Landstraße jenseits des Kanals, der uralten Straße, die vom Meer den Nil hinauf ins tiefe Afrika hinein- führt, ist nur ein undeutlicher Schimmer zu sehen. Vor drei Jahren: wie erschütterte da plötzlich mit einem gewalttätigen Stoß das Bild des Orients, zum erstenmal in diesem irdischen Leben erblickt, dort, jenseits des Kanals, bunt, betörend, wogend bewegt und doch ehern ruhevoll wie das jahrtausendalte, unwandelbar heilige Angesicht der östlichen Welt. Die Karawanen, langsam unter der Führung des wie ein Effendi beturbanten Leitkamels dahinziehend, vom Mittelmeer dem Äquator zu, durch blühendes Land in die tote, rieselnde Wüste; der blaue Scheich auf weißem Roß; Schiffzieher, braun und nackt, vor schwere Kähne gespannt; Segelboote mit leichter Fracht und zart gebogenen Masten; die Ziegelformer, die mit dürftigen uralten Quirlen Schlamm aus dem Kanalbett ziehen; die Eseltreiber, neben ihren Tieren einherlaufend und die aufrecht, mit schwebendem Gang unter schlanken Tonkrügen dahinschreitenden Fellachenweiber überholend; da — die kleinen Familien, uralt und heilig: die Mutter mit dem Kindlein auf dem silbernen Maultier, der Vater mit hohem Stecken in der Hand langsam neben dem Tier — und die dunklen Gruppen eilig in bunten Burnussen Dahinwandernder die Lehmdörfer der Straße entlang. Mit meinem kranken Arm muß ich rasch nach Kairo. Die Nachtstunden verschlingen die Straße, der Schmerz ist unter Betäubungsmitteln halb begraben. Auf einer Station, Damanhour, es kann auch Tanta sein, sehe ich beim Einfahren in die Stadt den Glühlichterkranz um die Spitze des Minaretts vorüberfahren. Hier vorn aber, wo der Zug hält, auf dem schmalen Bahnsteig der Station, kniet unter einer Bogenlampe ein Beter, ganz in sich versunken, richtet sich auf, wirft den Kopf zurück, beugt sich dann wieder mit einem Ruck tief, berührt mit der Stirn den Bahnsteig, die schmutzigen Pflastersteine, befreit von allem Hienieden, während der Zug schon pfeifend, eisern in seinen Gelenken rasselnd weiterfährt.
In meinem Wagen sitzen Leute aus der „Helouan“. Es ist der Wagen erster Klasse, ich bin allein in meinem Abteil, ein wenig betäubt, doch froh, von meinem Unfall nicht allzusehr belastet. Bis Bagdad werde ich jetzt festen Boden unter den Füßen behalten. Was sage ich, bis Bagdad — bis Bassorah, bis zum Persischen Golf, auf dem ich, wenn der Arm erst geheilt ist, zu Schiff nach Karachee weiterfahre ... Madame de Thebes ... der Friseur von der „Helouan“. Das Geschwätz vom Schicksal! Ein dummer Zufall, Sturz, erst der Aber glaube macht einen Fall daraus, der Trieb, Lebensgesetze zu suchen außerhalb des vernunftmäßig Bestimmbaren. Löst sich der Trieb aus der Umklammerung der kontrollierenden Vernunft los, dann erst ist der Seele die Herrschaft über das Geschehen genommen und das Leben wird hilflos hin und her gestoßen zwischen Zufall und Absicht und dem Willen, zu entrinnen — fliegt endlich in die Selbstaufgabe hinein, versinkt in orientalischen Fatalismus. All dies windet sich mit Mühe aus dem von anästhetisierenden Giften schwer gelähmten Bewußtsein herauf, aber es beweist — holla! — die Seele hat noch ihren Widerstand, wenn der Körper auch seinen Hieb abbekommen hat! Die Seele, jung und spannkräftig in dem immerhin gealterten mürben Fleisch — denn dieser Sturz, er ist nicht der einzige in den letzten Monaten, die mürben Knochen sind nicht allein hier, unter dem rechten Handgelenk, entzwei ... Schicksal, Zufall, Aberglaube — vor dem Schreibtisch hätte all das ein anderes Gesicht und wird es vermut- lich auch bekommen, wenn ich erst wieder einen Schreibtisch, das heißt festen Boden unter meinen Händen habe — jetzt aber, auf dem Wege nach Indien, China, der sagenhaften Mandschurei, dem fernen, östlichen Tor, beschwingt und trotz allem selig über die Welt ...
Draußen auf dem Korridor geht der Wiener Rothschild von der „Helouan“ vorbei, schaut in mein Abteil, sagt zu seinem Begleiter, mit einem Blick auf mich, im schleppenden Jargon des Jockeiklubs: „Der arme Kerl hat sich den Arm gebrochen!“. Hilf mir lieber beim Aussteigen! Denke ich mir. Die gelinde Wut, in die mich die wienerisch mitleidigen Worte versetzen, weckt mich vollends auf. Es sitzt seit Damanhour, oder war es Tanta, ein Mann in meinem Abteil mit unzähligen französischen und englischen Zeitungen, die er aus einer kleinen Suitcase nacheinander herausnimmt und methodisch und aufmerksam zu lesen scheint. Wir nähern uns Kairo.
Die Lichter der Stadt funkeln bereits auf durch die ägyptische Finsternis. Ich taste meine linke Körperhälfte entlang, wo ich Portefeuille mit Paß und Geld verstaut habe, schiebe den Paletot über die rechte Schulter, den kranken, festgebundenen Arm und Ellbogen, der Zug verlangsamt sein Tempo, hält. Im letzten Augenblick fällt mir ein: ich hätte Ernst telegraphieren sollen, daß er mich von der Bahn abhole. Aber da steht schon der Portier des Hotels, in dem ich ihn in einer halben Stunde finden werde; die Träger des Hotels stehen auf dem Bahnsteig, ich rufe, flink steigt einer durch das Fenster in den Wagen herein, hebt mein Gepäck hin- aus, springt aus dem Fenster auf den Bahnsteig hinunter. Mein Arm schmerzt. Bei jeder unbedachten Bewegung bohrt ein Dolch sich aus dem Gelenk in den Ellbogen. Vorsichtig taste ich mich in den Korridor hinaus. Die Stufen des Waggons zum Bahnsteig, diese verdammten ägyptischen Waggonstufen, sind steil, eine Kletterkunst, wie komme ich da hinunter? Im Korridor stehen noch Leute. Sie versperren mir den Weg zum Ausgang. Ich trete zurück, um sie erst aussteigen zu lassen. Unten der Träger mit meinem Handkoffer und Tasche läuft schon den Bahnsteig entlang. Ich gehe wieder auf den Korridor hinaus, da stehen die drei noch. Ich bemerke, es sind nicht Mitfahrende aus diesem Wagen, nicht Mitreisende von der „Helouan“, sie haben gar die verkehrte Tür nach dem falschen Bahnsteig geöffnet, ich aber muß durch, mein Gepäck ... was suchen die da noch, der Zug ist ja leer, ich muß mich zwischen ihnen durchdrängen, fühle mich vorwärts geschoben, nach der offenen Tür zum falschen Bahnsteig zu, schreie auf, „take care, you See, my arm“, umklammere schützend die kranke Rechte mit der heilen Linken, die drei steigen aus, einer murmelt eine Entschuldigung, sie steigen ... nach dem falschen Bahnsteig hinunter, geben mir den Weg frei ... im Nu taste ich meine linke Seite ab ... weg ... mein Portefeuille ist weg, mit Paß, Geld, Notizbuch, Kreditbrief ... Ich stürze den dreien nach, zur Tür, durch die sie hinaus sind ... der Bahnsteig leer! ... nach der anderen Seite, steige, rufend, die steilen Stufen hinab: „Police!“ — da steht die Bahnhofpolizei, etliche zehn Mann, schreiend, gestikulierend um einen armseligen Araber herum, den man soeben bei einem Taschendiebstahl erwischt hat ... meine Räuberskerle waren europäisch gekleidet, drei unauffällig gekleidete Ägypter in europäischer Tracht. — Zu spät.
Im Hotel sagt man mir: Ernst sei vor einer Stunde in ein arabisches Variete gefahren, „Tausend und eine Nacht“, ein paar Minuten weit vom Hotel. Ein Dragoman fährt mit mir, hilft mir in den Wagen. Ich fahre durch das nächtliche Kairo. Wir wollten diese Reise nach Indien, der Südsee, China, Rußland zusammen machen. Meine Absicht war, ihm als erfahrener Reisekamerad über die schwierigen Wege einer solchen Weltfahrt hinüberzuhelfen; er sollte Europa entrinnen, den Erinnerungen an Haft, Gefängnis, seine fünf schweren Jahre Niederschönenfeld — jetzt begegnen wir uns im Orient, wie's verabredet war, und er ist's, der mir helfen muß, ich bin es, der einen Dienst von ihm fordert, und dieser Dienst ist: in ein Polizeiamt mit mir zu fahren, in ein anderes, noch in dieser Nacht, Protokolle aufsetzen ...
„Das Leben ist von einer ungeahnten Gemeinheit.“
Spät nachts gehe ich in mein Zimmer hinüber und bin allein. Unter dem Fenster lärmt die Gasse. Das Saxophon drüben in Giros Klub inmitten des Gartens von violettem Gebüsch, Palmen, Sykomoren. Kutscher keifen, debattieren, auf Fahrgäste lauernd, bis zum Frühlicht. Das Moskitonetz fällt nieder über mein Bett, in dem ich mit offenen Augen liege — tausend kleine stechende Gedanken, Myriaden kleiner summender Sorgen schwirren innen um meinen wachen Kopf. Wach liege ich, bis die Falken, die Sperber ihre schwingenden Flüge vor dem Fenster zu vollführen beginnen, die großen, dunklen, kreischenden Tiere, Wächter der Toten in den alten Gräbern Ägyptens, die heiligen Vögel des Rha. Weiß Teufel, gründlich bestohlen! Nach dem Sturz der Raub. Alles, mit einem Griff, Paß, Geld, Notizen, der Kreditbrief — die Welt, noch vor Stunden offen, lockend da, die Meere, Kontinente — ver- sperrt, versunken. Hier aus der Tasche dieser Jacke holte die flinke Hand die Welt heraus. Teufel nochmal, geschickter, geschickter Dieb!
Nebenbei bemerkt, ist's ja nicht das erstemal, daß ich bestohlen werde. Ja, ich kann mich rühmen, daß ich ein besonderes Talent besitze, ein ganz besonderes, einzigartiges Talent zum Bestohlenwerden! Talent; denn wie zum Reichwerden, zum Berühmtwerden, zum Familienglück, zum Regieren, Massenmord, Stehlen, Lügen, ja zum Selbstmord Talent, angeborenes Talent gehört, so kann man auch zum Bestohlenwerden Talent haben, und ich besitze es in ausgiebigem Maße.
An den Fingern meiner heilen Hand werde ich's kaum herzählen können, wie oft an Gut, Arbeit, Ruhm, Lebensglück bestohlen ... Und jetzt: die drei im Zug, unauffällig aus einem fremden Wagen in meinen eingestiegen, um mir die Welt aus der Tasche zu stehlen ... wahrhaftig, Talent zum Bestohlenwerden, wenn zu nichts anderem — zum Bestohlenwerden ein mitgebrachtes, herrliches, einzig bewährtes Talent!
Die Nacht, in der ein Mensch alt wird, in der das Leben einen Schritt über dich hinüber macht, vergeht langsam. Wie stumme Tränen rinnen die Sekunden über dein erstarrtes Gesicht, und jede läßt eine Furche zurück. Alles ist aufgelöst wie ein Brei, Morast, in dem die Seele versacken muß, schier versacken. Ringsum ist nichts, um den Schrei, die Qual nichts, luftleerer Raum ohne Schall — für den Wehschrei, den der wüste Gott aus dir herauspreßt, sind die Wellen des Äthers nicht vorhanden. Dem vergehenden Menschen wird sein Atem ins Herz hinuntergestoßen, die Luft geht ihm aus, hilflos, preisgegeben das zermarterte Herz, ein Gefäß geworden für alles Bittere der Welt; die Zirkulation ist unterbrochen, der Strom versickert, du bist der passive Teil der Welt, keine Strahlen sendet dein Herz mehr aus, das entsetzliche Schicksal, das es also doch gibt, obzwar du gestern in einer Stunde der Auflehnung nahe daran warst, es zu leugnen, verleugnen, das entsetzliche Schicksal gräbt in dir herum, als wärst du scheintot, gräbt sozusagen mit fünf Fingern in deiner Tasche herum, ob da noch etwas wäre, was es dir nehmen könnte. Und mit einer verzweifelten Anstrengung richtest du dich auf, zeigst alles Verborgene her: bitte, hier, und dies da — das gehört mir noch, greif zu — alles tust du von deiner Seele ab, schamlos bietest du deine nackte, armselige, zerschundene Seele dem Schicksal dar, dem zynischen Dieb: da, bitte, greif zu, schlag mich nieder ... Schlag mich doch nieder.
Der Schmerz des Körpers ist willkommen. Der ziehende, bohrende, zerrende Schmerz ist herrlicher Wohltäter der Seele. Er reißt den Schmerz der Seele mit gewaltsamem Ruck zu sich hinüber, löst das fressende Weh der Verzweiflung auf in einem starken, realen, soliden, unleugbaren Element. Der kranke Arm, das zerbrochene Gelenk, die ganze rechte Körperhälfte brennt lichterloh, erst in unbestimmtem, hier und dort wild aufflackerndem Lodern, dann, wenn die Wirkung der Betäubungsgifte gänzlich verschwunden ist, in einem gewalttätigen, schaukelnden, schwingenden Rhythmus, der den Körper rollt, schleudert, so daß er wie ein leckes Schiff mit geborstener Maschine auf dem Ozean des Leidens ohne Land versinkt. Gestern, auf der Fahrt von Karakol zu Karakol, das heißt vom einen Polizeirevier zum zweiten, hat sich der Notverband verschoben, und seither sind der Arm, die Hand aus der Lage. Ehe der Chirurg morgen die Aufnahme macht, den Gipsverband anlegt, werde ich zum American Express müssen, um den Kreditbrief zu sperren — der Brief! Wäre Ernst nicht da, der hilfsbereite Freund, ich stünde ohne Pfennig in dieser Stadt. Nur wenige Pfunde haben die Diebe in dem Portefeuille gefunden, der Kreditbrief aber, die ganze große Summe war noch intakt. So habe ich ein Programm für morgen: erst der Express, die Riesenorganisation über die ganze Erde, sie wird doch die Sperrung veranlassen können, vielleicht ist nichts verloren, das Tor der Welt nur zugelehnt! — dann der Chirurg, der körperliche Schmerz, der kaum mehr zu ertragende, nimmt ein Ende — und dann, gegen Mittag: die Stadt, diese phantastische Stadt an der Wüste, das Wiedersehen mit dem Orient, dem tiefen, bezaubernden, hier, wenige Schritte vor dem Haus — dem weiten, brausenden Orient, der offen steht, mir keineswegs verschlossen ... nein ... Ich atme jetzt ruhiger. Bemerke, daß mein Atem viel ruhiger geht, als ob der Körper den Kampf mit dem Schmerz aufgegeben hätte, der Schmerz sich besänne. Unter dem dumpfen, dröhnenden, heißen Schmerz im Arm, dem Handgelenk — ein feines, rieselndes, zirpendes Kribbeln. Leises, haarfeines Vibrieren, Oszillieren der Magnetnadel — die zerrissenen Nervenfasern senden ihre Spitzen aus — über die zerbrochenen Knochen, Knorpel, Muskeln weg suchen sich die Enden der feinen Nerven, ziehen sich an, greifen der Heilung vor ... Schon treibt der Körper, schwerer und müder, dem Schlaf auf sanften Wellen des Atems entgegen. Im Entschwinden des Bewußtseins erfaßt die Seele noch den wunderbaren Prozeß: geheimnisvolle Anziehung, geheimnisvoll waltender Lebenstrieb, leise, im Körper, der in Schlaf versinkt, mit zarten, engelgleich singenden, sich sehnsüchtig suchenden Nervenspitzen tastet der Wille nach der verlorenen Welt, regen sich feine sehnsüchtige Strahlen von dir hinaus, von der Welt nach dir, die Heilung ist im Gange, der Mut, die Freude vielleicht, durch das geheimnisvolle Wesen entfacht, das in deinem Körper, deiner Seele wach ist, unbegreiflich wach, während dein Gesicht im Schlaf hingezogen nach Osten sich wendet, dem himmlischen Jerusalem zugekehrt.
Stadt bei der Wüste
In dieser Stadt vergehen meine Tage zwischen Grauen und Verzauberung. Grauen und Verzauberung — aus diesen Elementen ist die Stadt gebaut, zusammengebraut: der Verzauberung des tiefen Orients in den Vierteln um die Muski, bis zum Sandgebirg Mokattam, den Dörfern des Nilufers — und daneben der irrsinnigen Hast, dem nervösen, stampfenden Treiben des modernen Stadtviertels, ohne Übergang angeklebt an die Orientstadt der Eingeborenen. So, zwischen Würde und Angst, dem sublimen Überschwang der Seele, die den geruhsam tiefen Sinn des Orients erfaßt hat, und dem jähen Zurückstürzen in die schweißtreibende Wirklichkeit des Unglücks, vergehen meine Tage in Kairo. American Express sperrt die Auszahlung des Kreditbriefs. Dieser Brief lautet auf eine große Anzahl, auf all die Hunderte seiner Filialen in der ganzen Welt. Die ägyptischen, palästinensischen, syrischen werden sofort telegraphisch verständigt — angeblich sofort verständigt. Dann sollen in immer weiterem Umkreis die entlegeneren bis zu der entferntesten durch die Pariser Zentrale benachrichtigt werden. Natürlich ist die Spannweite zwischen meinem Anteil an dieser Angelegenheit, die für mich eine Katastrophe bedeutet, wesentlicher als für die Leute des Express, in deren Praxis solche Fälle wahrscheinlich alle Tage vorkommen. Ich werde den Eindruck nicht los, daß dieser Angelegenheit keine besondere Sorgfalt zugewendet wird — und doch hängt für mich von ihrem Ablauf mehr ab als diese Reise, diese wunderbare Reise allein ... Dagegen ist der Konsul meines Landes, den ich sofort aufsuche, um mir einen Notpaß zu verschaffen, von größter Dienstwilligkeit; er ist ein angesehener jüdischer Bankier Kairos und in seine Würde als Konsul Ungarns erst seit einer Woche eingesetzt. Mein Fall ist der erste, in dem er seine Funktionen ausüben kann. Die Behörden erweisen mir, ohne direkt im wesentlichen zu helfen, zarte Aufmerksamkeit. Im Hotel besucht mich ein englischer Beamter der Geheimpolizei und nimmt ein Protokoll auf. Von seinem Schreibblock erhebt er nur selten den Blick, aber dann mit einem durchdringenden, durchbohrenden Anschauen meines im Bewußtsein meiner Unschuld ruhig bleibenden Gesichtes. Ich glaube, ihn interessiert es vor allen Dingen: ob ich etwa nicht selber mit einer Diebsbande die ganze Sache arrangiert habe? Einen Tag später telephoniert es von der Bahnhofspolizei, Esbekieh Karakol. Ich erhalte die Nachricht erst spät nachts im Hotel. Soeben hat man einen Taschendieb gefaßt, der einem Amerikaner ein paar tausend Dollar gestohlen hat. Ich soll an den Bahnhof kommen, mir den Mann ansehen. In einer kleinen, von ägyptischen Polizisten überfüllten Wachtstube steht ein schlanker, intelligent aussehender Mensch von etwa dreißig Jahren, mit amerikanischer Hornbrille, in elegantem braunen Regenmantel, dessen Gurt er enger anzieht, als wir eintreten, um sich Haltung zu geben. Ich sehe den Mann an: es ist nicht meiner. Ich blicke in ein mürrisches, erstarrtes Gesicht, eine Larve fast. Ich bin der letzte Mensch, dem dieser Mensch ins Angesicht blickt, ehe die Gefängnishölle ihn verschlingt. Im Geiste bitte ich ihm die Schuld ab, die der ehrbare Bürger dem Verbrecher gegenüber hat. Nach meiner Erklärung wird der Mann sofort von einem Polizistenschwarm abgeführt. Er hinkt, man hat ihn, als er zu fliehen suchte, mit einem Hieb niedergeschlagen. Er trachtet aufrecht zu gehen, verschwindet in der düsteren, staubigen Halle.
„Ein Russe“, sagt der zurückbleibende Polizeiinspektor, „ein Ausländer“, und mit einer Handbewegung: „dem werden wir's zeigen. Wenn hier einem Fremden etwas gestohlen wird, heißt es gleich: die ägyptischen Taschendiebe! Dabei sind die meisten aus Europa zugereist. Dem Kerl werden wir's zeigen.“ Und wenn ich hundert Jahre alt werde, den Blick des russischen Diebes vergesse ich nicht, des Menschen vor dem Versinken in das Grauen eines ägyptischen Gefängnisses.
Wieder im Museum. Im ersten Stock die neuen Ausgrabungen aus dem Tut-En-Chamen-Grab. Ein Gang durch die unteren Hallen: Wiedersehen mit dem Dorfschulzen, dem schreitenden Priester des Ptah, der weißhäutigen Gipsprinzessin Nephret, mit dem König Myzerinus, den rechts seine Königin und links sein Dämon umarmt hält. Der Typus des Menschen, des Kulturmenschen, hat sich innerhalb sieben Jahrtausende nicht im geringsten verändert. Auf den Stockknäufen des Tut die Köpfe sehen genau aus wie Köpfe von Menschen, die man heute im Muski, auf Mokattam sehen kann; er selbst ist ein verwöhnter dekadenter Junge, der jeden Augenblick aus Shepheards Hotel von der Terrasse auf die Straße heruntersteigen könnte. Die gleichen Konflikte, Leidenschaften, Verdrängungen, die gleiche Überreizung, Nervosität und Hast auf den Gesichtern der Menschen von je und von heute, dieselbe überreizte Verfeinerung in dem Hausgerät von heute und den unerhört zarten, unbeschreiblich graziösen Alabastervasen für Räucherzeug, Kästchen für Schmuck, Schemeln und Stühlen Tuts. Sieht man die steinernen Gesichter und die aus Fleisch vor ihnen, dann fällt einem das Wort Renans ein, daß die Moral keine Fortschritte mache. Und es kommen einem seltsame Gedanken über politische Evolution, Macht, Knechtsinn, Selbstherrlichkeit und Zerknirschung, Götzendienst und Heldenverehrung oder was man heutzutage so nennen muß. In majestätischen Flügen, nach unten ausladenden, nach oben sich rapid verengenden Spiralen kreisen vor meinem Fenster die Sperber und Falken über dem violetten Garten um Giros Jazz-Kasino. Irr und mitgerissen, hin- und hergetrieben, in die Höhe geschleudert und breit und abgrundtief zum Boden hinuntergezogen, lebt die Seele, glühend und beseligt, unruhig ihren Tag zwischen Würde und Not in dieser Stadt des Orients.
Der Orient ist ein zertrümmertes Haus. Im Bau unterbrochen? Oder hat es vor Zeiten, nicht weit über dem Erdboden, einen Hieb abbekommen, daß die Fensterrahmen im ersten Stockwerk wie zerschlagene Zäune in die Höhe stechen? Aus unterirdischen Verliesen ein namenloses Gewimmel; zwischen Abfällen, üblem Geruch halbnackte Kinder, dunkel gekleidete Frauen mit schwarzen und bunten Tuchfetzen vor den Gesichtern; hohe dürre, in farbige Burnusse gekleidete braune Mannsgestalten. Und unmittelbar angeklebt an die niederen engen Wohnverliese die Wucht der europäischen Vielstockhäuser, Pariser Straßenarchitektur, Eleganz, Lungern und lauerndes armseliges Vegetieren durcheinander. Der Duft der Stadt ist ein anderer als vor drei Jahren — damals war's Herbst, die herrlichsten Früchte häuften sich auf den Tischen der Obstverkäufer: Granatäpfel, groß wie blonde Kinderköpfe mit kleinem aufgebundenen Schopf, Feigen, voll Sonne, die süßen seifigen Icecreamknollen des Kaktus, verzuckerte hellviolette Pasteken, kanaanitische Trauben von prickelndem, champagnerähnlichem Geschmack, die blassen Mondorangen aus den Gärten um Jaffa. Dafür duftet heute die kleine tropische Blumen- und Palmenoase mitten in der Stadt im Schmuck unerhörter Blumenfülle; zu Füßen der wild ineinandergeschlungenen Lianen sitzen auf den kleinen Bänken im Schatten des hereinbrechenden Abends Menschen, betäubt von der Wolke von Gerüchen über dem Garten.
Auf einer dieser Bänke sitzt allein ein Mensch und singt mit lauter Stimme. Er ist europäisch gekleidet, in helle Sommerfarben, hält zwischen den behandschuhten Händen einen Silberstock und singt, ganz einfach und ruhig, die griechische Litanei. Der Abend hat in dem Irrsinnigen die Ideenassoziation an die Zeit der Messe geweckt, in der er als Kind die Responsorien gesungen hat. Jetzt sitzt er da und singt mit angenehm tönender Stimme laut den sakralen Text, und auf den anderen Bänken sitzen wir und hören ihm geruhsam und ohne Staunen zu.
Zu Füßen Mokattams, zwischen dem Zitadellenberg und der Esbekieh-Oase inmitten der europäischen Stadt, liegt, um die lange Muski geschlungen, in wirre Gäßchen zerfasert, der Bazar. Wunderherrliche Moscheen erheben ihre dünnen Minarettnadeln wie Wegweiser aus dem Gewirr. An ihnen vorüber wagt sich der Fremde immer tiefer ins Labyrinth der schmalen Gänge, in die Lauben, die überdeckten, mit Segelleinwand, Latten, Lumpen, zerbrochenen Wölbungen, Torbogen, Laufgalerien kreuz und quer verbundenen Höfe, Alleen, Gäßchen und Schlupfwinkel. Verborgen im Mittelpunkt des Bazars das ungeheure Kaffeehaus, in dem um jede Tageszeit Hunderte von beschaulichen Arabern vor ihren kleinen Tassen sitzen, den buntgeschmückten Sauger der Wasserpfeife zwischen den breiten Lippen. Wie lang denn, ihr ganzes Leben lang sitzen sie da, rühren sich kaum, lassen sich auf dem trägen Strom des orientalischen Lebens von der Wiege zum Grabe gleiten; unter ihren schweren und immer schwerer werdenden, mit dunklem Kaffeesatz, süßem Fett genährten Leibern rinnt das Leben fatalistisch dahin, im Wasserbehälter ihrer Pfeife kräuselt sich zuweilen die trübe Flüssigkeit, das ist der einzige Beweis dafür, daß der Raucher lebt. Draußen, nicht weit von dem Kaffeehaus, in einer der kleinen Winkelgassen, sitzt in einer Runde von schweren schwarzgewandeten Weibern, die in ihren Binsenkörben allerlei verkäufliches Zeug feilhalten, eine alte Negerin mit einem schwarzen Tuch, das ihr, durch eine kleine Röhre von der Stirn an gehalten, von den Augen abwärts über Nase, Mund und Kinn fällt. Jeden Tag, an dem ich mit Ernst hier vorüberkomme, sitzt die Alte vor ihrem Korb, in dem ein halbes Dutzend Kaurimuscheln liegen, sechs kleine elende Kaurimuscheln. Es ist eine lächerliche Form des Bettelns, eine elende Finte. Wer in aller Welt soll der Alten ihre Muscheln abkaufen? Wenn man ihr einen Piaster in den Korb wirft, trifft einen ein Blick aus den alten Augen im Ausschnitt des schwarzen Tuches. Die Augenwinkel sitzen voll Fliegen. So elend ist die Alte, daß sie gar nicht mehr daran denkt, die Tiere aus ihren Augenwinkeln zu verscheuchen. Durch die Muski hinkt ein alter Bettler. Ganz in Lumpen gehüllt, schlurft und hinkt er an uns vorbei. Seine dürre Hand, dürr und dunkel, wie aus Ebenholz geschnitzt, wie die erhobene Hand jener Pharaonenmumie im Museum, mit Nägeln aus altem Elfenbein, streckt er uns entgegen. Die Menge stößt sich an ihm, an uns vorüber, weicht aber dem Alten ehrerbietig aus. Er hat auf seinem braungrauen Schädel einen grünen Turban sitzen, der besagt: der Alte hat das Grab des Propheten in Mekka besucht. Sein Grab, sein eigenes — lebe hundert Jahre, alter Freund! — es wird eine besondere Farbe erhalten. Die beiden Pfosten zu Häupten und zu Füßen seines Grabes, auf denen der Engel des Guten und der Engel des Bösen sitzen und um die Seele des Pilgersmannes disputieren werden, sie werden eine Tönung erhalten, die dem Auge Allahs wohlgefällig sein soll am Tage des Gerichts. Wie ich ihm, zugleich mit Ernst, meine Münze in die alte Hand drücke, hebt er beide Hände beschwörend auf und segnet meinen kranken Arm und die Binde, in der ich ihn trage, mit einem Gemurmel aus dem Koran. Wunderbar ist es, in den Gängen des Bazars herumzugehen, vor den kleinen abseitigen Höfen stehenzubleiben, die sich überraschend vor einem auf tun. Eine Werkstatt öffnet sich vor dem Blick wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. In kleinen muffigen Schusterhöhlen werden zierliche Saffianpantoffelchen geklopft, mit zierlichen Silbertroddeln auf dem Schnabel geschmückt, daneben hängen an die Wand gereiht die schweren derben Pantinen der Wüstenwanderer; sprühende Öfchen der Gold- und Silberschmiede spritzen Funken hinaus in die Allee, da hämmert ein Dutzend feiner Werkzeuge silberne Intarsien, Koransprüche, zierliche Buchstaben in große Metallplatten; Läden der Geldwechsler neben den anrüchigen, mit Flitterkram wie Bordellsalons geschmückten Barbierstuben; und eine Reihe von Werkstätten, in denen die Kopfbedeckung der Moslems, der rote Tarbusch, über große Messingformen geschlagen wird, sauberes Metier. Weithin duften die Kuskuskuchen mit breiten Fladen aus Weizenkuchen und Gemüsehäcksel, hohen Gläsern mit grellroten, violetten und grünen Einmachfrüchten, schwer zu verdauenden Leckerbissen aus Fett, Honig und Fruchtsaft. Die tausend kleinen Zellen, Kojen, Rattenlöcher, Nischen, Durchlässe, Höfe und teppichbehängte halbdunkle Läden, aus denen der unheimlich verästelte Bazar besteht, sie bergen ein wundervoll gleichmütiges, freundlich-heiteres, abgründig unheimliches, noch nicht erkanntes, vom Europäer kaum erforschbares Volk, dessen Leben vielleicht nur in der Vergangenheit, im tiefen Düster verschütteter Jahrtausende, ein Leben nach unserem Maßstab genannt werden könnte. Mit einem Seufzer, müde, und je müder ich werde, um so verzagender, nehme ich Abschied von dem Volk der emsig auf Metall klopfenden, von den mit roten Ambrarosenkränzen vor ihren kleinen Läden mit untergeschlagenen Beinen dasitzenden würdevollen Händlern, von dem labyrinthähnlichen Bazar und der Muski. Nicht werde ich, wie's meine Absicht war, gemächlich und sorglos mich immer weiter nach Sonnenaufgang zu durch Afrika, Kleinasien, die Wunderwildnis Ceylons, des Edengartens, durch Indien, Burma nach dem Ziel, dem unermeßlichen Sagenland China, treiben lassen können! ... Stillestehen an der Schwelle des Bazars, Erkennen der tiefen Verbundenheit — bei allem europäisch zerrissenen, schwankend eigenwilligen, rasch aufschießenden, rasch erlahmenden Trieb des intensiv lebenden Westmenschen — dieses unerklärliche, sichere und gewaltsame Gefühl des Hierhergehörens, der Verbundenheit mit diesen dahier, diesem semitischen Urvolk — Zugehörigkeit zu diesem rätselhaften, unbeweglichen, sich nur selten regenden, verfallenden, Gott verfallenen, kaum mehr noch und doch ewig lebenden Volk, das von seinem Gottglauben dermaßen beherrscht ist, daß es seine Bedrückung, Sklaverei als Kolonialvolk vielleicht als etwas kaum in Frage Kommendes, Nebensächliches, die Oberfläche der Seele nicht einmal von fern Streifendes erduldet ... Sehnsucht, sich hier hineinzufinden; hinunterzugelangen zu den Urgründen dieser Gesetze des Friedens, die eigene Unrast, das angeborene Unglück draußen zu lassen, abzustreifen wie das Schuhwerk, ehe man in die Moschee tritt; die heitere unirdische Versunkenheit in den Willen, den unerforschbaren, zu erlangen, die verschüttet irgendwo auf dem Grunde des Semitenglaubens, ob ihn nun ein Jude oder Mohammedaner besitzt, versteckt liegen muß! Ach, die Welt als ein leichtes Gekräusel um die dunstige Flüssigkeit im Kugelglase empfinden können, als leichten Dampf, emporquirlend zu den Nüstern des geruhigen Rauchers im Mittelpunkt des labyrinthähnlichen Bazars!
Drüben, jenseits des Nils, ruhen die klotzigen Steinhaufen im Vollmondschein. Die Sphinx enthüllt bei Nacht ihr geflicktes, mit Zement aufgefrischtes, mit roter Ziegelfarbe künstlich nachgeschminktes Angesicht. Die alte Allerweltshure muß sich von Zeit zu Zeit diese Toilette gefallen lassen, sonst ist sie dem Fremdengesindel, das sich um sie drängt, nicht mehr präsentabel. Die Sphinx, um die die Touristenschwärme auf Kamelrücken, in Automobilen, Eselkarawanen, Fußgängertrupps unaufhörlich kreisen, die alte Sphinx mit ihrer eingeschlagenen Nase ist heute bei Vollmond gut genug, um dem Gelichter in Smoking und Abendtoilette, das drüben im kostspieligen, jazz-durchflirrten Mena-House wohnt und sich langweilt, den in kostbar bemalte Schals und Silberkleider gehüllten, in Seidenschuhen dahertrippelnden amerikanischen Millionärsfrauen und breitschultrigen englischen Sudanoffizieren als Ziel des Abendspaziergangs, mystischer Rendezvousort herzuhalten. Das ironische Geschmeiß der Fremdenführer, Kameltreiber, Wahrsager, Lustknaben, Verkäufer von falschen Antiquitäten, alten Zähnen aus Pharaonenmäulern, der Erpresser und Kuppler, das sich hier bei Tag und bei Nacht um die Fremden herumtreibt, dieses backschisch-gierige Gesindel, das ist auch noch Orient. Der Fremde erkennt, daß es sogar einen notwendigen Bestandteil dieses Orients vorstellt, wie das Fliegengewimmel, dessen man sich durch Netze, Wedel, Klappen und Ventilatoren erwehrt. Mit Ausrufen der Begeisterung schmeichelt sich das an die Fremden heran, es trachtet seinen Backschisch auf der Stufenleiter der Einschätzung der nationalen Herkunft des Fremden vom englischen „wonderful“ bis zum deutschen „pyramidal“ herunter zu ergattern, bis es dann mit einem Berliner Fluch die Hoffnung aufgibt und, da die Nacht schon vorgeschritten ist, schimpfend und untereinander lärmend den Abhang zu den Nildörfern hinuntersteigt. Um die Sphinx, die großen Steinhaufen, hinter denen der Mond verschwunden ist, wird es stille. Unsere Begleiter sind den Weg nach Mena-House vorwärts gegangen. Jetzt wollen wir den Fleck suchen, sage ich Ernst, den Ort, vor dem sich das Wunder enthüllt. Vor der zweiten, der nach Chephren benannten Pyramide finden wir ihn endlich. Hier, flüstere ich dem Kameraden zu, hier. Und da hören wir, wie aus der Pyramide, aus dem Innern des riesenhaften Steinhaufens, ein ungeheures Rasseln, Kettenschlagen, Gebrüll gemarterter Stimmen in die stumme Mondnacht zu uns herausdringt. Aus dem Innern der Pyramide wahrhaftig, als lägen all die Leiden, das Elend der maßlosen, jahrtausendealten Sklaverei des Menschengeschlechtes unter diesen Steinen Mizraims begraben, eingebacken, aufbewahrt dem Gedächtnis fernster Geschlechter, nur den Seelen, den empfindlichen Sinnen der Dichter, der Leidenden, der für die Menschheit Kämpfenden, Hoffenden hörbar. „Hören Sie?“, frage ich meinen Reisekameraden. Aber ich brauche gar nicht zu fragen. Ich sehe es an Ernsts Augen, seinem lauschenden bewegten Angesicht, daß sich ihm die tiefe mystische Sprache dieses Kettengeklirrs, dieser Schmerzenslaut der verschütteten Völker, der von Urbeginn mißbrauchten, beladenen Menschheit geoffenbart hat. Hier innen, in diesem Phänomen, das sich dem Gehörsinn mitteilt, lebt das Schicksal des Orients, des tiefen mystischen Orients, in dem, ungleich unseren westlichen Begriffen, das Wort Atmen und das Wort Leben, das heißt: im Göttlichen und unter Menschen sich bewähren. Zu einem Synonym der Sprache zusammengeschmolzen ist.
Siebzehn Pyramiden am Horizont
Da stehen sie, vor meinem Fenster! Die Zeit, der wehende Sand, der Wüstennebel, der Sonnenglanz hat von ihnen zehn, elf wie Schatten auf die silberhelle Atmosphäre gemalt. Die anderen sechs, sieben sind starr, dunkler, ihre Kontur ungebrochen. Es sind, durch mein gutes Zeißglas zu zählen, vom Norden in Gizeh bis zum Süden in Gergieh ihrer siebzehn. Mitten inne steht die Stufenpyramide von Sakkara, fast genau gegenüber meinem Fenster. Die Stufen sind mit hellem Sand bestreut, die Spitze abgebrochen. Das Pyramidenbauen scheint vor siebentausend Jahren Mode gewesen zu sein, nach diesem Aufmarsch, der sich am Wüstenhorizont bis Assuan fortsetzt, zu urteilen! Schließlich hat man wohl jedem Pharaonenbalg, als er das Zeitliche segnete, solch einen Steinklotz über die Grabkammer gesetzt! Nicht alle sind so solid getürmt wie die des Cheops, des Chephren. Aus der Nähe besehen, sieht eine und die andere aus, wie aus zu groß geratenen, flachen Kieselsteinen zusammengetakelt. Manche ragen wie abgebrochene alte Krokodilzähne, Stümpfe, auseinanderfallende Haufen empor. Menschenkraft, Schweiß, Tränen, fruchtlose Arbeit, Totenkult als Luxus — an dem Schicksal der Masse, des unteren Volkes haben die Jahrtausende nicht viel gebessert. Welcher Unterschied besteht zwischen Schützengräben ausheben und Pyramidenbauen. Selbstherrlichkeit bedient sich durch Jahrtausende der Menschenkraft, Menschenschweißes, Menschentränen, Menschenblutes, Menschenohnmacht und -torheit. Vor den Pyramidenschatten ziehen über die beiden tiefen Arme des Nils, die durch breitgelagerte Inseln aus Sand und spärlichem Riedgras voneinander getrennt sind, zartgeschwungene schneeweiße dünne Möwenflügel langsam an dem Blick vorbei. Es sind die Segelmaste der Nilkähne, der Arabiehs. Das silberne Schimmern des Stromes zittert nur undeutlich in der Atmosphäre. Hier und da eine kleine rasch vorwärtsziehende Rauchsäule von einem der flachen Nildampfer, die Touristen aus Kairo tief nach Afrika bis zum ersten Katarakt führen. Noch näher zum Balkon meines Hotelzimmers sehe ich die Landstraße durch den Sand sich ziehen. Auf ihr „die Flucht aus Ägypten“, täglich viele Male wiederholt: der dunkle Mann, der Weib und Kind auf silbernem Eslein langsam und fromm über die Landstraße dahinführt.
Um das Haus breitet sich ein wunderlicher Garten aus, mit traumhaft hängenden Blütenzweigen; eine Woche Ausruhen mit Freunden, dem guten Dr. S. aus Jerusalem, einem Ordensbruder des heimlichen Bundes guter Menschen, der sich um den Gedankenkern „Zion“ kristallisiert hat. Hier, in dem Wüstenkurort Heluan, sind Kranke beisammen. In der brütenden Hitze des Chamsin, einer nordafrikanischen Abart des Wüstensamums, in der drückend furchtbarsten Hitze sondert der Körper keinen Schweiß ab. Menschen mit zerschossenen oder kranken Nieren, die anderswo keinen Monat länger leben könnten, sind hier beisammen, in dem aus weiten Hallen aufgebauten, üppig an das Paschadasein des ehemaligen Besitzers gemahnenden Tewfik-Palace. Frühmorgens weckt den Schläfer in seinem luftigen Käfig aus Moskitonetzen Vogelgeschrei, Vogelgesang — aber es ist das Gebet des Muezzin aus der unsichtbaren Moschee im Ort. Bald darauf surrt, orgelt und dröhnt der englische Flieger über das Hotel hinweg. Hier irgendwo ist der Flugplatz, aus dem die englische Weltmacht ihre bedrohlich schnell segelnden Flugzeuge weit hinein in die Wüste abschießt, täglich um Sonnenaufgang, damit die Völker der Wüste es nicht vergessen mögen, wer über ihnen ist und daß der gleiche, unerbittliche Wille jeden Morgen aufwacht! Im Nil ruht der Schlüssel der britischen Weltmacht, und unaufhörlich umkreisen diesen Schatz Luftschiff schwärme, dröhnend und orgelnd, in der trockenen. Laut bewahrenden Atmosphäre. In der Ferne beschreiben sie ihre Schleifen, Flugkunststücke, Stürze und akrobatisch witzigen Gleitpassaden um die siebzehn Pyramiden herum, folgen dem Lauf des Nils, meerwärts, kataraktwärts. Wem die Luft gehört, dem gehört der Strom, das Land, alles Leben.
Der Tod, die Zeit aber gehört dem Sand, der tiefen rätselhaften Wüstenei, die sich dort drüben jenseits der beiden Nilarme erstreckt. Unsere kleine Karawane verläßt eines Morgens das Hotel, schwimmt auf Fähren über das Wasser, watet durch den Sand der Inseln, reitet und rollt von dem Nildorf Bedrachein landeinwärts der Stufenpyramide zu. Hinter dem Dorf, das eine fortgesetzte eklige Backschischplage ist — unser Sandwagen rollt wütend vorwärts, die Eselreiter traben wie besessen, um dem Geschmeiß von Kameltreibern, Bettlern, Fremdenführern aus dem Dorf zu entrinnen —, hinter dem Nildorf Bedrachein liegt unter schütteren Palmenhainen, tiefem Sand, verstreuten kleinen Häusergruppen begraben das sagenhafte Memphis. Aus einer Pfütze ragt, aus Alabaster geformt, eine anmutige, nur wenig aufgefrischte Sphinx; auf einem Hügel ist zwischen Palmen über dem Sand der gewaltige Torso einer Ramsesfigur gebettet. Zu beiden Seiten der Straße, die über das begrabene Memphis hinausführt, in Sümpfen stehend halbnackte Männer, Frauen und viele Kinder. Auch Esel und Kamele stehen in den spiegelnden grünüberdeckten Feldern. Knietief arbeiten, von Fliegenschwärmen umsurrt, Menschen in den uralten Rieselfeldern, die den Reichtum dieses Landes ausmachen. Wie unsere Karawane von fernher sichtbar wird, patschen aus allen Gräben Kinder auf die Landstraße hinauf, um uns kilometerweit mit ausgestreckten Backschischpfoten nachzulaufen. Automobilkolonnen von Cook surren hoch oben auf dem Plateau vor den Pyramiden wie eilig dahinkriechende Raupenschwärme in unabsehbarer Reihe durch das Gelbgrau, verschwinden in einer Wüstenfalte, untiefen Mulde zwischen den grauen Sümpfen. Jetzt sind wir über die verschüttete Welt, über die Lehmdörfer, die Rieselfelder, über Paris, London und Newyork der Vorzeit gerollt, geritten. Käme ein Erdstoß, ein Tornado, der die Decke von dieser jahrtausendealten Welt emporhöbe, über dem Erdteil zerstäuben ließe, Millionen Zellen einer phantastisch grausigen Herrlichkeit lägen bloß, jede in ihrem Glanz, in endlos erhabener Herrlichkeit aneinandergereiht, wahrscheinlich so unberührt und von leibhaftiger Gegenwart erfüllt, wie es die Mastaba des Ti ist, in die wir, in der Wüste von Sakkara, jetzt hinuntersteigen. —
In der Grabkammer des Ti lebt an den Wänden, in der zarten, unerhört bewegten Darstellung der Reliefs, das Dasein des alten Volkes. Leise Tönung, Farben wie aus frischen Pastellkästen umreißen die Konturen dieses Tagesseins! Fischer holen in Netzen Fische aus dem Strom, Sakiehs kreisen, von weitgehörnten Ochsen gedreht, Bäcker schieben Teig in Öfen, Schlächter schlachten Vieh und Hühner für den Markt, für des Pharao Tisch, Tänzerinnen werfen ihre feinen Glieder, strecken ihre süßen Hände in lotosgleicher Fingerhaltung wie die Wigman, Nacken und Kinn zurückgeworfen schreiten andere in andächtigem Reigen, Schuldner werden in Ketten vor den Richter geführt, Schreiber notieren auf Papyrosrollen Steuerlisten. Daneben stillsitzende, im Profil gezeichnete Statuen, von denen man nicht weiß, sind's Könige oder schon Götter? Wie waren in jener Zeit die Zeichen der Macht vertauscht, die Grenzen von Tod und Leben aufgehoben!
Welche Lebenssehnsucht, Lebensbestätigung in diesen Grabmälern, in denen kaum ein geringes Zeichen vom Grauen des Todes zeugt, alles aber an das Leben gemahnt, das der Tote so unwillig verlassen hat, daß er alle seine Vorgänge sich an die Wand malen, gravieren ließ, damit sie den noch unbekannten Zustand auf alle Fälle beleben sollten — wenn er doch nun einmal die paar Schritte weit unter die Erdoberfläche hinuntersteigen muß. Ja, hübe ein Tornado die Sanddecke über der verschütteten Stadt in die Höhe in allen Pharaonensälen, allen Grabkammern würde man diese selben, monoton und doch millionenfältig verwandelt wiederkehrenden Darstellungen des täglichen Lebens des niederen Volkes wiederfinden. Es herrschte also doch, trotz Selbstherrlichkeit und Sklaverei, solch starke Verbundenheit zwischen dem niederen Volk und seinen Tyrannen, Gepeinigten und despotischen Peinigern! Sonderbar: in Sakkara an die Königsgemächer der europäischen Paläste zu denken, in denen hohle Kriegs- und Krönungsdarstellungen, auf die Herrscherherrlichkeit der Besitzer hinweisende, kunstverlassene Schildereien zu finden sind, nichts auf das Leben des Volkes Bezügliche wie hier, noch dazu in der höchsten Vervollkommnung der Kunstübung aller Zeiten! Tiefer als die Mastaba liegt ein grauenhaft unmenschliches, überirdisch unausdenkbares Kultmal der niemals ergründeten, niemals ganz begriffenen Zeit — das Serapeum, Grabtempel der heiligen Stiere. In riesigen gewundenen Gängen, dunkel ins Innere der Erde hinunterangenden, stehen die ungeheuren Granitsarkophage des Serapeums, Apis, das heilige Tier, aufbewahrend. — Furchtbar, wie die Vorstellung des geheimen Kultes, die jahrtausendelang im Gedächtnis der Menschen weiterlebt, ist aber das gegenwärtige Erlebnis einer Wirklichkeit, einer Nacht in diesem heutigen Heluan, das ich bei der Sekte der Schlangenfresser gehabt habe. Der junge schwäbische Lehrer, der in Heluan seine Nieren kuriert, kommt zu Ernst und mir ins Hotel. Er will uns zur Andachtsübung der Sekte führen, die jeden Donnerstag zu nächtlicher Stunde sich in einem verfallenen Gehöft des Ortes versammelt.
Sekte der Schlangenfresser
Da ist ein weiter unebener Hof, von niederen Häusern umgeben. Tiefe Erdlöcher führen in Keller, unterirdische Stuben. Frauen, schwarz vermummt, sitzen vor diesen Türen oder Maulwurfsverliesen. Hunde jagen sich über das weite dunkle Gehöft. Durch die Straße draußen kommt rasch ein Trupp heran, der eine riesige Laterne aus weißer, mit schwarzen Zeichen bemalter Leinwand in seiner Mitte trägt. Das weiße Licht wirft die Schatten der hageren, eilig dahinschreitenden Gesellen gespenstisch an die Häusermauern, wie ein Spuk schwankt der Zug durch die nächtliche Straße, strömt rasch in das Gehöft herein. Auf einer Eisenstange wird eine Azetylenlampe gehißt, dann breitet man eine lange Strohmatte über den Boden, und im Nu haben sich etwa fünfzig Männer, alte, junge, auch Knaben, zu beiden Seiten der Matte auf die Erde niedergekauert. Uns Europäern hat man Stühle hingestellt. Ein Bursche kommt und bietet uns kleine Tassen mit Zimtwein an, scharfes, nicht übel schmeckendes Getränk. Weihrauchbehälter werden geschwungen, so daß die beiden Reihen der Kauernden bald in einem Nebel verschwimmen. Gespräche, Schreie, dunkle, helle Laute stechen noch eine Weile aus dem Weihrauchdunst hervor, werden aber bald durch zwei Flöten übertönt, die schrill an den Enden der Matte zu lärmen angefangen haben. Bald springt, vom Zimtwein und dem Rauch gestachelt, hier und dort einer vom Boden auf. Schon reißt es die Hockenden alle in die Höhe, nun sind sie auf den Beinen, die ganze bunte Schar, Greise, Jünglinge und Knaben. Der Flötenlärm, der Wein, der betäubende Rauch, die Schar — aus ihr lösen sich Gestalten, Anführer der Zeremonie, ein riesiger Neger mit grünem Kopftuch, ein noch junger, bleicher Scheich, ganz in Weiß gekleidet, und ein Blinder, tastend an seinem Stab. Diese dirigieren den Chor, der in monotonem, sich rasch steigerndem Singsang die geheiligten Worte der Beschwörung ruft, singt, in rhythmisch stampfendem, dumpfem Geschrei artikuliert.
„La illaha il Allah! Mohammed rassul Allah!“
Der Neger ist der Wildeste unter den Anführern. Bei dem Worte Mohammed stößt er die zweite Silbe brüllend wie ein Stier mit Nackenschütteln in die beiden Menschenreihen hinein. Es dauert nicht lange, da sind diese beiden Reihen in ein Wiegen, Schwingen, hin und her wallende, immer stärker anschwellende rhythmische Bewegung geraten. Wir sind aufgestanden und haben uns den Reihen genähert. Ich stehe hinter einem untersetzten kaffeebraunen Araber, der in blauem Kattunkaftan bloßfüßig neben der Matte steht. Ich kann ihn genau beobachten. Er hat seine Hände ineinandergekrampft. Seine Füße stehen leicht und zart, wie schwebend auf dem Boden, während sein Oberkörper, den seine ineinander verketteten Finger, in weitem Bogen ausholend, zu dirigieren scheinen, in unerklärlich heftigem Schwung ekstatisch nach rechts, nach links sich biegt. Die Musik ist greller ge- worden, quietscht, pfeift, schrillt über die Köpfe weg. Die Worte: „la illaha il Allah!“ sind um den Kern des Spruches scheinbar niedergeschmolzen, und was geblieben ist, ist ein stoßweises, von all den fünfzig Körperschüttlern, Tänzern, schwingend gottversunkenen wilden Anbetern in einem gemeinsamen Röcheln hervorgestoßenes:
„Allah!“ Aber auch dieses Wort verliert bald seine Konsonanten. Es klingt jetzt wie:
„Aaah!“ ein tierisch dröhnender wilder Laut der Lust, der ekstatischen Wollust in dem Trance des Dienstes an der unbegriffenen, schrecklichen Gottheit.
Uns Europäern wird das Zuschauen fast unerträglich. Am liebsten möchte man fortstürzen, seinen Kopf irgendwo vergraben, sich vor diesem Anblick des drohenden schicksalhaften Orients, des mohammedanischen Menschen, der so nah zur europäischen Kultur beheimatet ist, schützen. Aber man bleibt stehen, verzaubert und gebannt, und nimmt die Botschaft dieser Übung in seine Seele auf, um sie seinem Weltbild, seinem Urteil über Menschheit und Völkerzukunft einzuverleiben.
Nach und nach ist die Sekte in derartiges Rasen der Körperschwingung geraten, daß aus dem Umkreis der Herumstehenden einer und der andere auf einen und den anderen der Schwingenden losstürzen muß, um ihn zu halten. Dann schwingen beide, der Ekstatische und der Hilfeleistende, wie von ungeheurem Wind geschüttelt hin und her.
Der Blinde, vor allem aber der weiße Scheich, wirft seinen Körper in rasendem Pendelausschlag nach rechts, nach links; obzwar er von starken Fäusten gehalten wird, schwingt sein weißbeturbanter Kopf derart rasch, daß man von dem blassen Gesicht, dem dünnen Bart nur einen leichten zitternden Schein zu sehen wähnt, schillernden Schaum statt eines Gesichts. Aber sie kann nicht lange dauern, diese Ekstase. Und tatsächlich bemerkt man schon ein Auseinanderfallen der Reihen, Abflauen, Müdewerden. Auch der untersetzte Blaue vor mir scheint aus seiner Besessenheit zu erwachen. Sein Körper schlägt kürzer, kürzer aus, wankt ein wenig, bevor er stillesteht, und nun lagern sich die Männer, alte und junge, die Burschen, die Knaben, stumpf und erschöpft zu beiden Seiten der langen Matte auf den Boden, vergraben den Kopf zwischen den Knien und kehren zum Bewußtsein zurück. Wenige Augenblicke der Ruhe, und der Trancezustand ist aus den Reihen der Versammlung verflogen. Mit einemmal aber schrillen die Flöten aufs neue auf, und damit ist das Signal zur Fantasia gegeben, die nun folgt.
Eine Flasche wird am Boden zerschlagen, ein hagerer Kerl springt auf und stopft sich die Scherben in den Mund, zerkaut sie mit hörbarem Zähneknirschen. Ein anderer hat einen krummen Säbel (der aber, wie ich mich überzeuge, ziemlich stumpf und rostig ist) mit einem Aufschrei sich über den Bauch geschlagen. Längs der Schneide knickt er in sich zusammen, so daß der Säbel ganz im Innern des Menschen verschwindet. Wie er sich wieder aufrichtet, sieht man die Spur des Säbels nur als einen etwas helleren Strich durch die braune Bauchfalte laufen. Ich habe den Eindruck, daß diese Übungen mehr für uns, die zahlenden Gäste, stattfinden, harmlose Gaukelei vorstellen, die man mit dem Eintrittsgeld zu hoch bezahlt hat. Was aber nun folgt, ist die heilige Prozedur, der oberste Ritus des Gottesdienstes der Sekte. Dem weißen Scheich wird eine lange, dünne, graue Schlange gereicht. Zwei Männer fassen das Tier, das sich in energischen Stößen windet und wehrt, beim Kopf, um den Leib, beim Schwanz, der Scheich preßt dem Tier den Kopf zusammen, daß der Rachen offen steht, und schlägt ihm an einem Stein die Giftzähne heraus. Lange schon sind die Flöten verstummt. Wir haben uns auf unsere Plätze zurückbegeben. Im ganzen weiten Hofe herrscht erwartungsvolle Stille. Zu beiden Seiten der Matte haben sich die Schüttler, die Körperschwinger niedergekauert. Über die Matte geht der weiße Scheich mit der Schlange. Mit raschen Schritten geht die weiße Gestalt, von der Azetylenlampe grell beschienen, hin und her. Hoch über seinem Kopf, zwischen den kräftigen, geballten Fäusten hält der Scheich die Schlange ausgestreckt. Man sieht, wie das Tier sich aus dem klammernden Griff der muskulösen Hände zu befreien sucht. Oft hat die Schlange die Oberhand, dann merkt man, wie die Fäuste in der Luft über dem Turban sich einander nähern, die Schlange beschreibt eine Wellenlinie, einen Bogen. Aber dann schieben sich die Fäuste wieder auseinander, und die Schlange sieht aus wie ein gerader weißlicher Strich über dem hellen Turban, glitzernd und auslöschend im Licht der Azetylenlampe, sobald der Scheich in seinem beschleunigten Gang sich ihr nähert oder von ihr entfernt. Der Scheich spricht laut vor sich hin. Der junge Schwabe, der uns hierhergebracht hat, weiß, es sind Suren des Koran, die der Scheich bei dieser symbolischen Handlung ausspricht. Immer rascher, immer heftiger werden die Schritte des Singenden, Psalmodierenden, der die Schlange in den erhobenen Fäusten hält. Von den Kauernden fällt einer und der andere in den Singsang ein, aber nur für kurze Augenblicke. Alle, die Sekte, die Umstehenden, wir, die Gäste, sind stumm und in Erwartung. Der Scheich nimmt in seinem Gehaben auch immer mehr die Starre an, die, wie jenes Körperschwingen, ein Beweis seiner Gottversunkenheit zu sein scheint. Die Stimme erhebt er kaum, auch seine Schritte werden nicht wankend, aber in dem ganzen Gehaben der weißen Gestalt prägt sich doch irgendetwas Ungewohntes, Unmenschliches, ein Entrücktsein vom Irdischen aus, das zu einer Kulmination hintreibt. Mit einemmal geht, wie ein Seufzer, ein abwehrender Laut vor etwas Unerträglichem durch die Kauernden zu beiden Seiten der Matte. Mit einem Ruck hat der Scheich die Schlange zu seinem Gesicht nieder- gebogen und ihr blitzschnell den Kopf abgebissen. Ohne seinen Gang zu beschleunigen oder zu verlangsamen, geht er nunmehr stumm die Matte auf und ab und kaut an dem Kopf des Tieres. Das Knacken des Bisses wiederholt sich in den mahlenden, malmenden Geräuschen des blutenden Mundes. Die Schlange sieht jetzt aus wie ein zickzackförmiger Stock aus Holz. Die Wellenlinie des Körpers hat sich in steifes Zickzack verwandelt. An der Stelle des Kopfes sitzt ein runder, blutiger Fleck. Der Scheich geht mit der Schlange viermal, fünfmal rasch über die Matte hin und her. Plötzlich steckt er den Stumpf des blutenden Schlangenkörpers wieder in den Mund, beißt noch ein Stück ab. Nun ist der Bann gebrochen, hier und dort springt einer auf, begehrt von der Schlange zu essen, der Scheich reicht sie ihm, wie ein Priester die Oblate reichen mag, und dasselbe widerliche Knacken ertönt. Damit ist diese religiöse Prozedur, die, wie uns versichert wird, eine tiefe mystische Bedeutung besitzt, zu Ende. — Es sind auch einige Ortsgendarmen unter den Gästen der Sekte, den Zuschauenden anwesend. Sie machen angewiderte Gesichter und lächeln uns Europäern verständnisvoll zu. Aus den unterirdischen Löchern steigen Frauen herauf, bringen auf großen Zinnplatten flache gelbe Fladen. Wir kriechen in die Höhle hinunter und sehen, wie diese Fladen zubereitet werden. In einem stinkenden dumpfen Raum steht ein schmutziges Himmelbett, auf dem zwei Kinder in tiefem Schlaf liegen. Daneben ist der Herd, um den Frauen hocken, die die Fladen backen, Gemüsehäcksel zwischen die Teigkrusten stopfen und dann auf der Steppdecke des Himmelbettes zu Stapeln schichten. Das ist die Küche, aus der die Sekte ihre Nahrung erhält. Auch das Gefäß, aus dem wir unseren Zimtwein eingeschenkt erhalten haben, steht da. Lebhaftes Kommen und Gehen entwickelt sich zwischen dem Gehöft, in dem jetzt ein munterer Lärm ertönt, und dieser unterirdischen Küche. Es ist schon spät in der Nacht. Mit höflichen Gebärden nehmen wir vom Scheich, den Männern der Sekte Abschied. Sie führen ihre Hände grüßend zur Stirne, und wir erwidern ihren Gruß: „Saida!“ Unser schwäbischer Führer hat derweil von uns den Tribut einkassiert, ein ägyptisches Pfund pro Kopf, gar nicht wenig! — Durch die schlafende Stadt, aus deren Stille entfernter Singsang, jenem ähnlich, der unsere Zeremonie begleitet hat, aufsteigt, gehen wir in unser Hotel zurück. Es sind also zu dieser nächtlichen Weile ringsum noch andere Sekten tätig!
Die Gottversunkenheit des auf dem Bahnsteig betenden Mohammedaners, die fatalistische Reglosigkeit des Wasserpfeifenschmauchers im Bazar, die wilde Berserkerei der Körperwerfer, Schlangenabbeißer — dieses Volk, ein gewaltiger Bruchteil der heut auf Erden lebenden Menschen, neben unserer Zivilisation, das heißt dem Zustand, in dem sich unsere westlichen Völker heute befinden und dem sie den Namen Zivilisation gegeben haben — schwer ermeßliche, kaum begriffene Bedrohung! Wie diese Bewohner des verschütteten und zerbrochenen Orients zu den Zielen, den nächsten Aufgaben der Entwicklung gewinnen, organisieren? Ein einziges Volk hat dieses Problem auf seine Art erfaßt und arbeitet an seiner Lösung: ein Volk, mit allen Elementen der verschütteten Urvölker ausgestattet und doch ein Westvolk zugleich: das Volk des großen europäisch-asiatischen Rußlands. In den Händen der neuen Lenker der Geschichte, die in Moskau ihren Sitz haben, sind die Wildheit der religiösen Vorstellungswelt, die Gottversunkenheit, die Trägheit der Bazarraucher ebenso viele Zügelstränge. Vielleicht liegt der Schlüssel, der die Zukunft aufsperren wird, gar nicht im Nil, sondern im Kreml? Daß aber in absehbarer Zeit ein Kampf von furchtbarem Ausmaß zwischen West und Ost, Zivilisation und Religion losbrechen wird, ist heute bereits deutlich erkennbar. Wer wird der Schlange die Giftzähne ausbrechen, ehe die Zeremonie anhebt ?