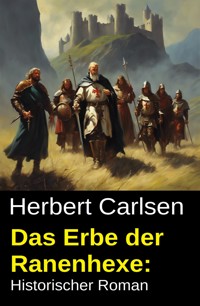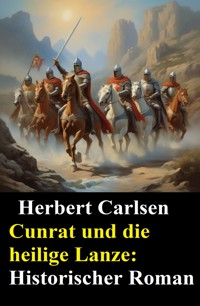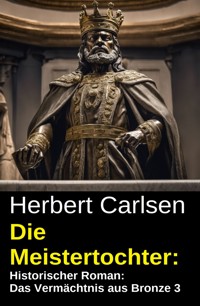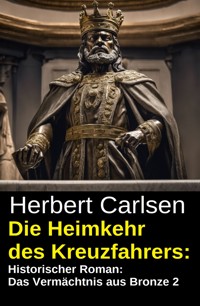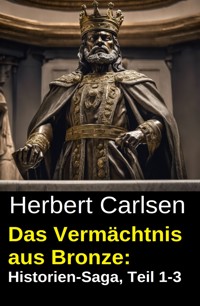
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Vermächtnis aus Bronze – Die Mainzer Meister-Saga Alle drei Bände in einem Buch Die bewegende Geschichte einer Familie, einer Stadt – und einer Tür, die alles verbindet. Mainz, vom frühen Mittelalter bis zur Zeit der Kaiser und Könige: Die Meisterfamilie begleitet den Bau und die Pflege der berühmten Bronzetüren am Dom. Über Generationen hinweg kämpfen Willigis, Affra, Ulrych, Gudrun und ihre Nachkommen um Halt, Maß und Zusammenhalt in einer Welt voller Wandel, Krisen und Hoffnung. Erlebe, wie Handwerk, Liebe und Verantwortung das Leben der Menschen prägen.Von den ersten Gießern und Chronisten über die Zeit der Kreuzzüge, Fluten und Dürre bis zu den neuen Generationen, die das Erbe weitertragen: Die Saga erzählt von Alltag und Aufbruch, von Verlust und Neubeginn, von kleinen Taten, die große Bedeutung bekommen. Atmosphärisch, authentisch und voller Gefühl: Tauche ein in die Welt der Werkstatt, der Bronzetür und der Menschen, die mit ihren Händen Geschichte schreiben.Für Fans von historischen Romanen, Familiensagas und starken Charakteren. Alle drei Bände in einem Buch: Teil 1: Katerina und der Bischof Teil 2: Die Heimkehr des Kreuzfahrers Teil 3: Die Meistertochter Das Vermächtnis aus Bronze – Die große Saga um Mainz, ihre Menschen und die Türen, die alles verbinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Vermächtnis aus Bronze: Historien-Saga, Teil 1-3
Inhaltsverzeichnis
Das Vermächtnis aus Bronze: Historien-Saga, Teil 1-3
Copyright
Katerina und der Bischof: Historischer Roman: Das Vermächtnis aus Bronze 1
Glossar
Personen
Orte
Begriffe
Erstes Kapitel: Die Türen, die singen
ERSTES ZWISCHEN-KAPITEL
ZWEITES ZWISCHEN-KAPITEL
DRITTES ZWISCHEN-KAPITEL
VIERTES ZWISCHEN-KAPITEL
Zweites Kapitel: Nacht der Namen
Drittes Kapitel: Feuerzeichen
Viertes Kapitel: Asche und Schwur
Fünftes Kapitel: Ritterschlag und Winterkorn
Die Heimkehr des Kreuzfahrers: Historischer Roman: Das Vermächtnis aus Bronze 2
Glossar
Personen
Orte
Begriffe
Sechstes Kapitel: Brachtal
Siebtes Kapitel: Stein wird Jahr
Achtes Kapitel: Die zweite Sonne
Neuntes Kapitel: Pfade und Pläne
Zehntes Kapitel: Abschied und Aufbruch
Elftes Kapitel: Das zweite Feuer
Zwölftes Kapitel: Schuld und Gelübde
Dreizehntes Kapitel: Lanze und Staub
Vierzehntes Kapitel: Stimmen im Holz
Fünfzehntes Kapitel: Erben und Fehler
Sechzehntes Kapitel: Risse im Ring
Siebzehntes Kapitel: Schuldenwind
Achtzehntes Kapitel: Vers und Pfand
Die Meistertochter: Historischer Roman: Das Vermächtnis aus Bronze
Glossar
Personen
Orte
Begriffe
Ereignisse
Neunzehntes Kapitel: Wasser und Wort
Zwanzigstes Kapitel: Schwelle und Schwur
Einundzwanzigstes Kapitel: Kante und Kurs
Zweiundzwanzigstes Kapitel: Abdrift und Anker
Dreiundzwanzigstes Kapitel: Der Junker und das Feuer im Lehm
Fünfundzwanzigstes Kapitel: Binde und Bund
Vierundzwanzigstes Kapitel: Sturm in den Gassen
Siebenundzwanzigstes Kapitel: Schrift und Scharnier
Sechsundzwanzigstes Kapitel: Hoftagsluft
Achtundzwanzigstes Kapitel: Erbe und Eisen
Neunundzwanzigstes Kapitel: Wahl und Werk
Dreißigstes Kapitel: Bote und Bronze
Zweiunddreißigstes Kapitel: Ankunft und Andacht
Einunddreißigstes Kapitel: Nachhall und Auftrag
Dreiunddreißigstes Kapitel: Ernte und Erinnerung
Vierunddreißigstes Kapitel: Flut und Fügung
Fünfunddreißigstes Kapitel: Hand und Hörer
Sechsunddreißigstes Kapitel: Lehrgang und Linie
Siebenunddreißigstes Kapitel: Zunft und Zeichen
Achtunddreißigstes Kapitel: Dürre und Dienst
Neununddreißigstes Kapitel: Bruch und Brücke
Vierzigstes Kapitel: Auftrag und Antwort
Einundvierzigstes Kapitel: Schlussstein und Echo
Epilog
landmarks
Titelseite
Cover
Inhaltsverzeichnis
Buchanfang
Das Vermächtnis aus Bronze: Historien-Saga, Teil 1-3
von HERBERT CARLSEN
Vermächtnis aus Bronze – Die Mainzer Meister-Saga“ (enthält alle drei Bände):
Das Vermächtnis aus Bronze – Die Mainzer Meister-Saga Alle drei Bände in einem Buch
Die bewegende Geschichte einer Familie, einer Stadt – und einer Tür, die alles verbindet.
Mainz, vom frühen Mittelalter bis zur Zeit der Kaiser und Könige: Die Meisterfamilie begleitet den Bau und die Pflege der berühmten Bronzetüren am Dom. Über Generationen hinweg kämpfen Willigis, Affra, Ulrych, Gudrun und ihre Nachkommen um Halt, Maß und Zusammenhalt in einer Welt voller Wandel, Krisen und Hoffnung.
Erlebe, wie Handwerk, Liebe und Verantwortung das Leben der Menschen prägen.Von den ersten Gießern und Chronisten über die Zeit der Kreuzzüge, Fluten und Dürre bis zu den neuen Generationen, die das Erbe weitertragen: Die Saga erzählt von Alltag und Aufbruch, von Verlust und Neubeginn, von kleinen Taten, die große Bedeutung bekommen.
Atmosphärisch, authentisch und voller Gefühl: Tauche ein in die Welt der Werkstatt, der Bronzetür und der Menschen, die mit ihren Händen Geschichte schreiben.Für Fans von historischen Romanen, Familiensagas und starken Charakteren.
Alle drei Bände in einem Buch:
Teil 1: Katerina und der Bischof
Teil 2: Die Heimkehr des Kreuzfahrers
Teil 3: Die Meistertochter
Das Vermächtnis aus Bronze – Die große Saga um Mainz, ihre Menschen und die Türen, die alles verbinden.
Keywords: historischer Roman, Mittelalter, Mainz, Familiensaga, Handwerk, Bronzetür, Dom, Generationen, Frauenfigur, Erbe, Zusammenhalt, Stadtgeschichte, Romanserie, Gesamtausgabe, emotional, authentisch
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2025 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Katerina und der Bischof: Historischer Roman: Das Vermächtnis aus Bronze 1
von HERBERT CARLSEN
Katerina und der Bischof: Historischer Roman – Das Vermächtnis aus Bronze, Band 1
Mainz, um das Jahr 1000:Die junge Katerina wird als Sklavin an den Ufern des Rheins verkauft und findet sich in einer fremden, rauen Stadt wieder. Ihr Schicksal scheint besiegelt – bis sie dem mächtigen Erzbischof Willigis begegnet, der den Bau des gewaltigen Doms und seiner legendären Bronzetüren wagt. Zwischen Katerina und dem Bischof entwickelt sich eine verbotene, zarte Beziehung, die beide für immer verändern wird.
Während Handwerker, Gießer und ihre Familien mit Mut, Geschick und Zusammenhalt gegen Armut, Vorurteile und die Gefahren der Zeit kämpfen, droht ein verheerender Brand das große Werk zu vernichten. Inmitten von Hoffnung, Verrat und Neubeginn muss Katerina ihren eigenen Weg finden – und entdeckt, dass nicht Gold, sondern Hände und Herz das Vermächtnis einer Stadt prägen.
Atmosphärisch, bewegend und voller historischer Details:Erlebe das mittelalterliche Mainz aus der Sicht derer, die alles zusammenhalten.Für Leserinnen und Leser von authentischen Mittelalter-Romanen, starken Frauenfiguren und großen Gefühlen.
Das Vermächtnis aus Bronze – eine neue große Saga über Liebe, Macht, Familie und die Kraft des Handwerks.
Keywords :historischer Roman, Mittelalter, Mainz, Dom, Bischof Willigis, starke Frauen, Liebe, Handwerk, Bronze, Brand, Familie, Gesellschaft, Aufstieg, Romanserie, Saga, authentisch, emotional
“Das Vermächtnis aus Bronze” ist ein großer historischer Roman über Mainz im Mittelalter – erzählt aus der Sicht derer, die alles zusammenhalten: der Handwerker. Als Erzbischof Willigis den Dom und seine Bronzetüren wagt, entstehen Schwelle und Schwur einer ganzen Stadt. Zwei Familien – die Gießer der Meister und die Hofleute von Brachtal – tragen Mainz durch Feuer (1009/1081), Hoftag (1184) und schließlich zur Krönung Friedrichs II. (1212).
Affra, Gudrun und ihre Männer formen Bronze, Riegel und Ketten; am Rhein, in der Halle und unter den Gewölben des Doms. Ein Kreuzzug reißt fort, Liebe und Arbeit holen heim. Ein Gelehrter macht Willigis’ Vermächtnis zur leisen Liturgie der Stadt. Immer wieder kehrt alles zurück zum Klang der Türen: Nicht mit Gold – mit Händen.
Für Leserinnen und Leser von atmosphärischem Mittelalter, Handwerkskunst und starken Figuren. Poetisch, sinnlich, präzise – ein Roman über Arbeit, Glaube, Familie und den Klang, der Städte zusammenhält.
Perfekt für alle, die Romane mit historischer Wucht lieben
Schlagworte: historischer Roman, Mainz, Mittelalter, Dom, Willigis, Bronzetüren, Handwerk, Familie, Rhein, Hoftag, Kreuzzug, Speyer, Friedrich II., Liebe, Glaube.
Perfekt für alle, die Romane mit historischer Wucht lieben.
Sehr gerne! Hier ist ein spoilerfreies Glossar für Teil 1 deines Romans „Katerina und der Bischof“ – mit den wichtigsten Personen, Orten und Begriffen, jeweils knapp und neutral erklärt, ohne spätere Entwicklungen oder Auflösungen zu verraten.
Glossar
Personen
KaterinaEine junge Frau, die als Sklavin nach Mainz verschleppt wird. Mutig, klug und voller Überlebenswillen sucht sie ihren Platz in einer fremden Welt.
WilligisErzbischof von Mainz und Erzkanzler des Reiches. Ein machtbewusster, visionärer Kirchenmann, der den Bau des Doms und seiner Bronzetüren vorantreibt.
BerengerEin erfahrener Bronzegießer und Handwerksmeister. Er ist bekannt für sein Können und seine ruhige, bestimmte Art.
GerboldEin Straßenjunge, der sich als Gehilfe in Berengers Werkstatt bewährt und dort eine neue Heimat findet.
AffraEin Mädchen aus einer Handwerkerfamilie, neugierig und willensstark. Sie beobachtet die Welt der Erwachsenen mit wachen Augen.
AnnaAffras ältere Schwester, praktisch veranlagt und oft die Stimme der Vernunft.
HildegardBerengers Lebensgefährtin, eine Frau mit viel Herz und Geschick, die ihre Familie zusammenhält.
LudgerEin Frauenwirt in Mainz, der mit harter Hand über sein Haus herrscht und mit den Schattenseiten der Stadt vertraut ist.
MargretHebamme und Kräuterfrau, die vielen Frauen in der Stadt mit Rat und Tat zur Seite steht.
AntheniusEin wandernder Heiler mit geheimnisvoller Vergangenheit, der sich um die Kranken und Schwachen kümmert.
BardoEin Geistlicher und Vertrauter von Willigis, der den Dombau begleitet.
Der namenlose PredigerEin wortgewaltiger, kritischer Wanderprediger, der das Volk mit seinen Reden aufrüttelt.
Orte
Mainz (Moguntia)Eine bedeutende Stadt am Rhein, Handels- und Kirchenzentrum des Mittelalters. Ort großer Bauwerke, politischer Macht und sozialer Gegensätze.
Dom zu MainzDas monumentale Bauprojekt von Erzbischof Willigis – Symbol für Glauben, Macht und den Zusammenhalt der Stadt.
RheinDer große Strom, Lebensader und Handelsweg, der Mainz prägt und verbindet.
BischofshofDer Sitz des Erzbischofs, Zentrum von Macht, Verwaltung und Planung.
Werkhalle / GießereiDie Werkstatt von Berenger, in der die Bronzetüren entstehen – ein Ort harter Arbeit, Gemeinschaft und Kreativität.
Ludgers HausEin Haus am Rande der Stadt, in dem Katerina zunächst leben muss.
Haus am FlussKaterinas späterer Wohnort, ruhig gelegen, mit Blick auf den Rhein.
MarktplatzDreh- und Angelpunkt des städtischen Lebens – Ort für Handel, Nachrichten und Begegnungen.
Begriffe
BronzetürenPrächtige, kunstvoll gegossene Türen, die den Eingang des Doms schmücken sollen. Sie stehen für Fortschritt, Handwerkskunst und das Vermächtnis einer ganzen Stadt.
Gießer / GießereiHandwerker, die Metall – vor allem Bronze – schmelzen und in Formen gießen, um Kunstwerke und Gebrauchsgegenstände herzustellen.
SchwelleSymbol für Übergang, Neubeginn und Entscheidung; spielt im Roman eine zentrale Rolle als Bild für persönliche und gesellschaftliche Veränderungen.
RiegelEin Verschlussmechanismus an Türen, der im Roman mehrfach als Sinnbild für Sicherheit, Grenze und Entscheidung dient.
HandwerkDie Arbeit mit den Händen, Grundlage des städtischen Lebens und Identität vieler Figuren.
HoftagEin festlicher, politischer und gesellschaftlicher Höhepunkt im mittelalterlichen Reich, bei dem wichtige Entscheidungen getroffen werden.
KreuzzugReligiös motivierte Kriegszüge ins Heilige Land, die das Leben vieler Menschen beeinflussen.
TaufeDas christliche Sakrament der Aufnahme in die Gemeinschaft, spielt im Leben der Figuren eine wichtige Rolle.
InschriftEingravierte oder gegossene Schriftzüge auf den Bronzetüren, die für Nachwelt und Besucher eine Botschaft tragen.
Hinweis:Das Glossar kann für spätere Bände ergänzt werden.Wenn du möchtest, kann ich die Liste noch um weitere Nebenfiguren, Handwerksbegriffe oder regionale Besonderheiten erweitern! Sag einfach Bescheid.
Erstes Kapitel: Die Türen, die singen
Als der Nebel vom Fluss her einschlich und die Planken der Anlegeplätze mit kaltem Hauch benetzte, lag Mainz wie eine dunkle, atmende Kreatur am Wasser. Aus dem Osten trug der Rhein das Rufen der Nachtwächter, das Klirren von Eisen an Holz und das langsame Schmatzen nasser Taue. In den wenigen erleuchteten Fenstern über den Gassen flackerte der Schein kleiner Leuchtfeuer, und dort, wo die Uferrampe zum Markt hin anstieg, stauten sich Schatten.
Sie hieß Katerina und war siebzehn Jahre alt. Man hatte sie gebunden und in den Bauch eines flachen Flussbootes geworfen, zusammen mit anderen, deren Sprache sie kannte und die dennoch in den Wochen der Fahrt zu einer fahlen Menge stummer Gesichter verschwommen waren. Als sie die Rampe hinaufgeführt wurde, brannte der Tau wie Messer an ihren nackten Füßen. Männer in grobem Wolltuch, manche mit schlichten Helmen, andere mit Kapuzen aus Fell, standen herum und starrten sie an, als sei sie etwas, das von der Strömung angespült worden war und das man nun auf seine Brauchbarkeit prüfte.
Der Mann, der auf sie deutete, war dick und hatte ein Gesicht, das vor Wohlleben glänzte. Sein Name war Ludger, doch hier, in den Gassen, nannte man ihn Frauenwirt. Er trug einen Mantel aus dunkelgrünem Loden, die Kapuze hing ihm wie ein Tierfell im Nacken. An seinem Gürtel klapperten Münzen, und wenn er lachte, tat er dies ohne Zähne zu zeigen.
„Die da“, sagte er und strich mit einem Finger an Katerinas Wange entlang, „hat Augen wie Nachtwasser. Sie wird hohe Preise bringen.“
Katerina verstand nicht viel von dem, was die Männer sagten. Ihre Sprache war das Singen ihrer Mutter gewesen, das Plätschern von Kähnen auf dem Peenekanal, das Pfeifen des Windes durch hafener Pelzmäntel. Hier klang alles kantig, wie schlampig gehauene Steine. Doch sie begriff, dass Ludger den Mann bezahlte, der das Boot gebracht hatte, und dass dieser Mann nicht noch einmal zu ihr sah, als er die Münzen zählte. Später, als man genau das Lederband an ihren Handgelenken löste, das sie seit Wochen gescheuert hatte, spürte sie ein Kribbeln, als erwache der Teil in ihr, der vergessen wollte. Sie hob die Hände, sah die roten Striemen, und der Geruch von Fisch, Menschen und feuchter Wolle drehte ihr den Magen um.
Mainz, dachte sie, ohne das Wort zu kennen. Die Leute nannten es Moguntia. Es roch nach nasser Erde, nach Rauch, nach der nahen Gerberei, deren Schmutzwasser im Gras am Ufer stand und die Wölbungen des Himmels grau einfärbte. Auf der Höhe, über dem Gewirr der Gassen, stand ein Holzgerüst, das in den Himmel griff wie das Gerippe eines erlegten Riesen. Dort sollte der große Dom entstehen, sagten die Männer vom Boot. Dort, wo der Bischof den Himmel zu fassen suchte.
Sie führte Ludger in sein Haus, das sich an eine schmale Gasse schmiegte, in der die Luft nie ganz trocken wurde. Frauen standen im Halbdunkel, ihre Schultern mit Tüchern verhüllt. Einige hatten frische Striemen auf Armen und Hals. Eine Alte brachte Katerina einen Becher mit heißem, bitterem Aufguss, der nach Kräutern roch und Zunge und Kehle brannte. Als sie den Becher hob, sah sie sich in den dumpfen Spiegeln aus geschliffenem Metall, die an den Balken hingen, wie in Teichwasser. Ihr Gesicht war schmal, die hohe Stirn von einem Strauch hellen Haares umrahmt, den man ihr später zubinden würde. Sie sah fremd aus, fremd wie die Sprache, die sie nun lernen sollte. Ludger klopfte ihr die Schulter, als sei sie ein Tier, dessen Fell man prüfen musste. Was er später an ihr prüfte, tat er mit der Erfahrung eines Mannes, der seit Jahren verkaufte und benutzte, was er kaufen und benutzen konnte.
Während Katerina in Ludgers Haus den ersten Tag in Mainz verbrachte, stand ein Mann in der Kälte des Morgens auf dem Hügel, wo Pfosten in die Erde gerammt, Stricke geknotet und Schnüre gespannt waren. Willigis, Erzbischof und Erzkanzler, zog den Handschuh aus und legte die Handfläche auf die raue Struktur des Holzgerüstes, als wollte er prüfen, ob es atmete. In seinem Rücken standen zwei Geistliche, Bardo, der damals noch nicht wusste, dass er einmal den Bau vollenden würde, und ein Notarius mit roten, vom Wind entzündeten Fingern, die die langen Wachstafeln hielten.
„Sie werden sagen, ich sei vermessen“, sagte Willigis, und der Wind nahm ihm den Rest der Worte von den Lippen, trug sie über die provisorischen Ziegelhaufen, über die Handkarren voller Kalk und das Feld, wo man gebrannten Stein in Reihen gelegt hatte. „Sie werden sagen, ein Bischof soll beten und nicht bauen. Aber Gott braucht keine kleinen Häuser.“
Bardo schwieg, wie man schweigt, wenn man dem Höheren Gestade gibt, seine Gedanken auszusprechen. Willigis lächelte schmal. Er hatte tief liegende Augen, in denen sich entschiedene Wachsamkeit und Müdigkeit mischten. Seine Hände, obgleich sie liturgische Gefäße trugen und Segenszeichen ausführten, hatten im Laufe eines langen Lebens ebenso viele Papiere gerollt und Siegel gebrochen, wie sie Wangen gestreichelt hatten.
„Aachen verweigert mir die Kanzel“, fuhr er fort. „Sie sagen, der Papst habe die Messe für mich verboten. Sie fürchten sich vor einem Mann, der nicht in den Schatten tritt. Wenn sie mir Aachen verwehren, bauen wir Aachen hierher. Größer. Schwerer im Wurf, weiter im Klang. Eine Kirche, die Könige krönen kann. Unser Haus des Herrn wird das Haus der Reichskrone.“
Bardo senkte den Blick. Der Wind trug den Ruf eines Marktschreiers herauf, der Fluss roch nach Metall.
„Und die Türen?“ fragte der Notarius, der seinen Mantel fester um die Schultern zog. „Ihr hattet gesagt, die Türen sollen künden.“
Willigis nickte, streifte mit dem linken Daumen über die Linie der Gerüststange, als streiche er eine Idee glatt.
„Bronze“, sagte er. „Nicht Holz, das fault und splittert. Keine verzierten Riegel, die rissig werden. Bronze, wie sie Karl sah und begehrte. Etwas, das nicht der Wurm frisst. Etwas, das singt, wenn man es berührt. Ich will, dass der, der hereinkommt, hört, dass er in einen anderen Raum tritt. Ich will, dass die Tür selbst predigt.“
„Es gibt nicht viele, die so etwas gießen können“, murmelte Bardo. „Ihr kennt die Handwerker. Viele schmelzen Kessel, Glocken vielleicht. Aber eine Tür...“
„Ich kenne einen“, sagte Willigis. „Berenger. Man sprach seinen Namen im Norden, als ich durch die Diözesen ritt. Er hat Hände, die Metall zur Ruhe bringen. Holt ihn. Holt ihn her.“
Am Nachmittag desselben Tages, nachdem Katerinas Kopf schwer war von den Sätzen, die Ludger ihr beibrachte – du sagst, du lächelst, du schweigst, wenn er kommt –, schob ein Wagenrad Schlamm an die Seiten der Hauptstraße, und ein Mann stieg vom Bock. Er war nicht groß, doch trug er sich wie einer, der sein Gewicht kannte. Ein Bart, der in der Mitte hell war, dunkelte zum Kinn hin nach; in der linken Hand hielt er das Maß seiner Welt: ein Bündel aus Holzzirkeln, Schnüren, einem Griffel aus Knochen, der vom Greifen glatt und dunkel geworden war.
„Ich suche das Haus des Bischofs“, sagte er zu einem Knaben, der in zerrissener Kleidung an der Ecke stand und eine Speckschwarte knabberte, die er offenkundig irgendwo gestohlen hatte. Der Knabe nickte, wischte sich mit dem Handrücken den Mund, und seine Augen leuchteten, als er das Pferd sah.
„Für einen Groschen führe ich Euch“, sagte er.
„Für einen Halben“, antwortete der Mann, und weil der Knabe schnell begriff, dass ein halber Groschen besser war als gar keiner, lief er vor, die Gassen geübt durchmessend, den Blick immer wieder auf den Mann mit den schweren Schuhen und den breiten, über die Knie gehenden Mantel gerichtet.
Er hieß Berenger. Und als er durch das Tor des Bischofshofes trat – ein Tor aus Holz, das dennoch so fest gebunden war, dass es wenig nachgab –, spürte er das alte, vertraute Kribbeln in den Fingerspitzen. Dort drinnen, wusste er, würde einem Mann, der aus Erz Geschichten machte, nicht nur zugehört, sondern er würde begehrt. Der Hof roch nach Wachs, nach Tinte, nach angefeuchtetem Sand über Schrift und nach dem Fett aus den Küchen der Domherren.
Willigis empfing ihn nicht im großen Saal, sondern in einem Raum, dessen Fenster sich boten wie aufgerissene Augen zur Baustelle hin. Auf dem Tisch lag ein ausgebreiteter Plan aus Pergament, kaum mehr als Linien und Zeichen, deren Bedeutung einem, der Mauern nicht in der Sprache des Geistes sah, verschlossen blieb.
„Meister Berenger“, sagte Willigis, ergriff seine Hand, die schwer und warm war, und hielt sie einen Herzschlag lang fest. „Man erzählte mir von Euch. Man erzählte mir, Ihr hättet Glocken gegossen, die so klar seien, dass Fische im Fluss sich zu ihnen kehrten.“
Berenger lächelte. „Fische sind eitle Tiere, Herr. Sie wenden sich allem zu, was ihnen vorkommt wie Wasser.“
„Eine Tür ist ein anderes Wesen“, fuhr Willigis fort, ohne auf den Scherz einzugehen. „Sie hält und lädt. Sie sagt nein, und sie sagt ja. Ich will, dass meine Türen beides können, und das sauber, ohne prahlerische Handschrift. Ihr sollt sie gießen.“
Berenger trat zum Tisch. Sein Blick glitt über die Zeichnung, blieb an der Linie hängen, die die Westfront widerspiegelte. Er sah, wie weit der Bischof dachte. Nicht nur ein Haus Gottes, sondern ein Gesetz. Er stellte Fragen, nicht aus Höflichkeit, sondern weil seine Hand bereits die Rillen im Wachs spürte, die er ziehen würde. Maße, Legierung, Relief, Inschrift. Willigis sprach geduldig, seine Finger fuhren über die Linien, als seien sie eine Landkarte seines Willens. Er sprach von Karl und Aachen, von Rom, vom Klang der Reichskrone, als sei sie eine Glocke, die in Mainz gegossen und in der Pfalz geläutet werden sollte.
„Und die Inschrift?“ fragte Berenger schließlich.
Willigis sah ihn an, und ein hartes, fernes Lächeln zuckte um seinen Mund.
„Man soll lesen, dass es seit Karl solche Arbeit hier nicht mehr gab“, sagte er. „Man soll wissen, dass Mainz nicht nur hört, sondern spricht.“
Als Berenger den Hof verließ, schob sich der Abend in die Stadt, und zwischen den engen Häusern, die sich gegenseitig das Licht stahlen, standen Menschen auf Fässern und Kisten. Ein Mann mit schmaler Brust und den Augen eines, der zu lange gefastet hatte, predigte. Er war in dunklen Stoff gehüllt, der an Armen und Ellenbogen dünn geworden war, als hätte er die Stelle, an der er seinen Leib mit Worten erwärmte, bereits abgerieben. Seine Stimme schnitt die Luft in Scheiben.
„Weltliches Blendwerk“, rief er. „Ein Bau nur, um Kronen zu krönen, nicht, um Gott zu loben. Der Herr sieht eure Steine nicht, wenn eure Herzen aus Erz sind. Und wer sich dem Fleisch ergibt, dessen Werk wird verbrannt.“
Die Leute nickten, manche spuckten aus, manche kreuzten die Finger, und manche, die Ludgers Haus kannten, lachten in den Mantel. Katerina sah den Prediger nicht. Sie saß in einem kleinen Raum, in dem man das Licht sorgfältig vor der Gasse verborgen hielt, und hielt eine Feder in der Hand, die ihr wie ein lebendiges Tier vorkam. Der Tintenstrich geriet, wie er wollte, nicht wie sie wollte. Die Frau, die neben ihr saß, war eine von Ludgers älteren, mit einem Mund, der es müde war zu lächeln, und zwei Händen, die schrieben, ohne hinzusehen.
„Das ist ein A“, sagte die Frau. „Wie dein Atem, wenn du schläfst.“ Sie zeichnete einen Bauch und eine Stange. „Und dies ist ein N. Es steht für nein, aber man kann es für Namen nehmen.“
„Wozu?“ fragte Katerina leise, die Zunge zwischen den Zähnen, als könnte sie dadurch den Strich halten.
„Manchmal“, sagte die Frau, „schreiben die Leute auf, was sie nicht sagen können, ohne dass es jemand anders hört. Ein Mann, der nicht sprechen darf, weil er etwas ist, das er nicht sein darf, der schreibt vielleicht. Und eine, die er hält, ohne sie halten zu dürfen, die liest dann die Zeichen, die er setzt. Zu ihrem Schutz, zu seinem. Oder einfach, damit sie weiß, dass er es war.“
Die Tür öffnete sich, leise wie ein Segeln im Wind. Ludger trat ein, sein Gesicht rot vom Zorn oder vom Wein.
„Heute Nacht kommt einer, der dich sehen will“, sagte er zu Katerina. „Halt dich sauber, halt dich still, und halt den Mund. Wenn du lächelst, dann so, dass er sich erinnert. Wenn du weinst, dann so, dass er zahlen will.“
Katerina nickte, weil sie gelernt hatte, dass Nicken die Nacht verkürzt. Als Ludger gegangen war, sah die Frau sie an, mit einem Blick, der durch die Jahre ging wie durch dichte Stoffe.
„Manche Männer“, sagte sie, „tragen Schwarz und rote Schuhe. Sie glauben, es verberge sie. Aber die Farben schreien. Wenn einer kommt, der so schreit, dann atme leise.“
Der Mann, der in dieser Nacht ins Haus kam, war groß. Nicht mehr jung. Seine Hände waren gepflegt, nicht weich, und seine Augen hielten sie einen Moment fest, bevor sie zitternd den Blick senkte. Sein Mantel war dunkel, und das Wappen, das die Brosche an seiner Schulter verriet, sah sie nur als Glanz. Die Luft kippte einen Moment um in dem kleinen Raum. Er setzte sich nicht wie einer, der eilt, sondern wie einer, der sich erlaubt, nicht zu eilen. Als sie neben ihm kniete, hob er eine Hand und berührte ihr Haar, als sei es ein Text, dessen ersten Zeile er erprobte.
„Wie heißt du?“ fragte er.
„Katerina“, sagte sie. Ihre Stimme war ruhig. Sie war überrascht davon.
Er nickte, als merke er sich etwas. Dann legte er die Hand an ihren Gesichtsknochen, an den Punkt, wo die Haut dünn ist, als wolle er fühlen, wie warm das Blut darunter ist.
„Kennst du Buchstaben?“ fragte er leise.
„Einige“, sagte sie. „Die ich gelernt habe, hervorzuatmen.“
Er lächelte, und in diesem Lächeln lag etwas, das an die Stelle von Zorn in seinem Gesicht trat, als wäre es der Ort, wohin er manchmal ging, um allein zu sein.
„Manchmal“, sagte er, „sind Worte die einzigen Türen, die nicht klemmen.“
Später, als die Nacht sich an ihre Schultern legte, als eine Hand wog, was sie wog, und ein Atem in ihrem Ohr stand wie Wind in Binsen, spürte Katerina, dass etwas anders war als sonst. Nicht weil der Mann sorgfältiger war als die, die Ludger in ihre Kammer schickte; nicht einmal, weil er zahlreicher an Fragen war. Es war die Art, wie er aufstand und sich die Hände wusch und das Wasser leise goss, als bitte er jemanden um Vergebung, der nicht in diesem Raum war, aber ganz nahe.
Er kam wieder. Nicht in derselben Nacht, und nicht die darauf. Er kam an Abenden, an denen die Glocke auf dem Hügel lange nachklang, wenn die Handwerker die Gerüste verlassen hatten. Er kam, wenn die Luft knisterte vor Kälte, und brachte Leinen mit, das so weich war, wie sie es nie unter den Fingern gehabt hatte, und kleine, feine Brotlaibe. Manchmal setzte er sich und sprach von Dingen, die sie konnte: wie man Fäden spinnt, die nicht reißen, wie man mit den Augen spricht, wenn die Zunge ein Tier ist, das man an die Leine legen muss. Und manchmal, besonders wenn sein Blick sich jenseits der Mauer verlor, sprach er von Steinen, von Bögen, von Gradzahlen, die nicht im Himmel standen, und von Türen, die Winde teilten.
„Wenn ich könnte“, sagte er einmal, „würde ich dich an einen Ort setzen, an dem man deine Hände nicht zählt, sondern deine Worte. Aber ich kann nicht.“
„Warum?“ fragte sie. Ihre Hand lag auf seinem Mantel, und unter dem Stoff fühlte sie den Sinn eines Mannes, der nicht da war, wo er gerade war. Er war an einem Tisch, an dem man aß und lachte und raunzte; er war auf einem Pferd, dessen Hufschlag den Boden an die Rippen schlug; er war an einem Altar, an dem Hände Zeichen machten, die Menschen ebenso trösteten wie irreführten. Und er war bei ihr in diesem Raum, in dem das Öl in einer kleinen Schale brannte und die Welt bis auf ihren Atem verschwunden war.
„Weil ich viele Türen habe“, sagte er. „Und weil ich nicht wählen darf, durch welche ich gehe.“
Sie verstand das nicht. Aber sie verstand, dass er Dinge trug, die schwerer waren als die Gürtel, die Ludger von seinen Mädchen abstreifte.
Während in den Gassen die Nächte das alte Lied sangen, dessen Refrain die Menschen mit ihren Sorgen füllten, begann Berenger in einer Halle nahe der Baustelle eine Wachsplatte zu glätten. Er legte sie auf einen Tisch, der schon lange für diese Arbeit diente. Er atmete tief, wie einer, der einen Wein prüft, den er selber gemacht hat, und erwärmte seine Hände über einer Schale mit heißem Wasser, bis die Finger so weich waren wie die Oberfläche des Wachses. Dann nahm er einen Stift und zog die erste Linie. Es war keine große Linie, nicht die Umrandung der Tür, nicht der Rahmen, der alles halten würde. Es war die Linie eines Rocksaums, die Bewegung eines Mantels, der im metallenen Wind liegen würde, wenn man die Tür öffnete. Dann setzte er eine Schrift darüber. Nicht irgendeine. Seine, die von Hand zu Hand, von Lehrer zu Schüler weitergegeben worden war, ohne dass jemand außer ihnen gelesen hätte, was sie trugen: den Rhythmus der Gießnaht, die Diktion des Bronzeatems.
An seiner Seite stand eine junge Frau, deren Haar er in den Monaten zuvor geflochten hatte, abends, wenn sie nach Fisch und Rauch roch. Hildegard hieß sie, und in ihren Händen lag der Trost, der Handwerker hält, wenn der Tag die Finger um die Werkzeuge gebogen hat. Sie brachte ihm Wasser und legte ihre Hand auf seine Schulter, wenn die Linien seinen Blick zu sehr forderten und die Welt darüber vergessen ging. Später, wenn Nacht die Halle halbierte, legte sie ihre Handflächen auf das Wachs. Ihre Wärme trug sich hinein, und wenn Berenger wieder ansetzte, spürte er, wo sie gewesen war. Er glaubte an so etwas: dass der, der arbeitet, die Hände derer braucht, die ihn halten.
Eines Abends, als Kälte die Luft so dünn machte wie Glas, schob ein Knabe die Tür der Halle auf und schlüpfte herein. Er war derselbe, der Berenger für einen halben Groschen zum Bischof gelotst hatte, und seitdem trieb er sich geblieben, wie Tiere in Scheunen bleiben, wenn es draußen knistert. Der Knabe hieß Gerbold, auch wenn er auf den Rufen der Gasse mit anderen Namen bedacht wurde. Er hatte das Gesicht eines Kindes, das gelernt hatte, dass die Welt Zähne hat; und die Art zu stehen von einem, der immer damit rechnet, gleich weglaufen zu müssen.
„Du schon wieder“, sagte Berenger, der gerade die Zeichnung eines Psalters an den Rand der Platte setzte. „Komm her. Wenn du schon stiehlst, dann stiehl dir etwas Ordentliches.“
Gerbold erstarrte, seine Hand noch in der Haltung, mit der er nach einer kleinen Metallsäge greifen wollte, die auf dem Tisch lag. Seine Augen huschten, wie Mäuse in einem trockenen Grasbüschel huschen, wenn der Schatten eines Raubvogels darüber streicht.
„Ich wollte nicht...“ Er stockte.
„Jeder will“, sagte Berenger. „Die Frage ist, was man mit dem Willen macht.“ Er deutete auf das Wachs. „Siehst du das? Das hier ist eine Tür. Aber bevor sie eine Tür ist, ist sie eine Zeichnung im Wachs. Und bevor sie das ist, ist sie eine Linie in einem Kopf. Und bevor sie das ist, ist sie ein Wunsch in einem Herzen. Nimm den Stift.“
Gerbold wich zurück. „Ich kann nicht zeichnen.“
„Ich hab nicht gesagt: zeichnen. Ich habe gesagt: nimm.“ Berenger hielt ihm den Stift hin, und Gerbold nahm ihn, vorsichtig, als sei er heiß. „Jetzt zieh eine Linie. Irgendeine. Gerade, wenn du kannst. Schief, wenn du musst.“
Gerbold setzte den Stift an und zog. Die Linie war erst zögerlich, dann mutiger, dann plötzlich zu mutig, und sie sprang. Berenger lachte, und sein Lachen füllte die Halle wie warmes Brot die Küche.
„Siehst du?“ sagte er. „So entstehen Türen. Aus Angst. Und aus Mut. Bleib. Wenn du arbeiten willst, arbeite. Wenn du stehlen willst, such dir einen anderen, der zu müde ist, dich zu sehen.“
Gerbold blieb. Er fegte zuerst, weil es Dinge gab, die ein Körper tun musste, um dort bleiben zu dürfen, wo Worte zu Metall wurden. Er trug Wasser, bohrte Löcher in Bretter, aus denen später die Gussformen geschnitten würden, und nach drei Tagen kannte er die Geräusche, die die Halle machte, wenn sie nichts machte. Nach drei Wochen kannte er die Art, wie Berenger schwieg, wenn er in seine Arbeit fiel; und nach drei Monaten wusste er, dass er bleiben würde.
Der namenlose Prediger stand am Rand eines der Marktplätze, als Berenger mit Gerbold am frühen Morgen einen Wagen mit Holzkohle entlud. Er redete immer noch. Vielleicht redete er nachts im Schlaf weiter. Seine Worte waren nicht dumm, nicht ganz. Sie waren nur scharf auf eine Weise, die mehr schneidet als öffnet.
„Ein Bischof, der schläft, wo er nicht schlafen soll“, rief er. „Ein Bistum, das den Zehnten für Bastarde verschwendet. Und ihr wollt Türen? Ihr wollt glänzendes Metall, das die Sonne spiegelt, wenn Gott euch den Rücken zeigt? Einmal, zweimal wird er euch warnen. Im Feuer.“
Gerbold warf einen Blick auf Berenger, der die Schultern zuckte, als seien Worte Wasser.
„Die Sonne spiegelt sich in Bronze“, sagte Berenger leise. „Der Herr spiegelt sich in Taten. Lass die Worte dem.“
In Ludgers Haus schrieb Katerina in dieser Zeit das, was sie schreiben durfte. Sie zeichnete ihren Namen auf Wachstafeln, ritzte ihn so lange, bis er ihr nicht mehr fremd war. Manchmal schrieb sie Sätze, die sie auswendig gelernt hatte. Ich bin wohler. Ich warte. Ich bitte um Erlaubnis. Bete. Einmal, als die Feder so leicht in ihrer Hand lag, dass sie glaubte, sie könne fliegen, schrieb sie etwas, das nicht in die Reihe der erlernten Sätze gehörte: Ich träume von Türen, die singen.
Sie wusste nicht, warum sie dieses Bild gewählt hatte. Vielleicht, weil der Mann, der zu ihr kam, vom Singen des Metalls gesprochen hatte, wenn der Wind daran fuhr. Vielleicht, weil sie seit Wochen an einem Ort lebte, der aus Türen bestand: Türen, die sich von innen schließen ließen, und solche, die von außen verriegelt wurden. Türen, hinter denen Männer Stimmen ablegten und neue anzogen; Türen, vor denen Frauen standen und warteten, ob man sie hineinließ an Wärme und Brot. Und vielleicht, weil ein Teil in ihr wusste, ohne zu wissen, dass ein anderer Mann in dieser Stadt Linien in Wachs zog, die Metall werden würden, das Stimmen hatte.
In der Halle, die ein Werkstatt war und wurde, sang die Bronze. Nicht laut. Noch nicht. Zuerst sangen die Feuer, die Holzkohle fraß und sie in etwas anderes verwandelte. Schmelzöfen redeten in Tönen, die näher an der Erde lagen als an der Luft. Wenn Berenger und Gerbold das Metall in die Form fließen ließen, war es ein Moment wie der der Geburt: Schmerz, Angst, ein Aufreißen im Stoff der Dinge, und dann die seltsame, schiefe Ruhe des Anfangs. Wenn die Form zu zittern schien, wenn an den Rändern der Schlamm krustete, wenn Hitze die Luft flirren ließ, war das Singen noch nicht zu hören. Es kam später, wenn man den Rohling hob, die Formen schlug, die Nähte beschnitt, wenn der erste Schlag eines Hammers auf eine Stelle traf, die genau dafür geschaffen war. Dann war da ein Ton, den man nicht wirklich hörte, sondern von dem man heil wurde. Gerbold hörte ihn zuerst als etwas, das seine Nervigkeit zähmte. Er merkte, dass seine Hände weniger zitterten, wenn der Ton da war. Berenger hörte die Geschichte seiner Lehrer. Hildegard hörte die Zukunft ihrer Kinder.
Und oben, an der Stelle, wo die Hügelkante sich dem Himmel entgegen streckte, wo Gerüste im Wind knackten und Männer sich Namen auf Riegelkerben ritzten, damit sie in den Balken blieben, auch wenn ihre Knochen eines Tages unter einer anderen Tür lagen, stand Willigis und sah zu. Er spürte manchmal den Blick der Stadt in seinem Rücken, als seien alle Türen, die sie hatte, Augen, die ihn beurteilten. Er hörte die Predigten, die nicht in seiner Kirche gehalten wurden, und die Gerüchte, die an sein Bett krochen, wenn er den Schlaf nicht finden wollte. Es gab Tage, an denen er sich daran erinnerte, wie es war, nicht derjenige zu sein, der entscheiden musste, durch welche Türen das Reich gehen würde. Die Erinnerung schmeckte wie Brot aus der Kindheit: schlicht und ehrlich und kaum gesalzen.
Eines Abends, als der Wind den Rauch aus den Schmieden über den Fluss trieb, hielt er Katerinas Hand in seinen. Sie saßen in dem kleinen Raum, in dem die Dinge zwischen ihnen anfingen, bevor sie anfingen, und er sah auf den Tisch, auf dem eine Wachstafel lag. Sie hatte – das erkannte er – mit schwerer Hand Zeichen gezogen, die sich bemühten, so zu stehen, wie Männer es liebten. Er las ihren Namen, und sein Herz tat etwas, das er sich nicht zu erlauben pflegte.
„Schreib mir“, sagte er. „Wenn ich nicht komme. Schreib mir, dass ich nicht komme. Schreib mir, dass ich soll. Schreib mir, dass du atmest.“
„Wer wird es bringen?“ fragte sie.
„Es gibt Hände“, sagte er. „Es gibt Türen. Dir wird eine offen sein.“
Die Winter gingen in die Schlammzeiten über, und die Stadt nahm weiter Form an um das, was kommen sollte. Die erste Türe wuchs, noch im Wachs, und Berenger hatte den Rahmen fast fertig, als sich am Rand der Halle zwei Mädchen zeigten, die sich die Nasen an dem, was innen passierte, platt drückten. Hildegard rief sie herein. „Kommt“, sagte sie, „wenn ihr sehen wollt, wie Männer Stücke machen aus dem, was weich ist.“
„Wie heißt das?“ fragte das ältere, und deutete auf die Platte.
„Tür“, sagte Gerbold, der seine Hände an einem Lappen abwischte, sodass nur der Schmutz sich verteilte.
„Und die Schrift?“ fragte das Jüngere.
„Sie sagt: Hier steht etwas, das seit Karl nicht mehr stand“, sagte Berenger, und seine Stimme hatte diesen Ton, den Männer annehmen, wenn sie etwas sagen, das größer ist als sie. „Sie sagt es nicht für die Ohren. Sie sagt es für die Augen. Und für das Herz.“
Die Mädchen kicherten nicht. Sie nickten, als hätten sie verstanden, ohne zu wissen, dass sie verstanden, und rannten hinaus, um es in den Gassen zu sagen: dass in einer Halle oben am Hügel Türen gemacht werden, die sprechen.
In der Stadt sprach der namenlose Prediger weiter. Er hatte gemerkt, dass man ihm zuhörte, wenn er von Feuer sprach, und so sprach er oft von Feuer. „Der Herr wird die Starken niederbrennen“, rief er. „Einmal, zweimal, bis sie hören. Und die Frau, die ihn hält, wird untergehen im gleichen Brand.“
Katerina hörte ihn eines Tags. Sie stand am Rand eines Marktes und hielt ein Bündel Brot in der Hand, das sie für die Frauen gekauft hatte. Sie hörte „Frau“ und „Sünde“ und „Brand“, und sie spürte, wie die Luft unter ihr einen Schritt zurück wich. Sie blieb stehen. Sie atmete. Sie tat, was die alte Frau sie gelehrt hatte: nicht den Kopf heben, nicht das Lachen, das in ihr aufstieg, zu laut werden lassen. Denn solche Männer hörten nur, was in ihrem eigenen Schädel hallte.
Als sie zurückging, trat jemand neben sie. Ein abgewetzter Mantel, eine Hand, die aussah, als habe sie mehr Pflöcke gezogen als Brot geschnitten.
„Man wird über dich reden, Mädchen“, sagte die Stimme an ihrer Seite. „Wenn sie deinen Namen wissen. Und wenn sie ihn nicht wissen, erfinden sie dir einen. Halt ihn dir nah.“
„Welchen?“
„Den, den du schreiben kannst.“
In der Halle stieg Dampf empor, als sie die erste Form mit Wasser kühlten. Hauptholzbalken, die man für die hölzerne Wand stützte, knarrten, als würden sie auf etwas antworten. Berenger stand dicht am Gussloch, Gerbold an seiner Seite. Sie hatten gewartet, offenbar länger als nötig. Es war nicht Furcht. Es war Respekt. Das Metall flutete in den Bauch der Form, schwer und doch mit einer Schnelligkeit, die jede Nachlässigkeit bestrafte. Gerbold hielt den Atem, und als der letzte Rest Bronze floss und der Schaum wie eine Haut erstarrte, ließ er ihn aus, lange und leise, als hätte er in dieser einen Minute ein Leben lang die Luft gehalten.
„Es wird gut“, sagte Berenger, leise, fast zu dem Metall hinunter. „Es wird gut. Und wenn nicht, machen wir es noch einmal. Türen lernen aus Fehlern.“
Gerbold nickte, und er wusste nicht, ob er an die Tür dachte oder an sich selbst.
Am nächsten Morgen, als die Sonne wie eine bleiche Münze durch den Nebel stieg und die Häuserflächen zu einem stumpfen Gold wurden, zog ein Zug von Reitern die Straße entlang. Die Menschen traten zur Seite, wie Wasser, wenn ein schwerer Kahn es zerteilt. Vorne ritt Willigis, und neben ihm haftete ein Blick an den Häusern, der anders war als der von Soldaten. Es war der Blick eines Mannes, der zählt, was er schon verloren hat, bevor er es hat. Er hielt vor Ludgers Haus an. Nicht lange. Gerade so lange, wie es dauerte, den Blick zu heben, eine Frage zu stellen, die keine Worte brauchte, und eine Antwort zu bekommen, ohne sie zu verdienen. Dann ritt er weiter, und hinter ihm schlossen sich die Gesichter, als seien sie Türen, die man gerade ins Schloss fallen hörte.
Katerina stand im Halbschatten der Kammer, ihre Hände vor dem Bauch verschränkt. Sie wusste, dass ihr Leben einen anderen Gang nehmen würde als das der meisten Frauen in Ludgers Haus. Nicht, weil sie hoffte – Hoffnung war etwas, das man bei Ludger nicht lange behielt –, sondern weil ihr Körper es ihr sagte, leise und unaufdringlich. Da war etwas in ihr, das von dem Mann stammte, der zwischen Türen stand und niemals ganz durch eine gehen durfte. Etwas, das später Lynhardt heißen würde.
Sie legte die Hand auf das Holz der Tür, die sie von der Gasse trennte, spürte die Rillen vom vielen Greifen. Sie dachte an die Zeichnung der Frau mit dem müden Mund, die ihr die Buchstaben gegeben hatte. A. N. N. A., hatte sie einmal geübt, ohne zu wissen, dass sie einen Namen schrieb, der später in ihre Familie gehen würde wie ein gutes Messer in einen Laib Brot. Nun aber, in diesem Moment, dachte sie nur: Türen. Türen aus Bronze. Türen, die singen. Türen, die vielleicht eines Tages ein König öffnen würde, und darunter würde der Name eines Mannes eingraviert sein, der sie aus einem Haus gekauft hatte, in dem Männer sprachen, als könnten sie den Wind bändigen.
Draußen verklingelte eine Glocke den Morgen, und der Prediger setzte an, einen neuen Zorn zu predigen. In der Halle hob Berenger den Rohling und klopfte an eine Stelle, genau an eine, die er kannte. Der Ton sprang an, hell wie eine Klinge in der Sonne. Gerbold hielt die Hand darüber, als könnte er den Klang fühlen, wie man Wärme fühlt.
„Hörst du?“ sagte Berenger.
„Ja“, sagte Gerbold.
„Das ist, was er will“, sagte Berenger nach einem Moment, und er meinte den Mann auf dem Hügel. „Ein Klang, den sie sich merken. Und vielleicht, wenn Gott gut ist, merken sie sich auch, was sie geschworen haben, wenn sie durchgehen.“
Gerbold nickte. Er wusste noch nicht, dass er sein Leben an solche Töne hängen würde. Katerina wusste noch nicht, dass ihre Worte eines Tages den Weg ins Feuer finden und mit dem Rauch in den Novemberhimmel von Mainz steigen würden. Willigis wusste noch nicht, dass er sein Werk, einmal gebaut, einmal verbrannt, wieder würde beginnen lassen müssen. Aber sie alle standen in einem Winter vor Türen, die kommen sollten, und hörten in den unterschiedlichen Räumen ihres Herzens dasselbe: den ersten Ton eines Liedes, das so lange dauern würde, wie Bronze hält. Und länger, wenn Worte wahr blieben.
Am Abend trug Gerbold einen Korb mit Kohlen durch die Gasse, und ein Mann in dunklem Gewand trat aus einem Schatten. Er sah Gerbold an, stammte an, dann fasste er sich.
„Du arbeitest oben, beim Meister“, sagte er. „Man sagt, er macht Türen, die in die Ewigkeit gehen sollen.“
„Man sagt viel“, gab Gerbold zurück.
„Dann sag ihm dies“, flüsterte der Mann und beugte sich so nah, dass Gerbold seinen Atem roch. „Der Himmel zählt anders.“
Gerbold zog den Korb höher, drückte sich an dem Mann vorbei und dachte, dass die einen die Wagschalen mit Metall füllten, die anderen mit Worten. Und dass am Ende vielleicht beides dasselbe war. Auf dem Hügel brannte ein Feuer in einer Schale, die Männer mit großen Händen wärmten sich daran, und in Ludgers Haus schrieb eine Frau, die früher einmal ein Mädchen gewesen war, einen Namen auf eine Tafel, den sie später in ihren Mund nehmen und als Mutter aussprechen würde.
Die Stadt atmete, schwer und wissend. Und in ihrem Atem lag das Lied einer Tür, die noch nicht aus ihrem Ton war, und die doch schon da war, in der Hand, die ihren ersten Strich ins Wachs gezogen hatte, in dem Blick eines Mannes, der in einem kleinen Raum die Hand einer Frau hielt, und in den Schritten eines Knaben, der das erste Mal in seinem Leben einen Stift aus eigenem Willen gehalten hatte.
ERSTES ZWISCHEN-KAPITEL
Der Frühling trat unauffällig ein. Es war nicht die jähe, grüne Flut, die die Dörfer ihres Heimatlandes überrollte, wenn die Teiche auftauten und das Schilf zu wispern begann; es war ein vorsichtiger Hauch, der die Kanten des Frostes abrundete und das Pflaster der Gassen aufweichte. In den Höfen wurden Fässer ans Licht geschleppt, um die Winterleere aus ihnen zu spülen, und die Hunde lagen an sonnigen Wänden und taten so, als hätten sie nie den Mond angeheult.
In Ludgers Haus änderte der Frühling die Gerüche, nicht die Regeln. Männer kamen, Männer gingen, und Katerina lernte, ihre Augen an einem Punkt über deren Schulter zu halten, als läse sie dort eine Schrift. An einem Abend, in dem der Rhein ein schmutziges Silber war und die Krähen wie Risse im Himmel hingen, trat Willigis erneut ein. Nicht in den Mantel eines Mannes gehüllt, der anonym bleiben wollte, sondern in die Gewissheit eines, der wusste, dass es nun keinen besseren Augenblick geben würde.
Er stand im Vorraum, in dem sich die Luft aus feuchter Wolle und altem Rauch zusammenzog, und schlug die Kapuze zurück. Ludger tat, was er immer tat, wenn ein reicher Mann sein Haus betrat: Er lächelte, als sei sein Gesicht eine Schale, in die man Münzen legte, und ließ die Augen klein werden, um ihre Gier zu verbergen.
„Herr“, sagte er, „Euer Besuch ehrt mein Haus.“
„Dein Haus ist kein Haus“, sagte Willigis ruhig. „Es ist ein Bauch. Er frisst, was hineinpasst, und scheidet aus, was ihm nichts mehr nützt.“
Ludger ließ das Lächeln nicht fallen. „Ein Bauch, der Euch nicht schlecht ernährt hat, Herr.“
Willigis nahm eine kleine Geldtasche vom Gürtel. Er hielt sie nicht hin wie ein Bettler das Almosen, sondern legte sie auf den Tisch wie einen Stein auf ein Grab. Ludgers Blick klebte an ihr.
„Sie geht mit mir“, sagte Willigis.
„Alles geht mit dem, der zahlen kann.“ Ludger hob die Tasche, wog sie in der Hand. Eine gewisse Gleichung lief in ihm ab, sichtbar in den kleinen Muskeln am Hals, die sich spannten und wieder lösten. Er nickte. „Sie ist gut. Noch besser, seit sie schreiben lernt.“ Er grinste breit. „Sie ist klug. Klug ist teuer.“
„Klug ist kostbar“, erwiderte Willigis. „Teuer ist nur, was man bereuen muss.“
Er wandte sich um, noch bevor Ludger ihm dankte, als verachtete er Worte, die der Mann in den Mund nahm. In der Tür zu dem kleinen Zimmer, in dem Katerina wartete, hielt er inne. Sie stand, die Hände an die Seiten gelegt, die Schultern gerade, als sei der Raum eine Kirche, in der man gerade stand. Ihr Blick traf ihn, offen, nicht fordernd, nicht ängstlich. Eine Sekunde lang machte sie die Bewegung, sich zu verneigen; dann ließ sie es sein und trat nur einen Schritt auf ihn zu, als wüchse der Boden unter ihren Füßen.
„Pack, was dir gehört“, sagte er. „Es ist Zeit, eine andere Tür zu schließen.“
Sie hatte nicht viel. Ein Tuch, in das sie zwei Kittel und ein Paar gestrickte Strümpfe wickelte; die Wachstafel; die Feder, die sie gestohlen hatte, ohne zu wissen, dass sie stahl; ein kleines, glatt poliertes Stück Holz, das eine der Frauen ihr in die Hand gedrückt hatte, ein Talisman gegen schlimme Träume. Als sie den kleinen Bund hob, fühlte sie ein Gewicht, das nicht in den Dingen lag.
Auf der Schwelle stand die Alte mit dem müden Mund. Sie sah Katerina an, dann den Mann dahinter. In ihren Augen lag kein Neid, nur etwas, das wie Irritation über späten Regen war. Sie hob eine Hand, berührte Katerinas Stirn, einmal, leicht.
„Schreib, wenn du kannst“, sagte sie. „Schreien wir die richtigen Dinge an die falschen Türen, hören sie vielleicht doch zu.“
Sie gingen in die Gasse. Der Frühling roch jeden Abend anders, und an diesem trug er den Duft verbrannten Fetts und die Ahnung von geschnittenem Holz. Letzteres, wusste Katerina noch nicht, stammte von den Formen, die man in Berengers Halle für den nächsten Guss aufstellte. Willigis hielt sich einen Schritt hinter ihr, und sie spürte seinen Blick zwischen ihren Schulterblättern wie eine neue Art Mantel. Vor ihnen löste sich der Strom der Menschen für sie, nicht weil man sie kannte, sondern weil man ihn kannte, und weil nichts so schnell Platz schafft wie die Gewissheit, dass einer die Macht hat, jemanden auf die Knie zu zwingen.
Sie gingen nicht hinauf zum Bischofshof, nicht zuerst. Er führte sie hinunter zum Fluss, wo kleine Häuser am Ufer klebten wie Muscheln an einer Buhne. Er schloss die Tür eines dieser Häuser auf, die mit einem eisernen Riegel besetzt war, der gut geölt war. Drinnen war es kühl, sauber, leer. Ein Tisch stand da, zwei Stühle, eine Truhe, ein Lager mit frischen Strohsäcken, über die eine Leinenbahn ausgebreitet war.
„Hier wohnst du“, sagte er. „Bis ich etwas Besseres weiß. Niemand kommt ohne meinen Willen herein.“
„Wird man wissen, dass es euer Wille ist?“ fragte sie.
Er zuckte kaum merklich die Schultern. „Man wird es vermuten“, sagte er und lächelte. „Und wer mich in solchen Dingen nur vermutet, ist bereits vorsichtiger als einer, der es weiß.“
Er blieb nicht lange. Er erklärte ihr, wo Wasser und Brot zu holen seien und bei wem. Er sagte Namen, die sie nicht kannte, aber auf die Wachstafel schrieb, später, als das erste Licht gewichen und die Ruhe des Raums sie erschreckt hatte wie die Weite eines Feldes. Als er ging, stand er kurz in der Tür und sah zurück. Sein Blick hielt an ihrem Gesicht, als versuche er, es zu lesen, und fände es leichter, als man vermuten möchte.
„Schreib mir“, sagte er. „An den Mann, den ich dir nannte. Er weiß, was er zu tun hat.“
Sie nickte. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, hörte sie das Metall des Riegels singen. Es war ein anderer Ton als der, den Berenger liebte, aber es war einer. Sie setzte sich an den Tisch, legte die Wachstafel vor sich hin und schrieb ihren Namen, als würde sie die neue Luft unterschreiben.
Auf der Baustelle ließen die Männer die Seile gleiten. Ein Balken hob sich, und für einen Moment hielt die Welt den Atem an, als sei dieser Balken ein Gott. Berenger trat zur Seite, wischte sich Stirn und Hände, und Hildegard stellte ihm einen Krug Wasser hin. Gerbold trug Lehm, schob ihn mit dem Fuß an die richtige Stelle, der Blick voller ungeduldiger Bewunderung.
„Meister“, sagte er. „Wird man unseren Namen lesen, wenn man durchgeht?“
Berenger legte den Kopf schief. „Man wird meinen Namen lesen“, sagte er trocken. „In der Inschrift. Deinen liest du in dem, was du tust. In der Naht, die nicht bricht. In der Kante, die nicht schneidet. In dem Ton, der bleibt.“
Gerbold verzog den Mund. „Der Ton bleibt in meinem Ohr. Ob er im Kopf eines anderen bleibt, weiß ich nicht.“
„Dann mach ihn lauter“, entgegnete Berenger und strich mit dem Daumen über einen Grat, der nicht da sein sollte. „Nicht schriller. Klarer.“
Am Rand der Halle tauchten zwei kleine Köpfe auf, die sich bald als nicht nur neugierige, sondern auch verwandte erwiesen. Hildegards Bauch zeichnete sich seit Wochen unter dem Gürtel ab, und Berenger betrachtete ihn mit einer Mischung aus Staunen und Sorge, die Männer zärtlich macht. Es sollten Mädchen werden, sagte die Hebamme, und Berenger tat so, als sei das eine Feststellung ohne Wertung. In Wahrheit dachte er bereits an Mitgift und daran, wie Hände, die kleiner waren als seine, eines Tages Formen streicheln würden, um Unebenheiten zu spüren. Später waren die Jungen, die die Gassen prägten, laut; die Mädchen aber, die die Werkstatt betraten, taten dies auf die gleiche Weise, wie man eine Kirche betritt – und manchmal mit demselben Hunger. Er wusste es noch nicht, aber eines seiner Mädchen würde einmal mit zäher Hand die Zunftgespräche unterbrechen, um zu sagen, dass eine Naht nicht hält, nur weil ein Mann sie so nennt.
Die erste Tür war jetzt im Metall. Grob noch, ihr Gesicht verdeckt von den Krusten, die sich übergetan hatten, und von den Kanten, die nach Feilen schrien. Berenger und Gerbold arbeiteten an ihr, und manchmal, wenn der Meister inne hielt und den Kopf hob, sah er durch das geöffnete Tor der Halle das Aufblitzen des Flusses. Dann dachte er an das, was Metall ins Wasser fallen ließ: Kreise, die breiter wurden, als Stein sie werfen kann.
In den Tagen, in denen Katerina sich an ihrem neuen Tisch ein Glas Wasser einschenkte, das klarer war als alles, was sie in Wochen getrunken hatte, schrieb sie ihren ersten Brief. Ihre Hand strich, bevor sie schrieb, über die Fläche des Wachses, als wolle sie es beruhigen. Sie schrieb nicht viel. Sie schrieb, dass sie atmete, wie er verlangt hatte. Dass das Haus roch wie der Morgen über einem Feld, das man noch nicht angepflügt hat. Dass der Riegel sang. Und dass ihr Bauch manchmal etwas tat, das sich anfühlte wie ein Fisch, der schlägt.
Die Antwort kam zwei Tage später. Ein Mann, schmal, mit stumpfem Haar, brachte sie. Er legte die Tafel auf ihren Tisch, ohne etwas zu sagen, und ging, als fürchte er, Worte könnten ihm ein Netz über den Kopf werfen. Auf der Tafel stand: Ich hörte den Riegel. Und mehr, in einem Wechsel aus strengen und unerwartet geschwinden Linien: Iss. Ruhe. Und wenn das Kind tritt, dann weiß es, dass du es gehört hast.
Sie legte die Hand auf die Stelle, an der sie die Bewegung am deutlichsten spürte, und nickte, als hätte jemand etwas gesagt, das man nicht widersprechen konnte.
Die Wochen waren voll von Dingen, die in einer Stadt passieren, die größer werden will als das, was sie ist. Händler kamen, die ihre Ware nicht auf dem Markt auslegten, sondern in Hinterzimmern, wo die Luft nach Wolle und Wein roch. Männer stritten über Linien auf Pergamenten, als wären es Grenzen in der Erde, und einer warf dem anderen vor, ein Stück Acker dem Bischof zu billig verkauft zu haben. Der Prediger redete weiter, und manchmal lachten die Kinder, wenn er mit der Hand auf den Himmel zeigte und dabei nur den Rauch der Schmieden traf.
Gerbold gewöhnt sich an den Geruch von Metall, als sei es ein zweites Blut. Er begann, in den Rändern der Formen Muster zu sehen, die nicht da waren, und Berenger ließ ihn, solange es die Arbeit nicht störte, mit einem Messer kleine gerade Furchen ziehen, die die Bronze später feiner zeichnen würden. Hildegard saß neben ihnen und nähte Leinen, und wenn das Kind in ihr trat, legte sie die Hand darauf und lächelte mit einer Selbstverständlichkeit, die Gerbold einschüchterte.
„Du wirst Vater“, sagte er einmal, und Berenger sah auf, als hätte er vergessen, dass es so war.
„Ich werde gut gießen“, erwiderte er knapp. Dann nickte er, als müsse er etwas korrigieren. „Und Vater.“
Eines Nachmittags, als die Luft schwer war und die Mauern das Frühjahr wie eine Last auf dem Rücken trugen, stand Katerina im Schatten ihres Hauses und betrachtete die Gasse. Ein Junge mit einer Holzstange trieb eine Gans vor sich her, die sich laut beschwerte. Eine Frau mit einem Korb unter dem Arm hielt an und nahm Katerina ins Visier wie eine Schwalbe einen Insektenschwarm. In ihrem Blick lag erst Neugier, dann Spott, dann so etwas wie Berechnung.
„Du bist die von oben“, sagte sie ohne Gruß.
„Ich bin Katerina“, antwortete Katerina.
Die Frau schnaufte. „Namen sind für die, die sie sich leisten können.“ Sie hob den Korb. „Man sagt, der Bischof zahlt für das Kind, das du trägst.“
Katerina spürte, wie eine kühle Welle von den Füßen zur Stirn kroch. Sie hob das Kinn. „Man sagt vieles“, sagte sie. „Ich höre, was ich lesen kann.“
Die Frau runzelte die Stirn, als hätte man ihr einen Becher hingehalten und behauptet, er enthalte Luft, die man trinken könne. Sie spuckte zur Seite. „Halt dein Haus sauber“, sagte sie. „Der Fluss vergisst nichts.“
Als sie ging, blieb in der Luft der Geruch ihres Körpers, eine Mischung aus Milch, Schweiß und Lauge. Katerina stand noch einen Moment, dann ging sie hinein. Sie setzte sich und schrieb auf: Der Fluss vergisst nichts. Es war kein Satz, den sie ihm schicken würde. Es war einer, den sie behalten wollte, ein Stück Welt, das in ihrer Hand die Form anderer Dinge annahm.
Am Rand der Baustelle, an einem Tag, an dem die Sonne sich traute, warm zu sein, stand Willigis und betrachtete die Tür, die man probeweise aufgerichtet hatte. Sie lag noch nicht an ihrem Platz. Männer hatten sie mit Seilen mühsam an einer Wand hochgezogen, die noch kein Gesicht hatte, nur eine Absicht. Die Bronze glänzte nicht; sie war matt, zeigte die Spuren der Werkzeuge wie Narben, die heilen würden. Er trat näher, legte die Hand auf das Metall. Es war warm vom Tag. In den Buchstaben glänzte etwas, das nicht Licht war: der Stolz eines Mannes, dessen Name, klein und dennoch unübersehbar, am Rand stand.
„Meister Berenger“, sagte Willigis, ohne den Blick zu heben, und neben ihm machte einer, den er ohne Hinsehen erkannte, einen halben Schritt vor. „Ihr habt getan, was ich wollte.“
Berenger verneigte sich knapp. „Ich habe getan, was die Bronze wollte. Sie weigert sich zu schmeicheln. Das ist ihr Adel.“
Willigis nickte. „Sie wird uns trotzen, wenn sie will. Und dennoch wird jeder sie öffnen müssen, der hinein will.“
Der Prediger hatte die Menge noch nicht; es war nicht der Tag für Zorn. Trotzdem stand er am Rande, die Hände im Ärmel, die Augen schmal. Sein Mund bewegte sich, ohne zu klingen, als übte er an Worten, die später sitzen sollten. Er sah auf das Metall, und etwas in ihm zuckte, ein Muskel, der nicht mehr unter seiner Herrschaft stand. Vielleicht war es Bewunderung, so zart und kurz, dass er sie verdrängen konnte. Vielleicht war es nur die dunkle Lust, etwas Großes fallen zu sehen.
Abends saß Katerina am Fenster, das auf den Fluss hinausging. Eine Barke zog vorbei, langsam, als trüge sie Steine. Sie dachte an die Hand auf der Tür, an den Mann, der sie gelegt hatte, an das, was sein Atem an ihrer Schläfe getan hatte. In ihrem Bauch schlug das Kind, und sie legte beide Hände darauf, als wolle sie es beruhigen. Sie begann einen neuen Brief. Sie schrieb ihm, dass sie eine Frau getroffen habe, die an Namen sparte, dass der Fluss nicht vergesse, und dass sie manchmal die Stimmen aus der Halle oben zu hören glaubte, wenn der Wind recht stand: das Singen von Metall, das heiß war und dennoch schon an Morgen dachte.
Gerbold warf den Rest Kohle in den Ofen, fegte die Werkstatt und blieb am Türrahmen stehen. Draußen war die Nacht voller Geräusche, die er kannte. Ein Hund bellte dreimal und hörte auf. Ein Mann hustete, und es klang nicht nach Tod. Ein Rad fuhr durch eine Pfütze und spritzte. Er dachte an den Tag, an den Ton, den die Tür gemacht hatte, als der Hammer sie zum ersten Mal wirklich getroffen hatte. Es war, als hätte die Luft über dem Rhein einen neuen Schatten bekommen, einen, der nicht düsterte, sondern die Dinge schärfer machte.
„Morgen“, sagte Berenger hinter ihm, „schleifen wir den Rand. Wenn man ihn mit der Hand entlangfährt, soll man nur die Schrift spüren. Nichts, was verletzt.“
Gerbold nickte. Er drehte sich um, sah an dem Mann vorbei zu Hildegard, die an der Tür zum kleinen Haus der Halle stand. Ihre Hand lag auf dem Bauch, und ihre Augen waren glänzend vor Müdigkeit und etwas, das viel größer war. Er wusste plötzlich, gewiss, ohne es begründen zu können, dass das Kind, das kommen würde, ihm einmal den Rücken stärken würde an Tagen, an denen er an sich zweifelte. Und dass irgendwo in der Stadt ein anderes Kind in einem Bauch lag, das ihm später so oft den Weg kreuzen würde, dass er sich fragen würde, ob es Zufall sei oder mehr.
Nachts ging der Prediger eine Gasse entlang, in der Wasser stand, das das Licht der Sterne trug. Er blieb vor einem Haus stehen, in dem eine Frau an einem Tisch saß und schrieb. Er sah das, was sie tat, und ihm kam ein Wort in den Sinn, das er sonst selten zu Ende dachte: Gnade. Er schüttelte es ab wie ein Hund den Regen. Dann sah er hinauf zur Baustelle, wo das Gerüst knarrte, als übte es bereits das Stöhnen, das Holz macht, wenn es brennt.
Der Wind drehte. Er trug den Geruch von feuchter Erde und ein fernes Echo von Metall, das singt. In Katerinas Haus presste das Kind die Ferse gegen ihre Hand, als ob es antwortete. In der Halle legte Berenger sein Werkzeug neben das andere, die sorgfältige Ordnung eines Mannes, der weiß, wo seine Dinge liegen müssen, wenn Panik kommt. Gerbold rollte sich in seine Decke, und zum ersten Mal seit er denken konnte, dachte er an Morgen, ohne darin eine Gefahr zu suchen. Willigis lag in seinem Bett und richtetet sich im Halbschlaf auf, als hätte eine Hand an seiner Schulter gerührt; er dachte, ohne wach zu sein, an Türen. Es war, als lägen sie alle – der Bischof, die Geliebte, der Meister, der Knabe, die Stadt – vor einer Schwell, die nur so breit war wie ein Atemzug. Danach würde alles anders klingen. Und wenn der Prediger recht hatte, würde das Lied ein Feuer kennen. Und wenn er Unrecht hatte, würde das Feuer das Lied nicht verstummen lassen.
Im Morgengrauen, kurz bevor die Glocke die Mette rief, trat ein Schatten aus den Schatten. Der Mann hieß nicht Ludger, aber er kannte ihn, und in seinen Händen lag die Geschmeidigkeit eines, der Türen leise öffnete, wenn andere schliefen. Er blieb auf halbem Weg zwischen Ludgers Haus und dem niedrigen Haus am Fluss stehen, sah zu beiden, als könne er sich nicht entscheiden. Dann wandte er sich nach oben, zur Halle. Er wartete, bis der erste Wächter am Gerüst vorbeigegangen war, und lächelte ohne Freude. Er flüsterte etwas, das wie ein Gebet klang, aber keines war. Es war ein Preis.
Und über ihnen allen hob der Himmel seine Farbe, ein Ton heller, so als nähme er Atem. Die Stadt blinzelte und tat, was Städte tun: Sie tat so, als gehöre alles, was kommen würde, ohnehin zu ihr. In einem Haus am Fluss wachte eine Frau und hielt mit zwei Händen etwas, das in ihr wuchs. Auf einem Hügel hob ein Mann den Hammer. Am Rand eines Markts hob ein anderer die Stimme. Und irgendwo in einem Zimmer, in dem man wichtige Dinge aufschrieb und sie siegelte, trocknete auf einem Stück Leder eine Unterschrift, die später jemandem das Leben und jemand anderem die Ehre retten würde. Die Türen waren noch keine, nicht die aus Bronze, nicht die in den Köpfen. Aber sie standen schon im Raum, und der Raum wusste es.
ZWEITES ZWISCHEN-KAPITEL
Der Tag, an dem die Glocke zweimal schlug, bevor sie klang, blieb vielen im Gedächtnis. Der Strick war feucht gewesen, und das Holz des Klöppels nahm den ersten Schlag so widerwillig, als müsse es geweckt werden. Katerina saß aufrecht in ihrem Bett, als der zweite Ton eine Spur sauberer durch die Luft schnitt, und spürte, wie der Schmerz kam, nicht wie eine Klinge, sondern wie eine Hand, die sie aus dem Schlaf hob.
Die Hebamme kam, als sei sie hinter der Tür gestanden. Sie war klein, hatte die Unterarme eines Bäckers und die Stimme einer, die schon oft befohlen hatte, ohne dass Männer merkten, dass sie gehorchten. Sie hieß Margret, trug ein Tuch, das vom vielen Waschen dünn war, und roch nach Kräutern, die den Winter überlebt hatten.
„Atme“, sagte sie, ohne zu grüßen. „Atme da hin, wo es weh tut, und nicht in den Kopf. Und wenn du schreien willst, schrei in die Decke, nicht in den Himmel. Gott weiß, dass Kinder kommen.“
Katerina tat, was man ihr sagte. Zwischen den Wehen dachte sie an nichts, und doch war sie voll von Dingen: an eine Hand auf einem Riegel, an den Ton, den Metall macht, an die Gasse vor dem Fenster, die jetzt leer war wie der Vorraum einer Kapelle vor der Messe. Margret sprach in kurzen Sätzen, die sie nicht in Erinnerung behalten würde. „Jetzt. Nicht jetzt. So. Ja. Gut. Halt.“
Als der Morgen zur Tür hereinkroch wie ein zu schlaues Tier, das man dennoch im Haus duldet, war das Kind da. Es kam mit einem Laut, der mehr war als Schrei; es klang, als hätte es etwas zu sagen, und sei wütend, dass man ihm nicht zuhörte. Margret hielt es hoch, prüfte, was man prüft, und nickte. Sie legte es Katerina auf die Brust, und die Welt zog sich zusammen und wurde ganz klein: Haut an Haut, der feuchte Schreck, das Staunen, die Wärme.
„Ein Junge“, sagte Margret. „Er ist nicht leicht, und er will leben. Das ist mehr als genug für den Anfang.“
Katerina lachte und weinte gleichzeitig. Sie hob die Hand, als müsse sie prüfen, ob das Gewicht auf ihr kein Traum war, und fuhr mit dem Finger an der Linie entlang, wo das Ohr in den Kopf überging. Das Kind roch nach etwas, das nicht von dieser Welt war: Eisen, Milch, Haut, und etwas, das an den ersten Regen nach einem langen Sommer erinnerte.
Später, als sie die Müdigkeit wie eine Decke über sich gezogen hatte und doch nicht schlafen konnte, weil das Kind ihre Brust fand und dort zu arbeiten begann mit einer Ernsthaftigkeit, die sie erschütterte, ging die Tür leise und ein Mann trat ein, den Margret nicht kannte und doch erkannte. Er war nicht in Gewändern eines Bischofs; er war in etwas, das man tragen konnte, wenn man draußen unterwegs war, und doch verrieten die Hände, dass er nicht alltäglich arbeitete.
„Du kommst spät, Herr“, sagte Margret und stellte sich so vor Katerina, dass zwischen ihnen niemand Platz hatte. „Aber früh genug.“
Willigis nickte. Er sah auf Katerina, auf das Kind, und es geschah etwas in seinem Gesicht, das er selten vor Zeugen geschehen ließ: Die Strenge wich, als wäre jemand mit warmen Fingern darübergefahren.
„Er lebt“, sagte er unnötigerweise.
„Und wird Lärm machen“, entgegnete Margret. „Wie es sich gehört. Er wird essen, schlafen und schreien, und wenn er Glück hat, lieben und sterben. Mehr ist dem Menschen nicht zugedacht.“
Er trat näher. Er legte eine Hand auf den Kopf seines Sohnes, leicht, als könne er ihn sonst zerbrechen. Das Kind spürte die Wärme und hob unwillkürlich den Blick, wiewohl es nichts sah. Seine kleine Zunge löste sich von der Brust, und er machte den Mund auf, als wolle er etwas sagen. Es kam nur Luft.
„Wie willst du ihn nennen?“ fragte Margret, die unsentimental war, wenn sie konnte, und sentimental, wenn es notwendig war.
Katerina hob den Kopf, als müsse sie ein Wort aus dem Wasser ziehen. Sie hatte Namen gedacht, nachts, wenn der Schmerz noch wie eine fernliegende Insel gewesen war. Namen, die in ihrer Sprache schimmerten, und solche, die in dieser Stadt nicht auf der Zunge stolperten.
„Lynhardt“, sagte sie. „Er soll stark sein in der Anmut. Und herrisch, wenn er muss.“
Margret nickte, als habe sie mit diesem Namen gerechnet. Willigis’ Augen verrieten ein Flackern – Erkennen und Zustimmung, eine Spur von Wehmut, die er verjagte, indem er das Kinn hob.
„Lynhardt“, wiederholte er, und es klang, als schenke er dem Wort Gewicht.