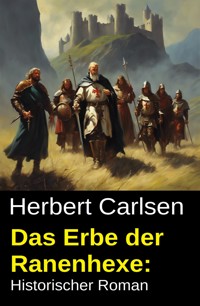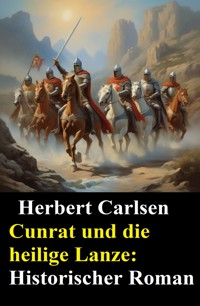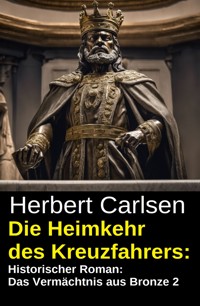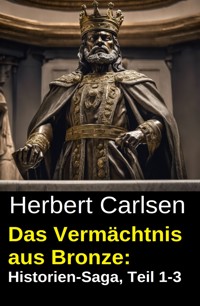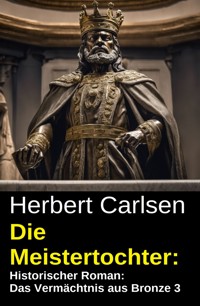
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Meistertochter: Historischer Roman – Das Vermächtnis aus Bronze, Band 3 Mainz im Hochmittelalter:Die Stadt wächst, und mit ihr die Hoffnungen, Sorgen und Herausforderungen ihrer Menschen. In der traditionsreichen Werkstatt der Meister steht Gudrun, die Tochter der Familie, vor ihrem eigenen Weg: Zwischen alten Werten und neuen Aufgaben lernt sie, was es heißt, Verantwortung zu tragen, Halt zu geben und die Arbeit der Hände weiterzuführen. Während politische Unruhen, Flut und Dürre die Stadt erschüttern, hält Gudrun die Halle zusammen. Sie begegnet Berchtold, dem „Junker“, der anders ist und doch Stärke beweist. Gemeinsam meistern sie Alltag und Wandel, bewahren das Erbe der Bronzetüren des Doms und führen die Tradition fort – mit Mut, Geduld und Zusammenhalt. Eine bewegende Geschichte über Handwerk, Familie und das Weitergeben von Werten.Erlebe, wie Gudrun und die Meisterfamilie durch Generationen gehen, wie kleine Taten große Bedeutung bekommen und wie der Ton der Tür zu einem Lied wird, das die Stadt verbindet. Für Fans von historischen Romanen, starken Frauenfiguren und berührenden Familiensagas. Das Vermächtnis aus Bronze – Die große Saga um Mainz, ihre Menschen und die Türen, die alles verbinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Meistertochter: Historischer Roman: Das Vermächtnis aus Bronze 3
Inhaltsverzeichnis
Die Meistertochter: Historischer Roman: Das Vermächtnis aus Bronze 3
Copyright
Glossar
Personen
Orte
Begriffe
Ereignisse
Neunzehntes Kapitel: Wasser und Wort
Zwanzigstes Kapitel: Schwelle und Schwur
Einundzwanzigstes Kapitel: Kante und Kurs
Zweiundzwanzigstes Kapitel: Abdrift und Anker
Dreiundzwanzigstes Kapitel: Der Junker und das Feuer im Lehm
Fünfundzwanzigstes Kapitel: Binde und Bund
Vierundzwanzigstes Kapitel: Sturm in den Gassen
Siebenundzwanzigstes Kapitel: Schrift und Scharnier
Sechsundzwanzigstes Kapitel: Hoftagsluft
Achtundzwanzigstes Kapitel: Erbe und Eisen
Neunundzwanzigstes Kapitel: Wahl und Werk
Dreißigstes Kapitel: Bote und Bronze
Zweiunddreißigstes Kapitel: Ankunft und Andacht
Einunddreißigstes Kapitel: Nachhall und Auftrag
Dreiunddreißigstes Kapitel: Ernte und Erinnerung
Vierunddreißigstes Kapitel: Flut und Fügung
Fünfunddreißigstes Kapitel: Hand und Hörer
Sechsunddreißigstes Kapitel: Lehrgang und Linie
Siebenunddreißigstes Kapitel: Zunft und Zeichen
Achtunddreißigstes Kapitel: Dürre und Dienst
Neununddreißigstes Kapitel: Bruch und Brücke
Vierzigstes Kapitel: Auftrag und Antwort
Einundvierzigstes Kapitel: Schlussstein und Echo
Epilog
landmarks
Titelseite
Cover
Inhaltsverzeichnis
Buchanfang
Die Meistertochter: Historischer Roman: Das Vermächtnis aus Bronze 3
Herbert Carlsen
von HERBERT CARLSEN
Die Meistertochter: Historischer Roman – Das Vermächtnis aus Bronze, Band 3
Mainz im Hochmittelalter:Die Stadt wächst, und mit ihr die Hoffnungen, Sorgen und Herausforderungen ihrer Menschen. In der traditionsreichen Werkstatt der Meister steht Gudrun, die Tochter der Familie, vor ihrem eigenen Weg: Zwischen alten Werten und neuen Aufgaben lernt sie, was es heißt, Verantwortung zu tragen, Halt zu geben und die Arbeit der Hände weiterzuführen.
Während politische Unruhen, Flut und Dürre die Stadt erschüttern, hält Gudrun die Halle zusammen. Sie begegnet Berchtold, dem „Junker“, der anders ist und doch Stärke beweist. Gemeinsam meistern sie Alltag und Wandel, bewahren das Erbe der Bronzetüren des Doms und führen die Tradition fort – mit Mut, Geduld und Zusammenhalt.
Eine bewegende Geschichte über Handwerk, Familie und das Weitergeben von Werten.Erlebe, wie Gudrun und die Meisterfamilie durch Generationen gehen, wie kleine Taten große Bedeutung bekommen und wie der Ton der Tür zu einem Lied wird, das die Stadt verbindet.
Für Fans von historischen Romanen, starken Frauenfiguren und berührenden Familiensagas.
Das Vermächtnis aus Bronze – Die große Saga um Mainz, ihre Menschen und die Türen, die alles verbinden.
Keywords: historischer Roman, Mittelalter, Mainz, Meistertochter, Handwerk, Familie, Bronzetür, Dom, Saga, Generationen, Frauenfigur, Erbe, Zusammenhalt, Tradition, Stadtgeschichte, Romanserie, emotional, authentisch
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2025 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Glossar
Personen
Gudrun Meister Tochter der Meisterfamilie, wächst in die Verantwortung der Werkstatt hinein und prägt die nächste Generation mit Mut und Haltung.
Berchtold von Brachtal Junger Mann aus der Familie vom Landhof, sensibel und klug, findet seinen Platz in der Halle der Meister.
Hantz Meister Erfahrener Handwerker und Gießer, übernimmt zunehmend die Leitung der Werkstatt.
Hadewig Hantzens Frau, bekannt für ihre praktische Art und ihre Liebe zur Familie und Arbeit.
Armin Chronist und Schreiber, bringt Ordnung in die Stadtgeschichte und hält den Willigis-Tag fest.
Wieg Jüngster der Familie, beginnt seine Lehrzeit in der Werkstatt und zeigt Talent für das Handwerk.
Affra Meister Matriarchin der Familie, prägt die Halle mit ihrer Erfahrung und ihrem Sinn für Zusammenhalt.
Ulrych Meister Senior der Familie, steht für Tradition und Handwerk.
Jorgen von Brachtal Vater von Berchtold, bewirtschaftet den Landhof außerhalb von Mainz.
Hellwina Jorgens Frau, sorgt für das Wohl der Familie im Brachtal.
Hadewig Hantzens Frau, unterstützt die Familie mit Tatkraft und Herz.
Kylion Priester und Chronist, verfasst die Verse und hält die Geschichte der Stadt fest.
Siegfried Stadtherr von Mainz, sorgt für Ordnung und setzt sich für die Stadt ein.
Arnold von Selenhofen Ehemaliger Erzbischof von Mainz, prägt eine Zeit politischer Unruhe.
Orte
MainzStadt am Rhein, Zentrum von Handel, Handwerk und Geschichte.
Dom zu Mainz Bedeutendes Bauwerk und Wahrzeichen der Stadt, mit den berühmten Bronzetüren.
Halle der Meister Werkstatt der Familie, Ort für Handwerk, Zusammenhalt und Tradition.
Brachtal Landhof der Familie von Jorgen, gelegen außerhalb von Mainz.
Speyer, Köln, Worms, Andernach, Metz Wichtige Städte im Umfeld von Mainz, mit denen die Werkstatt Handel treibt.
Domhof Bereich am Dom, in dem wichtige Ereignisse stattfinden.
Armenhaus Ort in Mainz, der von der Familie mit kleinen Arbeiten unterstützt wird.
Begriffe
Bronzetür Kunstvoll gefertigte Tür am Mainzer Dom, Symbol für Beständigkeit und Handwerkskunst.
Riegel, Bolzen, Klammer, Haken Handwerkliche Produkte der Werkstatt, stehen für Sicherheit und Verbindung.
Medaille/Medallion Kleine Bronzeplättchen, die an Willigis’ Tag verteilt werden und für Zusammenhalt stehen.
Willigis-Tag Jährlicher Gedenktag zu Ehren des Erbauers der Bronzetür, gefeiert mit Vers, Licht und Brot.
Zunft Handwerksvereinigung, die für Ordnung und Qualität in der Stadt sorgt.
Lehrling Junger Mensch, der das Handwerk in der Werkstatt erlernt.
Vers/Chronik Gedichtzeile oder Aufzeichnung, die die Geschichte und Werte der Stadt bewahrt.
Pfosten, Schwelle, Kante Bauteile und Metaphern für Halt, Übergang und Maß.
Ereignisse
Flut und Dürre Naturereignisse, die die Stadt und die Werkstatt herausfordern.
Krönung Festlicher Einzug eines Königs, bei dem die Bronzetür eine besondere Rolle spielt.
Stadtunruhen Politische Spannungen und Veränderungen in Mainz, die das Leben der Familie beeinflussen.
Zunftversammlung Treffen der Handwerker zur Ordnung und Anerkennung der Werkstätten.
Willigis-Tag Feier zu Ehren des Domerbauers, mit Versen, Lichtern und Brot für die Stadt.
Lehrzeit Abschnitt, in dem die jungen Familienmitglieder das Handwerk erlernen.
Neunzehntes Kapitel: Wasser und Wort
Der Rhein kam in diesem Jahr nicht als Freund. Er kam, wie einer kommt, der lange zugehört hat und jetzt reden will. Erst stand er hoch und tat unschuldig, schob die Kähne näher an den Rand, als würden sie sich nur in seiner Nähe wärmen wollen. Dann kroch er über die Böschung, so höflich, dass die Kinder lachten und die Hunde bellten. Schließlich blieb er, wo er nicht bleiben sollte, und nahm den Marktgeruch mit hinunter in die Gassen, bis der Kies knirschte, wo sonst der Huf dämpfte.
„Wasserjahr“, sagte ein alter Mann am Ufer, als sei das ein Schicksal wie ein Geburtszeichen.
Die Halle der Meister lag nicht tief genug, um das Wasser begrüßen zu müssen, aber tief genug, um seine Absicht zu schmecken. Der Hof bekam eine Haut aus Schlamm, die die Füße wegnahm, wenn sie nicht aufpassten. Affra ließ Bretter legen, die trockener bleiben als Tritt. Ulrych schnürte die Kisten höher, nicht aus Angst, aus Wissen. Hantz stand an der Tür und sah dem Strom zu, als sei er eine Zinne, auf die man später steigen will.
„Die Scharniere am Dom“, sagte einer der Männer, die an der Westfront Wache standen, „sie quellen. Nicht schlimm. Aber es tropft.“
Affra band das Tuch fester. „Nicht tropfen“, sagte sie. „Öl. Noch bevor jemand ‚heilig‘ sagt.“
Ulrych nickte und ging. Man kann warten, bis Dinge rufen. Oder man hört, wenn sie einen räuspern. Die Domherren, die an diesem Morgen mit hochgezogenen Gewändern auf den Stufen standen, waren erleichtert, als sie ihn sahen. Die Türen waren geschlossen, die Kante dunkel vom Regen. Ulrych legte die Hand auf das Metall, so, wie Kylion die Hand auf Stein legt: mit einem Respekt, der nicht tiefer liegt als Arbeit.
„Wir nehmen sie nicht aus der Angel“, sagte er. „Wir geben ihnen nur den Atem zurück.“ Er holte Talg, ölige Lappen, das Messer, das an Kanten mehr Geduld hat als an Holz. Affra wischte, tastete, hörte, wie die Bronze Leute hört: durch die Hand. Hantz stand daneben und machte die Bewegungen mit, als sei er der Schatten, der lernt.
Die Tür antwortete, als sie später schloss. Der Ton war da, nicht lauter, nicht müder – nur mit diesem Hauch, den Dinge bekommen, die wissen, dass es knapper war als sonst. Ein Domherr seufzte hörbar, als ob das Metall ihm das Wetter aus der Brust genommen habe.
„Wasser“, sagte Affra, als sie die Lappen ausdrückten, „ist wie Schuld. Wenn man es laufen lässt, kommt es wieder. Man muss ihm Wege geben, die nicht durch die Stube gehen.“
„Dann ziehen wir Gräben“, erwiderte Ulrych. „In den Büchern wie im Hof.“
Kylion stand in diesen Tagen mehr in der Kapelle als im Chor. Er hatte die Verse in einen Zusammenhang gebracht, den Rom lesen konnte, ohne die Stirn zu runzeln; sie waren nicht brüllend, nicht kniefällig. Adalbert, der wieder in der Stadt weilte, wenn auch als einer, der mit dem Kaiser Rangeln nicht mehr so genoss wie früher, hörte zu, als Kylion die Strophen leise las. „Er baute. Er fiel. Er hielt“, murmelte der Erzbischof. „Ja“, sagte Kylion. „Und wir halten mit.“
„Die Leute brauchen Gesichter“, entgegnete Adalbert. „Und Tage. Lass uns einen Tag setzen, an dem sie ihn nennen, und schauen, ob Rom mitatmet.“ Er nannte ein Datum, das nicht laut war: ein Wintertag, an dem die Luft so klar ist, dass Glocken weiter klingen. „Wir feiern ihn“, sagte er, „nicht als Gott. Als Mann, der den Gottesdienst möglich gemacht hat.“
In der Halle saß Hantz abends und strich mit der Hand über die Figur der Frau mit dem Krug. Mathilde war fort, die Luft hatte wieder Platz, und dennoch lag etwas in ihm, das nicht von allein ging: das Leuchten, das man hat, wenn einer applaudiert, und die Leere, die man trinkt, wenn der Applaus aus ist. Er sah Affra an. „Ich werde noch einmal heiraten“, sagte er, so plötzlich, dass der Satz wie ein Becher klang, der auf Holz trifft. Affra hob die Brauen, nicht hoch, nicht abweisend. „Geh nicht nach rot“, sagte sie. „Geh nach ruhig.“
Sie hieß Hadewig und roch nach Wolle und Brot. Nicht nach Wein. Ihre Hände waren nicht schmal, sie waren gut gebaut, wie Dinge, die oft benutzt werden. Sie lachte wenig und dann richtig. Hantz sah sie zuerst am Fluss, wo sie Tücher klopfte und die Haare im Nacken festband, als hätten sie ihr nie gehört. „Du bist Hantzens“, sagte sie, als er etwas sagte, was man in solchen Momenten sagt. „Und die Halle ist die Halle. Wenn du das weißt, komme ich.“ Er wusste es, oder er glaubte, es zu wissen. Affra sah Hadewig, und in ihrem Nicken lag ein Segen, den sie selten gab.
Ulrych freute sich still, wie Väter sich freuen, wenn Söhne etwas Richtiges tun, ohne zu prahlen. „Sie hält dich“, sagte er. Hantz nickte. „Sie hält mich fest“, erwiderte er. „Und wenn ich zu fest ziehe, hält sie mich los.“
Die Hochzeit war kein Fest, das Leute von außen erzählten. Sie war warm, mit Suppe und einem zu spät gebackenen Brot, das man dennoch lobte, weil Matthis, der Bäcker, alt war und den Ofen so liebte wie Gerbold einst die Feile. Kylion saß in einer Ecke und sprach eine kurze Bitte, die auf Hände passte, nicht auf Banner. Jorgen kam und legte Hantz die Hand auf die Schulter, wie er es bei Ulrych getan hatte, wie er es bei so vielen getan hatte, die er halten wollte. Er änderte kaum seine Sätze. Männer wie er brauchen es nicht.
Der Wasserwinter ging, als wäre er nie gewesen. Er hinterließ eine Rinde an den Wurzeln und Morast an Karrenachsen und die Erinnerung daran, dass das Geräusch von Eimern, die Wasser schöpfen, eines ist, das man lieber in Kellen hört.
Als der Wintertag kam, an dem Adalbert Willigis’ Namen „in Ehren“ nannte, war es einer jener Morgen, an denen die Kälte den Atem so scharf macht, dass Leute weniger reden. Sie kamen, nicht in Scharen, mehr als für jeden anderen Namen, der nicht Gott war. Kylion stand im Schatten, weil er hören wollte, wie die Verse klangen, wenn die Luft sie trug. Adalbert sprach sie, nicht als wären sie sein eigenes Werk, aber so, dass die Stadt den Mann hören konnte, den sie brauchte: keinen Heiligen mit Wunder, sondern einen, der gewollt hat, dass Türen halten.
„Er baute“, sagte Adalbert. „Als andere sprachen. Er hielt, als andere fielen. Wir danken, nicht mit Gold, sondern mit Arbeit. Wir feiern ihn, nicht für Pracht, sondern für Maß.“ Die Tür im Westen, die Kante noch dunkel vom Wasserjahr, sprach einen Ton, als draußen jemand den Riegel berührte. Die Leute sahen kurz dorthin, nicht weil sie abgelenkt waren – weil sie verstanden.
Nach dem Gottesdienst stand eine alte Frau an der Tür, deren Hände mehr Haus gehalten hatten als die meisten. „Er hat mich einmal angeschaut“, sagte sie zu niemandem. „Ich war Kind. Er trug den Mantel wie andere Männer die Zeit. Ich habe den Riegel gehört seitdem, wenn ich die Tür schob.“ Kylion lächelte sie an. „Schreibt es auf“, sagte er leise. Sie lachte, rau. „Ich schreibe nicht“, sagte sie. „Ich koche. Ihr schreibt.“
Die Halle trug diese Tage wie ein Gurt. Die Arbeit war nicht weniger, die Wege waren nicht besser, aber es gab eine Wärme, die nicht vom Ofen kam: das Wissen, dass die Stadt einen Satz gefunden hatte, in dem ihre Hände Platz hatten. Ulrych machte Ringe, ohne zu brummen. Hantz machte Ringe, ohne den Rücken zu krümmen. Nachts machte er Gesichter, weniger als früher, aber besser. Hadewig brachte ihm Wasser, manchmal Wein, mehr Wasser. Sie war nicht eifersüchtig auf Bronze. Sie war eifersüchtig auf Müdigkeit. „Schlaf“, sagte sie. „Du bist schöner, wenn du wach bist.“
Mathilde kam nicht zurück. Einmal erreichte die Halle ein Gerücht, das wie ein Blatt vom westlichen Wind in den Hof fiel: Sie sei in Metz eine Dame von Abenden, die Dinge kosteten. Affra hob es auf, warf es fort. Gerüchte kann man sortieren, wie man Nägel sortiert: die, die man braucht; die, die verletzen; die, die in den Eimer gehören, den man nie leert.
Im Brachtal kam ein Kind. Hantz und Hadewig standen in der Halle, als Jorgen und Hellwina das Bündel hereinbrachten, weil der Weg überfroren war und man die Luft in der Stadt wärmer hielt. „Sie heißt Gudrun“, sagte Hellwina, und in dem Namen lag ein Ton, der fest war. Affra nahm sie, und Gudruns Hand, nicht größer als die Kuppe eines Daumens, packte den Rand eines Lederriemens, als hielte sie schon etwas fest. „Sie wird halten“, sagte Affra. „Und sie wird mit dem Kopf durch Dinge gehen, die andere umkehren.“
„Wir brauchen die, die durchgehen“, erwiderte Ulrych, mit einem Blick, in dem Zukunft nicht weh tat.
Kylion, der an diesem Tag eine neue Strophe trug – „Er war streng und sanft“ –, sah Gudrun an, als wolle er prüfen, ob Willigis’ Tür in ihr ein Zuhause fände. Er sah die Hand. Er nickte. „Wir schreiben sie auf“, sagte er, ohne zu wissen, dass er später ihre Zeilen nicht schreiben würde, aber dass andere es täten.
Der Frühling, der auf diesen Winter folgte, zog schnell. Er hatte das Wasserjahr abgeschüttelt und lief, servil und gut. Die Halle atmete durch. Der Mann aus Andernach kam und nahm die zweite Rate, weniger schwer als die erste. „Ihr seid klug“, sagte er. „Ihr pfändet keine Modelle. Ihr nehmt Tuch.“ „Wir sind arm“, erwiderte Affra. „Wir wissen, was wir nicht sind.“
Hantz hielt das Haus mit einer neuen Zärtlichkeit. Er sah, wie Hadewig die Listen füllte, die Constanze begonnen, Affra gehalten, Mathilde verachtet hatte. Er sah, wie Ulrych sich an manchen Abenden an die Tür lehnte, als sei er selber ein Riegel. Er sah, wie Affra auf dem Hocker saß, den Berenger hinterlassen hatte, und die Hände in den Schoß legte, wenn die Halle schlief. Er ging zu ihr, legte ihr die Hand auf den Rücken. „Ruh dich“, sagte er. „Ich bin da.“
Sie sah ihn an und in diesem Blick standen Jahre: ein Junge, der Ringe schleifen musste, als er lieber Löwen machte; ein Mann, der ging, als er bleiben sollte; ein Sohn, der jetzt blieb, da er gehen müsste. „Ich ruhe, wenn ich liege“, sagte sie und lächelte. „Noch sitze ich.“
Der Sommer brachte eine Auftragsarbeit, die die Halle wie ein Geschenk und wie ein Spiegel nahm: Die Domherren wollten die Inschrift an den Türen ergänzen, klein, sauber, mit einem Vers, der sagte, was alle wussten: dass der Klang blieb, weil Männer ihn hielten. Kylion schrieb die Zeile, die man in Bronze gießen konnte. „Nicht mit Gold wird sein Klang, mit Händen bewahrt.“ Adalbert sah sie, strich mit dem Finger darüber, als sie noch im Wachs war, und nickte. „So will Rom ihn“, sagte er. „Und so will Mainz sich.“
Affra setzte die Buchstaben, Hantz goss, Ulrych hielt den Spiegel auf die Kante, damit der Guss sauber blieb. Als sie den Deckel hoben, lag die Zeile da, wie ein Band, das man schließt, wenn man das richtige Ende gefunden hat. Die Stadt las sie, nicht laut, nicht im Chor. In den Gassen sagte man sie einander vor, wenn man vor der Tür stand, die schloss. Es war, als hätten sie eine neue Gewohnheit.
Und in Brachtal lag eine Decke auf einem Tisch, auf der Anna mit mehliger Hand den Namen Gudrun schrieb, als könne man auf Leinen Worte für die Zukunft vorschreiben. Jorgen setzte sich und sah zu, wie der Bach leiser wurde, weil der Sommer ihn kleiner machte. Er legte die Hand auf die Kante der Bank, an die schon sein Vater die Hand gelegt hatte. „Halt ihn fest“, sagte er noch einmal. Hellwina streichelte mit dem Handrücken Gudruns Fuß, der Luft trat. „Wir halten“, sagte sie.
Am Abend zog Wind vom Westen durch die Stadt, einer, der keine Gerüchte trug, sondern den Ton von Arbeit. Ulrych legte die Stirn an die Tür. Kylion stand daneben und sprach die erste Strophe leise, die er an diesem Morgen zum ersten Mal ganz zu sagen gewagt hatte: „Er baute, und wir halten.“ Affra setzte sich auf den Hocker, schloss kurz die Augen und flüsterte ihre vier Worte. Hantz stand an der Bank, nahm einen Ring und einen Löwen in die Hand. Er legte den Löwen weg. Er feilte am Ring. Hadewig lächelte, unscheinbar und stark. Gudrun schlief in der Stube, die Hand auf einem Stück Leder, als wisse sie bereits, was das Haus von ihr wollte.
Und die Stadt, die mehr aus Atem bestand als aus Gezeter, sagte still: Ja. Für dieses Jahr. Für das nächste. Für ein Lied, das man mit Händen singt. Für einen Vers, den man nicht lügen lässt. Für Wasser, das Wege hat. Für Kinder, die Namen bekommen, die durch Türen gehen. Für Pfänder, die Modelle nicht sein dürfen. Für das, was bleibt. Für morgen. Für Mainz. Für den Ton, der hält. Und der, solange einer ihn hört, Welt ordnet. In Ring und Vers. In Arbeit und Atem. In Tür und Zeit.
Zwanzigstes Kapitel: Schwelle und Schwur
Der Sommer verging, als wäre er nie laut gewesen. Er ließ eine Spur aus feinem Staub auf den Fensterbänken und die Erinnerung an Abende, in denen der Fluss roch wie Metall, das man gerade aus der Form gehoben hat. Die Stadt schob den Herbst vor sich her, nicht aus Trägheit, aus Maß: Mainz hatte lernen müssen, Schritt für Schritt zu gehen, auch wenn die Wege zogen.
Ulrych ging die Wege noch immer, aber er rechnete mit Atem, nicht mit Mut. Man sah es an der Art, wie er vom Kahn stieg: ohne den kleinen Sprung, der früher im Körper saß. Als er eines Abends in die Halle trat, legte er die Hand an den Pfosten, an die alte Kerbe, und zählte in sich, wie er es tat, wenn der Tag zu groß gewesen war. Affra sah es und sagte nichts. Sie stellte ihm den Becher hin, der ihm den Mund nicht redete, den Hals wärmte.
„Köln zahlt – halb“, sagte er. „Andernach erstaunlich ganz. Worms…“ Er ließ das Wort stehen, als hätte es den Rücken eines Viehs, das nicht über den Hof wollte. „Worms verschiebt wieder. Nicht aus Böswillen. Aus Bauten.“
„Dann bauen wir weiter an dem, was wir sind“, erwiderte Affra. Das war kein Trost. Es war ein Satz, der die Hände findet.
Hantz kam in jenen Wochen mit der Ruhe eines Mannes, der Fehler nicht mehr mit Lachen kaschiert. Hadewig war an seiner Seite. Ihr Tuch roch nach Wolle und ein wenig nach Rauch. Er stellte eine kleine Kiste auf den Tisch, schob den Deckel auf und holte vier Ringe heraus, blank, ohne Prunk. „Für Utrecht“, sagte er. „Sie wollen eine Markierung. Eine kleine, innen: ME – Meister. Nicht außen.“
„Sie haben begriffen“, nickte Affra. „Dass Ruhm von innen kommt.“
Hantz lächelte, so leise, dass nur die, die ihn kannten, es hörten. Er arbeitete die Kanten, sauber, geduldig, und wenn ihm in mancher Nacht das Gesicht einer Figur in den Griff wollte, legte Hadewig ihm die Hand auf den Arm. „Morgen“, sagte sie. „Heute Ringe.“
Im Brachtal stand der Bach wieder artig in seinem Lauf. Jorgen hatte die Böschung mit Weiden gesteckt, die die Wurzeln halten. Er sah Hellwina zu, wie sie die Staketen prüfte, die er gesetzt hatte, und fühlte die Ruhe, die von ihr ausging, als sei sie das Gegenstück zu dem, was einmal in ihm gebrannt hatte. Anna saß auf der Bank mit Mehlstaub an der Schürze und machte Striche auf Leinen – keine Worte, nur Linien, die aussahen wie Felder von oben.
„Worms ruft“, sagte eines Tages ein Mann auf dem Hof, ein abgerittener Bote mit Lippen, die vom Staub sprangen. „Nicht nach Arbeit. Nach Männern in Gewändern. Kaiser und Papst – oder doch deren Hände – wollen reden.“
„Sie reden immer“, brummte Hans, der alte Hans, dessen Hände Holz erklären konnten. „Sie hören selten.“
Kylion hörte und ging. Nicht weil man ihn befahl – weil er in Jahren gelernt hatte, dass Worte, die die Welt zusammenhalten, dort fallen, wo Könige und Bischöfe sich auf die Finger sehen. Worms war an diesem Herbsttag lauter als sonst. Der Rhein stand ordentlich, als wolle er ein gutes Beispiel geben. In einem Saal, der für Feste gebaut schien und nun Sachlichkeit trug, standen Männer, die man Geschichten anmerkte, und andere, die man nur an ihren Namen kannte.
„Concordia“, sagte einer, der übersetzte, damit beide Stuben dieselbe Sprache hören konnten. Ein Einvernehmen. Hände, die nicht die selben Dinge wollten, legten sich nebeneinander auf Tischkanten: das Recht des Kaisers, Ringe zu stecken; das Recht des Papstes, Hirtenstäbe zu geben. Kylion stand am Rand und schrieb keine Gesetze. Er schrieb Sätze, die auf Mainz fielen: „Wenn sie sich finden, fällt weniger auf uns.“
Adalbert war nicht der, der unterschrieb. Er stand nahe genug, um zu lächeln, als der Knoten wenigstens im Wort gelöst wurde. Später legte Kylion seine Hand auf den kalten Stein einer Säule und dachte an Türen, die ohne Streit singen. Er fuhr zurück mit dem leisen Befund: Man hatte etwas zugemauert, das zu oft gerissen war. Es war nicht heilig. Es war brauchbar.
In Mainz roch die Luft nach Korn, das noch nicht ganz trocken war. Die Halle nahm die Nachricht, ohne sie zu feiern. Affra sah Kylion in der Tür und hob den Kopf. „Und?“, fragte sie.
„Sie haben eine Brücke gelegt“, sagte er. „Aus Worten. Wir werden sehen, ob die Schritte halten.“
„Wir sind gewohnt zu halten“, erwiderte sie.
Ulrych hörte es und nickte. „Brücken sind gut“, sagte er. „Solange man weiß, wo das Ufer ist.“