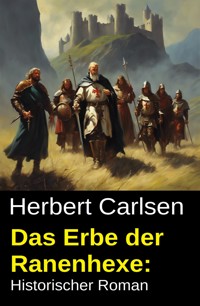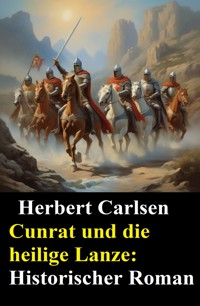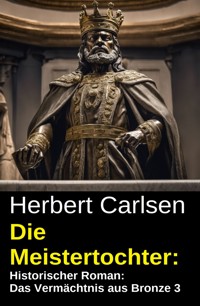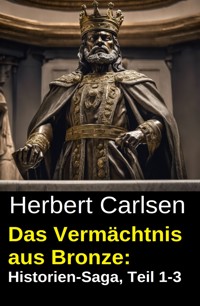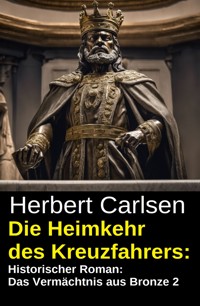
Die Heimkehr des Kreuzfahrers: Historischer Roman: Das Vermächtnis aus Bronze 2 E-Book
Herbert Carlsen
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Heimkehr des Kreuzfahrers Historischer Roman – Das Vermächtnis aus Bronze, Band 2 Mainz im 11. Jahrhundert:Die Stadt wächst – und mit ihr die Hoffnungen, Sorgen und Geheimnisse ihrer Menschen. Während die Werkstatt der Meister neue Wege geht und die Bronzetüren des Doms zum Symbol für Zusammenhalt und Veränderung werden, bricht Jorgen von Brachtal als Kreuzfahrer ins Heilige Land auf. Doch Ruhm und Glauben haben ihren Preis: Als Jorgen nach Jahren gezeichneter Heimkehr zurückkehrt, muss er sich seiner Schuld stellen – und dem Leben, das ihn erwartet. Auch in Mainz selbst kämpfen die Familien um ihren Platz in einer Welt voller Wandel, Konkurrenz und Gefahr. Affra hält die Halle zusammen, Ulrych ringt mit der Verantwortung als Erbe, und Kylion sucht als Chronist und Priester nach Wahrheit und Versöhnung. Zwischen Bränden, Krönungen, wirtschaftlichen Krisen und persönlichen Tragödien zeigt sich, was wirklich zählt: Arbeit, Liebe, Geduld – und der Klang der Türen, die eine ganze Stadt verbinden. Packend, atmosphärisch und voller historischer Details: Erlebe, wie Schuld, Hoffnung und die Kraft der Gemeinschaft eine Epoche prägen.Für Fans von authentischen Mittelalter-Romanen, bewegenden Familiengeschichten und großen Gefühlen. Das Vermächtnis aus Bronze – Die große Saga um eine Stadt, ihre Menschen und die Türen, die alles verbinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Heimkehr des Kreuzfahrers: Historischer Roman: Das Vermächtnis aus Bronze 2
Inhaltsverzeichnis
Die Heimkehr des Kreuzfahrers: Historischer Roman: Das Vermächtnis aus Bronze 2
Copyright
Glossar
Orte
Begriffe
Sechstes Kapitel: Brachtal
Siebtes Kapitel: Stein wird Jahr
Achtes Kapitel: Die zweite Sonne
Neuntes Kapitel: Pfade und Pläne
Zehntes Kapitel: Abschied und Aufbruch
Elftes Kapitel: Das zweite Feuer
Zwölftes Kapitel: Schuld und Gelübde
Dreizehntes Kapitel: Lanze und Staub
Vierzehntes Kapitel: Stimmen im Holz
Fünfzehntes Kapitel: Erben und Fehler
Sechzehntes Kapitel: Risse im Ring
Siebzehntes Kapitel: Schuldenwind
Achtzehntes Kapitel: Vers und Pfand
landmarks
Titelseite
Cover
Inhaltsverzeichnis
Buchanfang
Die Heimkehr des Kreuzfahrers: Historischer Roman: Das Vermächtnis aus Bronze 2
von HERBERT CARLSEN
Die Heimkehr des Kreuzfahrers Historischer Roman – Das Vermächtnis aus Bronze, Band 2
Mainz im 11. Jahrhundert:Die Stadt wächst – und mit ihr die Hoffnungen, Sorgen und Geheimnisse ihrer Menschen. Während die Werkstatt der Meister neue Wege geht und die Bronzetüren des Doms zum Symbol für Zusammenhalt und Veränderung werden, bricht Jorgen von Brachtal als Kreuzfahrer ins Heilige Land auf. Doch Ruhm und Glauben haben ihren Preis: Als Jorgen nach Jahren gezeichneter Heimkehr zurückkehrt, muss er sich seiner Schuld stellen – und dem Leben, das ihn erwartet.
Auch in Mainz selbst kämpfen die Familien um ihren Platz in einer Welt voller Wandel, Konkurrenz und Gefahr. Affra hält die Halle zusammen, Ulrych ringt mit der Verantwortung als Erbe, und Kylion sucht als Chronist und Priester nach Wahrheit und Versöhnung. Zwischen Bränden, Krönungen, wirtschaftlichen Krisen und persönlichen Tragödien zeigt sich, was wirklich zählt: Arbeit, Liebe, Geduld – und der Klang der Türen, die eine ganze Stadt verbinden.
Packend, atmosphärisch und voller historischer Details: Erlebe, wie Schuld, Hoffnung und die Kraft der Gemeinschaft eine Epoche prägen.Für Fans von authentischen Mittelalter-Romanen, bewegenden Familiengeschichten und großen Gefühlen.
Das Vermächtnis aus Bronze – Die große Saga um eine Stadt, ihre Menschen und die Türen, die alles verbinden.
Keywords: historischer Roman, Mittelalter, Mainz, Kreuzfahrer, Heimkehr, Schuld, Familie, Handwerk, Bronzetüren, Dom, Saga, Erbe, Liebe, Gemeinschaft, Stadtgeschichte, Romanserie, authentisch, emotional
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2025 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Glossar
Personen
Jorgen von Brachtal Junger Ritter aus Mainz, der als Kreuzfahrer ins Heilige Land zieht und nach Jahren zurückkehrt. Seine Erfahrungen prägen ihn und seine Familie.
Affra Meister Handwerkerin und Herz der Werkstatt. Sie hält die Familie und die Halle zusammen und ist für ihre Tatkraft und Klugheit bekannt.
Ulrych Meister Affras Sohn, Händler und Gießer. Er übernimmt Verantwortung für die Werkstatt und sucht seinen eigenen Weg zwischen Tradition und Wandel.
KylionSohn von Katerina und Anthenius, Chronist und Priester. Er beobachtet, schreibt und sucht nach Wahrheit und Versöhnung.
Mathilde Hantz’ Frau, bekannt für ihren Ehrgeiz und ihre Liebe zum Glanz. Sie bringt neue Ideen und Herausforderungen in die Familie.
Constanze Königkrämer Kaufmännisch begabte Frau, die als Händlerin und Planerin die Werkstatt unterstützt und neue Handelswege erschließt.
Gerbold Erfahrener Gießer, Mentor und Vaterfigur. Er steht für handwerkliche Tradition und Beständigkeit.
Anna Jorgens Mutter, kluge und praktische Frau, die das Leben auf dem Hof organisiert.
Mechthild Jorgens Schwester, bekannt für ihre Fröhlichkeit und ihr Gespür für Familie.
Hantz Ulrychs Sohn, künstlerisch begabt, mit einer Vorliebe für Figuren und Bildhauerei.
Hellwina Jorgens Frau, bodenständig und herzlich, hält den Hof und die Familie zusammen.
Siegfried Erzbischof von Mainz, ein Mann von Prinzipien, der die Stadt durch schwierige Zeiten führt.
Der Namenlose Prediger Wandernder Geistlicher, der mit seinen Worten und Taten die Menschen bewegt.
Marie d’Aragnon Eine junge Frau aus Burgund, die als Gast nach Mainz kommt und neue Impulse in die Gemeinschaft bringt.
Orte
Mainz Große Stadt am Rhein, Handelszentrum und Schauplatz der Handlung. Hier treffen Handwerk, Glauben und Politik aufeinander.
Dom zu Mainz Das bedeutende Bauwerk der Stadt, Zentrum für Glauben, Macht und Gemeinschaft. Die Bronzetüren sind ein Symbol für die Stadt.
Brachtal Landgut und Hof der Familie von Jorgen, gelegen außerhalb von Mainz. Ort für Arbeit, Rückzug und familiäre Tradition.
Werkstatt der Meister Die Gießerei und Schmiede, in der Affra, Ulrych und ihre Familie arbeiten. Zentrum für Handwerk und Innovation.
Haus am Fluss Wohnhaus von Katerina und ihrer Familie, ruhig gelegen mit Blick auf den Rhein.
St. Alban Kloster und Kirche in Mainz, Ort für Gebet, Wissen und Austausch.
Köln, Andernach, Worms, Speyer, Trier, Metz, Utrecht, Bingen, Koblenz Wichtige Städte im Umfeld von Mainz, mit denen die Werkstatt Handel betreibt.
Begriffe
Kreuzfahrer Pilger und Krieger, die ins Heilige Land ziehen, um an den Kreuzzügen teilzunehmen.
Bronzetüren Kunstvoll gefertigte Türen des Mainzer Doms, Symbol für Beständigkeit, Arbeit und Gemeinschaft.
Handwerk Die Arbeit mit Metall, Holz und anderen Materialien, zentrale Lebensgrundlage der Figuren.
Gießer / Meister Handwerker, die Bronze und andere Metalle verarbeiten und als „Meister“ Anerkennung und Verantwortung tragen.
Ring, Riegel, Scharnier Handwerkliche Produkte der Werkstatt, oft auch als Metapher für Verbindung, Schutz und Übergang verwendet.
Feuer / Brand Gefahr und Prüfstein für die Gemeinschaft, Symbol für Wandel und Bewährung.
Schuld / Buße Zentrale Themen im Roman, die das Leben und die Entscheidungen der Figuren prägen.
Vers / Chronik Die schriftliche Aufzeichnung von Ereignissen, Meinungen und Erinnerungen – oft von Kylion geführt.
Ketten, Nägel, Beschläge Produkte der Werkstatt, wichtig für Handel und Alltag.
Predigt / Messe Religiöse Zeremonien, die das Leben der Stadt und ihrer Menschen strukturieren.
Krönung Feierliche Zeremonie, bei der Könige und Königinnen in Mainz gekrönt werden.
Handelswege Routen und Beziehungen, über die Waren und Nachrichten zwischen Städten ausgetauscht werden.
Sechstes Kapitel: Brachtal
Der Tag, an dem man Willigis zu Grabe trug, war klar und kalt. Ein Hauch von Eis lag auf dem Wasser, das in den Rinnen stand, und die Krähen saßen in den kahlen Wipfeln, als hätten sie in den Bäumen Plätze gekauft. Die Stadt bewegte sich gedämpft, nicht aus Angst, sondern aus jenem Respekt, der nichts mit Ehrfurcht und viel mit Gewohnheit hat: Man hatte sich daran gewöhnt, dass der Mann mit der schmalen Geduld und dem harten Willen da war, und die Gewohnheit fehlt, wenn sie stirbt, wie eine Stufe fehlt, auf der man immer aufsetzt.
Bardo, dessen Name schon vor dem Brand wie ein Vers in die Sätze der Werkleute gefallen war, stand neben der Bahre. Er trug keine Pracht. Er trug sein Gesicht, das ernster geworden war, seit er die Stadt durchs Feuer geführt hatte. Männer, die den Ton der Türen noch im Ohr hatten, trugen den Sarg, und Frauen, die Eimer getragen hatten, standen an den Rändern und hielten ihre Hände, damit sie nicht wieder nach Arbeit griffen. Der Namenlose Prediger war da, schmal im schwarzen Gewand, die Kapuze im Nacken, die Lippen trocken. Er sprach nicht. Nicht, weil ihm die Worte ausgegangen wären. Weil die Stadt voll davon war.
Katerina stand am Rand, nicht vorn, nicht ganz hinten. Anthenius neben ihr. Lynhardt hielt die Hand an ihrem Mantel, der ihm zu schwer vorkam für den Tag. Willigis’ Gesicht war bedeckt. Man sah nur die Hände, auf denen die langen Finger ruhten, die so viele Pergamente gehalten, so viele Siegel gebrochen und so selten gestreichelt hatten. Als die Glocke sich senkte, gab es einen Ton, der durch die Brust fuhr wie kalte Luft. Manche sagten später, sie hätten in diesem Ton die Türen gehört. Manche sagten, sie hätten nur die Glocke gehört. Beides war wahr.
Die Tage danach waren Tage, an denen Ordnung gesucht wurde. In Rom schrieb man auf Latein, was man auf Deutsch längst wusste: dass Mainz einen Mann brauchte, der den Stuhl hielt. Erkanbald kam – kein Freund, kein Feind, ein Amt. Er ging durch die Räume, die noch den Atem des Toten trugen, und seine Blicke waren die eines, der Möbel rückt. Er nahm die Briefe in die Hand, legte sie ab, nicht aus Missachtung, sondern aus jener Kühle, die sich einstellt, wenn man an einen Tisch gesetzt wird, an dem der Stuhl des Vorgängers noch warm ist.
Katerina merkte die Verschiebung, bevor ihr jemand die Tür abwies. Die Männer, die sie in den Gassen gegrüßt hatten, grüßten weiterhin – aber mit jenem Tonfall, der das eigene Gesicht als Maske benutzt. Ein Schreiber, der ihr bislang die Wachstafeln aus Willigis’ Kammer gebracht hatte, trug sie nun in den Ärmeln und ging schneller. Der Notarius kam dennoch. Er kam nicht mehr oft. Aber er kam mit einem Stück Pergament, das nicht die Wärme eines Handbriefs trug und dennoch mehr wog als manches Wort.
„Brachtal“, sagte er, kaum dass er die Tür hinter sich geschlossen hatte. „Es steht. Nicht nur als Strich. Als Eintrag.“
Er rollte das Pergament aus. Die Linien waren einfach: ein Bach, der nach Westen lief, ein Hügel, der sich darüber legte, ein Stück Wald, der nicht den Herren gehörte, sondern dem, der ihn pflegte. Ein Rechteck für den Hof. Eine Markierung für einen Brunnen. In den Ecken die Zeichen derer, die zu bestätigen hatten, dass Land nicht nur auf Papier existierte. Am Rand die kleine, bockige Hand des Notars: Lynhardt.
Katerina fuhr mit der Handfläche über die Kante, als prüfe sie, ob das Papier atmete. „Und er?“ fragte sie, ohne den Namen auszusprechen.
„Er hat getan, was er konnte, bevor er ging“, sagte der Notarius schlicht. „Es wird nicht widerrufen. Nicht durch Neid. Nicht durch neue Gewohnheiten.“
Sie nickte. Ihr Blick ging darüber hinweg in einen Raum, der nicht in diesem Haus lag: eine Aue, die im Frühjahr etwas anderes trug als Fußspuren, ein Pfad, den der Wind nicht ausradiert.
Noch in derselben Woche ritt Lynhardt hinaus. Nicht in Ritterpracht – die war neu und wartete auf Anlässe –, sondern in einem Wams, das Anna ihm enger gemacht hatte, damit der Wind nicht darin wohnte. Gerbold gab ihm einen kleinen, festen Hammer mit, den man fürs Hufeisen und für den Nagel gebrauchen konnte. „Es gibt keine Türen ohne Nägel“, sagte er. „Es gibt keine Häuser ohne Hufe.“ Affra stand daneben und steckte ihm ein Tuch in den Gürtel. „Für den Regen“, sagte sie. „Und falls du mit jemandem reden musst, der nicht sprechen will.“ Er lachte, und Katerina sah ihn reiten, als sähe sie den Rücken eines Mannes, der größer war als der Junge, den sie auf den Armen getragen hatte.
Brachtal stellte sich anders heraus, als das Pergament es vermocht hatte zu zeigen. Der Bach machte im Tal einen Haken, als habe er sich einmal an einem Stein gestoßen und beschlossen, diesen Stoß zu erinnern. Ein alter, halb eingestürzter Schuppen stand neben der Stelle, wo man einen Hof stellen konnte, und ein Mann mit einem Gesicht wie Rinde kam aus dem Schatten. „Ich bin Hans“, sagte er. „Ich hab immer gemacht, was man mir sagte. Nun sagt’s mir einer neuer. Gut. Sagt’s.“
Lynhardt stieg ab und trat auf das Land, als gehöre es ihm seit Jahren. „Wir bauen“, sagte er. „Nicht groß. Gerade so, dass es steht. Und dass man im Winter das Dach nicht hereintragen muss.“
Hans nickte, als habe er genau diesen Satz hören wollen. „Holz haben wir. Stein holen wir. Wasser kommt von selbst.“ Er spuckte in die Hand, die trotz der Kälte nicht ganz kalt wurde, und reichte sie. Lynhardt schlug ein. Der Hammer in seinem Gürtel fühlte sich plötzlich nicht mehr nach Geschenk an, sondern nach Gewicht.
Katerina kam ein paar Tage später. Anthenius ritt neben ihr. Sie saß im Sattel, als sei sie nie etwas anderes geritten als einen Plan. Als sie das Tal erreichte, roch sie nasses Heu, kalte Erde, den ersten Schimmel eines Winters, der nicht recht hatte zu bleiben. Sie stand an der Stelle, wo der Brunnen sein sollte, und legte die Hand auf den Boden. „Da“, sagte sie. „Da hört er auf zu reden und fängt an zu geben.“
„Du hörst gut“, sagte Anthenius.
„Ich musste gut hören“, entgegnete sie, nicht bitter. „Sonst hätte ich Worte verwechseln können.“
Sie blieb zwei Nächte. Sie trug Holz, weil Hände schneller trösten, wenn sie Arbeit halten. Sie kochte Suppe mit der Art von Ruhe, die Männer anzieht, die einen Hof aufrichten. Sie schlief schlecht, weil sie in der Ferne die Stadt hörte, die sie liebte. Am Morgen des dritten Tages stand sie mit Anthenius am Bach. Das Wasser war klar. Es sagte nicht viel.
„Heirate mich“, sagte Anthenius, so schlicht, dass der Bach kaum ein Echo fand.
Sie sah ihn an. Sie hätte ja und nein zugleich sagen können, und beides wäre richtig gewesen. „Ja“, sagte sie. „Aber nicht für den Hof. Für den Tisch.“
Er lächelte, und in dem Lächeln lag weder Triumph noch Rührung. Es lag das Einverständnis eines Mannes, der nicht mehr beweisen musste, dass er bleiben konnte. „Für den Tisch“, wiederholte er.
Sie ritten zurück. In Mainz banden sie den Knoten vor dem Tisch, der schon einmal ein Knoten gesehen hatte. Margret brachte Brot. Der Notarius brachte nichts und alles: die Erlaubnis, es ohne Pergament gut sein zu lassen. Der Namenlose Prediger stand in der Gasse und beobachtete, wie zwei Menschen taten, was sie wollten, ohne zu fragen, ob man es ihnen gönnte. „Es gibt Gelübde, die Gott lieber hört als unsere“, murmelte er, und niemand widersprach ihm.
In der Halle arbeitete Gerbold an dem Taufbecken, das Bardo schließlich in der Kapelle aufstellte. Er hatte die Kante so lange mit den Fingern geprüft, bis sie keine Sprache mehr hatte, die schneiden konnte. Als er das Becken hinsetzte, lag eine Stille über dem Raum, die nicht von der Kälte kam. „Wasser“, sagte Bardo. „Mehr als genug.“
Gerbold fühlte den Blick Berengers im Rücken. Es war kein prüfender. Es war einer, der weiterreichte als bis zum Rand des Beckens. „Du öffnest“, sagte der Meister. „Mehr wird man von dir verlangen, als du zu geben glaubst. Gib, was du nicht sparen willst.“
„Ich habe gelernt, zu tragen“, sagte Gerbold. „Ich kann noch lernen, zu geben.“
Affra stand so nah, dass er die Wärme ihrer Schulter durch den Stoff spürte. Sie hob die Hand, als wolle sie ihm übers Haar streichen, ließ sie aber sinken. Nicht aus Scham. Aus Geduld. „Später“, sagte ihr Blick, und er verstand ihn.
Die Wochen glitten, und der Wind drehte langsam. Erkanbald hatte einen Stil, der weniger die Stadt erhitzte als beruhigte. Er war nicht Willigis. Das genügte manchen, ihn als Redlichen zu bezeichnen. Es ärgerte andere, die einen Mann bevorzugten, dessen Hände heiß waren. Bardo arbeitete weiter wie einer, der nicht jedes Gespräch als Schlacht sieht. Der Prediger sprach seltener, aber wenn, dann klang es nicht mehr nach Donner, sondern nach Frost: scharf, klar, nicht tötend.
In den Ecken der Stadt begannen Händler von Speyer zu reden, als sei es ein Baum, der die Sonne nehmen wolle. „Sie bauen dort“, hieß es. „Sie bauen höher, länger, sauberer. Ihr werdet sehen.“ Willigis hätte gelacht, wenn er noch genug Atem gehabt hätte. Bardo lächelte. „Bauen ist gut“, sagte er. „Konkurrieren ist dumm, wenn Gott der Hausvater ist.“
Die Nachricht, die den Winter in ein anderes Licht setzte, kam im Februar eines Jahres, das man rasch notierte und wieder vergaß: Der König erwäge, sich in Mainz krönen zu lassen. Noch sei der große Dom nicht bereit. Aber Williges’ Stuhl lebe, wenn Männer ihn hielten. Katerina hörte es und spürte, wie sich etwas in ihr spannte wie ein Faden zwischen zwei Nägeln: der eine in einem Traum, der andere in einer Gegenwart, die sich nicht beugen wollte.
Der Frühling schob sich in die Adern der Stadt, ohne um Erlaubnis zu bitten. Brachtal wurde ein Hof, nicht groß, aber im Lot. Hans dünnte den Wald mit der sparsamsten Leidenschaft, die es gibt: der eines Mannes, der verstanden hat, dass Bäume, die fallen, denen helfen, die stehen. Lynhardt trieb erste Pfähle in den Boden, lachte, als der Hammer ihm einmal von der Schulter rutschte, fluchte, als ein Nagel sich weigerte, gerade zu gehen, und sprach den Namen der Stadt, wenn er mit dem Rücken gegen den Bretterstapel sank. „Mainz“, sagte er, und Hans nickte, als sei dieser Name ein Werkzeug.
In Mainz wuchs in diesen Wochen ein anderes Kind. Katerina bemerkte es zuerst in der Müdigkeit, die anders war als die der Arbeit. Anthenius sah es im Puls, der schneller ging, wenn er die Finger auflegte. „Ein zweiter“, sagte er, ohne die Zunge an die Zähne zu legen. Katerina lächelte, müde und stark. „Ein zweiter“, bestätigte sie. „Er wird nicht wie der erste sein. Keiner ist wie der andere.“
„Nein“, sagte Anthenius. „Und das ist gut. Sonst würde man Kinder nur zählen.“
Die Hochzeit von Affra und Gerbold fand im Hof statt, nicht in der Halle. Nicht aus Frömmigkeit. Aus Ordnung. Bardo stand da, legte die Hände über die ihren, sprach die Worte, die Dinge fest machen, und ließ die Stadt im Hintergrund summen. Hildegard wischte sich Tränen ab, die sie nicht für möglich gehalten hatte. Anna legte den Kopf schief und stand so, dass der Wind ihren Zopf nicht ruinierte. Der Notarius brachte ein kleines Pergament, das wenige Zeilen trug und viel Gewicht: Meister Berenger bestätige, dass Gerbold die Werkstatt teilen werde – und später tragen. Unten stand ein Wort, das manche stutzen ließ: Meister. Nicht als Titel. Als Name. „Es ist Zeit“, sagte Berenger, als er die Feder hob. „Die Welt merkt sich Namen, die sagen, was sie sind.“
„Und manchmal erinnert sich die Welt an Namen, die sagen, was sie nicht sind“, entgegnete der Prediger, der randstand und sich den Wind in die Kapuze wehen ließ. „Meister ist ein großes Wort.“
„Nicht größer als Arbeit“, sagte Affra.
Der Sommer war noch fern, als ein Reiter aus dem Westen die Stadt erreichte und die Nachricht brachte, die man als Beleg für Träume nimmt: Der neue König, Konrad, werde zum Herbst nach Mainz kommen. Er werde die Krone empfangen. Der große Dom sei noch nicht in dem Zustand, den die Pracht verlange, aber die Stadt habe Häuser, die dem Herrn genügen. Die Predigt werde ein anderer halten. Die Krönung – sie gehöre Mainz.
Bardo las den Brief und strich mit dem Daumen über das Siegel. Er dachte an Willigis, und sein Mund machte den schmalen Zug eines Mannes, der das Abwesende zu sichern versucht. „Er wollte es“, sagte er leise, und niemand musste fragen, was „es“ war. „Dann soll es so werden.“
Gerbold und Affra standen in der Halle, als Bardo spät am Abend die Tür aufstieß, einen seltenen Glanz in den Augen. „Die Türen“, sagte er. „Sie werden ihn nicht sehen, wenn er die Krone empfängt. Aber er wird sie hören, wenn er später eintritt.“ Er legte die Hand an den Rand des Flügels, und der Ton, der antwortete, war so ruhig, dass man ihn mit einem Gebet verwechseln konnte.
Im Brachtal legte Lynhardt die erste Schwelle des Hauses, das seinen Namen tragen würde, auch wenn es ihn nicht schrieb. Er hielt den Atem an, als der Balken saß. Hans, der daneben stand, nickte, ohne Worte zu verschwenden. „Steht“, sagte er. Katerina, die ein paar Tage gekommen war, saß am Rand und hielt ihre Hand an den Bauch. „Steht“, wiederholte sie, als sage sie es einem Kind.
Anthenius schlug Nägel ein, obwohl er die Hände hatte, die Kräuter mischen konnten, und lachte, als einer schief stand. „Ich lerne“, sagte er.
„Das tust du“, erwiderte Hans. „Ihr alle lernt. Die Stadt lernt. Die Welt lernt immer dann, wenn niemand aufschreibt.“
In Mainz saß der Namenlose Prediger auf einer Stufe, die im Sommer warm sein würde, und ließ die Hände ruhen. Ein Kind blieb stehen und fragte, ob er wieder vom Feuer spreche. „Heute nicht“, sagte er. „Heute spreche ich von Wasser.“
„Was sagt Wasser?“, fragte das Kind.
„Es sagt: Ich laufe“, antwortete er. „Und manchmal sagt es: Ich stehe. Und manchmal sagt es gar nichts, und dann muss man die Hand hineinhalten, um zu verstehen.“
Das Kind streckte die Hand aus, als müsse es den Rhein erreichen. „So?“
„So“, sagte der Prediger. „Und dann gehst du nach Hause und isst Brot, bevor deine Mutter ruft.“
Als der Herbst kam, war die Stadt still und aufgeregt zugleich, wie ein Tier, das die Fährte des Windes versteht. Konrad zog ein, nicht mit einem Lärm, der Mauerwerk lockert, sondern mit dem Ton, der die Köpfe hebt. Die Krönung fand nicht im großen Dom statt – Bardo ließ eine andere Kirche bereiten, eine kleinere, aber nicht weniger ehrlich – und als die Krone den Kopf des Mannes berührte, murmelten in den Gassen einige einen Namen, den sie nicht aussprachen. Nicht Konrad. Willigis.
Bardo stand im Chor, sprach klar, ruhig, als sei er nicht der Dritte in einer Reihe, die anders begonnen hatte. Draußen, vor der Westfront, legten Menschen die Hände an die Türen, die nicht an ihrem Platz hingen, und lauschten. Die Bronze sang. Es war ein Ton, der nicht prahlte. Er sagte: Hier. Und: Noch.
Katerina stand mit Lynhardt am Rand einer Menge, die sich nicht drängte, weil ihre Freude Platz hatte. Anthenius neben ihr. Sie legte die Hand auf den Bauch. Das Kind in ihr bewegte sich, als höre es einen Ton, der seinen Namen noch nicht kannte. „Kylion“, sagte sie leise, und der Wind nahm das Wort, ohne es loszulassen.
Gerbold hielt Affra an der Hand, unauffällig, wie Leute Hände halten, die viel zu tun haben. „Er hat es bekommen“, sagte er.
„Und wir haben unsere Arbeit“, entgegnete sie. „Morgen.“
„Morgen“, wiederholte er und dachte an den Bolzen, an das Becken, an den ersten Schlag eines Hammers auf eine Kante, die nicht schneiden durfte. Er dachte an Brachtal, an das Haus, an das Wasser. Er dachte an eine Stadt, die ihre Türen noch einmal anheben würde, wenn es sein musste, und an einen Namen, der in ihr weiterging, obwohl der Mann, der ihn groß gemacht hatte, längst unter der Erde lag.
Die Nacht nach der Krönung roch nach Wein, nach Fett, nach Feuer, das diesmal dort brannte, wo es sollte. Der Prediger stand am Rand und schwieg. Die Bronze war still. Aber wer die Hand aufgelegt hätte, hätte den Ton gefühlt. Wie einen Herzschlag. Wie ein Versprechen. Wie Brachtal. Wie eine Tür, die wartet. Auf Hände. Auf Schritte. Auf Jahre. Auf die zweite Sonne, die noch weit war und doch schon einen Schatten warf, den nur die Geduld sah.