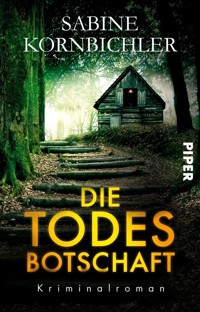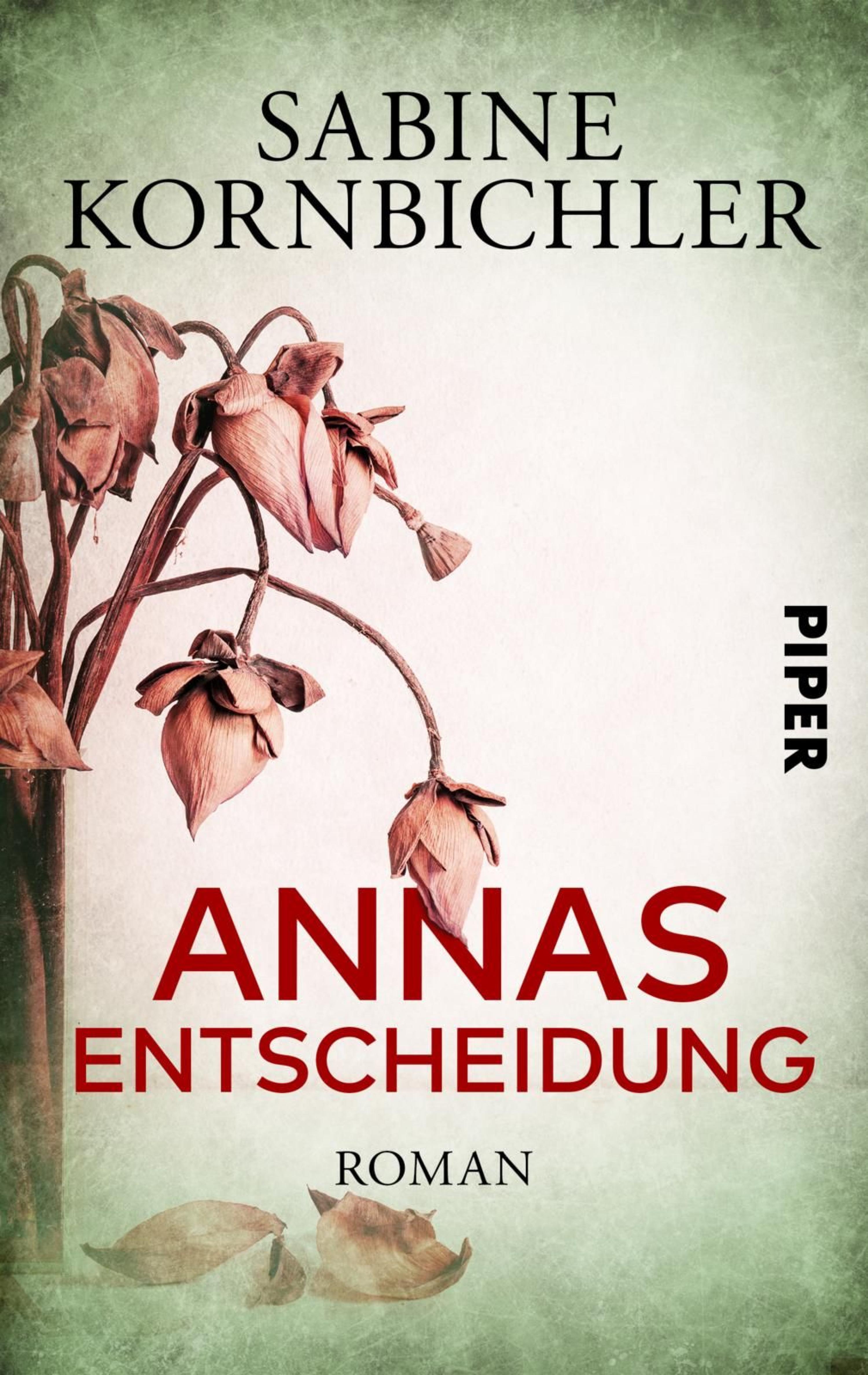
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein psychologisch raffinierter, nachdenklich machender Roman von Bestseller-Autorin Sabine KornbichlerNach dem Unfalltod ihrer geliebten Eltern ist Anna völlig am Boden zerstört - und stürzt sich Hals über Kopf in eine Beziehung mit dem Mediziner Steffen, der sich liebevoll um sie kümmert. Sie könnte wieder Geschmack am Leben finden, wäre da nicht Thea, Steffens Mutter, die sich als ewiges Opfer fühlt und von ihrem Sohn ständige Zuwendung fordert. Ehe sie sich versieht, wird auch Anna zur Zielscheibe des Giftes, mit dem Thea ihre Umgebung lähmt. Doch da ist auch noch Ruppert, der ihr mit seinen lebensklugen Ratschlägen immer wieder den Spiegel vorhält und Anna neuen Lebensmut gibt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
1 – Was willst du …
2 – Wie fasst man …
3 – Was ich lange …
4 – Vier Tage später …
5 – »Hast du ihn …
6 – In den darauffolgenden …
7 – Was ich kaum …
8 – Es kam, wie …
9 – Obwohl wir lange …
10 – Mein Ausflug hatte …
11 – In den nächsten …
12 – In dieser Nacht …
13 – Im Büro erwartete …
14 – Und so erzählte …
15 – Das Wochenende entließ …
16 – Die Unterhaltung mit …
17 – Dieses Wort tat …
18 – Es gab keine …
19 – Nachdem ich an …
Über die Autorin
1 – Was willst du …
Was willst du mehr?, hätte sie mich mit leisem Tadel gefragt. Sitzt an einem wunderschönen Sommertag auf einer Bank und blickst auf ein Bergpanorama, das einem das Herz höherschlagen lässt. Im Geist hörte ich die Stimme meiner Mutter, als stünde sie neben mir. Sie hätte tatsächlich nicht mehr gewollt, sie war ein Mensch gewesen, der akzeptierte, was nicht zu ändern war. Ich aber wollte die Zeit zurückdrehen und alles ungeschehen machen. So sinnlos dieser Gedanke auch schien, er war tausendmal besser als die Bilder, die mich seit jenem Tag im Mai verfolgten. Sie hatten von mir Besitz ergriffen und hielten mich ständig in ihrem Bann. Sie ließen keinen Raum für etwas anderes als dieses maßlose Entsetzen.
Ich will, dass das aufhört. Sofort!, antwortete ich meiner Mutter im Stillen und starrte auf die Berge, die sie so sehr geliebt hatte und für deren Schönheit ich blind geworden war. Weder der strahlend blaue Himmel noch die Wärme der Sonne auf meiner Haut konnten meine innere Starre auflösen. Würde es jemals etwas geben, das stärker war als die Bilder meiner Fantasie, etwas, das sie verdrängte und mich aus dieser Folterkammer befreite?
Wenn es etwas gab, so würde ich es hier jedoch nicht finden, das spürte ich ganz deutlich. Schwerfällig erhob ich mich von der Bank und setzte meine Wanderung fort. Ich war noch nicht weit gegangen, als ich merkte, dass ich meine Zigaretten auf der Bank hatte liegen lassen. Wäre ich nicht noch einmal umgekehrt und dabei auf einem Stein abgerutscht, der verdeckt im Gras lag, wäre ich Steffen wahrscheinlich nie begegnet.
»Au!«, schrie ich, als ein stechender Schmerz durch meinen linken Knöchel fuhr und mich in die Knie zwang. Ich ließ mich ins Gras fallen, zog meinen Schuh aus und massierte das schmerzende Gelenk. Gerade wollte ich aufstehen, um zu testen, ob ich auftreten konnte, als ich neben mir die Stimme eines Mannes hörte.
»Nein, nicht bewegen!«
»Wie bitte?« Über meine Schulter hinweg sah ich in hellbraune Augen unter einer tief in die Stirn gezogenen dunkelblauen Schirmmütze.
»Ich möchte mir das erst einmal anschauen, wenn Sie nichts dagegen haben.« Er kniete sich neben mich.
»Und wenn ich etwas dagegen habe? Mein Knöchel ist schließlich kein Ausstellungsstück.« Ich sah ihn abweisend an.
»Ich bin Arzt.«
»Das mag sein, aber ich habe Sie nicht gerufen. Oder läuft Ihre Praxis so schlecht, dass Sie sich auf diese Weise Patienten beschaffen müssen?«
Er hatte seine Hände schon nach meinem Fuß ausgestreckt, zog sie jedoch blitzschnell wieder zurück, als hätte er sie sich auf dem Weg dorthin verbrannt. »Entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.«
»Nein, ich muss mich entschuldigen«, lenkte ich halbherzig ein, als ich seinen zerknirschten Gesichtsausdruck sah. »Sie haben mich nur gerade auf dem falschen Fuß erwischt.«
»Auf dem umgeknickten«, meinte er lächelnd, während er sich auf seine Unterschenkel setzte. »Steffen Wolf.« Seine Hand streckte sich mir versöhnlich entgegen.
»Anna Laudien.«
»Darf ich jetzt Ihren Knöchel untersuchen?«
»Wenn Sie dann heute Nacht besser schlafen.«
»Eigentlich geht es mir darum, dass Sie heute Nacht gut schlafen«, entgegnete er ernst und begann vorsichtig, meinen Fuß abzutasten und in alle Richtungen zu drehen.
»Um das zu erreichen, müssten Sie ein Wunderheiler sein.« Wenn ich an die Nächte der vergangenen Wochen dachte, konnte ich mich ausschließlich an Albträume erinnern.
»Geben Sie mir eine Chance«, sagte er sanft.
»Warum sollte ich?«
»Weil …« Er sah mich forschend an und stockte sekundenlang. »Weil Traurigkeit lähmt – weit schlimmer als ein verstauchter Knöchel.«
Es war nicht Traurigkeit, die mich lähmte, aber wie sollte er das wissen? »Sprechen Sie aus Erfahrung?«, fragte ich mit leisem Spott, den er jedoch nicht zu bemerken schien.
»Schon vergessen? Ich bin Arzt.«
Mein Blick verfing sich in seinem, der ebenso viel Wärme ausstrahlte wie seine Hände, die meinen Fuß nach wie vor umfangen hielten. »Und ich hätte meinen Fuß jetzt gerne wieder.«
»Oh, Entschuldigung, natürlich.« Im Aufstehen reichte er mir seine Hand und zog mich hoch. »Was halten Sie davon, wenn ich Sie bei einer Tasse Tee über die möglichen Spätschäden von verstauchten Knöcheln aufkläre?«, fragte Steffen Wolf mit einem ebenso schiefen wie hoffnungsvollen Lächeln.
»Nichts«, antwortete ich ehrlich und erntete einen enttäuschten Blick, der sich bei meinem nächsten Satz jedoch in einen freudigen wandelte. »Aber gegen einen Kaffee hätte ich nichts einzuwenden. Ich hole nur schnell meine Zigaretten von der Bank dort drüben, bin gleich zurück.« Ich zog meinen Schuh an und trat vorsichtig auf. Mein Knöchel tat bei jedem Schritt weh, sodass mein Gang in ein Humpeln ausartete.
»Sie müssen Ihren Fuß später unbedingt kühlen«, rief er mir hinterher.
Seine Fürsorge tat mir gut. Zum ersten Mal seit Wochen entspannten sich meine Mundwinkel für einen wohltuenden Moment. Ich verstaute die Zigaretten in meinem Rucksack und ging zu ihm zurück. »Wohin wollen wir gehen?«
»Das Café Krugalm ist gleich da vorn, dort habe ich auch meinen Wagen abgestellt.«
»Ja … okay.« In dem Café, auf halbem Weg zwischen Bayrischzell und Schliersee gelegen, hatten meine Eltern auf ihren Wanderungen oft eine Pause eingelegt. Vor einem Jahr hatte ich sie zuletzt auf einem dieser Ausflüge begleitet.
Wir hatten Glück und bekamen draußen noch einen Platz im Schatten einer Linde. Steffen Wolf nahm die Schirmmütze ab und strich sich durch seine dunkelblonden Haare, die sich jedoch durch die Richtung, die er ihnen damit vorschreiben wollte, nicht beeinflussen ließen. Sie fielen ihm sofort in die Stirn. Während er versuchte, die Aufmerksamkeit der Kellnerin zu erlangen, betrachtete ich ihn etwas genauer. Er hatte ein schmales, fein geschnittenes Gesicht mit einem sehr sensiblen Mund. Im Vergleich zu den gebräunten Gesichtern an den Nachbartischen sah seines eher blass aus. Er trug ein weinrotes Polohemd zu dunkelblauen Bermudas und zählte offensichtlich zu jenen Menschen, die nicht leicht schwitzen. Trotz der siebenundzwanzig Grad im Schatten wirkte alles an ihm frisch.
»Machen Sie Urlaub hier?«, begann ich das Gespräch, nachdem die Kellnerin unsere Bestellung aufgenommen hatte.
»Halb und halb, ich war auf einem Kongress in Schliersee und hänge jetzt noch in Geitau das Wochenende zum Ausspannen dran.«
»Hat er sich gelohnt?«
»Wer?«
»Der Kongress natürlich.«
»Ja … schon allein, weil ich Sie sonst nie kennengelernt hätte.« Er sagte es mit einer fast andächtigen Aufrichtigkeit und ohne jeden Anflug von billiger Schmeichelei.
Von kennen kann keine Rede sein, dachte ich, sagte es jedoch nicht, um ihn mit meiner Ruppigkeit nicht gleich wieder zu verschrecken.
Inzwischen hatte er seinen Tee und ich meinen Milchkaffee bekommen. Ich holte meine Zigaretten aus dem Rucksack und hielt ihm die Schachtel hin. »Rauchen Sie?«
Er schüttelte den Kopf und sah mir über seine dampfende Tasse hinweg zu, wie ich mir eine Zigarette anzündete und den Rauch tief inhalierte. »Sind Sie Kinderarzt?«
»Nein.« Meine Frage schien ihn zu amüsieren.
»Sie sind auf eine so besondere Weise fürsorglich, da dachte ich …«
»Meine Patienten sind zwar auch manchmal wie Kinder«, unterbrach er mich mit einem Lächeln, »aber weit älter. Ich bin Internist und habe mich auf Geriatrie spezialisiert.«
»Geriatrie? Das sagt mir nichts«, gab ich offen zu.
»Einigen meiner Kollegen sagt diese Ausrichtung leider auch nichts. Aber um Ihre Frage zu beantworten: Geriatrie ist Altersheilkunde.«
»Wie sind Sie denn darauf gekommen? Als Vorsorgemaßnahme zum Selbstzweck?«
Er zuckte merklich zusammen und starrte mich entgeistert an. Seine Antwort kam zögerlich: »Bei meinem Vater wurde Alzheimer diagnostiziert … er hat …«
»O mein Gott, das tut mir leid«, brachte ich stotternd heraus. Ich hätte mich ohrfeigen können. Was glaubte ich denn? Dass ich mich aus meiner Gefühlsstarre würde lösen können, indem ich anderen Schmerzen zufügte? Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken.
»Wie sollten Sie das wissen – es steht doch nicht auf meiner Stirn geschrieben.« Die Falte, die sich plötzlich zwischen seinen Augenbrauen die Stirn hinaufzog, sprach allerdings Bände.
»Trotzdem war es taktlos von mir.« Und das war noch untertrieben.
»Schon vergessen«, sagte er beschwichtigend.
Wenn sich nur alles so schnell vergessen ließe, dachte ich müde. Um es wenigstens für den Moment zu versuchen, schnitt ich ein unverfänglicheres Thema an: »Wo leben Sie?«
»In Düsseldorf, dort habe ich meine Praxis und auch meine Wurzeln.«
Ich zog fragend meine Augenbrauen in die Höhe.
»Ich bin dort geboren, aufgewachsen und habe dort studiert.«
»Muss ja eine faszinierende Stadt sein, wenn es Sie nie von dort weggezogen hat.«
»Ach, ich weiß nicht«, sagte er mit wenig Begeisterung. »Ich denke, Düsseldorf ist so faszinierend wie jede andere deutsche Großstadt auch. Es hat sich für mich nur nie ergeben, von dort wegzugehen. Aber wir reden die ganze Zeit nur von mir – was ist mit Ihnen?«
»Ich lebe in Hamburg«, gab ich ihm knapp Auskunft. Nachdem ich mir noch einen Kaffee bestellt hatte, zündete ich mir eine weitere Zigarette an.
»Wenn Sie das noch ein paar Jahre machen, sterben Sie, lange bevor Sie ein Fall für einen Geriater werden könnten.«
»So mörderisch ist Hamburg nun wirklich nicht«, entgegnete ich, obwohl ich genau wusste, worauf er anspielte. »Außerdem töten uns meist die unvorhersehbaren Dinge.«
»Diese Ansicht ist nicht gerade altersgemäß, Sie …«
»Der Tod ist auch nicht immer altersgemäß«, unterbrach ich ihn vehement, zog kräftig an meiner Zigarette und gab mir Mühe, meine Gedanken in andere Bahnen zu lenken. »Wie alt sind Sie eigentlich, Herr Geriater?«
»Vierzig. Und falls es Sie interessiert«, fuhr er leise fort, »ich habe keine Kinder und bin weder verheiratet noch liiert.«
»Möchten Sie gerne, dass mich das interessiert?« So, wie ich mich ihm gegenüber gab, konnte ich mich selbst nicht ausstehen. Ich hatte jedoch so viel Wut in mir, dass ich sehnsüchtig nach einem Opfer suchte, an dem ich sie auslassen konnte.
Er stützte sein Gesicht in die Hände und sah mich ruhig an. »Ich glaube schon.«
»Warum?«, fragte ich verwundert. Er kannte mich so gut wie nicht, wirkte jedoch auch nicht wie ein geübter Aufreißer.
»Ein vages Gefühl von Seelenverwandtschaft.«
Da ich nicht bereit war, nach einer Stunde von Seelenverwandtschaft zu reden, versuchte ich, dem Ernst in seinen Augen mit leisem Spott zu begegnen. »Und meine aparte Erscheinung beeindruckt Sie gar nicht?«
»Soll ich ehrlich sein?«
»Nur zu! Ich bin erst vierunddreißig, also durchaus noch in einem Alter, in dem ich Ehrlichkeit vertrage.«
»Ich mag es lieber, wenn Frauen ein wenig weiblicher sind.«
Mit diesen Worten hatte er mich völlig überrumpelt. Zwar war ich mit einem Körper, der in Anbetracht seiner Maße inzwischen durchaus für eine Margarine-Werbung herhalten konnte, sicher nicht der Prototyp der Weiblichkeit. Aber mit meinen schulterlangen blonden Haaren, einem ebenmäßigen Gesicht und tiefdunkelblauen Augen machte ich dieses Manko wieder wett. Jedenfalls hatte ich das bisher angenommen. »Was, in Gottes Namen, ist an mir unweiblich?«, brachte ich schließlich heraus.
»So habe ich das nicht gemeint«, machte er schnell einen Rückzieher. »Sie sehen nur sehr dünn aus und …« Jetzt blieben ihm die Worte im Hals stecken.
So gab ich mir selbst die Antwort: »Und Sie bevorzugen ein wenig üppigere Formen.« Obwohl er selbst asketisch schlank wirkte. Was Polohemd und Bermudas von seinem Körper preisgaben, sah nach Knochen und Muskeln, aber nur wenig Fettpolstern aus.
Sein Ja kam einem Stoßseufzer sehr nahe. »Damit Sie aber keine falschen Schlüsse ziehen: Ich bin nicht auf der Suche nach einer Ersatzmutter«, sagte er mit Nachdruck.
»Wonach suchen Sie dann?« Kaum war die Frage heraus, musste ich an ein Sprichwort denken: Wer mit dem Feuer spielt, kommt darin um. Steffen Wolf wirkte jedoch weder gefährlich noch feurig. Er war einfach nur ein unglaublich sympathischer Mann, der zumindest in diesem Moment nicht zum Scherzen aufgelegt war.
»Ich suche nach einer warmherzigen, liebenswerten Frau …«
»… mit üppigen Formen«, sagte ich mit einer Mimik, die die Bitte um Entschuldigung bereits einschloss.
Er nickte, während sein Blick den meinen nicht losließ.
»Warum sitzen Sie dann hier mit mir?«
»Schon einmal etwas vom Prinzip Hoffnung gehört?«
Ich beugte mich vor und drosselte die Lautstärke meiner Stimme. »Hoffen Sie auf einen Hormonschub, der meine Körbchengröße um drei Nummern in die Höhe schießen lässt?«
»Nein«, erwiderte er völlig unbeeindruckt. »Ich hoffe auf meine beruhigende Ausstrahlung. Als Kind habe ich reihenweise Igel gezähmt.«
»Sie denken dabei doch hoffentlich ausschließlich an die Stacheln und nicht an die kurzen Beine«, konterte ich mit einem drohenden Unterton.
»Was ich denke, verrate ich Ihnen beim Abendessen. Abgemacht?«, fragte er ohne Umschweife.
Einen Moment blieb ich stumm. Das Letzte, wonach mir im Augenblick der Sinn stand, waren Männerbekanntschaften. Aber Steffen Wolf war anders als alle Männer, die ich bisher kennengelernt hatte – jedenfalls soweit ich es nach dieser knappen Stunde überhaupt beurteilen konnte. Es war schwer, sich seiner Wärme und Fürsorge zu entziehen. Und noch etwas kam hinzu: Ich würde den Abend nicht allein in der Ferienwohnung meiner Eltern verbringen müssen.
»Ja«, sagte ich schließlich mit einiger Verzögerung, was seine offensichtliche Freude jedoch nicht zu trüben vermochte.
Nachdem wir gezahlt hatten, bot er mir an, mich zurück nach Bayrischzell, dem Ausgangspunkt meiner Wanderung, zu fahren, was ich in Anbetracht meines schmerzenden Knöchels gerne annahm. Für den Abend verabredeten wir uns in einem Gasthof in Geitau. Und dies auch erst, nachdem ich ihm mehrfach versichert hatte, dass mein Auto Automatik habe und mein Knöchel somit geschont bliebe.
Als ich die Wohnung meiner Eltern aufschloss, blieben mir noch drei Stunden bis zum Abendessen. Anstatt endlich mit Packen, dem eigentlichen Sinn meiner Reise, zu beginnen, verkroch ich mich auf die Eckbank in der Küche. Die Stille, die mich dort umfing, wurde nur durch das leise Ticken der Wanduhr durchbrochen. Ich lehnte meinen Kopf gegen die kühle Wand. Es war Wochen her, dass meine Eltern zuletzt durch diese Räume gegangen waren, trotzdem schien die gesamte Atmosphäre noch von ihrer Gegenwart erfüllt zu sein. Was ich hier tun musste, kam mir vor wie ein unverzeihlicher Eingriff, wie die unwiderrufliche Demontage eines schönen Traums.
Worauf mein Blick auch fiel, ob auf das Wandregal mit den bemalten Tellern oder die selbst genähten und bestickten Kissen auf der Holzbank – jeder Gegenstand hatte meinen Eltern ihren Lebensabend verschönern sollen. Hier, wo sie so viele glückliche Urlaubstage verlebt und sogar Freunde gefunden hatten, hatten sie als Rentner für immer bleiben wollen. Dafür hatten sie jeden einzelnen Pfennig umgedreht und gespart, was immer sich erübrigen ließ. Völlig vergebens. Diese beiden Worte saßen wie ein Kloß in meinem Hals. Warum löste er sich nicht endlich in Tränen auf?
Humpelnd ging ich Richtung Wohnzimmer und blieb im Türrahmen stehen. Ich hatte bereits die Hamburger Wohnung meiner Eltern ausgeräumt, hatte jede Schublade, jeden Schrank geöffnet und nur Leere zurückgelassen. An die Schmerzen hatte ich mich jedoch nicht gewöhnen können. Wie gerne wäre ich geflohen, hätte alles unberührt gelassen und die Tür hinter mir zugeschlagen. Wie gerne wäre ich irgendwann zurückgekehrt, um alles unverändert vorzufinden, wie auf einem Schnappschuss, der die Zeit anhält.
Aber die Realität sah anders aus. Bis Montag musste ich alle persönlichen Dinge aus dem Apartment räumen, da der von mir beauftragte Makler ernsthafte Interessenten gefunden hatte, die es möbliert und unrenoviert kaufen wollten. Und es gab niemanden, der mir dabei helfen konnte. Mein Bruder Ralph hatte sofort nach der Trauerfeier wieder zurück nach Singapur fliegen müssen. Man hatte ihm in seiner Bank nicht länger freigegeben. Ich hätte Freunde meiner Eltern um Hilfe bitten können, aber das wollte ich nicht. So stand ich allein vor dem Berg, den zwei Menschen hinterlassen, wenn sie plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen werden. Plötzlich und unerwartet – voller Bitterkeit dachte ich über diese Redewendung nach. Auf meine Eltern traf sie tatsächlich zu. Wie oft hatte ich sie dagegen schon in Todesanzeigen von über Neunzigjährigen gelesen und mich darüber gewundert. Was erwarteten diese Menschen? Ein ewiges Leben? Meinen Eltern hätte ein Lebensabend genügt.
Zögerlich sah ich mich im Wohnzimmer um, das eher die Bezeichnung bäuerliche Stube verdient hätte. Auch hier bestand alles aus Holz. Bis auf die Vitrine, hinter deren Glas das Lieblingsgeschirr meiner Mutter stand. Sie hatte es nur zu ganz besonderen Gelegenheiten herausgeholt und es ausschließlich mit der Hand abgespült. Mir war immer verborgen geblieben, was sie darin gesehen hatte. In meinen Augen war das Blümchenmuster ein bisschen spießig, in ihren hatte es einen freudigen Glanz hinterlassen. Genauso wie die kleine Sammlung aus Porzellanhunden, die meine Eltern über Jahre hinweg zusammengetragen hatten. Oder die zahllosen Häkeldeckchen, die die Holzflächen vor Kratzern schützten.
Ich ging hinüber zu einer Kommode und zog die oberste Schublade heraus. Hier fand ich all das, was ich in ihrer Hamburger Wohnung vermisst hatte: die Fotoalben, die mit liebevoller Akribie die Kindheit und Jugend von Ralph und mir dokumentierten. Darunter verborgen war ein kleiner Holzkasten mit unseren ersten Schuhen, eingeschlagen in ein Stück Stoff unser Taufkleidchen. Aus einer Plastikhülle quollen Zeichnungen, die mein Bruder und ich gemacht hatten – zum Muttertag, zu Geburtstagen, zu Weihnachten. Hier hatten meine Eltern unsere gemeinsame Vergangenheit aufbewahrt, in diese Wohnung hatten sie all die Dinge gebracht, die ihnen wichtig gewesen waren.
Ich starrte blicklos darauf. Wie in weiter Ferne spürte ich Trauer und Tränen, die Erlösung aus einer Starre, die seit jenem Tag im Mai nicht weichen wollte. Aber mir war der Weg dorthin verstellt – durch eine Wand aus den Bildern zweier verkohlter Leichen.
Ein Blick auf die Uhr zeigte mir, dass zweieinhalb Stunden vergangen waren, ohne dass ich auch nur einen einzigen der Umzugskartons, die im Flur an der Wand lehnten, zusammengebaut und gefüllt hätte. Ich hatte nichts von dem geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Eine Warnmeldung meines Computers ging mir durch den Kopf: System ist überlastet und instabil. Genauso fühlte ich mich. Während der Computer in solchen Fällen automatisch abschaltet, musste ich weiter funktionieren. Die Kartons würden sich nicht von selbst füllen.
Ralph und ich hatten ernsthaft darüber nachgedacht, die Wohnung zu behalten. Bis wir uns die Unsinnigkeit dieses Vorhabens eingestanden: Ohne die beiden würde die Wohnung auf Dauer ihre Bedeutung für uns verlieren. Ganz abgesehen davon, dass sich keiner von uns eine Ferienwohnung leisten konnte.
Mit hängenden Schultern ging ich in das kleine Gästezimmer und ließ mich dort kraftlos auf die Bettkante sinken. Ich fühlte mich zutiefst erschöpft und gleichzeitig wie unter Strom. Diese fatale Mischung ließ mich seit Wochen nicht zur Ruhe kommen. Wenn ich einschlief, dann nur, um kurz darauf wieder wie elektrisiert und mit Herzklopfen aufzuwachen. Ich, die ich immer problemlos hatte schlafen können, hatte plötzlich Angst davor. Im Wachzustand konnte ich immer noch versuchen, mich abzulenken, im Schlaf war ich den Bildern hilflos ausgeliefert.
Eine halbe Stunde vor meiner Verabredung ging ich endlich unter die Dusche und zog mich dann in Windeseile an.
Mit leichter Verspätung schloss ich schließlich die Wohnungstür hinter mir zu. Mein Fuß tat nach wie vor weh. Später würde ich ihn tatsächlich kühlen müssen, da er inzwischen leicht angeschwollen war und nur noch in einen klobig anmutenden Turnschuh passte. Darüber, dass dieses Schuhwerk nicht gerade ideal zu meinem leichten Baumwollkleid passte, sah ich gleichgültig hinweg. Es gab tatsächlich Schlimmeres.
Eine Viertelstunde zu spät machte ich mich im Gasthof Rote Wand auf die Suche nach Steffen Wolf. Ich war mir sicher, dass er bereits auf mich warten würde. Und richtig: Im Garten fand ich ihn – tief in Gedanken versunken.
»Wo sind Sie gerade?«, fragte ich.
Sein angestrengter Gesichtsausdruck verwandelte sich in einen freudigen, als er zu mir aufsah. »Weit weg bei einer Patientin, deren Fall ich auf dem Kongress mit einem Kollegen diskutiert habe.«
»Dann gehören Sie einer aussterbenden Art an«, sagte ich ohne jede Ironie, während ich mich ihm gegenübersetzte.
»Sie meinen, weil ich eine ärztliche Leistung erbringe, für die ich nicht bezahlt werde?«
Ich nickte. »Vielleicht wird man Sie eines Tages dafür heiligsprechen.«
»Das klingt nach schlechten Erfahrungen.« Er sah mich mit einem Blick an, als wollte er sich dafür entschuldigen.
»Keine Angst«, beruhigte ich ihn, »ich halte nichts von Sippenhaft.«
»Das heißt, ich habe eine Chance?«
Irritiert wich ich seinem Blick aus. In den vergangenen zwei Jahren hatte es durchaus Zeiten gegeben, in denen ich bei der Aussicht auf eine neue Liebesbeziehung Purzelbäume geschlagen hätte. Aber seit dem gewaltsamen Tod meiner Eltern war mein Fühlen in seiner Bandbreite sehr eingeschränkt. Neben Entsetzen, Wut und einem mir bis dahin völlig fremden Gefühl von Hilflosigkeit schien nichts mehr in mir einen Nährboden zu finden. Als ich noch darüber nachdachte, wie ich mein Nein möglichst freundlich verpacken könnte, kam ein Kellner an unseren Tisch, brachte die Speisekarten und enthob mich so einer Antwort.
Dankbar sah ich in die Karte, deren kulinarisches Angebot mir bis vor ein paar Wochen sicher das Wasser im Mund hätte zusammenlaufen lassen. Aber da hatte ich auch noch Hunger oder zumindest Appetit gehabt. Während Steffen Wolf sich für Schnitzel mit Bratkartoffeln entschied, bestellte ich mir einen gemischten Salat.
»So wird das nichts mit den üppigen Formen«, feixte er, nachdem der Kellner mit unserer Bestellung Richtung Küche verschwunden war.
»Ich will Ihnen ja auch keine Hoffnungen machen.« Es war eine Sache, mit ihm essen zu gehen, eine andere, daraus Komplikationen erstehen zu lassen, denen ich mich im Moment nicht gewachsen fühlte. Und er war einfach zu nett, ich wollte seine Gefühle nicht verletzen.
Wenn ihn meine Antwort enttäuscht hatte, so ließ er es sich nicht anmerken. Von seinem Gesicht wanderte mein Blick über sein hellblaues Baumwollhemd hinunter zu seinen Händen. Erstaunt bemerkte ich, dass er zu jenen Menschen gehörte, die bis ins Erwachsenenalter hinein ihre Fingernägel malträtieren.
»Eine dumme Angewohnheit«, teilte er mir zur Erklärung mit. Er hatte meinen Blick bemerkt.
»Genau wie Zigaretten«, sagte ich mit einem Schulterzucken und zündete mir eine an.
»Ist es ein Mann, der Sie so traurig macht?«
»Sie sind kein Liebhaber von sanften Überleitungen, nicht wahr?«
»Wenn ich Zeit habe, schon, aber ich reise morgen ab. Und bis dahin hätte ich gerne Ihre Telefonnummer.«
»Wozu?«
»Um Sie hin und wieder in Hamburg anzurufen.«
»Und wenn ich das nicht möchte?«, fragte ich so behutsam es eben ging.
»Sind Sie verheiratet?«, stellte er stirnrunzelnd die Gegenfrage, um gleich darauf mit jungenhaftem Charme fortzufahren: »Wenn ja, sagen Sie es lieber gleich. Ich bin nämlich kein sehr risikofreudiger Mensch, ich vermeide es lieber, mich unglücklich zu verlieben.«
Dass er sich auch unglücklich verlieben konnte, wenn ich ledig war, auf die Idee kam er offensichtlich nicht. Aber ich wollte die Diskussion zu diesem Thema möglichst schnell beenden. »Dann halten Sie Ihr Herz gut fest«, erwiderte ich deshalb mit einem entschuldigenden Lächeln.
Er sah mich enttäuscht an. »Wie schade.«
»Trotzdem guten Appetit!«
Unser Essen stand längst vor uns auf dem Tisch, und zumindest seines drohte kalt zu werden. Ich griff zur Gabel und begann, in meinem Salat herumzustochern. Für eine Weile konzentrierte er sich ausschließlich auf seinen Teller. Die Gedanken, die währenddessen hinter seiner Stirn arbeiteten, konnte ich nicht ergründen.
Steffen Wolf war vielleicht nicht risikofreudig, aber er war beharrlich, wie ich gleich darauf feststellen sollte. Von seiner Seite aus war das Thema nämlich noch nicht beendet. »Er hat Sie nicht verdient.«
Jetzt war ich es, die die Stirn runzelte.
»Er macht Sie nicht glücklich«, setzte er zu einer Erklärung an.
Unwillig schüttelte ich meinen Kopf. Da half nur eine Klarstellung! »Er hat mich nicht glücklich gemacht, deshalb haben wir uns vor zwei Jahren scheiden lassen. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass in meinem derzeitigen Leben kein Raum für einen Mann ist.«
»Uff«, sagte er erleichtert und griff sich symbolisch ans Herz. »Was für eine gute Nachricht.«
Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass er entweder nur zur Hälfte zugehört hatte oder über eine sehr gute selektive Wahrnehmung verfügte. Erstaunt dachte ich über seine Bemerkung nach. Als eine gute Nachricht hatte ich meine Scheidung nie angesehen, eher als Fehlentscheidung.
»Können wir jetzt über etwas anderes reden?«, fragte ich ihn erschöpft.
»Natürlich.«
»Erzählen Sie mir etwas von sich.«
»Über mich gibt es nicht viel zu erzählen«, begann er. »Ich habe viel zu wenig Zeit, um etwas Nennenswertes zu erleben. Meine Praxis ist noch im Aufbau und beansprucht mich ziemlich stark. Der einzige Luxus, den ich mir gönne, besteht darin, an den Wochenenden zum Segelfliegen zu gehen.«
Ich hörte nur fliegen und schrak zusammen.
»Dort oben fühle ich mich wirklich lebendig.« Während sich in seinem Gesicht ein Strahlen breitmachte, überzog eine Gänsehaut meine Arme.
Bis man abstürzt, schrie es in mir. Mein Gaumen war vollkommen trocken.
»Mein Gott, Sie sind ja ganz blass geworden. Ist Ihnen nicht gut?« Er griff nach meinen Händen. »Eiskalt«, stellte er fest. »Und ich rede die ganze Zeit. Sie müssen ja einen schrecklichen Eindruck von mir bekommen.«
Ich entzog ihm meine Hände und griff zitternd nach meinen Zigaretten.
»Trinken Sie lieber einen Schluck Wasser.« Er hielt mir auffordernd mein Glas vor die Nase.
Nachdem ich einen Schluck getrunken hatte, zündete ich mir trotz seiner Missbilligung eine Zigarette an. »Meine Eltern sind vor ein paar Wochen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.« Ich konnte weder daran denken noch darüber reden, ohne dass mein Magen sich verkrampfte und wie Feuer brannte.
Im ersten Moment schien er nicht begriffen zu haben, was ich gerade gesagt hatte, dann folgte ein mir gut vertrauter Unglaube, bis sich die Erkenntnis durchsetzte, dass er sich nicht verhört hatte. All das nahm ich bis ins kleinste Detail wahr. Auch sah ich, dass ihm mehrere Fragen durch den Kopf gingen, er sie jedoch nicht zu stellen wagte. Ich kannte jede einzelne auswendig und beantwortete sie ungefragt mit tonloser Stimme.
»Es war eine kleine Propellermaschine. Meine Mutter hatte meinem Vater zu seinem sechzigsten Geburtstag einen Rundflug über die Alpen geschenkt. Es war in zweierlei Hinsicht ein besonderes Geschenk für ihn. Erstens war so ein Rundflug schon lange sein Traum gewesen. Zweitens hatte meine Mutter eine Heidenangst vorm Fliegen, sie hat sich nur ihm zuliebe überwunden. Am Morgen haben wir noch miteinander telefoniert. Mein Vater war ganz aufgekratzt, während meine Mutter vor lauter Aufregung kaum von der Toilette herunterkam. Für beide war es ihr erster und gleichzeitig letzter Flug.« Ich schluckte gegen den Kloß in meinem Hals an und fuhr leise fort: »An dem Tag muss in den Bergen wunderschönes Wetter gewesen sein. Es war einer dieser ganz besonderen Maitage, zum Weinen schön, wie meine Mutter sagte. Sie schwärmte mir davon vor und versprach, mir am Abend von ihren Erlebnissen zu berichten.«
Steffen Wolf sah mich mit einer Mischung aus Betroffenheit und Mitgefühl an.
»Sie waren noch nicht lange in der Luft, als der Motor ausfiel.« Ich atmete tief durch, da ich das Gefühl hatte, an dem Kloß in meinem Hals ersticken zu müssen. »Der Pilot hat eine Notlandung versucht, die jedoch misslang. Die Maschine ist in Flammen aufgegangen. Außer meinen Eltern und dem Piloten saß noch ein anderes Ehepaar darin. Alle sind umgekommen.« Mir war, als würde sich meine Stimme in nichts auflösen.
Er griff behutsam nach meinen Händen und streichelte sie. Etwas von meinem Entsetzen fand ich in seinen Zügen wieder. »Das tut mir unendlich leid«, sagte er leise.
Wie oft hatte ich diesen Satz in letzter Zeit gehört. Aber er war nur selten mit einem so tiefen Empfinden ausgesprochen worden. Es war nicht, was er sagte, sondern wie er es sagte.
»Vom Versagen des Motors bis zum Absturz hat es genau vier Minuten gedauert«, wiederholte ich, was man mir gesagt hatte. »Ein paar Tage danach habe ich mich hingesetzt und vier Minuten lang auf den Zeiger meiner Uhr gestarrt. Wenn man zum Zug muss, dann rast die Zeit, und ein paar Minuten sind gar nichts. Aber unter Todesangst muss jede Sekunde eine unerträgliche Qual sein. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, male ich mir die Szenen im Flugzeug aus, ich stelle mir meine Eltern vor und glaube, sie zu sehen – in dem Moment, als sie begriffen haben, dass es um ihr Leben geht. Ich frage mich, was …«
»Hören Sie auf! Damit zermartern Sie sich.«
»Das weiß ich«, erwiderte ich matt. »Aber diese Bilder überfallen mich immer wieder. Manchmal denke ich, ich würde besser damit fertig, wenn sie von einer Sekunde auf die andere mit dem Flugzeug gegen einen Berg geprallt wären. Wenn der Tod ganz überraschend mitten in einem Satz, mitten in einem Lachen gekommen wäre und sie nicht hätten leiden müssen. Aber so?«
Sekundenlang sah er mich stumm an. »Ich würde Ihnen gerne helfen, diese Bilder zu verscheuchen.« Der große Ernst, mit dem er es sagte, ließ diesen Satz einem Versprechen nahe kommen. Er hielt immer noch meine Hände in seinen.
»Darf ich Ihnen noch etwas bringen?«, hörte ich plötzlich die Stimme des Kellners neben mir.
Für eine Weile hatte ich alles um mich herum vergessen. Ich schüttelte den Kopf. »Nur die Rechnung bitte.«
»Wollen Sie nicht noch ein paar Minuten bleiben?«, fragte Steffen Wolf. »Ich mag Sie so gar nicht gehen lassen.«
»Das geht schon«, wehrte ich ab. »Ich muss in der Wohnung meiner Eltern noch so viel tun.«
»Kann ich Ihnen dabei helfen?«
Noch am Nachmittag hatte ich mir gewünscht, nicht allein diesen Berg bewältigen zu müssen. Mit Ralph zusammen – ja. Aber mit einem Fremden? »Nein danke.«
Nachdem wir gezahlt hatten, standen wir auf und gingen Richtung Ausgang. Mein Fuß schmerzte bei jedem Schritt, was sowohl in meinem Gang als auch in meiner Mimik zum Ausdruck gekommen sein musste.
»Das habe ich ja völlig vergessen«, sagte er aufgebracht. »Haben Sie den Knöchel heute Nachmittag gekühlt?«
Mein Kopfschütteln löste einen ganzen Schwall von Rügen aus, die in dem unmissverständlichen Befehl mündeten, ihn unverzüglich in sein Zimmer zu begleiten.
»Es ist im Gästehaus gleich gegenüber, dort werde ich Sie erst einmal mit Eiswürfeln versorgen.«
»Sie glauben tatsächlich, dass ich mit in Ihr Zimmer komme?«, fragte ich ungläubig.
»Stellen Sie sich einfach vor, es sei die Notaufnahme eines Krankenhauses.« Er griff nach meinem Ellenbogen und übernahm die Führung. »Dann ist Ihre ausufernde Fantasie wenigstens zu etwas Gutem nütze.«
»Meine ausufernde Fantasie, wie Sie es nennen, malt mir etwas ganz anderes aus«, sagte ich halb ernst, halb scherzend.
»Nur keine falschen Hoffnungen. Wie ich bereits sagte: Mir genügt Ihre Telefonnummer, fürs Erste jedenfalls.«
»Und wie lange währt so etwas wie das Erste bei Ihnen gewöhnlich?«
»Lange«, antwortete er gelassen. »Ich bin ein geduldiger Mensch.«
Und er hatte nicht gelogen. In der Hotelküche besorgte er sich eine Plastiktüte mit Eiswürfeln und lotste mich dann hinauf in sein Zimmer im zweiten Stock. Es war geräumig und trotz oder vielleicht gerade wegen seines uneinheitlichen Stils sehr gemütlich. Außer einem Bett, zwei Sesseln und einem kleinen Tisch gab es noch ein lang gestrecktes Sofa, zu dem er mich führte. Nachdem er mir drei kleine Kissen in den Rücken gestopft hatte, bedeckte er meinen Fuß mit dem Eiswürfelbeutel und Handtüchern. Die Kühlung kam einer kleinen Erlösung gleich.
Während er noch einmal hinunterging, um uns etwas zum Trinken zu holen, ließ ich mich in die Kissen zurücksinken. Dieser Tag hatte mich maßlos erschöpft. Eigentlich war es nur wenig, was ich getan hatte, aber es hatte ausgereicht, um im Zimmer eines mir fast fremden Mannes einzuschlafen. Als ich aufwachte, saß Steffen Wolf mir gegenüber auf seinem Bett und betrachtete mich.
»Wie lange sitzen Sie da schon?«
»Eine halbe Stunde«, sagte er, als wäre es das Normalste von der Welt.
»Warum haben Sie mich nicht geweckt?«
»Es war schön, Sie einfach nur anzusehen.« Sein Gesichtsausdruck war unergründlich. »Erzählen Sie mir von Ihren Eltern.«
»Das wollen Sie nicht wirklich hören«, wehrte ich ab. »Doch.« Sein Lächeln hatte etwas Liebevolles.
»Warum?«
»Erstens aus echtem Interesse.«
»Und zweitens?«, fragte ich, als er stockte.
»Vielleicht ist das der Weg zu Ihnen.«
»Ich habe Ihnen doch gesagt …«
»Es gibt auch freundschaftliche Wege«, unterbrach er mich. »Sie gehören wirklich einer aussterbenden Art an«, sagte ich verwundert.
»Und Sie wiederholen sich«, entgegnete er leise. »Erzählen Sie mir etwas, was ich noch nicht weiß.«
2 – Wie fasst man …
Wie fasst man das Leben von zwei Menschen in ein paar Worte? Wie sollte ich Steffen Wolf, einem Menschen, der meinen Eltern nie begegnet war, erklären, wie sie gewesen waren? Da ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte, griff ich das heraus, was mir so wichtig an ihnen gewesen war: ihre Redlichkeit und ihr unverbrüchlicher Anstand, ihre Unermüdlichkeit, mit der sie Ralph und mich in all unseren Plänen und Wünschen unterstützt hatten, auch wenn sie nicht immer alle hatten nachvollziehen können. »Mein Vater war Buchhalter in einer Elektroinstallationsfirma gewesen, meine Mutter Schneiderin. In ihrer Welt hatte ihnen niemand etwas vormachen können, von allem, was dahinterlag, wussten sie zu wenig, um uns darauf vorzubereiten. Aber sie haben uns etwas viel Wichtigeres als dieses Wissen mitgegeben, nämlich die Zuversicht, dass wir uns überall zurechtfinden würden. Ich weiß gar nicht so genau, wie ihnen das gelungen ist«, überlegte ich laut. »Eigentlich wirkten die beiden wie zwei richtige Stubenhocker und ziemlich zurückhaltend, wenn es darum ging, etwas Neues zu entdecken. Früher dachte ich immer, sie wären am glücklichsten zu Hause und wollten gar nicht weg. Ich weiß noch, wie oft ich gerade meiner Mutter vorgeworfen habe, sie sei engstirnig und habe einen begrenzten Horizont. Sie hat zu Hause gearbeitet«, sagte ich zu ihm, als wäre das die Erklärung für alles.
Er saß gegen das Kopfende seines Bettes gelehnt, hatte seine Beine locker übereinandergeschlagen und hörte mir zu, ohne mich zu unterbrechen.
»Wenn ich heute daran denke, was mein Bruder und ich beiden im Laufe unseres Lebens an den Kopf geworfen haben, dann schaudert es mich jetzt noch. An den Tagen, an denen wir es bei spießig und kleinkariert bewenden ließen, hatten sie Glück. Dabei haben sie gearbeitet, was das Zeug hält, und jede Mark, die übrig war, für unsere Ausbildung gespart. Sie wollten uns beiden ein Studium ermöglichen. Aber ich hatte meinen eigenen Kopf. Ich wollte nicht studieren und bin stattdessen auf eine Hotelfachschule gegangen.«
»Und Ihr Bruder?«
»Der hat Betriebswirtschaft studiert.« Ich erinnerte mich noch sehr gut an die stolzen Gesichter meiner Eltern, als er ihnen sein Diplom zeigte. »Sie haben mich ihre Enttäuschung über meine Berufswahl nie spüren lassen.«
»Vielleicht waren sie gar nicht enttäuscht.«
»Sicher waren sie das. Sie haben sich jahrelang krummgelegt, sind nicht verreist, haben sich kaum etwas gegönnt und mussten sich dafür noch Beschimpfungen anhören. Meine Mutter hat mir später einmal erzählt, warum sie nicht mit der Wahrheit herausgerückt sind. Wir sollten nicht in die übliche und weitverbreitete Dankbarkeit gedrängt werden, nach dem Motto: Wir tun das ja alles nur für euch. Dabei hatten sie es nur für uns getan, sie selbst waren mit dem zufrieden gewesen, was sie erreicht hatten.« Einen Augenblick lang schwieg ich und dachte nach. »Sie haben mich frei entscheiden lassen, obwohl meine Berufswahl zumindest einen ihrer Träume hat platzen lassen. Das einzig Gute daran war, dass sie mit dem Geld, das sie dadurch gespart hatten, den Grundstein für einen anderen Traum legen konnten, für ihre Ferienwohnung in Bayrischzell.« Ich schlang meine Arme um meinen Oberkörper, da mir plötzlich kalt war. »In einem Jahr hätten sie die letzte Rate gezahlt, und in zwei Jahren wären sie in Rente gegangen und für immer hierher gezogen. Jetzt wird ein anderes Paar seinen Lebensabend in der Wohnung verbringen.«
»Ich kann Ihre Verzweiflung gut verstehen«, sagte Steffen Wolf leise.
Ich war froh, dass er es dabei bewenden ließ und mir keinen Vortrag darüber hielt, wie wichtig es sei, jetzt zu leben und nichts aufzuschieben. Das hatte ich schon zur Genüge zu hören bekommen. Ich fand ihren viel zu frühen Tod tragisch, wollte jedoch kein Lehrstück daraus gemacht haben, zumal meine Eltern für diese Wohnung gespart, aber nicht dafür gelebt hatten.
»Manchmal weiß ich gar nicht, auf wen ich wütender bin, auf das Schicksal oder auf mich: Sie haben mich so oft eingeladen, sie hier zu besuchen, aber mir war meist irgendetwas anderes wichtiger.«
»Machen Sie sich keine Vorwürfe.«
»Es geht nicht um Vorwürfe, es geht um versäumte Gelegenheiten. Die beiden waren so selbstverständlich da, dass ich mich in der falschen Gewissheit wog, das würde noch lange so bleiben. Sie liefen mir ja nicht davon. Sie hatten hier und da mal ein Zipperlein, waren aber ansonsten für ihr Alter rundum fit. Bestimmt hätten sie uralt werden können, wenn nicht dieser verdammte Motor ausgesetzt hätte.«
Während ich versuchte, die Gedanken zu ordnen, die sich in meinem Kopf überschlugen, spürte ich Steffen Wolfs Blick auf mir ruhen. Weder drängte er mich weiterzureden, noch fühlte er sich gezwungen, mein Schweigen zu überbrücken. Er war ein guter Zuhörer.
»Es bleibt so vieles ungesagt«, fuhr ich fort. »All die Dinge, für die nie der passende Moment da war …«
»Wie viel sie Ihnen bedeutet haben?«
»Ja. Sie hatten beide sehr viel Herz, in ihrer Nähe habe ich nie gefroren. Ich glaube, ihre Wärme und Fürsorge ist das, was ich am meisten vermisse … obwohl ich gerade gegen die Fürsorge am heftigsten protestiert habe, besonders gegen die meiner Mutter. Wenn es eine Zauberfee gäbe«, sagte ich aus tiefstem Herzen, »wünschte ich mir noch einmal eine Stunde mit meinen Eltern. Dann könnte ich mich von ihnen verabschieden.«
»Von meinem Vater habe ich mich auch nicht verabschieden können«, sagte er in die nachfolgende Stille hinein. »Er hat sich umgebracht.«
Die Worte klangen in mir nach. Mir fiel jedoch nichts ein, was ihn hätte trösten können. Ich wollte keine Fragen stellen, deren Antworten ich nicht ertragen konnte. Meine Belastungsgrenze für erschütternde Schicksale war längst erreicht. So sah ich ihn nur stumm an. Er hingegen schien gar nicht auf eine Reaktion gewartet zu haben. Mit einem in die Ferne gerichteten Blick schaute er zum Fenster hinaus in die Dunkelheit.
Von draußen drangen plötzlich Stimmen zu uns hoch. Es war bereits weit nach Mitternacht, und die letzten Gäste machten sich auf den Heimweg. Auch für mich wurde es langsam Zeit, ich machte Anstalten, aufzustehen und zu gehen.
»Wenn Sie mögen, bleiben Sie einfach«, lud er mich ein. Er wandte seinen Blick vom Fenster ab, wirkte jedoch immer noch abwesend.
»Das geht doch nicht«, wehrte ich halbherzig ab. Die Vorstellung, mich todmüde, wie ich war, noch einmal aufrappeln zu müssen, hatte überhaupt nichts Verführerisches. Andererseits fand ich die Situation höchst ungewöhnlich, schließlich kannte ich diesen Mann kaum. Dann musste ich an die Igel denken, die er gezähmt hatte, und fühlte mich diesen kleinen Wesen auf seltsame Weise verbunden.
»Das Bett ist breit genug für zwei«, holte er mich aus meinen Gedanken zurück, »ich bin todmüde und neige auch im ausgeschlafenen Zustand nicht zu tätlichen Übergriffen. Also?«
»Also … gut«, erwiderte ich zögernd, »wenn Sie mir ein T-Shirt leihen …«
Ich hatte den Satz kaum ausgesprochen, als er bereits den Schrank geöffnet hatte, mir eines reichte und gleich darauf im Bad verschwand, von wo ich kurz darauf das Summen einer elektrischen Zahnbürste hörte. Als ich völlig erschöpft unter die Decke kroch, glitt ich augenblicklich in einen Zustand zwischen Wachen und Schlafen. Der Schlaf musste ziemlich schnell gesiegt haben, denn ich konnte mich am nächsten Morgen nicht daran erinnern, wann mein Bettgenosse sich neben mich gelegt hatte. Mitten in der Nacht weckte mich einer meiner Albträume, und ich fand mich in den Armen von Steffen Wolf wieder, der mich fest umschlungen hielt. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis ich wieder eingeschlafen war.
Als ich das nächste Mal aufwachte, war es heller Tag, und ich hörte wieder die Zahnbürste brummen. Schnell schlüpfte ich aus dem T-Shirt und in mein Kleid und fuhr mir mit den Händen durch die Haare. Mein Knöchel war über Nacht etwas abgeschwollen und tat weit weniger weh als noch am Abend zuvor. Einem ersten Impuls folgend, ging ich Richtung Tür, um dieser ungewöhnlichen Situation, die ich nicht einordnen konnte, zu entfliehen. Dann siegte jedoch mein Gewissen und signalisierte mir, wie unfair das wäre. So setzte ich mich auf die Bettkante und wartete, bis er geduscht und angezogen herauskam.
»Guten Morgen«, sagte er kurz darauf sichtlich erfreut.
Zum ersten Mal, seit ich ihm begegnet war, fügten sich seine Haare seinem Willen, und das auch nur, weil sie noch feucht waren. Mit ihm wehte ein frischer, angenehmer Duft aus dem Bad.
»Ich muss gehen.«
»Nicht, ohne noch schnell mit mir zu frühstücken.« Er hatte bereits die Türklinke in der Hand und erstickte meinen Protest im Keim. »Keine Widerrede!«
Ungeduscht, mit einem pelzigen Belag auf den Zähnen und in den Sachen vom Vortag fühlte ich mich wie nach einer durchzechten Nacht. Ich sehnte mich nach einer Dusche. Dieser Sehnsucht hier nachzugeben kam für mich jedoch nicht infrage. Am liebsten hätte ich mich auf der Stelle nach Bayrischzell aufgemacht, aber er hatte es nicht verdient, dass ich ihn jetzt einfach stehen ließ und ging. Also folgte ich ihm hinüber zum Gasthof.
Trotz der frühen Morgenstunde war der Gastraum bereits gut besucht. Wir zogen es jedoch vor, im Freien zu frühstücken, deckten uns am Buffet mit Brötchen, Butter und Marmelade ein, bestellten uns Kaffee und Tee und suchten uns einen Platz im Schatten einer Kastanie. Die Luft war drückend an diesem Morgen, es würde ein heißer Tag werden.
Steffen Wolf schien das Ungewöhnliche unserer Situation entweder gar nicht zu realisieren oder zu ignorieren. Er ging mit einer Selbstverständlichkeit damit um, die mich überraschte.
»Machen Sie das öfter?« Ich hielt meine Kaffeetasse in beiden Händen und sah ihn darüber hinweg prüfend an.
»Was?«
»Aus Ihrem Hotelzimmer eine Notaufnahme.«
»Das kommt auf die Notfälle an«, erwiderte er mit einem Lächeln.
»Anatomisch gesehen?«
»In Ihrem ganz speziellen Fall wohl eher kardiologisch.« Der Ausdruck in seinen Augen verriet mir etwas über seine Verwundbarkeit. Es war eine Mischung aus Hoffnung und Vorsicht. »Und Sie? Machen Sie so etwas öfter?«
»Nein«, gab ich ehrlich zu. »Aber ich bin im Moment auch nicht ganz zurechnungsfähig.«
»Vielleicht ist das meine Chance.« Jetzt überwog die Hoffnung in seinem Blick.
»Ich habe im Augenblick keine Chancen zu vergeben.«
»Dann warte ich eben.« Bevor ich meine Abwehr definitiver zum Ausdruck bringen konnte, zeigte er auf drei Segelflugzeuge, die in der Ferne ihre Kreise an dem wolkenlosen Julihimmel zogen.
Unsere Blicke, die ihnen folgten, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Meiner entsprach einer abgrundtiefen Abneigung, seiner einer nahezu überschwänglichen Begeisterung.
»Ich weiß, dass Sie das im Augenblick schwer nachvollziehen können, aber dort oben fällt alles von einem ab«, schwärmte er mit einem Glitzern in den Augen. »Gestern Vormittag bin ich auch geflogen, der Segelflugplatz von Geitau ist nur fünf Minuten von hier entfernt. Es ist wie …«Er ließ den Satz unvollendet, als er meinen Blick bemerkte.
Ich hatte mir eine Zigarette angezündet und den Rauch tief inhaliert.
»Seit wann rauchen Sie?«
»Erst seit ein paar Jahren.« Ich hätte auch sagen können, seit meiner Scheidung, aber ich wollte nichts aufwühlen, was endlich zur Ruhe gekommen war.
»Wenn Sie wollen, dass ich Sie eines Tages küsse, dann fangen Sie lieber bald an, sich das abzugewöhnen.« Er sagte es in einem so selbstverständlichen Ton, als würde sein Warten in jedem Fall belohnt werden.
»Gehen Sie alles so strategisch an?«, fragte ich ihn irritiert.
»Vorausschauend. Deshalb weiß ich auch, dass Sie am Ende Ihrer Zigarette aufstehen werden, um zu gehen.« Er rief einen Kellner zu sich und bat ihn um Zettel und Stift. Beides schob er mir dann über den Tisch zu.
»Ach ja, die Telefonnummer.« Angesichts seiner Beharrlichkeit konnte ich ein Lächeln nicht unterdrücken und schrieb ihm meine Nummer auf.
»Wie wär’s, wenn wir uns zum Abschied duzen?«, fragte er. »Immerhin haben wir eine ganze Nacht zusammen verbracht.«
»Tschüss, Steffen«, sagte ich daraufhin im Aufstehen. »Und vielen Dank! Für alles.«
Er kam um den Tisch herum und nahm mich kurz in den Arm. »Auf Wiedersehen, Anna!«
Ich ging, ohne mich noch einmal umzusehen. Was ich mitnahm, war ein undefinierbares Gefühl. Bis tief in die Nacht hinein hatte ich ihm mein Herz ausgeschüttet und damit eine vermeintliche Nähe geschaffen, die, soweit es mich betraf, nicht der Realität entsprach. In diesem Moment, als ich mich von ihm entfernte, hätte ich nicht sagen können, ob ich ihn tatsächlich wiedersehen wollte. Und als ich in mein Auto stieg, drängten sich bereits andere Gedanken in den Vordergrund. Sie eilten mir kilometerweit voraus zu dem alten ausgebauten Bauernhaus mit den dunkelgrünen Fensterläden und den Geranienkästen, in dem sich die Wohnung meiner Eltern befand.
Von der fünfzehnminütigen Fahrt durch die Landschaft, die es meinen Eltern so sehr angetan hatte, nahm ich so gut wie nichts wahr. Genauso wenig wie am Tag zuvor, als es mich hinaus in die Wiesen gezogen hatte – nur fort von der Aufgabe, die mir über den Kopf zu wachsen drohte. Aber ich konnte nicht davonlaufen, ich hatte nur noch diesen einen
Tag. Am Montagmorgen würde noch genug zu regeln sein, und gegen Mittag musste ich zurück nach Hamburg fahren. Am Dienstag sollte ich bereits wieder am Hotelempfang stehen und mit einem freundlichen Lächeln die Gäste begrüßen.
Vielleicht war es der Zeitdruck, der mir half, vielleicht auch der Wunsch, diesen Ort so schnell wie möglich zu verlassen. Was auch immer es war – als am Montagmorgen der Makler zur Schlüsselübergabe kam, hatte ich fünf Umzugskartons in meinem Auto verstaut. Er versprach, alles Weitere für mich zu regeln. Ich war ihm dankbar, dass er ohne die zukünftigen Besitzer der Wohnung gekommen war. Sie in den Räumen meiner Eltern zu erleben hätte ich nicht ertragen. Obwohl ich dieses Mal keine Leere zurückließ, war es um keinen Deut leichter, die Tür für immer zu schließen. Als ich zum Auto ging, drehte ich mich noch einmal um. Für den Bruchteil einer Sekunde sah ich meine Eltern am Fenster stehen und mir zuwinken, so wie sie es getan hatten, wenn ich sie hier besucht hatte. Voller Sehnsucht ging ich ein paar Schritte auf das Haus zu. Das Bild ließ sich jedoch nicht festhalten, es verschwand wie eine Fata Morgana und ließ nur Verzweiflung zurück.
Meine Hände waren zu Fäusten geballt, in der rechten hatte der Autoschlüssel tiefe Kerben hinterlassen. Ich sah blicklos darauf und verlor mich in einer nicht enden wollenden Gedankenflut, bis eine Passantin mich fragte, ob sie mir helfen könne. Hätte ich sie gebeten, mir ein paar Tränen zu leihen, hätte sie mich wahrscheinlich für verrückt erklärt. So schüttelte ich nur meinen Kopf und ging zurück Richtung Auto. Während ich einstieg und den Motor anließ, versuchte ich, mich auf das zu konzentrieren, was vor mir lag.
Ich musste beim Steinmetz noch einen Grabstein aussuchen. Auch das hatte ich so lange wie möglich hinausgeschoben. Wäre es allein nach mir gegangen, wäre ich direkt auf die Autobahn gefahren. Aber es ging um meine Eltern. Sie hatten die Ordnung der Dinge geschätzt, sie hatte ihrer Welt einen Rahmen verliehen. Und in diese Ordnung gehörte auch ein Grabstein, nicht das schlichte Holzkreuz, das immer noch auf ihrer letzten Ruhestätte stand. Während ich durch die vielen Reihen mit Steinen ging, wurde mir klar, wonach ich suchte: Es musste ein natürlicher, unbehauener Stein sein, der ihre Liebe zur Natur widerspiegelte. Als ich ihn schließlich fand, war es eine Entscheidung von Sekunden. Später würde ich ihn in einem Brief an meinen Bruder als völlig unscheinbar und dennoch besonders beschreiben.
Nachdem ich mit dem Steinmetz die Beschriftung besprochen hatte, blieb mir nur noch ein Besuch auf dem Friedhof. Ich war froh, dass ich mich durchgesetzt und erreicht hatte, dass meine Eltern hier in Bayrischzell beigesetzt wurden. Viele ihrer Freunde in Hamburg hatten mich davon überzeugen wollen, dass einzig ein Hamburger Friedhof infrage komme, da sie ihr ganzes Leben in dieser Stadt verbracht hatten. Aber ich hatte mich nicht beirren lassen. Meine Eltern hatten zwar nie darüber gesprochen, wo sie einmal liegen wollten, aber ich war mir ganz sicher gewesen, dass sie sich für Bayrischzell entschieden hätten. Hier hatten sie schließlich alt werden wollen.
Ich beeilte mich, um noch vor dem sich zusammenbrauenden Gewitter zum Grab zu kommen. Als ich vor dem Holzkreuz stand, das bald einem Stein weichen würde, überfielen mich wieder die Bilder ihrer verkohlten Leichen. Mein Hals wurde eng. Ich versuchte, mich in die Vorstellung von der Asche in den beiden Urnen zu retten, aber es wollte mir nicht gelingen. Schnell holte ich aus meiner Tasche einen kleinen grauen Porzellanhund aus ihrer Sammlung und legte ihn direkt vor das Kreuz. Mit zusammengebissenen Zähnen ging ich zum Ausgang zurück. In diesem Moment brach das Gewitter mit voller Kraft los. Es sollte jedoch noch ein paar Wochen dauern, bis ich es der Natur gleichtat und meine Anspannung entlud.
Mir war schwindelig. Ich hatte an diesem Morgen noch nicht einmal einen Kaffee getrunken, geschweige denn etwas gegessen. Wenn ich die Fahrt nach Hamburg durchstehen wollte, musste ich vorher etwas in meinen Magen bekommen, andernfalls würde mein Kreislauf ganz schlappmachen. So legte ich auf dem Weg zur Autobahn einen kurzen Zwischenstopp in einem Café ein, aß auf die Schnelle ein belegtes Brötchen, trank einen Milchkaffee dazu und fragte mich, ob jemals etwas die große Lücke füllen würde, die meine Eltern hinterlassen hatten. Diese Lücke – sie fühlte sich an wie eine offene Wunde.
Um vierzehn Uhr saß ich endlich im Auto und machte mich auf den Heimweg, froh, meinen immer noch schmerzenden Knöchel entlasten zu können. Knapp neunhundert Kilometer und neun Stunden später hielt ich in Hamburg vor dem Haus, in dem sich meine Wohnung befand. Ich hätte nicht sagen können, wie die Fahrt dorthin gewesen war. Es war allein glücklichen Umständen zu verdanken, dass ich trotz völliger Übermüdung und etlicher Regenschauer heil angekommen war.
In einer letzten Kraftanstrengung schleppte ich die Umzugskartons in den dritten Stock und stapelte sie im Flur meiner kleinen Einzimmerwohnung. Im Keller war längst kein Platz mehr. Dort standen bereits die Habseligkeiten meiner Eltern aus ihrer Mietwohnung. Zum Schluss holte ich meine Reisetasche hoch, ließ sie jedoch unausgepackt im Zimmer stehen. Mit einer Zigarette in der Hand hörte ich meinen Anrufbeantworter ab, auf dem fünf Nachrichten aufgelaufen waren. Die letzte stammte von Steffen, der sich erkundigen wollte, wie meine Fahrt gewesen war.
»Ich habe sie überlebt«, murmelte ich vor mich hin, als das Telefon klingelte. Kaum hatte ich mich mit meinem Namen gemeldet, hörte ich auch schon Steffens Stimme.
»Wie gut, dass du da bist, Anna, ich habe mir Sorgen gemacht.«
Seine Worte ließen blitzartig eine Erinnerung auftauchen. Mit fast den gleichen Worten hatte meine Mutter mich am Telefon begrüßt, wenn ich von einem Besuch bei ihnen in Bayrischzell nicht schnell genug wieder in Hamburg angekommen war. »Hallo, Steffen«, sagte ich leise.
»Wie war die Fahrt?«
»Okay.«
»Und dein Knöchel?«
»Ist schon viel besser.«
Einen Moment war es still in der Leitung. »Soll ich dich lieber morgen wieder anrufen? Du klingst so müde.«
»Ich habe morgen Frühdienst und muss um sechs Uhr im Hotel sein«, setzte ich zu einer Erklärung an.
»Dann geh jetzt ganz schnell schlafen … ich denke an dich.«
»Ja …« Das Gefühl eines Déjà-vu ließ mich nicht los. Ich dachte an die liebevolle Fürsorge meiner Eltern, die so selbstverständlich für mich gewesen war und die ich jetzt so schrecklich vermisste.
Kaum hatte ich aufgelegt, klappte ich mein Bettsofa auf, zog mich aus und schlüpfte unter die Decke. Während ich im Dunkeln an die Decke starrte, versuchte ich, mir Steffens Arme vorzustellen, die mich in der vorletzten Nacht so fest umschlungen hatten. Mit der Erinnerung daran wollte ich einschlafen. So erschöpft und überdreht, wie ich war, sollte der Schlaf jedoch noch fast zwei Stunden auf sich warten lassen. Völlig unausgeschlafen erschien ich am nächsten Tag im Hotel und quälte mich durch den Dienst.
Hatte ich eine Zeit lang noch gehofft, dass mit zunehmender Erschöpfung mein Schlaf wieder tiefer werden würde, so wurde ich in den kommenden Tagen und Wochen eines Besseren belehrt. Die Geister, die mich nachts mit Schreckensvisionen überfielen, kamen nicht zur Ruhe. In dem Maße, in dem meine Schlafstörungen zunahmen, wuchs auch meine Gereiztheit. Meine Reserven für Freundlichkeit schienen fast völlig erschöpft zu sein, in meiner Seele herrschte ein Notstand, der mich zu einer Furie werden ließ, die Wut und Hilflosigkeit in verbale Aggression umwandelte.
Als Erste bekamen es meine Freunde zu spüren. Kamen sie bei mir vorbei und boten mit einem Blick auf die Kisten im Flur an, mir beim Auspacken zu helfen, blaffte ich sie an, sie sollten sich gefälligst um ihre eigenen Kisten kümmern. Ratschläge, zum Arzt zu gehen und mir Hilfe zu holen, schmetterte ich wütend ab. Ich biss so sehr mit Worten um mich, dass sich schließlich selbst die Gutmütigsten und Verständnisvollsten unter meinen Freunden zurückzogen. Als ihre Besuche und Anrufe nach und nach ausblieben, nahm ich es zunächst gar nicht wahr. Schließlich gab es immer noch Steffen, der regelmäßig anrief und mich mit Worten umsorgte.
Von meinem Bruder Ralph einmal abgesehen, hielt er von allen noch am längsten durch. An dem Tag jedoch, an dem ich ihn durchs Telefon anschrie und aufforderte, mit seinem verblödeten Gesäusel doch lieber seine Alzheimer-Patienten zu beglücken, die hätten es wenigstens am nächsten Tag wieder vergessen, war es mit seiner Geduld vorbei. Er rief nicht wieder an.
Blieb nur noch Ralph, der sich angewöhnt hatte, mir zu schreiben, weil diese Art der Kommunikation angeblich Ruhe in sein hektisches, von Telefon und Computer beherrschtes Leben brachte. Auch er kam nicht ungeschoren davon. In meinen Briefen beschimpfte ich ihn als herzlosen Klotz, der nach dem Tod unserer Eltern zur Tagesordnung übergegangen sei. Wie kannst du einfach so weitermachen wie bisher – als wäre nichts geschehen?
Zwei Wochen später kam seine Antwort: Lass die beiden endlich gehen, Anna. Sie sind tot, du kannst sie nicht festhalten, auch wenn du es dir noch so sehr wünschst. Kaum dass ich ihn gelesen hatte, zerriss ich den Brief in winzig kleine Fetzen.
Zwei Stunden später – ich stand längst am Hotelempfang – war ich immer noch wütend. Als ein Hotelgast auf seinem Rechnungsformular ein überschüssiges »r« in seinem Vornamen entdeckte und um eine korrigierte Version bat, rastete ich aus. Er solle doch froh über meinen Fehler sein, immerhin sei er so wenigstens einmal in seinem Leben ein Herr gewesen. So leicht werde er dem Hermann nie wieder entkommen. Als er vor Empörung zu schnaufen begann und mich lautstark aufforderte, sofort seinen Anweisungen zu folgen, war es um mich geschehen. Ich druckte ihm eine korrigierte Rechnung aus und übergab sie ihm mit einem süffisanten Lächeln. Es war aber weniger dieses Lächeln als der Nachsatz, der mich fast meinen Job gekostet hätte. Ich machte ihm ein Kompliment dafür, dass er sein Sakko ganz hervorragend auf seinen Geist abgestimmt habe. Beides sei ähnlich kleinkariert. Während sich meine Kollegin bei dem Versuch, ihr Lachen zu unterdrücken, fast verschluckte, erstarrte mein Chef, der gerade vorbeikam, zunächst in seiner Bewegung, um mich gleich darauf mit einem eisigen Blick zum Schweigen zu bringen. Nachdem er den Gast so gut es ging beschwichtigt hatte, verschwand er in seinem Büro und ließ mir kurz darauf von einem Mitarbeiter der Personalabteilung eine Abmahnung überreichen. Noch so ein Ausbruch, und ich könne mir meine Kündigung bei ihm abholen.
Nun gibt es sicher Menschen, die auch diese Drohung wenig beeindruckt hätte, mich ließ sie jedoch mit einem sehr unsanften Ruck aufwachen. Von einem Tag auf den anderen hatte ich kein Ventil mehr für meine Aggressivität und stand vor der Wahl, sie gegen mich selbst zu richten oder mir endlich Hilfe zu suchen. Zum Glück entschied ich mich für Letzteres, wandte mich an meine Frauenärztin und bekam von ihr die Adresse von Valerie Blumberg.
So betrat ich an einem trüben Septembermorgen, an dem ich Spätdienst hatte, ihre Praxis für ein Erstgespräch. Ein dezentes Schild an der Tür wies sie als psychologische Psychotherapeutin aus. Beladen mit allen möglichen Vorurteilen trat ich zögernd ein und wurde von einer fröhlichen Mittvierzigerin begrüßt, deren Augen vor Lebensfreude sprühten. Noch nie zuvor hatte ich ein Gesicht gesehen, das so sehr von den Augen beherrscht wurde, obwohl auch der Rest in Form einer nicht eben unauffälligen Nase und eines temperamentvoll geschwungenen Mundes bemerkenswert war. Ganz zu schweigen von ihrer pechschwarzen Lockenpracht, die aussah, als wäre sie schwer zu bändigen. Ich hielt sie für die Sprechstundenhilfe und beglückwünschte Frau Blumberg im Geiste zu ihrem guten Geschmack.
»Gehen wir doch gleich hinein«, schlug sie vor, ging mir voraus in einen Raum, der in gedämpftes, warmes Licht getaucht war, und machte mir plötzlich gar nicht mehr den Eindruck einer Sprechstundenhilfe.
Ich blieb unschlüssig im Türrahmen stehen. »Sie sind es selbst?«
»Über eine Antwort auf diese höchst philosophische Frage müsste ich eine Weile nachdenken, aber ich glaube, deshalb sind Sie nicht hergekommen, oder?« Sie hatte es in einem Ton gesagt, als erteilte sie mir gerade schulfrei.
Und in gewisser Weise fühlte ich mich auch befreit. Mein erstes Gespräch mit Valerie Blumberg verlief völlig anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Weder bombardierte sie mich mit Fragen, noch hüllte sie sich in schwer lastendes Schweigen. Nachdem sie in einer Mischung aus Sachlichkeit und Einfühlsamkeit herausgefunden hatte, warum ich ihr gegenübersaß, erklärte sie mir ausführlich ihre Arbeitsweise, die katathym-imaginative Psychotherapie. Nach einer Entspannungsübung gebe sie mir ein bildhaftes Motiv vor, das sich verselbstständige und andere Bilder auftauchen lasse. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass man damit nicht nur zu unterbewussten Schichten, sondern auch zu Lösungsmöglichkeiten vordringe. Anfangs konnte ich mir nicht genau vorstellen, wie das funktionieren sollte, aber den wichtigsten Schritt hatte ich unbewusst bereits getan, indem ich ihr vertraute und mich darauf einließ.
Ein halbes Jahr lang besuchte ich Valerie Blumberg einmal in der Woche. Hatten in den vergangenen Monaten Wut und Aggressivität mein Verhalten bestimmt, so taten sich durch die Bilder, in die ich eintauchte, ziemlich bald Alternativen auf. Und in dem Maße, in dem sich meine Albträume verflüchtigten, wuchs in mir eine heilsame Traurigkeit. Ganz alltägliche Bilder von meinen Eltern tauchten in meiner Erinnerung auf und ersetzten mehr und mehr die Fantasiebilder von ihren verkohlten Körpern. Das, was ich mir von der Zauberfee erhofft hatte, fand ich bei Valerie Blumberg: den Abschied von meinen Eltern.
In meinen Augen war sie ein Phänomen. Bis sie auf ihrem Stuhl Platz nahm, sprühte sie vor Temperament, kaum saß sie jedoch, war sie die Ruhe selbst. Es war, als würde sie einen Schalter umlegen. Diese Ruhe übertrug sich auf mich und wirkte oft noch lange in mir nach. Und nicht nur das, auch die Gedanken, die sie mir mit auf den Weg gab, halfen mir, die Zeit bis zu unserem nächsten Termin zu überbrücken. Sie beschrieb mir die Nahtoderfahrungen von Menschen, die Flugzeugabstürze und andere Katastrophen überlebt hatten. Aus einschlägigen Berichten gehe hervor, dass diese Menschen schlichtweg aus Zeitmangel keine Angst gehabt hätten, da ihr ganzes Leben im Zeitraffer an ihnen vorbeigezogen sei. Und sie schilderte mir ausführlich die Erzählungen Betroffener über den Weg durch einen Tunnel, an dessen Ende ein wunderschönes, warmes Licht auf sie wartete.
Das halbe Jahr meiner Therapie war eine intensive und zunächst einsame Zeit, da ich in den ersten Monaten nichts anderes tat als arbeiten, weinen und Bilder erleben. Der einzige Mensch, mit dem ich während dieser Zeit außerhalb des Hotels Kontakt hatte, war Ralph. Meine Briefe an ihn glichen einem Tagebuch, seine an mich purem Balsam.
Mein Entsetzen über den Flugzeugabsturz hatte sich ganz allmählich in Trauer über den Tod meiner Eltern gewandelt. Ich war zutiefst unglücklich, aber nicht mehr unausstehlich oder ungenießbar. Als ich mir sicher war, dass keine unkontrollierten Ausbrüche mehr drohten, rief ich nach und nach meine Freunde an und meldete mich zurück.