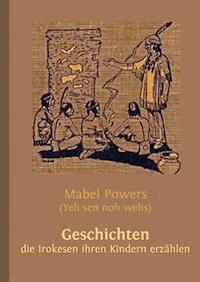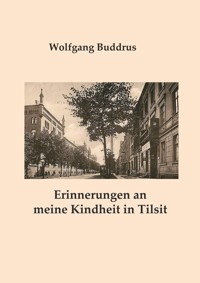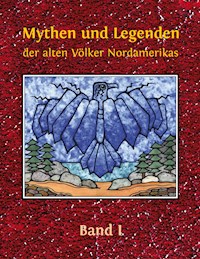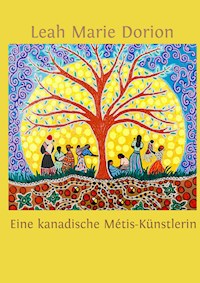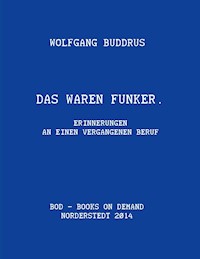
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zahlreiche Berufe, die es über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte gab, sind heute nur noch dem Namen nach bekannt. FUNKER war nahezu ein Jahrhundert lang ein richtiger Beruf, bis die besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Funker in der Nachrichtenübermittlung durch den Einsatz von Satelliten und Computern nicht mehr benötigt wurden. Der Autor (Jahrgang 1938) war selber Berufsfunker und hat über Jahrzehnte an der Ausbildung von Berufsfunkern mitgearbeitet. Er versucht hier, den weniger in die "Geheimnisse" der Funkerei Eingeweihten einen Eindruck von der Arbeit der Funker zu vermitteln. Deshalb ist der Blick weniger auf die Nachrichtentechnik gerichtet, hier geht es mehr um die Ausbildung, die Arbeitsbedingungen und die Aufgaben der Funker in ihren vielen verschiedenen Einsatzgebieten. Zahlreiche Abbildungen und Tabellen dokumentieren und erläutern den Text. Den ehemaligen Funkern kann dies ein Erinnerungsbuch sein, in dem sie sicher auch das eine oder andere ihnen unbekannte Detail entdecken werden. Und schließlich kann es auch unseren Enkeln die Frage beantworten: Was hast Du damals als Funker eigentlich gemacht, Opa? Ein Überblick über die optische Telegrafie in Europa leitet das Buch ein, es folgt eine Würdigung der Telegraphisten vor dem Funk und schließlich werden alle Einsatzgebiete der Funker beschrieben. Dem Erfahrungsbereich des Autors entsprechend, konzentriert sich die Darstellung auf den Zeitraum etwa 1950 bis 1990 auf dem ehemaligen Staatsgebiet der DDR.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Die Telegrafie vor dem Funk
Die optische Telegrafie
Der französische Flügeltelegraf
Die preußische Telegrafenlinie Berlin – Koblenz
Andere europäische Telegrafensysteme
Die elektrische Telegrafie
Die Morse-Telegrafie
Die Entstehung der „Morse-Zeichen“
Friedrich Gerke und der Internationale Morse-Code
Der Morse-Schreiber
Der Klopfer
Leitungsnetze und Kabel-Linien
Die Telegrafisten
„Die amtlichen Vorschriften für die Ausbildung der jüngeren Beamten des technischen Telegraphendienstes“
Die Funktelegrafie
Funkt es beim Funken?
Weltweite Nachrichtenübermittlung – ohne Satelliten
Die Arbeitsmittel eines Funkers
Die Morsezeichen
Wie funkte man in anderen Sprachen
Geben und Hören oder Hören und Geben?
Wie bestimmt man das Tempo einer Morsesendung?
Die Morsetasten
Eine beruflich bedingte Erkrankung
Schlackertaste, Bug und Vibroplex
Die „Handschrift“ eines Funkers und „Emotimorsen“
Kopfhörer und Lautsprecher
Sende- und Empfangsanlagen
Was ein Funker sonst noch können mußte
Internationale und nationale Bestimmungen für das Funkwesen
Bildung und Verwendung von Rufzeichen
Frequenzen und Frequenzbänder
Die einheitliche Uhrzeit
Die Buchstabieralphabete
Im Funkverkehr verwendete Codes und Verkehrsabkürzungen
Der Funkverkehr in Notfällen
Ausbildung und Zeugnisse
Meine Erinnerungen
Meine Ausbildung zum Funker
Weshalb ich Funker wurde
Königs Wusterhausen
Die Funkschule Königs Wusterhausen
Der Komplex auf dem Funkerberg
Das gesellschaftliche Leben
Die Unterrichtsfächer 1955
Unsere Lehrer
Der weiße Kittel
Streifen, Streifen, Streifen
Die Funkerhandschrift
Unser Betriebspraktikum im Sommer 1956 in Glowe
Die ersten fertigen Funker
Das letzte Jahr in Königs Wusterhausen
Als Funker bei Rügen Radio
Der erste Arbeitsvertrag
Der Funkerdienst
Die „alte Garde“
Abschied von der Funkerei
Als Lehrer an der Funkschule
Meine erste Funkerklasse: die 921
Das Fach Englisch
Die Reformen in der Funkerausbildung
Das Ende der Funkschule
Das waren Funker
Tätigkeitsbereiche der Funker
F
UNKER IM ÖFFENTLICHEN
N
ACHRICHTENVERKEHR
Haupttelegraphenamt Berlin und Funkempfangsstelle Beelitz
Funker aus dem HTA erinnern sich
Die Sende- und Empfangsstellen im festen Funkdienst
Funker im Seefunkdienst
Funker auf Küstenfunkstellen
Die 50 ersten Seefunkzeugnisse
Der normale Verkehrsablauf Schiff – Land
Funker auf Seefunkstellen – die Funkoffiziere
Die Schiffspresse und andere Spezialitäten
Die Zusammenarbeit zwischen Flotte und Rügen Radio
Die erste und die letzte Reise
Die Funkoffiziere in der Fischereiflotte
„Einen Ost-West-Konflikt gab es nicht“
Eine Funkerkarriere in der Seefahrt
Die Schiffe als Arbeitsstellen der Funkoffiziere
Von der Langdrahtantenne zum Radom
Seefunk ohne Funker
Die Ausbildung der Funkoffiziere und die Lehrkräfte
Die Ingenieurhochschule für Seefahrt
Die Ausbildung von Seefunkern in anderen Ländern
Bundesrepublik Deutschland
Österreich
Japan
Frankreich
Seefahrtschule „Admiral Makarow“ in Leningrad
USA: Die Funker der Liberty-Flotte
The Wireless Operators‘ Memorial in New York
Registry of Radio Operators Lost at Sea
F
UNKER IN DEN NICHT-ÖFFENTLICHEN
F
UNKDIENSTEN
Funker im Flugfunkdienst
Lufthansa und Interflug
Zulassungskennzeichen und Funk-Rufzeichen
Flugzeugbau in der DDR?
Die Funker der Lufthansa/Interflug
Ein ausgezeichneter Funker der Bodenfunkstelle Schönefeld
Militärfunker
Auch ein Militärfunker ist Soldat
Zur Geheimhaltung
Die Funker der Volksmarine der DDR
„Der beste Funker“
Eine Funkerlaufbahn in der Armee
Militärfunker anderer Staaten
Funker im Polizeidienst
Funker in den Geheimdiensten
Spione oder Aufklärer?
Aufklärer und ihre Funker im 2. Weltkrieg
Funker in den militärischen Geheimdiensten
Der militärische Geheimdienst der NVA
Funker in den staatlichen Sicherheitsdiensten
Elektronische Kampfführung mit und ohne Funker
Funker im diplomatischen Dienst
Die Anfänge in der Luisenstraße
Die Hallstein-Doktrin und ihre Niederlage
Die Botschaftsfunkstellen
Die Verkehrsabwicklung
Die Empfangsstelle Willmersdorf
Eine kleine statistische Bilanz
Diplomatenfunk und Sicherheitsdienst
Der SFD und das MfS
„Meine besten Funkerjahre hatte ich in Peking“
25 Jahre Botschaftsfunker
Ein zufälliger Funker wird Direktor für Funkbetrieb
Funken als Sport und Hobby
Schnelltelegrafie als Sport
Weltrekorde
Außenseiter - Spitzenreiter: Die Funkamateure
Wie ich als Mädchen zum Amateurfunk kam
DL7VOG auf DXpedition
Funker am Nord- und Südpol
„Freundschaft“
Australier am Südpol
Die deutschen Antarktis-Stationen
Funkamateur Nikolai Schmidt und die Nobile-Expedition
Polarfunker Ernst Krenkel
Funker auf driftenden Eisschollen
Was bleibt?
Erinnerungen an einen vergangenen Beruf
Quellen und Literaturverzeichnis
Einleitung
Böttcher, Köhler, Stellmacher, Wagner, Hufschmied, Feilenhauer, Dengler, Blechschmied, Kupferschmied, Kesselmacher, Bechermacher, Pfeifendrechsler, Ziegler, Sattler, Lohmüller, Weißgerber, Leineweber, Zopfmacher, Gürtler, Täschner, Postreuter, Bader, Türmer, Schreiber, Buchdrucker, Notenstecher, Buchdrucker, Buchbinder, Schildermaler, Seifensieder, Bürstenmacher, Schuster, Scherenschleifer, Müller, aber auch Straßenbahnschaffner, Schriftsetzer, Drogist, Fotolaborant, Büromaschinenmechaniker, Telegraphenbeamter, Radiomechaniker – alle diese hochspezialisierten und oftmals auch hochqualifizierten Berufe und wohl noch einige hundert weitere gibt es nicht mehr. Die technische Entwicklung hat die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die bei diesen Tätigkeiten hervorgebracht wurden, überflüssig gemacht. Vieles, was einst in kunstvoller Handarbeit hergestellt wurde und oftmals über Generationen auch gebraucht werden konnte, ist heute durch industrielle, kurzlebige Massenware ersetzt worden. Und noch eins haben die obengenannten Berufe gemeinsam: Wer sich auch nur ein bißchen mit der deutschen Sprache auskennt, wird leicht erkennen können, welche Tätigkeiten in den Berufen ausgeübt wurden. Die ganz alten Berufe erkennt man auch daran, daß sie zu häufigen deutschen Familiennamen geworden sind.
Eine ganze Reihe von Berufen sind dabei, sich so zu verändern, daß man sie kaum noch erkennen kann. Gibt es den Goldschmied, den Uhrmacher, den Fotografen wirklich noch?
Bei anderen Berufen hat man aus verschiedenen Gründen die Bezeichnung geändert, obwohl sich die Tätigkeit im Grunde nicht verändert hat. Aus dem Schauer(mann) wurde der Hafenfacharbeiter, aus dem Tagelöhner der Wanderarbeiter oder Leiharbeiter, aus der Stewardeß die Flugbegleiterin, aus der Sekretärin der Office-Manager (m/w).
Für viele neue Tätigkeiten/Berufe mußte man auch neue Bezeichnungen finden. Dabei kam es zu Monstren wie diesen: Callcenteragent; Kaufmann/Kauffrau für Marketingkommunikation; Kaufmann/Kauffrau für Dialogmarketing; Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (KEP); Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik; Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft; Kraftfahrzeugmechatroniker/in.
Allerdings gibt es einige Letzte der alten handwerklichen Berufe, die gegenwärtig vielleicht sogar gefragter sind als vor zehn, zwanzig Jahren. Sie sitzen in ihren Werkstätten, die nicht selten Museen gleichen, und sind mit Aufträgen von vermögenden Liebhabern beschäftigt: Sie binden kunstvoll Bücher, fertigen edle Bürsten, exquisiten Schmuck und Uhren, schneidern Kleidung aller Art, passend auf nur einen Leib, und viele Dinge mehr, von denen unsereiner nicht einmal ahnt, daß es sie gibt.
Der Funker wurde nicht mehr benötigt, als Satelliten und Rechner in Gebrauch kamen, mit denen man immer größere Datenmengen schneller, bequemer und sicherer übertragen konnte. Einige Funker wurden Techniker, Ingenieure und Verwaltungsleute, einige wenige, die sich von Taste und Mikrofon, selbstbedientem Empfänger und Sender nicht trennen wollten, wurden Funkamateure, das heißt, sie blieben Funker aus Leidenschaft.
Den klassischen Berufsfunker, der Verbindungen zu Funkerkollegen in der ganzen Welt herstellen konnte, gab es etwa von 1910 bis 1990, also ein knappes Jahrhundert. Aber merkwürdigerweise findet man bis heute (2010) im Internet noch Texte wie diese:
»Berufsbild Funker/in
Funker/innen stellen drahtlose Kommunikationsverbindungen her und tauschen Meldungen aus. Darüber hinaus warten sie funktechnische Anlagen und halten diese instand. Funker/innen arbeiten hauptsächlich bei Unternehmen der Binnen- und Seeschifffahrt sowie der Luftfahrt. Ebenso bieten Taxiunternehmen sowie die Einsatzzentralen von Rettungsdiensten, Feuerwehren, der Polizei und der Bundeswehr Beschäftigungsmöglichkeiten. In der Praxis des Schiffsverkehrs z.B. liegt die Aufgabe des Funkers/der Funkerin hauptsächlich in der Steuerung der Verkehrsabwicklung (z.B. in Häfen, vor Schleusen), im Kontakt zur Reederei und zu Wetterstationen sowie in der Entgegennahme von Not-, Dringlichkeits- oder Sicherheitsmeldungen. Im Schiffsverkehr wirken Funker/innen darüber hinaus durch Funkpeilung an der Navigation mit. Schiffsfunker/innen führen als Inhaber des Allgemeinen Betriebszeugnisses für Funker (Global Maritime Distress and Safety Management) den Seefunkverkehr an Land und zu anderen Schiffen und versorgen so die Schiffsführung mit Informationen zur Führung des Schiffs und seiner Sicherheit. Sie geben Nachrichten an die Besatzung weiter, nehmen Hilferufe von in Seenot geratenen Menschen entgegen und beteiligen sich bei der gegenseitigen Hilfeleistung in der Schifffahrt. Häufig ist das Absetzen und Entgegennehmen von Funksprüchen durch eine strikte Funkdisziplin geregelt, an die sich die Funker/innen zu halten haben. Im Notverkehr findet der Funkverkehr nur innerhalb einer geschlossenen Benutzergruppe statt.
Voraussetzungen für Funker/in
Um als Funker/in tätig zu sein, benötigt man üblicherweise eine Ausbildung im Bereich elektrische Anlagen und Bauteile sowie die für die jeweilige Betriebsart vorgeschriebene Lizenz oder Berechtigung, beispielsweise der Erwerb des Allgemeinen Betriebszeugnisses für Funker/innen im Seefunkdienst. Schiffsfunker/innen müssen ein nautisches Befähigungszeugnis, ein gültiges Allgemeines Sprechfunkzeugnis für den Seefunkdienst bzw. das Allgemeine Betriebszeugnis für Funker/innen (Global Maritime Distress and Safety Management) vorlegen. Darüber hinaus benötigen sie ein Zeugnis über die Seediensttauglichkeit. Erwartet werden auch fundierte Kenntnisse der englischen Sprache.«
Stand: 02.03.2010. Weitere Informationen auf:
http://www.jumpforward.de/beruf/7379/Berufsbild-Funker-in.html
Einen ganz ähnlichen Text veröffentlicht auch die Bundesagentur für Arbeit unter:
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/resultList.do
Fazit:
Funker übten eine Tätigkeit aus, die alle Anforderungen erfüllte, die man gemeinhin an einen Beruf stellt:
man erlernte ihn in einer speziellen Ausbildung,
man erhielt ein Zeugnis, das zur Ausübung dieser Tätigkeit berechtigte,
man übte die Tätigkeit gewerblich aus, d.h., man verdiente damit seinen Lebensunterhalt.
Aus diesen Kriterien ergibt sich auch, daß nicht jeder, der sich zur Nachrichtenübermittlung des Funks bedient, ein Funker ist. Ein Kapitän oder Steuermann in der Schiffahrt, Flugzeugführer und Fluglotsen im Tower der Flugplätze benutzen Funkgeräte, Polizisten wie Ganoven benutzen tragbare Funksprechgeräte (walkie-talkies), trotz der Übermacht des Funktelefons verwenden einige noch den CB-Funk (citizens‘ band radio), eine sogenannte „Jedermannfunkanwendung“. Aber Funker sind sie deshalb alle noch nicht.
Andererseits gibt es die Amateure, die ich sehr wohl als Funker (und oft sehr gute!) bezeichnen möchte, obwohl sie aus Liebhaberei und nicht zum Gelderwerb funken.
In der Hochseeschiffahrt und im Flugwesen, den einstigen Domänen der Funkerei, werden meines Wissens heute jedenfalls keine Funker mehr beschäftigt.
Durch zahlreiche Erfindungen und immer wieder technische Verbesserungen kam der kommerzielle Funk etwa in den 1980er Jahren zu seiner Blüte, als es möglich war, praktisch jeden Punkt auf der Erde über Funk zu erreichen. Das Personal, das zur Handhabung dieser Technologie erforderlich war, waren Spezialisten, die durch nichts und niemand zu ersetzen waren, das waren die Funker.
Es wäre ungerecht und unkollegial, in einer Schilderung des Berufs des Funkers die unmittelbaren Vorgänger, die Telegrafisten, zu übergehen. Diesen Könnern der Nachrichtenübermittlung mittels Morsezeichen über Draht- und Kabelverbindungen ist deshalb auch ein Kapitel gewidmet. Und auch die historischen Kollegen der optischen Telegrafenlinien wollte ich dabei nicht ganz übergehen.
Technische Fragen spielen in dieser Darstellung nur dann eine Rolle, wenn sie zum Verständnis der Tätigkeit eines Telegrafisten/Funkers unerläßlich sind. Im Mittelpunkt sollen die Menschen stehen, die auf den verschiedensten Gebieten mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen als Funker tätig waren.
Die geografische Konzentration auf das Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik ergibt sich aus dem Erfahrungsbereich des Autors. Man kann allerdings davon ausgehen, daß die Tätigkeit der Funker in allen Nachbarstaaten ganz ähnlich war. Die eingefügten Berichte und Schilderungen ausländischer Funker bestätigen das.
Es war mir wichtig, möglichst viele Funker selbst zu Wort kommen zu lassen, denn ich wollte erstens möglichst alle Bereiche, in denen Funker tätig waren, sachkundig darstellen und zweitens Authentizität und Farbe damit erreichen.
Allen Freunden und ehemaligen Kollegen danke ich sehr für ihre mündlichen und schriftlichen Auskünfte, für die Überlassung wertvollen Materials und die Genehmigung zur Verwendung in diesem Buch. Durch die unerwartet gute Aufnahme des Buches wurde ich zu dieser gründlich überarbeiteten Neuauflage ermutigt.
Altefähr auf Rügen im Januar 2014
Die Telegrafie vor dem Funk
Abb. 1. Frederic Remington (1861-1909): Rauchzeichen.
Die optische Telegrafie
Bei allen in Gruppen lebenden Wesen ist eine Verständigung auch über größere Entfernungen in vielen Situationen nützlich oder sogar notwendig. Wie das bei einigen Tierarten geschieht, das wissen wir wohl bis heute noch nicht sicher. Etwas klarer scheint das bei unserer eigenen Gattung, dem Menschen, zu sein. Mimik genügte für kurze Entfernungen, Gebärden und einfache Laute reichten weiter, und laute stimmliche Signale erreichten einen Empfänger in noch größerer Entfernung. Dann gab es aber auch Situationen, in denen es wichtig war, Informationen an eine andere Gruppe von Menschen zu übermitteln, die weiter entfernt war als die Reichweite der menschlichen Stimme. Hier mußten technische Hilfsmittel eingesetzt werden: Man konnte weithin sichtbare große Gegenstände in einer bestimmten Weise bewegen, man konnte mit Feuern oder Fackeln Rauch- oder Lichtzeichen oder (bei Sonnenschein) mit reflektierenden Flächen Blinkzeichen geben oder mit Hilfe bestimmter Vorrichtungen laute akustische Signale aussenden. Mit der Entwicklung des menschlichen Denkens wurden diese grundlegenden Möglichkeiten immer weiter verfeinert und in einigen Regionen zu erstaunlicher Perfektion entwickelt. Die Rauchzeichen der Ureinwohner Amerikas und die Trommelsignale der afrikanischen Ureinwohner informierten die Nachbarn in vielen Kilometern Entfernung z.B. über das Eindringen der europäischen Eroberer.
Aus der griechischen und römischen Antike um das Jahr Null sind bereits Beispiele für Nachrichtenübermittlung mittels Feuerzeichen über große Entfernungen bekannt. Die Römer errichteten auf ihren Grenzwällen (Limes) Beobachtungstürme, die auch für die Nachrichtenübermittlung genutzt wurden. Es soll sich dabei u.a. um eine „Fackeltelegraphie“ gehandelt haben, mit der man nicht nur verabredete, sondern sogar frei formulierbare Botschaften in Buchstaben übermitteln konnte. Das Verfahren war denkbar einfach, und das Prinzip wurde in der Geschichte der Telegraphie mehrfach wiederholt: Hinter einer verdeckenden Wand standen Soldaten, die brennende Fackeln links und rechts an einer bestimmten Position hervorhielten. Dabei ergab die jeweilige Position der Fackeln einen Code für einzelne Buchstaben. Trotz aller begreifbaren Mängel brachte dieses Telegraphie-Verfahren den Römern bedeutende militärische Vorteile.
Abb. 2. Albrecht Dürer: Der Postreiter.
Über Jahrhunderte wurden Botschaften dann offenbar durch Läufer oder Reiter, vereinzelt wohl auch durch Vögel befördert, bis am Ende des 18. Jahrhunderts eine europäische Erfindung es ermöglichte, eine Botschaft in wenigen Minuten über eine solche Entfernung zu übermitteln, für die ein Reiter mehrere Tage gebraucht hätte. Das war der Flügeltelegraph, und vielleicht kann man überhaupt erst mit seinem Erscheinen von Telegraphie sprechen. Diese Technologie hatte außer einer gut durchdachten Konstruktion der Signalanlagen noch eine andere technische Voraussetzung, die allerdings schon seit langem existierte: das Fernrohr. Es war zu Beginn des 17. Jh. von dem holländischen Brillenmacher Hans Lipperhey erfunden und danach mehrfach verbessert worden, u.a. von Galileo Galilei. Auf dieser Grundlage funktionierten die einzelnen Signaltürme als Relaisstationen in einer Übertragungskette.
Der französische Flügeltelegraf
Abb. 3. Claude Chappe (1763-1805).
In Frankreich, einem einheitlichen, zentral regierten Staat mit einer großen Fläche, hatten die Behörden und vor allem das Militär allergrößtes Interesse an schnellen Nachrichtenverbindungen, und so ist es nicht erstaunlich, daß hier die Idee und dann die Demonstration einer schnellen Nachrichtenübermittlung mit Hilfe von Flügeltelegrafen auf großes Interesse stieß und auch die erforderliche materielle Unterstützung erfuhr.
Claude Chappe, ein französischen Priester, der durch die Französische Revolution von 1789 „arbeitslos“ geworden war und sich dann zusammen mit seinem Bruder Ignace der Technik widmete, gilt als der Erfinder des Flügeltelegrafen. 1791 stellte er seine Erfindung vor. Sein Flügeltelegraph war ein Semaphor, er bestand aus einem mehrere Meter hohen Mast, an dem ein horizontal verstellbarer Querbalken mit zwei weiteren Balken an jedem Ende angebracht war. Mit diesen Signalarmen konnten 196 unterschiedliche Positionen dargestellt werden, d.h., es konnten mit Hilfe eines entsprechenden Codes 196 verschiedene Zeichen übermittelt werden. In der Praxis wurden jedoch deutlich weniger Positionen angewendet.
Das Chappe-System wurde von mehreren Staaten mit einer großen Flächenausdehnung übernommen: Rußland (St. Petersburg – Warschau), Schweden (bis 1880 ein kurze Strecke für den König in Betrieb!), Dänemark (mit vielen Inseln), England mit zahlreichen Häfen an seiner langen Küste), USA (New York – Philadelphia), Ägypten (Alexandria – Kairo – Suez).
Anders lagen die Verhältnisse auf dem Gebiet, das später Deutschland wurde. Das Land war zersplittert in zahlreiche kleine Fürstentümer, in denen der Landesherr natürlich gar keinen Bedarf an langen Telegrafenlinien sah. Erst nach dem Wiener Kongreß von 1815, als die Rheinprovinz zu Preußen kam, änderte sich hier etwas. Jetzt bestand Preußen geografisch aus zwei großen Inseln, und die mit einer schnellen Nachrichtenlinie zu verbinden lag durchaus im Interesse der politischen Zentrale in Berlin.
Abb. 4. Semaphorstation in Nordfrankreich 1789.
Die preußische Telegrafenlinie Berlin – Koblenz
Abb. 5. Franz O'Etzel (1783-1850).
Der spätere Berliner Geheime Postrat Carl Philipp Heinrich Pistor (1778 – 1847) legte im Dezember 1830 dem preußischen Generalstab eine Denkschrift über die Errichtung einer Telegraphenlinie in den Königlich Preußischen Staaten vor. Nachdem König Friedrich Wilhelm III. im Juli 1832 die Genehmigung zum Bau einer optisch-mechanischen Telegrafenlinie von Berlin bis Koblenz erteilt hatte, wurde die Bauleitung dem Major im Generalstab, Franz August O’Etzel (1783–1850, irischer Abstammung), übertragen. Pistors Werkstätte wurde als Lieferant der Stationsausrüstungen mit Signalgebern und Fernrohren beauftragt. O’Etzel war offenbar genau der richtige Mann für diese Aufgabe. Er entwickelte das Codesystem und die umfangreichen Verfahrensanweisungen für den Betrieb der Telegrafenlinie und leitete das gesamte Projekt ab 1835 als Königlich Preußischer Telegraphendirektor. Er hatte schließlich noch Anteil an der Einführung der elektromechanischen Telegrafie in Preußen.
Bereits 1830 war eine Linie Berlin – Potsdam errichtet worden, und ihre erfolgreiche Arbeitsweise hat den Generalstab und den König sicherlich bewogen, die Verbindung zu den Rheinprovinzen zu beschleunigen. 1832-33 wurde die bestehende Linie verlängert zur Preußischen Telegrafenlinie Berlin – Koblenz. Über die Station 4 auf dem 96 Meter hohen Telegrafenberg in Potsdam führte die Linie nach Brandenburg und Magdeburg (bis 1832) dann weiter über Goslar, Paderborn, Soest, Hagen nach Köln-Flittard und von dort am östlichen Rheinufer entlang bis zur damaligen Kaserne im Koblenzer Schloß. Mit knapp 550 Kilometern Länge und schließlich 62 Stationen war sie dann die längste mitteleuropäische Telegrafenlinie. Die Entfernung zwischen den Stationen betrug zwischen 7,5 und 15km. Ursprünglich war die Linie sozusagen ein geschlossenes System, d.h., es wurden nur Depeschen von der Ausgangs- zur Endstation übermittelt. Erst 1836 bekam auch die wichtige Station in Köln neben Berlin und Koblenz den Status einer Expedition, also einer Station, in der Depeschen aufgenommen und chiffriert sowie dchiffriert und mit Boten zugestellt werden konnten.
Im internationalen Telegrammverkehr benötigte eine Nachricht von Paris nach Berlin, die mittels des französischen Telegrafen nach Metz übermittelt wurde, von dort per Boten über Saarbrücken nach Koblenz gelangte und von dort über den preußischen Telegrafen nach Berlin signalisiert wurde, etwa 30 Stunden.
Eine Liste aller 61 Stationen mit detaillierten Angaben zu jeder Position findet man unter:
wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stationen_des_preußischen_optischen_Telegrafen.
Abb. 6. Schematischer Querschnitt einer preuß. Telegrafenstation.
Die preußischen Flügeltelegrafen unterschieden sich deutlich von den französischen. Unabhängig davon, ob für eine Station ein neues Gebäude errichtet oder ob sie in einem bereits existierenden Turm eingerichtet wurde, immer gab es als Mindesteinrichtung einen separaten Observationsraum, durch dessen Dach ein sicher verankerter Mast ragte. Befand sich eine Station in einer abgelegenen Gegend oder im Ausland (vier Stationen befanden sich ja außerhalb des preußischen Territoriums), wurden dem Bau auch Wohnungen für das Personal mit ihren Familien sowie Lagerräume für Ersatzteile und Pferdeställe für den Notfall angefügt. Es waren dann komplette Wohnungen für zwei Familien und Gärten für die Selbstversorgung vorgesehen.
Der Signalmast trug auf drei Ebenen jeweils rechts und links einen Signalarm, so daß insgesamt sechs Arme (Indikatoren) zur Signalbildung zur Verfügung standen. Die Stellung der Arme konnte vom Observationsraum aus über Seilzüge verändert werden, und zwar in den vier Stufen 0° (Arm hängt am Mast herunter, ist praktisch nicht zu sehen), 45°, 90°, 135°, jeweils bezogen auf die Mast-Senkrechte. Auf diese Weise waren theoretisch 4096 Zeichen darstellbar.
Zur Darstellung eines kompletten Signals sollten die Telegraphisten eine Notation mit folgendem Schema verwenden: Zuerst der Buchstabe für die Etage der Arme A, B, C (von unten nach oben), gefolgt von den Signalen, die die beiden Arme auf der Etage darstellten.
Das leicht einzuprägende Prinzip dieses Signalcodes für die Ziffern 0 – 9 ist in Abb. 7 dargestellt. Bei den Ziffern 0 bis 6 sieht es so aus, als bewege sich ein Arm wie ein Uhrzeiger in Schritten von 45°, dann bleibt der Arm auf der Stellung „6“, und der zweite Arm zählt weiter: 6+1=7, 6+2=8, 6+3=9.
Doppelzahlen (getrennt durch einen Punkt) ergaben sich, wenn der rechte Arm 1, 2 oder 3 anzeigte und der linke 4 oder 5. Dabei wurde die Anzeige des linken Armes zuerst gelesen. In den Abbildungen finden sich praktische Beispiele.
Die Fernrohre zur Beobachtung der Nachbarstationen lieferten nach heutiger Erkenntnis eine 40-bis 60fache Vergrößerung.
Bemerkenswert ist sicher auch, daß für alle Stationen der Telegrafenlinie eine einheitliche Zeit festgelegt wurde, und zwar die Berliner Ortszeit, von der die am westlichsten gelegenen Stationen um immerhin 20 Minuten abwichen. Die regelmäßige Übermittlung eines Zeitsignals (Laufzeit max. eine Minute) sicherte eine verhältnismäßig präzise Synchronisierung der Stationen.
Abb. 7. Beispielnotationen im preußischen Signalsystem
In diesem System konnte eine Station maximal zwei Zeichen pro Minute ablesen und stellen, im normalen Depeschenverkehr durchlief ein Zeichen die Strecke in 7½ bis 14 Minuten. Mit dem französischen Chappe-System erreichte man zwar fast die doppelte Zeichengeschwin-digkeit, aber die Preußen konnten das durch ihr wesentlich größeres Zeichenrepertoire (Preußen: 4096, Chappe: 196) ausgleichen. Praktisch verwendet wurden auf der preußischen Linie allerdings „nur“ etwa 2200 Zeichen.
Die Anforderungen an die beiden im Observationsraum tätigen Telegrafisten waren auch nach heutigen Maßstäben recht hoch. Sie mußten zwar nicht ununterbrochen, aber doch sehr häufig und vor allem sehr intensiv durch ein Fernrohr die Nachbarstationen beobachten. Nach der Vorschrift mußte der Beobachter alle sechs Minuten bei beiden Nachbarstationen feststellen, ob dort ein neues Signal gesetzt war. Für die Richtung Köln – Berlin gab es zwar feste Übertragungszeiten, doch wegen möglicher dringender Depeschen („citissime“) sollte eine dauernde Empfangsbereitschaft gesichert sein. Wurde von einer Nachbarstation eine neue Depesche angekündigt, bestimmte die Übermittlungsvorschrift die folgenden vier „Hauptgeschäfte“:
Der Spähtelegrafist liest die Notation von der sendenden Station ab und diktiert sie laut seinem Kollegen in der vorgeschriebenen Reihenfolge (von Ebene A zu C jeweils zuerst der linke Arm, dann der rechte);
dieser (der Kurbeltelegrafist) stellt die angesagte Notation an der eigenen Steuereinrichtung ein und geht dann zum Fernrohr, um bei der nachfolgenden Station zu kontrollieren, ob sie das richtige Zeichen eingestellt hat (das Zeichen erschien für ihn dann gespiegelt, er sah es ja „von hinten“); der erste Telegrafist kontrolliert an der eigenen Steueranlage, ob das Zeichen richtig eingestellt wurde und trägt es dann ins Journal ein; der Kurbeltelegrafist bringt die eigenen Indikatoren in die Nullstellung als Bestätigung für die empfangende Station, daß sie die richtige Notation weitergegeben hat, und als Aufforderung an die sendende Station, mit der Sendung fortzufahren.
Welchen Text sie da übermittelten, erfuhren die Telegrafisten nicht, für sie gab es nur die Notationen für die Indikatorenstellungen, die ja codiert waren. Das konnte etwa so aussehen:
B4.3 C4.2 - A6 B3 C7 - B5.1 C8 - B6.2 C5.3 usw.
Abb. 8. Zwei preußische Telegrafisten im Observationsraum.
Die Protokollierung aller empfangenen und gesendeten Notationen im Stationsjournal war auf der preußischen Telegrafenlinie Vorschrift, auf den französischen Linien nicht. Auch dadurch brauchte die Übermittlung einer Nachricht auf der preußischen Linie etwas mehr Zeit.
Im Interesse einer schnelleren Übermittlung war die Ausgangsexpedition befugt, die oft umständlich formulierten und mit langen Personentiteln überladenen Staatsdepeschen zu vereinfachen, d.h. zu verkürzen. Die Bestimmungsexpedition hatte dann den übermittelten verkürzten Text allerdings wieder mit dem üblichen „Schmuck“ zu versehen, bevor die Depesche an den zustellenden Boten übergeben wurde. Dazu kam dann noch die Codierung bzw. Decodierung, so daß es erklärlich ist, daß eine längere Depesche mehrere Stunden bei dem Inspektor einer Expedition in Arbeit war, bevor sie einem Telegrafisten zum Senden bzw. einem Boten zur Zustellung an den Empfänger übergeben wurde. Der Wortlaut der aufgegebenen Depesche konnte deshalb nie mit dem Wortlaut der Depesche, die der Empfänger dann in den Händen hielt, übereinstimmen. Aber das hat merkwürdigerweise wohl nie jemand moniert. Wie die späteren Funktelegramme enthielt jede Depesche außer dem Namen der absendenden Station auch Datum und Uhrzeit der Aufgabe. Die Telegrafenlinie Berlin – Koblenz war für das Militär (Preußens neue Westgrenze zu Frankreich!) konzipiert, eine private Nutzung war nicht vorgesehen. Auch ein Gesuch der Kaufmannschaft von Berlin diese Linie zur Übermittlung von Handels- und Börsennachrichten nutzen zu dürfen, wurde 1834 vom König abgelehnt. Erst ab 1835 war dem Ministerium des Inneren und der Polizei, später dann auch dem Finanz- und dem Außenministerium die Nutzung gestattet. Um 1840 gab es eine begrenzte Öffnung der Telegrafenlinie für die Presse, deren Meldungen vor ihrer Freigabe selbstverständlich einer monarchie-freundlichen Zensur unterlagen.
Zeitgenössische Quellen geben einen Durchsatz von 2 bis 6 Depeschen pro Tag an bei einer täglichen durch die Lichtverhältnisse begrenzten Betriebszeit von etwa 6 Stunden im Sommer und etwa drei Stunden im Winter. Auch sichtbehindernde Witterungen wie Nebel, Regen oder Schneefall konnten das Erkennen der Stellung der Indikatoren spürbar beeinträchtigen oder sogar unmöglich machen; Ausfälle der Linie über mehrere Tage oder gar Wochen sind belegt. Wenn man nun die effektiv zur Verfügung stehende Zeit ins Verhältnis setzt zur Übermittlungsgeschwindigkeit und zur Länge der Staatsdepeschen, dann ist einzusehen, daß an eine Nutzung der Telegrafenlinie auch für private Zwecke gar nicht zu denken war.
Außer den codierten Staatsdepeschen konnten zwischen den einzelnen Stationen auch betriebliche Informationen ausgetauscht werden. Das waren die einzigen Signale, deren Inhalt die Telegrafisten auf den Stationen verstanden. Der Wortlaut dieser Informationen und ihre jeweilige Notation waren nämlich in einem Wörterbuch für die Telegraphisten-Correspondenz verzeichnet, das auf jeder Station vorhanden war. Funker werden hier sicher gleich an den von ihnen verwendeten Q-Gruppen-Code denken. Ein paar Beispiele für Betriebsabkürzungen in der optischen Telegrafie auf Seite →.
Das Personal
Abb. 9. Signalarme (oben) und Steueranlage (Rekonstruktion).
Das Personal auf den preußischen Telegrafiestationen bestand selbstverständlich aus Militärangehörigen. Sie kamen aus einer neu aufgestellten etwa 200 Mann starken Spezialeinheit, dem Telegraphen-Corps, das dem Chef des Generalstabs der Armee unterstand und von dem bereits genannten Königlich Preußischen Telegraphendirektor Generalmajor O’Etzel geleitet wurde. Auf jeder Station waren mindestens zwei Telegrafisten (Ober- und Untertelegrafist) eingesetzt, dazu kamen manchmal Reserve-Telegrafisten. Die Expeditionen hatten natürlich mehr Personal, vor allem auch Boten für die Zustellung, die einem Oberinspektor unterstanden.
Die Telegrafisten auf den Stationen waren altgediente Militärangehörige, oft im Rang eines Unteroffiziers mit Anspruch auf Anstellung oder Versorgung. Zu den Voraussetzungen für die Aufnahme in das Telegraphen-Corps gehörten ein „in jeder Beziehung anständiges Betragen“ sowie ein gutes technisches Verständnis und gute Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen (nach dem Instructionsbuch für Telegraphisten, Band 1: Eigenschaften eines guten Telegraphenbeamten). Über eine spezielle Ausbildung der Telegrafisten ist mir nichts bekannt. Wahrscheinlich gab es im Telegraphen-Corps verschiedene Kurse, in denen das Ablesen und Einstellen der Signale erlernt und trainiert wurde. Dafür spricht auch, daß innerhalb des Corps Beförderungen möglich und auf den Stationen Ober- und Untertelegrafisten tätig waren. In dem obengenannten Instructionsbuch wurde jedenfalls betont, daß man von jedem Telegrafisten regelmäßiges, fleißiges Üben erwartete. Die Angehörigen des Corps wurden zur Verschwiegenheit verpflichtet und als Beamte vereidigt, sie waren also Militärbeamte. Von ihnen wurde die strikte Befolgung einer strengen militärischen Disziplin verlangt, aber sie hatten auch ein gutes Auskommen. Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, verrichteten sie ihre Tätigkeit in voller Montur. Dazu hatten sie in den meisten Fällen das Recht auf eine Dienstwohnung für ihre Familie in der Telegrafenstation. Damit hatten die Angehörigen des Telegraphen-Corps eine angesehene soziale Stellung.
Abb. 10. Die "Redesätze" kann man als Vorläufer des späteren Q-Codes betrachten.
Abb. 11. Die Notation in dem Logo signalisiert: A4.3 - B4.1 - C4.2.
Am 12. Oktober 1852 wurde als das letzte Stück der preußischen Telegraphenlinie die Strecke Köln – Koblenz eingestellt; überall gab es inzwischen Leitungen für das neue Verfahren: die elektrische Telegrafie. Einzelne Stationen der preußischen Linie sind heute noch in Resten zu sehen, einige wurden in den letzten Jahrzehnten auch rekonstruiert und sind durchaus sehenswerte kleine Museen. In Potsdam gibt es eine Interessengemeinschaft Optischer Telegraph in Preußen Station 4 Potsdam Telegrafenberg, die im Internet nützliche Informationen verbreitet.
Die Telegrafenlinien Cuxhaven – Hamburg und Bremerhaven – Bremen
Unter den Hamburger Reedern und Kaufleuten kam kurz nach der Einführung des Chappeschen Telegrafen in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts die Idee auf, diese Art der Nachrichtenübermittlung auch für ihre Zwecke zu verwenden. Für sie war es nämlich von großer ökonomischer Bedeutung, so früh wie möglich zu erfahren, welches Schiff mit welcher Ladung wann einlaufen würde. Wenn ein Schiff mit Bestimmungshafen Hamburg in Cuxhaven gesichtet wurde, brauchte es immerhin noch vier bis fünf Stunden bis in den Hamburger Hafen. Man schickte sogleich eine Studienkommission nach Frankreich, aber es sollte (offenbar aus finanziellen Gründen) noch bis 1837 dauern, bis die erste Linie Hamburg – Cuxhaven mit 32 Telegrafisten den Betrieb aufnahm. Jetzt konnten die Schiffsmeldungen über sieben Relaisstationen in wenigen Minuten von Beobachtungsstellen in Cuxhaven nach Hamburg übermittelt werden. Der sehr aktive Initiator und Betreiber der Linie war ein Altonaer Kaufmann namens Johann Ludwig Schmidt. Er erdachte auch das Telegrafiesystem, das sich mit seinen Zeigern grundsätzlich an die bereits bestehenden französischen und preußischen Systeme anlehnte, aber doch eine eigene Entwicklung war. Aus diesem Grunde soll es hier kurz erläutert werden.
Abb. 12. Verlauf der Schmidtschen Telegrafenlinien.
Der Schmidtsche Telegraf bestand aus drei unabhängig voneinander einzustellenden Signalarmen, die in der „Ruhestellung“ ein Kreuz bildeten und in dieser Form auch meist auf den seltenen Abbildungen zu sehen sind. Jeder Arm konnte mit Hilfe eines über eine Rolle laufenden Seilzuges in acht verschiedene Stellungen (22,5-Grad-Schritte) gebracht werden. Damit waren weit mehr Signaleinstellungen möglich, als tatsächlich gebraucht wurden. Im Schmidtschen Telegrafiesystem waren alle Buchstaben, die Zahlen 0 bis 12 und Satzzeichen enthalten, darüber hinaus auch ganze Wendungen und Sätze.
Obwohl Kaufmann Schmidt mit seiner Aktiengesellschaft die Telegrafenlinie Hamburg – Cuxhaven sehr bald auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellte, blieb der geschäftliche Erfolg aus. Erst als Clemens Gerke 1841 als Telegrafeninspektor der Hamburg-Cuxhavener optischen Telegraphen-Compagnie eingestellt wurde, änderte sich das – allerdings zu spät. Die elektrische Telegrafie
löste überall die optischen Telegrafenlinien ab, Gehrke selbst wechselte auf das neue Gebiet und machte sich dort einen Namen durch die Verbesserung des amerikanischen Morse-Codes.
Schmidt jedoch baute1846 noch eine zweite optische Telegrafenlinie, die sogenannte „Weserlinie“ zwischen Bremerhaven und Bremen, und die ergänzte er im gleichen Jahr durch eine Querverbindung zwischen den beiden Linien, das war die Strecke Bremerhaven – Hechthausen (siehe Abb. 12). Und 1848 soll sogar noch ein nördlicher Abzweig der Weserlinie nach Wremen gebaut worden sein. Jedoch wurde zur selben Zeit, als Schmidt seine Weserlinie fertigstellte, bereits die elektrische Telegrafenlinie Bremen–Bremerhaven als erste längere elektrische Telegrafenstrecke innerhalb Europas in Betrieb genommen. Sie arbeitete mit elektrischen Zeigertelegrafen und war dem Schmidtschen System natürlich haushoch überlegen.
Die beiden Schmidtschen Telegrafenlinien waren seinerzeit die einzigen öffentlich zugänglichen; sie entstanden aus dem Kommunikationsbedürfnis der Hamburger und Bremer Reeder und Kaufleute. Die großen Linien in Frankreich, England und Preußen dagegen wurden vom Staat errichtet und vom Militär betrieben und dienten ausschließlich militärischen und staatlichen Bedürfnissen.
Die verzweifelte Verteidigung der „Holztelegrafie“ und die Verteufelung der elektrischen Telegrafie als gesundheits- und umweltschädigend, die Schmidt auch mit kuriosen Mitteln betrieb, erinnern ein wenig an Don Quichotes Kampf mit den Windmühlenflügeln. Und es erinnert uns auch an das Ende unserer geliebten Funktelegrafie knapp 150 Jahre später. Im August 1849 mußte die Linie Hamburg – Cuxhaven den Betrieb einstellen, die Weserlinie folgte 1852.
Andere europäische Telegrafiesysteme
Eine schwedische Erfindung: die Klappentelegrafie
Nur wenigen Menschen wird der Name Abraham Niclas Edelcrantz (1754 – 1821) heute noch etwas sagen, dabei war er in seiner Zeit ein bekannter Mann in Europa. Er soll hier nicht genannt werden wegen seiner Leistungen als Schriftsteller, Theatermann, Wissenschaftler und Privatsekretär des schwedischen Königs, die ihm einen Eintrag in so manchem Lexikon sicherten. Für uns hier ist er interessant durch seine Erfindung eines seinerzeit weitverbreiteten optischen Signalsystems. Es wurde 1794 in Schweden offiziell eingeführt.
Edelcrantz verwendete keine Flügelarme, sondern Klappen in Rahmen. Diese quadratischen Klappen mit einer Seitenlänge von etwa 2 Metern konnten mit Hilfe eines Seilzuges senkrecht und waagerecht gestellt werden. Das geschah mit einem Fußpedal, später auch mit einer Kurbel. Einmal füllte die Klappe den Rahmen aus und einmal war sie (waagerecht liegend) aus der Entfernung kaum wahrzunehmen, der Rahmen erschien also leer. Für jeden Rahmen gab es also nur zwei Zustände: „geschlossen“ und „offen“. Die für eine Nachrichtenübermittlung notwendige Vielfalt der Zeichen wurde durch die Anordnung von drei (später vier) Reihen mit jeweils drei Rahmen erreicht. Dazu kam noch eine einzelne, größere Klappe ganz oben, mit der die Anzahl der möglichen Einstellungen noch einmal verdoppelt werden konnte. Damit standen mehr als genug Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung. Das System erscheint zunächst kompliziert, wurde aber in Schweden (sogar bis 1880!) und Finnland erfolgreich eingesetzt und soll fast doppelt so schnell wie das Chappe-System gearbeitet haben. Auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung, im Jahre 1809, hatte das schwedische Telegrafennetz eine Länge von 124 Meilen (~ 200km) mit 50 Stationen.
»Die Telegraphen wurden hauptsächlich von militärischem Personal bedient. Edelcrantz beschrieb die minimalen Anforderungen an das Bedienungspersonal wie folgt: „…Die Beamten und Soldaten, welche die Telegraphen bedienen sollen, sollten in der Lage sein zu lesen und Zahlen aufzuschreiben. Des Weiteren würde es sehr hilfreich sein, wenn diese einfache arithmetische Berechnungen durchführen könnten.…“ Die Vorbereitung des Bedienungspersonals dauerte eine Woche, eine Stunde pro Tag. Ein Offizier pro Regiment im Bereich Stockholm und ein Soldat pro Kompanie wurden dem Royal Telegraphie Corps zugeteilt.« (Holger Weiß auf seiner Webseite „Die Geschichte der Telegrafie“.)
(http://www.devcon3.de/optische-telegraphie.htm)
Die englischen Telegrafiesysteme
Nach dem Erfolg der chappeschen Telegrafenlinien im napoleonischen Frankreich bemühten sich Ausgang des 18. Jh. mehrere Staaten, eigene optische Telegrafenlinien einzurichten, und das Vereinigte Königreich machte da natürlich keine Ausnahme. Unter der Regie (oder muß man hier sagen: unter dem Kommando?) der britischen Admiralität wurden optische Telegrafenlinien vor allem entlang der Südostküste errichtet und betrieben, denn es war die Zeit der napoleonischen Kriege. Fremde Schiffsbewegungen vor der eigenen Küste sollten möglichst schnell an die Admiralität gemeldet werden, und die wollte ihre Flotten rechtzeitig an den richtigen Ort dirigieren.
Es wäre dem britischen Nationalstolz nicht möglich gewesen, das bereits erprobte französische System zu übernehmen, es mußte etwas ganz Eigenes, eben Britisches sein. In den etwa 50 Jahren der optischen Telegrafie hat es in Großbritannien mindestens ein halbes Dutzend Vorschläge unterschiedlichster Art gegeben. Es setzte sich 1796 auf der Strecke London - Deal zunächst ein Klappen-System durch, das der spätere Bischof Lord George Murray (1761-1803) vorgelegt hatte; es war bis 1816 im Einsatz. Murray gab sein System als eigene Erfindung aus, aber dem war wohl nicht so, denn der finnische Schwede Niclas Edelcrantz veröffentlichte ein Büchlein, in dem er die englische „Erfindung“ des Lord George Murray als eine plumpe Verarbeitung seines eigenen, zwei Jahre zuvor eingeführten Systems bezeichnete. Die britische Sicht auf die Dinge war (und ist?) jedoch wie in vielen anderen Fällen eine andere. Die Online-Enzyklopädie The Gazetteer for Scotland (http://www.scottish-places.info/people/) zum Beispiel schreibt zu Lord George Murray: »Lord George Murray (30 January 1761 – 3 June 1803) developing Britain's first optical telegraph, which began relaying messages from London to Deal in 1796.
The optical telegraph was first invented by Frenchman Claude Chappe, but his system was complex and little used. However, in 1796, Murray developed the shutter telegraph, which used six pivoting boards to encode messages character-by-character and designed a system to transmit messages from London to the British warships lying in Portsmouth Harbour. The system involved a chain of ten relay stations, built on high-ground, up to 11 miles (18km) apart. The Admiralty made good use of the system, which was much more effective than Chappe's original, allowing orders to reach their destination in a matter of minutes, and paid Murray £2000 for his efforts. Further lines were set up between London, Yarmouth and Plymouth but the network did not survive the end of the Napoleonic Wars, when it was dismantled.« (Holger Weiß, a.a.O.)
Nur mal zur Erinnerung: Mit dem „komplizierten und wenig gebrauchten“ französischen System wurden bereits um 1800 Nachrichten auf 29 Linien übermittelt, 1844 bestanden in Frankreich 5.000km Chappe-Linien mit 534 ständigen Stationen. Napoleon konnte mit dem System Chappe immerhin Nachrichten von Toulon (Südfrankreich) über Mainz und über die Endstelle des preußischen Systems in Koblenz nach Berlin übermitteln.
Murray selbst pries die Einfachheit seiner Maschinen mit der Absicht, sie für die kommerzielle Nutzung interessant zu machen:
»… one person will suffice to operate even the largest telegraph, especially at the terminal stations. The telescope, which should be available at every station, should be placed close by, so that the operator can observe and operate the shutters; however, for the sake of greater accuracy, and especially at the intermediate stations, where observations need to be made with two telescopes and in two opposite directions, two people should be at hand to relieve each other in the observations while the machine is idle. This does not require any more understanding than possessed naturally by most people.
Almost the only skill required is the ability to write numbers and to add the numbers 1, 2, and 4. During the experiments that I carried out for the past 1/2 years, young children could easily be employed. They could be trained in a few hours. That is why I thought that, especially for the largest machines, I should sacrifice some of the simplicity of design and construction for the greatest simplicity and ease of operation. When one is often forced to utilize less trained people, it is important not to burden their memories or their understanding with too many different facts.«
(http://royal-signals.org.uk/Datasheets/Telegraph%20.php 16.11.2012)
Murray änderte sein System mehrmals. Bei der Einführung war es ein Sechs-Klappen-Telegraf, der kurz darauf in einen Neun-Klappen-Telegraf umgewandelt wurde und schließlich noch eine zehnte Klappe obenauf erhielt. Das war dann genau das gleiche Prinzip des Klappensystems von Edelcrantz aus dem Jahre 1794. Diese häufigen Änderungen machten es dem Personal schwer, sich richtig in ein Verfahren einzuarbeiten.
1806 folgte die britische Admiralität der Kritik von seiten der Konkurrenten Murrays und führte offiziell das System ihres Adminrals Sir Home Riggs Popham (1762-1820) ein. Das bedeutete die Abkehr von dem Klappentelegrafen und die Einführung des zweiarmigen Zeigertelegrafen. Als ein wesentlicher Vorteil wurde auch gesehen, daß für die Bedienung einer Station in Home Pophams System nur zwei Mann gebraucht wurden, während bei Murray vier Mann nötig waren.
1822 wurde Pophams System dann noch einmal von Colonel (später General) Charles W. Pasley (1780-1861) überarbeitet. Jetzt war die Länge der beiden Arme vorgeschrieben, nämlich 1 Fuß (= 0,30cm) pro zu überbrückendem Kilometer, was auf eine Länge von 6 bis 8 Fuß (1,8 – 2,4 Meter) hinauslief. Es gab 64 Kombinationsmöglichkeiten; die Bedienung war mit einem einzigen Mann möglich. Die Royal Navy behielt dieses System, allerdings mit nur einem Signalarm, auf ihren Schiffen bis 1943 bei.
Die niederländische Scheibentelegrafie
Als sich Belgien 1830 als von den Niederlanden unabhängiger Staat erklärte, hielt man es in S’Gravenhage (heute: Den Haag) für angezeigt, für den Fall eines Krieges eine Telegrafenverbindung zur Verfügung zu haben. Der Industrielle Antoine Lipkens wurde beauftragt, eine Linie zu errichten. Er entwarf ein System mit sechs um ihre Achse drehbaren Scheiben von je zwei Meter Durchmesser. Die Scheiben waren allerdings nicht wie bei den schon länger bekannten Klappentelegrafen in einem Rahmen angeordnet, sondern am Ende langer Standen befestigt. Durch Drehen der Stangen konnten sie aber ebenfalls in die Stellungen „sichtbar“ und „nicht sichtbar“ gebracht werden. Auf zeitgenössischen Abbildungen sieht man häufig, daß hohe Kirchtürme als Träger der Signalanlagen dienten. Auf Kirchtürme hätte man keine Gerüste für die herkömmlichen Klappentelegrafen setzen können, so sparten sich die Holländer die Errichtung neuer Hochbauten. Es sieht schon merkwürdig aus, wenn aus einem Kirchturm sechs Stangen hervorragen, doch diese Lösung war möglich, weil die Kirchen in Holland den Kommunen, also dem Staat unterstanden und nicht den religiösen Institutionen. Und die wiederum werden froh gewesen sein, wenn der Staat damit auch die Kosten für die Erhaltung des ganzen Gebäudes übernahm.
Eine erste Linie zwischen S’Gravenhage und Breda über Rotterdam nahm 1831 den Betrieb auf, kurz darauf wurde in einem Abzweig von Breda die Marinebasis Vlissingen angeschlossen über Bergen-op-Zoom, Bat und Arnemuiden. Zwischen S’Gravenhage und Vlissingen lagen 17 Relais-Stationen. Schließlich war das ganze Land mit zuverlässig arbeitenden Telegrafenstationen überzogen. Der Scheibentelegraf war in den Niederlanden bis 1831 in Betrieb.
Optische Telegrafie in Rußland
Eine erste optische Telegrafenlinie gab es zwar schon 1824 zwischen St. Petersburg und dem Ladogasee, aber das war nicht mehr als ein Versuch. Zar Nikolaus I., der 1825 den Thron bestieg und gleichzeitig König von „Kongreß-Polen“ war, legte mehr Wert auf die Telegrafie, und so wurde 1833 eine Linie zwischen dem Winterpalais und der Festung Kronstadt errichtet, kurz darauf wurde die kaiserliche Sommer-Residenz in Zarskoja Selo mit St. Petersburg (etwa 25km) verbunden. Es lief also ebenso wie in Schweden: der König hat Bedürfnisse, dann kommt das Militär. Und das russische Militär hatte viel zu tun mit der Unterdrückung der polnischen Aufstände in Warschau. Also wurde innerhalb kürzester Zeit eine optische Telegrafenverbinung zwischen St. Petersburg und Warschau (1.200km, 149 Stationen mit 1.908 Personen Personal) errichtet. Sie nahm 1839 den Betrieb auf und konnte auch nachts eingesetzt werden.
Aus ebenfall rein militärischen Gründen wurde 1854 eine Linie von Kronstadt nach Hanko (42 Sationen) in zwei Monaten gebaut. Wegen der Wetterlagen mit häufig schlechter Sicht wurden Reiter bzw. Ruderboote zur Überbrückung ausgefallener Stationen stationiert. Wenig später wurde die Linie sogar noch bis Turku und Nystad verlängert. Die gesamte Linie wurde von 22 Offizieren und 460 Mann betrieben.
Die laufenden technischen Verbesserungen in der Morsetelegrafie ab den 1830er Jahren machten die Überlegenheit dieser Technologie über die optische Telegrafie immer deutlicher:
Die Übertragungsgeschwindigkeit einer Nachricht war bedeutend höher.
Die Verbindungslinien waren billiger zu bauen und zu unterhalten.
Die elektrischen Linien konnten ununterbrochen bei jedem Wetter betrieben werden.
Obwohl beide Technologien in vielen Ländern noch ein paar Jahrzehnte parallel verwendet wurden, war das baldige Ende der optischen Telegrafie klar zu erkennen, und das nicht nur in Ländern wie Preußen und Rußland, die ihre optischen Telegrafenlinien gerade erst errichtet hatten.
Die optische Telegrafie war fast ein halbes Jahrhundert lang die schnellste Möglichkeit, eine Textnachricht über große Entfernungen zu übermitteln.
Abb. 14. Eine preußische Telegrafiestation.
Abb. 13. Französisches System nach Chappe auf dem Louvre in Paris.
Abb. 15. Holländische Scheibentelegrafie. Station Bergen op Zoom
Abb. 16. Eine schwedische Station nach dem System von Edelkrantz
Abb. 18. Der britische Klappentelegraph nach Murray.
Abb. 17. System Murray. Beispiel für Klappenstellungen.
Die elektrische Telegrafie
Von der Entdeckung der Elektrizität im Jahre 1600 bis zu den ersten Ideen, daß man deren hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit zur Übertragung von Nachrichten nutzen könnte, vergingen anderthalb Jahrhunderte. Schon bevor man die Elektrizität speichern konnte, wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jh. sowohl mehrere Ideen zur Übertragung von Buchstaben mit Hilfe elektrischer Impulse als auch zur Konstruktion mehradriger unterirdischer Leitungen geboren. In dieser Zeit gab man einem elektrischen Übertragungssystem in Spanien bereits den Namen telégrafo. Mehrere Entdeckungen und Erfindungen beschleunigten die technische Entwicklung zu Beginn des 19. Jh. und führten nach der Entdeckung des Elektromagnetismus 1820 zu immer praktikableren Telegrafen.
Telegrafie vor Morse
Carl August von Steinheil (1801-1870), ein deutscher Physiker, Astronom und Optiker, konstruierte 1836 den ersten voll funktionsfähigen Schreibtelegrafen. In seinem System wurden positive und negative Spannungsimpulse übertragen, die auf der Empfängerseite je einen Schreibstift über einem vorbeigezogenen Papierstreifen aktivierten. Die beiden Stifte zeichneten entsprechend den ankommenden Impulsen Punkte in zwei parallelen Spuren auf. Auf dieser Grundlage entwickelte Steinheil einen Code, in dem er die Anzahl der Punkte für ein Zeichen (Buchstaben und Ziffern) auf vier begrenzte. Dadurch standen dem System dann lediglich 31 unterschiedliche Zeichen zur Verfügung, so daß es etliche Doppelbelegungen gab.
Wenn das Steinheil-System wegen seiner Kompliziertheit auch keinen Eingang in die Telegrafiepraxis fand, so war mit ihm doch nachgewiesen worden, daß Texte mit der Geschwindigkeit der Elektrizität über größere Entfernungen übertragen werden konnten.
Abb. 19. Der Steinheil-Code.
Eine andere Entwicklungsrichtung führte zu den Nadel- und Zeigertelegrafen. Eine bestimmte Einstellung auf einer Art Zifferblatt auf der sendenden Seite führte zu einer entsprechenden Stellung von Nadeln oder eines Zeigers bei dem empfangenden Gerät.
Eine Textübertragung war also direkt ohne Codierung möglich. Die deutschen Wissenschaftler Carl Friedrich Gauß (1777-1855) und Wilhelm Weber (1804-1891) lieferten die Grundlagen, nach denen die Engländer William Fothergill Cooke (1806-1879) und Charles Wheatstone (1802-1875) einen Zeiger-Telegrafen konstruierten, der mit mehreren nachfolgenden Veränderungen ab 1837 für viele Jahre in England im praktischen Einsatz war. In Deutschland bevorzugte man den von Werner von Siemens (1816-1892) gebauten Nadeltelegrafen, der ab 1848 auf der Telegrafenlinie von Berlin nach Frankfurt/M. eingesetzt wurde.
1838 entdeckte Steinheil, daß für eine Telegrafieverbindung nicht unbedingt zwei Drähte (Hin- und Rückleitung) nötig waren; ein einzelner, gut isolierter Draht genügte, denn die Funktion des Rückleiters konnte das Erdreich übernehmen.
Trotzdem setzte sich letzten Endes ein Übertragungssystem mit Codierung durch: die „Morse-Telegrafie“. Wenn bei diesem Übertragungsverfahren auch speziell ausgebildetes Personal benötigt wurde, die wesentlich höhere Übertragungsgeschwindigkeit gab den Ausschlag. Der Faktor Schnelligkeit spielte im internationalen Wirtschaftsleben eine immer größere Rolle.
Die Morse-Telegrafie
Als 1820/30 der Elektromagnetismus bekannt wurde, beschäftigten sich mehrere Wissenschaftler auch mit der praktischen Nutzanwendung dieser Erscheinung: Ein Eisenstab wird magnetisch, wenn er in einer von Strom durchflossenen Drahtspule steckt; unterbricht man den Stromfluß, verschwindet die Magnetwirkung wieder.
In den USA konstruierte der Physiker Joseph Henry (1797-1878) einen Elektromagneten, der eine Last von fast 10kg (22 lb) heben konnte. Aber er demonstrierte auch eine andere Nutzanwendung des Elektromagneten. Er schickte einen elektrischen Impuls über eine Leitung von einer Meile (etwa 1,6km) Länge, um dort einen Elektromagneten zu aktivieren, der ein eisernes Hebelchen anzog, welches dann gegen eine Glocke schlug und somit ein akustisches Signal erzeugte. Damit hatte er praktisch den elektromagnetischen Telegrafen erfunden. Die Lorbeeren ernteten jedoch andere, Henry war Wissenschaftler, kein Unternehmer. Er war der Ansicht, daß wissenschaftliche Entdeckungen und Erfindungen allen Menschen gehören sollten; sich seine Erfindungen durch ein Patent zu sichern, darauf kam er nicht.
Das war 1830, als man in Preußen gerade erst dabei war, den Flügeltelegrafen einzuführen. Doch das lag nicht unbedingt an der preußischen Bürokratie, in allen Ländern existierte die optische Telegrafie noch Jahrzehnte parallel zur elektrischen Telegrafie. Der Grund dafür ist wohl einfach darin zu sehen, daß man mit der optischen Telegrafie etwas Erprobtes und Bewährtes in der Hand hatte, während die politisch Verantwortlichen und die Geldgeber (heute sagt man wohl „Entscheidungsträger“ und „Sponsoren“) sich noch nicht recht vorstellen konnten, daß man aus dieser unsichtbaren Elektrizität einen praktischen Nutzen ziehen könnte.
Einer indessen konnte sich vorstellen, Henrys Demonstration einer Fernwirkung auch zur Übermittlung ganzer Nachrichten mit der Geschwindigkeit des elektrischen Stroms zu nutzen. Zwei Probleme gab es noch, doch die waren lösbar. Man mußte erstens die durch den Draht geschickten elektrischen Impulse auf eine bestimmte Weise variieren und diesen unterschiedlichen Signalen eine zu verabredende Bedeutung geben. Zweitens wäre es hilfreich, auf der Empfangsseite eine Vorrichtung zu haben, die diese verabredeten Signale aufzeichnete. Der Mann, der das erkannte und mit unternehmerischer Tatkraft und einer regelrechten Sucht nach Ruhm daranging, seine Idee zu verwirklichen, war der US-Amerikaner Samuel Finley Morse (1791-1872). Er nutzte dabei alle bis dahin gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen, die er sich genau ansah, um aus ihnen zu lernen. Dabei war er bei der Übernahme fremder Ideen und Konstruktionen nicht gerade pingelig. Mit Steinheil und Wheatstone, deren Arbeiten er aus eigener Anschauung kannte, geriet er sogar in Streit über die Urheberschaft. Und erst auf seinem Sterbebett im Alter von 80 Jahren soll er bekannt haben, daß er seinem fähigsten Mitarbeiter, Alfred Vail, Unrecht getan hatte.
Abb. 20. Samuel Morse ( 1791-1872).
Die Entstehung der „Morse-Zeichen“
Daß die bis heute bekannten “Morse-Zeichen“, also der aus „Punkten“ und „Strichen“ bestehende Telegrafie-Code, gar nicht der Code ist, der seinerzeit von Morse erfunden wurde, das ist wenig bekannt, aber eine Tatsache. Das von Samuel Morse erdachte System bestand aus der Übermittlung verschiedener Kombinationen von kurzen elektrischen Impulsen für die Ziffern 1 bis 0 und einem aus einer Malerstaffelei konstruierten Gerät zur schriftlichen Aufzeichnung dieser Impulse. Dazu gehörte ein Code-Buch, in dem jedem englischen(!) Wort und auch jedem einzelnen Buchstaben eine Zahl zugeordnet war. Zum Senden mußte ein Text also mit Hilfe des Code-Buches in eine Reihe von Zahlen übertragen werden, und auf der Empfangsseite mußte dasselbe in umgekehrter Reihenfolge geschehen.
Ein englisches Plakat von 1843 warb für öffentliche Vorführungen eines elektro-magnetischen Telegrafen, der Nachrichten mit der Geschwindigkeit von 280.000 Meilen pro Sekunde übertragen kann. Das muß zu der Zeit eine Sensation gewesen sein wie für uns die Landung eines Menschen auf dem Mond. Der interessante Text folgt hier. (Damals hieß der elektrische Strom im Englischen noch nicht „electric current“, sondern „electric fluid“!)
THE WONDER of the AGE!!
INSTANTANEOUS COMMUNICATION.
—————————
Under the special Patronage of Her Majesty & H.R.H. Prince Albert
———————
THE GALVANIC AND ELECTRO-MAGNETIC
TELEGRAPHS,
on the
GT. WESTERN RAILWAY.
May be seen in constant operation, daily, (Sundays excepted) from 9 till 8, at the
TELEGRAPH OFFICE, LONDON TERMINUS, PADDINGTON AND TELEGRAPH COTTAGE, SLOUGH STATION.
An Exhibition admitted by its numerous Visitors to be the most interesting and ATTRACTIVE of any in this great Metropolis. In the list of visitors are the illustrious names of several of the Crowned Heads of Europe, and nearly the whole of the Nobility of England.
“This Exhibition, which has so much excited Public attention of late, is well worthy a visit from all who love to see the wonders of science.” – MORNING POST
The Electric Telegraph is unlimited in the nature and extent of its communications; by its extraordinary agency a person in London could converse with another at New York, or at any other place however distant, as easily and nearly as rapidly as if both parties were in the same room. Questions proposed by Visitors will be asked by means of this Apparatus, and answers thereto will instantaneously be returned by a person 20 Miles off, who will also, at their request, ring a bell or fire a cannon, in an incredibly short space of time, after the signal for his doing so has been given.
The Electric Fluid travels at the rate of 280,000 Miles per Second.
By its powerful agency Murderers have been apprehended, (as in the late case of Tawell,) – Thieves detected; and lastly, which is of no little importance, the timely assistance of Medical aid has been procured in cases which otherwise would have proved fatal.
The great national importance of this wonderful invention is so well known that any further allusion here to its merits would be superfluous.
N.B. Despatches sent to and fro with the most confiding secrecy. Messengers in constant attendance, so that communications received by Telegraph, would be forwarded, if required, to any part of London, Windsor, Eton, &c.
ADMISSION ONE SHILLING.
T. Home, Licenser
Morses Code sah so aus:
(Der __ steht für eine Pause.)
Die Ziffernreihe 3 7 0 5 1 hat dann wohl so ausgesehen:
Die Länge der Impulse war bei diesem Code nicht so wichtig, wichtiger waren die Pausen. Diese Idee war genial einfach, aber bei Morses Code war die Gefahr der Verwechslung einzelner Signale – wie ein Funker an dem obigen Beispiel leicht erkennen wird – sehr hoch. Das ganze System benötigte außer den Telegrafisten noch Kodierer und Dekodierer.
Von der Tragfähigkeit seiner Idee überzeugt, ging Morse mit großer Energie an ihre Verwirklichung. Dazu führte er sehr bald vier weitere Menschen zusammen, die als Geldgeber, Techniker, Wissenschaftler, Politiker und Rechtsanwalt mit ihm zusammen praktisch die Firma Morse bildeten (Morse Patentees – Morse-Patentinhaber). Mit Alfred Lewis Vail (1807–1859) hatte er einen offenbar sehr fähigen technischen Mitarbeiter und Geldgeber. Auf dessen Leistungen wird noch einzugehen sein.
Lange Zeit gingen der Punkt-Strich-Code und der Streifenschreiber auf Morses Konto, seit einigen Jahrzehnten jedoch gibt es immer mehr Darstellungen, in denen festgestellt wird, daß Samuel Morse lediglich der ursprüngliche Ideengeber und Teilhaber der außerordentlich erfolgreichen Firme „Morse“ war. Der eigentliche Erfinder des Morse-Alphabets sowie auch der Sende- und Empfangsapparaturen war Alfred Vail. William G. Pierpont (S. → f.) zitiert aus der 1899 erschienenen, offenbar sehr gründlichen Untersuchung The Story of Telecommunications u.a. die folgenden Sätze:
»Wenn Sie fragen, wer den Telegrafen erfunden hat, würde die Mehrzahl der Amerikaner antworten: „Morse“. Aber Morse erfand weder den Punkt-Strich-Code, noch die „Morse“ taste, noch den „Morse“-Streifenschreiber.«
»Morse’s Gier nach Ruhm [war] derartig stark, daß er posierte und dozierte und jedem klarzumachen versuchte, wie großartig er sei, und er war sehr eifrig bemüht, diesen Anspruch auch zu rechtfertigen.«
Die Engineering News vom 14. April 1886 stellte fest, daß „das Verdienst für die Erfindung des Alphabetes, der Übertragungsapparate und anderer wichtiger Bestandteile des Morse-Systems in keinster Weise Morse zukommt, sondern Alfred Vail, dessen Name für immer geehrt werden und in Erinnerung bleiben soll.“
Der bereits erwähnte US-amerikanische Physiker Joseph Henry (dem zu Ehren die Einheit der elektrischen Induktivität mit Henry, SI-Einheitenzeichen H, benannt wurde) äußerte sich 1831 im American Journal of Science folgendermaßen:
»Ich bin mir nicht bewußt, daß Morse jemals eine selbständige Entdeckung auf dem Gebiet der Elektrizität, des Magnetismus oder Elektromagnetismus gemacht hat, die für die Erfindung des Telegrafen verwendbar wäre.« (Zitiert bei Reuter, S. 52)
Was waren nun Alfred Vails Verdienste? Als auf das Praktische und Effektive orientierter Techniker ging es ihm vor allem darum, in der telegrafischen Praxis ein Code-Buch zu vermeiden, indem er einen Telegrafie-Code erdachte, in dem jeder Buchstabe sein eigenes Signal hatte. Und die übermittelten Signale sollten auf dem Papierstreifen des Empfangsapparates einfach und eindeutig als Text zu lesen sein. Der entscheidende Fortschritt in dieser Richtung war die Einführung des „Strichs“, also eines längeren Signals als das für einen „Punkt“. Bereits Anfang 1838, als Morse noch für lange Zeit an seinem Zahlen-Wörterbuch arbeitete (er war zu dieser Zeit Professor für Kunst und Design an der New York University), stellte Vail seinen ersten, rein alphabetischen Code vor. Der kannte vier Elemente:
ein kurzes Signal („Punkt“)
ein längeres Signal („Strich“)
ein noch längeres Signal („langer Strich“)
die Pausen zwischen diesen Elementen.
In diesem ersten Code standen einige Zeichen noch für zwei verschiedene Buchstaben, in einer neuen Fassung von 1843 hatte Vail dann aber für jeden Buchstaben ein besonderes Zeichen. Und die Zuordnung war darauf ausgerichtet, daß die im Englischen am häufigsten gebrauchten Buchstaben die kürzesten Zeichen hatten. (Es geht die Legende, Vail sei auf diese Idee gekommen, als er in einer Druckerei die unterschiedlich großen Kästen für die einzelnen Bleilettern gesehen habe.)
In dieser Form war das Zeichen-Alphabet lange als sogenannter „amerikanischer Code“ oder manchmal auch als „Vail-Code“ in Gebrauch.
Abb. 21. Alfred Vail (1807-1859).
Abb. 22. Dies soll die erste von Vail gebaute und verwendete Taste gewesen sein. Sie befindet sich heute in sicherer Verwahrung in einem Museum in den USA.
Friedrich Clemens Gerke und der internationale Morse-Code
Friedrich Clemens Gerke nahm nach den verschiedensten Tätigkeiten (u.a. diente er 1821 bis 1823 in der britischen Armee in Kanada) 1847 eine Tätigkeit als Inspektor bei der maritimen Telegraphenlinie Cuxhaven – Hamburg der Elektro-Magnetischen Telegraphen-Companie auf. Dieser Schiffsmeldedienst benutzte als erster in Europa den Morse-Code.
Gerke gebrauchte seine englischen Sprachkenntnisse auch zum Übersetzen von Fachliteratur zur Telegrafie und stieß so auch auf Vails Veröffentlichungen. Er erkannte die Schwächen in Vails Code und erarbeitete ein eigenes System, das eine weitere Vereinfachung und Erweiterung brachte. Er erreichte das, indem er nur noch zwei klar definierte Zeichenlängen („Punkt“ und „Strich“) verwendete und auch die Länge der Pausen zwischen ihnen exakt festlegte. Am Ende war fast die Hälfte der Zeichen verändert. Und Gerke führte deutsche Umlaute ein. Sein Telegrafiealphabet, das eigentlich kein „Morse-Alphabet“ mehr war, aber auch von ihm zu Ehren von Samuel Morse so genannt wurde, wurde 1865 nach geringfügigen Änderungen (welche die Buchstabenhäufigkeit in englischen Texten berücksichtigen sollten) als Telegrafenalphabet des neu gegründeten Internationalen Telegraphenvereins (UIT – Union International des Télécommunications / ITU – International Telegraph Union) übernommen.
Abb. 23. Friedrich Clemens Gerke (1801-1888).
Der Morse-Schreiber
Dieser Impuls-Code war sozusagen die Software. Die Hardware, die Vail dazu entwickelte, war ebenfalls so einfach und funktionssicher, daß sie mit einigen Verbesserungen weit über 100 Jahre in Gebrauch war.
Da war auf der sendenden Seite das Gerät, mit dem die elektrischen Impulse abgeschickt wurden, und zwar indem man auf die denkbar einfachste Weise mit einer Taste einen Stromkreis schloß und wieder unterbrach: die Morse-Taste. Sie ist bis heute das wohl bekannteste Symbol der Telegrafie.
Der von Morse erdachte und von Vail konstruierte Empfangsapparat für die elektrischen Impulse des Codes war ebenfalls so einfach und wirkungsvoll, daß er (mit einigen Verbesserungen natürlich) bis in die Zeit meiner Ausbildung zum Funker als „Morse-Übungsschreiber“ verwendet wurde.
Der 1844 patentierte Morse-Schreibtelegraf funktionierte nach dem gleichen Prinzip wie Henrys Anordnung von 1830, nur setzte Vail am Ende keinen Klöppel mit Glocke ein, sondern einen Schreibstift, der jedes Mal, wenn ein elektrischer Impuls ankam, auf einen gleichmäßig vorbeigezogenen Papierstreifen gedrückt wurde. Auf diese Weise wurden die aufgenommenen kurzen und langen Impulse (Punkte und Striche) dauerhaft aufgezeichnet und konnten dann entschlüsselt werden. Mit der Schreibvorrichtung wurde in den folgenden Jahren viel herumexperimentiert, als beste Lösung erwies sich schließlich ein Rädchen, dessen unterer Rand durch einen Behälter mit Schreibfarbe lief, während seine Oberseite im Rhythmus der elektrischen Impulse gegen den vorbeilaufenden Papierstreifen gedrückt wurde.
Abb. 24. Das Prinzip der Übertragung von Morse-Zeichen mit schriftlicher Aufzeichnung.
Was die Öffentlichkeit verständlicherweise am meisten beeindruckte, war die Geschwindigkeit, mit der jetzt Nachrichten übertragen werden konnten (siehe S. →). Und die Hauptinteressenten an einer instantaneous communication (augenblicklichen Kommunikation) waren die Eisenbahngesellschaften. Für ihr Zugmeldesystem installierten sie parallel zu den Schienensträngen Telegrafenleitungen. Die erste für den Zugbetrieb regulär genutzte Telegrafenleitung wurde 1839 von der Great Western Railway in Großbritannien in Betrieb genommen. (Diese legendäre Eisenbahngesellschaft existierte von 1833 bis 1947 und verband London mit Südwestengland, Westengland und Südwales.)
Der Klopfer
Es dauerte nicht lange, bis einigen Telegrafisten auffiel, daß der Schreibhebel unterschiedliche Geräusche machte, je nachdem, ob er einen kurzen Impuls für einen Punkt oder einen längeren für einen Strich erhielt. William G. Pierpont, ein Veteran der US-amerikanischen Telegrafisten, nennt in seinem verdienstvollen Buch „Die Kunst der Radiotelegraphie“ mehrere Beispiele dafür, daß einige Telegrafisten bereits 1845 am Klicken des Rekorders die Buchstaben erkannten und in der Lage waren, einen Text nach dem Gehör aufzuschreiben, ohne den Rekorder-Streifen gesehen zu haben. Es soll auch damals schon „Naturtalente“ gegeben haben, die einen Text erst nur hören und dann niederschreiben konnten. Ein Beispiel ist als Gerichtsfall aus Louisville überliefert. Dort hatte ein Makler in einem Telegrafenbüro gesessen, als die Börsennachrichten gesendet wurden. Er hatte sie nach dem Gehör aufgenommen und wollte sie ohne die Gebühr, die er für diese Nachricht hätte zahlen müssen, geschäftlich verwenden.
Abb. 25. Das Prinzip des Klopfers.
Das Niederschreiben von Nachrichten nach den Klickgeräuschen der Morse-Schreiber war zunächst offiziell untersagt, weil man nur den Aufzeichnungen auf dem Papierstreifen traute. Erst als mehrere Telegrafisten nachwiesen, daß sie auch lange Nachrichten nur nach dem Gehör fehlerfrei niederschreiben konnten, kam man auf die Idee, für diese schnellere Methode spezielle Geräte zu bauen. 1856 wurde der „Klopfer“ geboren, der dann die Rekorder verdrängte.
Abb. 26. Ein französischer Telegrafist am Klopfer mit Schallkammer.
Der Klopfer funktionierte nach dem gleichen Prinzip wie der Schreiber: Über zwei Elektromagneten (In der Abb. 25