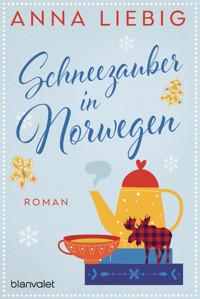2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein nostalgisches Karussell im Schnee, verlorene Träume und ein neuer Anfang …
Nachdem die fünfzehnjährige Antonia ihre Mutter bei einem Unfall verloren hat, findet sie sich bei ihrem bislang unbekannten Großvater Otto auf dessen Bauernhof im Taunus wieder. Die Annäherung zwischen dem mürrischen Greis und dem Teenager gestaltet sich schwierig – bis Antonia ein altes Karussell in der Scheune entdeckt. Sie ist ganz verzaubert von dem nostalgischen Fahrgeschäft, und eines Abends beginnt ihr Großvater schließlich zu erzählen: von damals, als er noch ein junger Schausteller war und sich auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt zum ersten Mal im Leben unsterblich verliebte …
Ein modernes Weihnachtsmärchen – perfekte Unterhaltung für kuschelige Winterabende!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
1990: Nachdem die fünfzehnjährige Antonia ihre Mutter bei einem Unfall verloren hat, findet sie sich bei ihrem bislang unbekannten Großvater Otto auf dessen Bauernhof im Taunus wieder. Die Annäherung zwischen dem mürrischen Greis und der Teenagerin gestaltet sich schwierig – bis Antonia ein altes Karussell in der Scheune entdeckt. Sie ist ganz verzaubert von dem nostalgischen Fahrgeschäft, und eines Abends beginnt ihr Großvater schließlich zu erzählen: von damals, als er noch ein junger Schausteller war und sich auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt zum ersten Mal im Leben unsterblich verliebte …
Autorin
Anna Liebig ist das Pseudonym von Nicole Steyer, einer erfolgreichen Autorin historischer Romane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus. Bereits mit acht Jahren begann sie, Geschichten zu erfinden und niederzuschreiben. »Das Winterkarussell« ist ihr erster Roman bei Blanvalet und gleichzeitig eine Liebeserklärung an die schönste Zeit des Jahres: Weihnachten.
Weitere Informationen unter: www.literatur-steyer.de
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ANNALIEBIG
DasWinterKarussell
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Deutsche Erstveröffentlichung 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenCopyright © 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenDieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 HannoverRedaktion: Matthias TeitingUmschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagmotiv: Bernadeta Kupiec/Arcangel Images; www.buerosued.deDN · Herstellung: samSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-25576-3V003www.blanvalet.de
Für Matthias, Sophie und LisaIhr drei seid mein größtes Glück.
Ein altes Karussell
Für jeden Menschen bedeutet Glück etwas anderes. Und Glück ist eine der schönsten Empfindungen überhaupt. Es sorgt für ein warmes Gefühl im Bauch und zaubert uns ein Lächeln auf die Lippen. Das größte Glück meines Vaters war sein Karussell. Er liebte es mehr als alles andere auf der Welt. Es ist ein altes Karussell, erbaut von seinem Vater um das Jahr 1900 in Hamburg, wo es in den ersten Jahren seines Lebens die Kinderaugen mit seinen auf und ab hüpfenden Pferdchen, den Rondellen, Schlittenanhängern, Schaukelbänken und den funkelnden Lichtern auf dem immerwährenden Jahrmarkt in St. Pauli zum Strahlen brachte. Doch die Augen meines Vaters brachte es auch ohne das Funkeln und die Musik zum Leuchten, selbst wenn es stillstand und im Dunkeln lag. Erst dann fühlt es sich richtig lebendig an, hat er einmal zu mir gesagt. Für ihn war das Karussell so viel mehr als ein Gegenstand. Oftmals hielt er Zwiesprache mit ihm, streichelte die Pferde, wienerte und polierte das Holz. Liebevoll nannte er es: mein altes Mädchen.
Heute ist es mein altes Mädchen. Es ist verstaubt und wirkt müde. So müde, wie ich es bin. Das Glücksgefühl ist Wehmut gewichen – vielleicht auch ein wenig Schmerz. Das Karussell birgt Erinnerungen, erzählt so viele alte Geschichten aus längst vergessener Zeit. Das Karussell bringt ihr Gesicht zurück, ihr Lachen, das ich niemals wieder hören werde. Das Gefühl von Glück. Ich fühlte es einmal, irgendwann, in einer anderen Zeit.
1. Kapitel
Oktober 1990 – Wiesbaden
Antonia bog in die von Laubbäumen gesäumte Werderstraße ein und blieb vor dem Haus mit der Nummer fünf stehen. Es war eines der typischen Gründerzeithäuser, wie es viele in Wiesbaden gab. Den ganzen Rückweg von der Schule hatte sie sich Gedanken darüber gemacht, wie sie ihrer Mutter die Fünf in Mathe erklären könnte. Schlechter Tag, Migräne, der Lehrer hatte das Thema im Unterricht nicht richtig besprochen. Sie wusste, dass ihre Mutter jede ihrer Ausreden durchschauen würde. Sie hatte schlichtweg zu wenig gelernt. Aber andere Dinge waren eben wichtiger gewesen. Elementare, unvorhersehbare Begebenheiten, die sie daran gehindert hatten, sich hinter ihre Bücher zu klemmen. Judith, ihre beste Freundin, die allerbester Freundin auf der ganzen Welt, um es genau zu sagen, war von ihrer großen Liebe Marco verlassen worden. Da konnte man sich doch nicht mit so etwas Profanem wie Wurzelrechnen beschäftigen. Nur leider war das jetzt schon ihre zweite Fünf in Mathe. Mama würde zetern, schimpfen, ihr Hausarrest verpassen, vielleicht sogar Telefonverbot. Das wäre die Höchststrafe. Zu Hause zu hocken war eine Sache, aber durch den Entzug moderner Kommunikationsmittel von der Außenwelt abgeschnitten zu sein, das war entsetzlich. Zuletzt hatte es diese Bestrafung allerdings nicht wegen einer verpatzten Note, sondern wegen einer exorbitant hohen Telefonrechnung gegeben. Antonia hatte die Hälfte der Rechnung von ihrem kläglichen Ersparten zahlen müssen, den Rest würde sie bis Weihnachten von ihrem Taschengeld abstottern. Zwei Mark jede Woche. Immerhin blieb genug für einen Kinobesuch, das Schwimmbad oder die Eisbahn übrig.
Trotz dieser strengen Erziehungsmaßnahmen liebte Antonia ihre Mama. Und sie wusste, dass nach dem Zetern und Schimpfen, nach dem großen Streit, der unausweichlich vor ihr lag, bald der Frieden wiederhergestellt wäre. Vielleicht holte Mama wieder das Schokoladeneis aus dem Gefrierschrank, sie setzten sich damit an den Küchentisch und löffelten es direkt aus der Packung. Sie könnte es ja gleich rausholen. Das wäre eine gute Idee, um dem Streit aus dem Weg zu gehen. Wortlos das Eis holen, zwei Löffel dazu und sich an den Tisch setzen. An der dummen Fünf ließ sich sowieso nichts mehr ändern, wozu also streiten und schimpfen.
Antonia beschloss, ihre Idee in die Tat umzusetzen und nahm die wenigen Stufen zur Eingangstür. Sie knarrte wie gewohnt, als sie sie öffnete. Im Treppenhaus empfing sie der übliche Geruch. Eine Mischung aus Bohnerwachs, Reinigungsmittel, Zigarettenrauch und gebratenen Zwiebeln. Ihre Wohnung lag im zweiten Stock rechts. Als sie dort ankam, öffnete sich die Nebentür und Frau Wagners Kopf tauchte auf. Frau Wagner war bereits siebenundachtzig und Witwe. Ihr Erwin war vor zehn Jahren verstorben. Das hatte sie ihnen gleich am Tag ihres Einzuges erzählt. An einem Herzinfarkt. Kinder gäbe es keine, dafür hatte sie einen Dackel, den Ludwig, der schon an Altersschwäche litt. Er war blind und inkontinent, weshalb ihm Frau Wagner immer eine Windel anzog.
Die Tür von Frau Wagner öffnete sich tagsüber jedes Mal, sobald sie den Treppenabsatz im zweiten Stock betraten. Antonia hatte sich daran gewöhnt. Ihre Mama meinte, dass die alte Dame einsam sei. Sie hatte sogar einmal überlegt, sie zum Kaffee einzuladen, es dann jedoch gelassen. Was hätte man mit der seltsamen Nachbarin schon reden sollen? Und so war es bis zum heutigen Tag – und sie wohnten nun bereits seit drei Jahren in diesem Haus – bei dem üblichen Schwätzchen im Treppenhaus geblieben.
»Das Fräulein Antonia, wie nett«, begrüßte Frau Wagner sie. Neben ihr tauchte Ludwig auf, der ein müdes Wuff von sich gab. »Die Frau Mutter ist noch gar nicht aufgetaucht«, sagte sie. »Normalerweise kommt sie doch mittwochs vor dir nach Hause. Gell, da hast du doch lang Schule.«
»Guten Tag, Frau Wagner«, grüßte Antonia und hielt ihren Turnbeutel in die Höhe. »Wie gewohnt.«
»Wenn deine Mutter kommt. Ich hätte da ein Päckchen für sie angenommen. Heute war leider nicht die freundliche Postbotin da, sondern so eine Aushilfskraft. Der war nicht von hier, irgendwas Südländisches. Ich hab ihm gleich gesagt, dass niemand da ist. Aber er wollte nicht hören und hat geklingelt.«
»Ich kann das Päckchen gern nehmen«, sagte Antonia und überging die Geschichte mit der Aushilfe.
»Ach, ich weiß nicht. Ist ja doch für die Frau Mama«, antwortete Frau Wagner. »Nicht, dass ich was Falsches mache. Soll sie doch einfach bei mir läuten, wenn sie kommt.«
Antonia nickte und versprach, es ihrer Mutter auszurichten. Auch dieses Vorgehen der schrulligen Dame kannte sie bereits.
Sie öffnete die Wohnungstür und wünschte Frau Wagner noch einen schönen Nachmittag. In der Wohnung warf sie ihren Schlüssel auf eine im Flur stehende bunt bemalte Kommode, ließ ihren Schulrucksack und den Turnbeutel wie immer achtlos auf dem knarrenden Parkettboden liegen und schälte sich auf dem Weg in die Küche aus ihrer Jacke. Um diese Uhrzeit war es dort am schönsten, denn das warme Licht der Nachmittagssonne fiel durch die Balkontür auf den rot gefliesten Boden. Die Küche war altmodisch eingerichtet, was Antonia mochte. Der Raum hat Charme, hatte ihre Mama gleich nach dem Einzug zu ihr gesagt. Es gab einen Gasherd mit Backofen, eine Spüle mit einem geblümten Vorhang darunter und ein altes Küchenbüfett, vermutlich aus den Dreißigerjahren. Das Büfett und die weiß gestrichene Eckbank hatten sie vom Vormieter übernommen. In der Spüle stand ihr Frühstücksgeschirr. Eine Spülmaschine gab es nicht. Auf dem Küchentisch lag ein Zettel. Antonia nahm ihn zur Hand und überflog die wenigen Zeilen.
Liebe Toni,
ich vergaß, Dir zu sagen, dass es bei mir heute später wird. Wichtige Konferenz mit anschließendem Abendessen. Im Eisfach ist eine TK-Pizza.
Hab Dich lieb.
Mama
Tiefkühlpizza. Na prima, dachte Antonia. Vermutlich wieder die scheußliche mit Thunfisch. Dann doch lieber ein schnelles Wurstbrot. Sie öffnete den Brotkasten. Leider herrschte darin gähnende Leere. Sie seufzte. Dann eben Nutella pur aus dem Glas, oder besser gesagt die billige Nutella-Kopie, die ihre Mutter ständig kaufte. Sie wollte gerade den Vorratsschrank öffnen, als das Telefon läutete. Antonia ging in den Flur, wo der grüne Apparat auf einem Telefonbänkchen stand, und nahm den Hörer ab. Es war Judith, die sofort losredete: »Wir müssen uns sehen, jetzt gleich. Er hat eine Neue. Und das jetzt schon. Unsere Trennung ist doch erst drei Wochen her. Manuela hat ihn gesehen. Und stell dir vor: Es ist Simone.«
»Simone«, wiederholte Antonia.
»Ja, dieses Biest. Ich wusste schon immer, dass sie ein Auge auf ihn geworfen hat. Und wenn die beiden schon, bevor wir, ich meine …« Judith fing zu heulen an.
»Jetzt beruhige dich erst mal. Das glaube ich nicht. So einer ist Marco nicht.«
»Nein, das ist er nicht«, antwortete Judith und zog die Nase hoch. »McDonald’s und Hamburger?«, fragte sie. »Ich brauch jetzt Fastfood und eine Freundin.«
»Gern«, antwortete Antonia. »Allerdings bin ich mal wieder pleite. Du weißt doch, meine Telefonschulden.«
»Ich hab genug Kohle für uns beide. Ich lad dich auf ein BigMac-Menü mit allen Schikanen ein, und danach noch ein Eis, das mit der Schokosoße. Kalorien gegen Kummer.«
»Gute Idee«, antwortete Antonia und verabschiedete sich in Gedanken von der Nuss-Nougat-Creme.
»Treffen in zehn Minuten.«
»Abgemacht«, antwortete Antonia, legte auf und zog ihre Jacke über. Die Aussicht auf das Treffen mit Judith freute sie. Gerade als sie den Schlüssel in ihre Tasche steckte, läutete es an der Tür. Wer war das denn nun? Immer im unpassendsten Moment. Antonia öffnete die Tür und sah in die Gesichter von zwei Polizisten.
»Guten Tag«, grüßte der eine.
»Das ist die Tochter. Antonia Saler«, hörte Antonia Frau Wagners Stimme aus dem Hintergrund.
»Wir kommen, um Ihnen eine Mitteilung zu machen«, sagte der eine Polizist. »Dürften wir reinkommen?« Er sah zu seinem Kollegen, der sich räusperte. Die beiden rochen nach Zigarettenqualm, einer trug einen Schnauzbart, der andere ein Kassengestell auf der Nase.
Antonia nickte und ließ die beiden Männer eintreten. Ihr Herzschlag hatte sich beschleunigt. Mit zittrigen Händen schloss sie die Wohnungstür. Wenn die Polizei vor der Tür stand, dann war etwas passiert.
Sie traten ins Wohnzimmer.
»Es gab heute Morgen einen Verkehrsunfall«, sagte der eine. »Ihre Mutter, Gabriele Saler, ist dabei schwer verletzt worden.«
Antonia erstarrte.
»Einen Unfall? Aber das kann doch, ich meine … wie denn.« Das ungute Gefühl in ihrem Inneren schwoll an, und sie glaubte zu ersticken. Sie sank auf einen Stuhl.
Die Mienen der Beamten waren besorgt.
»Es war ein Fahrradunfall. Mehr wissen wir leider auch nicht. Sie ist in die Horst-Schmidt-Kliniken gebracht worden.«
Antonia nickte. In ihren Ohren begann es zu rauschen. Es musste schlimm sein, sonst hätte ihre Mama doch angerufen, sonst würden nicht zwei Polizisten bei ihr vor der Tür stehen.
»Wo ist denn dein Vater?«, fragte der eine und beugte sich zu ihr herab.
Antonia hörte seine Stimme wie von fern. »Er ist tot«, antwortete sie.
Der Beamte nickte. Einen Moment sagte niemand etwas. Eine sonderbare Art von Beklemmung lag im Raum. Antonia bebte innerlich, Tränen traten in ihre Augen.
»Wir können dich gern in die Klinik zu deiner Mutter fahren«, bot einer der Beamten an.
Antonia nickte. Inzwischen liefen die Tränen über ihre Wangen.
Der zweite Beamte reichte ihr ein Taschentuch und erkundigte sich, ob sie ein Glas Wasser wolle. Antonia lehnte ab und stand auf. Sie musste zu ihr. Sie musste wissen, wie es ihr ging. Mama brauchte sie jetzt. Sie hatten doch nur noch einander. Und vielleicht war ja alles halb so schlimm. Anders durfte es nicht sein. Sie stand auf. »Es wäre sehr nett, wenn Sie mich in die Klinik bringen könnten.« Ihre Stimme klang tonlos, seltsam sachlich und fremd. Noch immer rauschte es in ihren Ohren, der Raum drehte sich leicht. Sie atmete tief durch und trat in den Flur, die Beamten folgten ihr.
Vor dem Haus stand der Streifenwagen, einige bunte Blätter waren von den Ahornbäumen daraufgefallen. Einer der Beamten öffnete die hintere Wagentür, und Antonia nahm auf dem Rücksitz Platz. Die Fahrt begann, die Stadt flog an ihr vorüber. Der Beamte fragte sie nach ihrem Alter.
»Fünfzehn«, antwortete sie leise.
Sie hielten an einer roten Ampel, und Antonia beobachtete, wie eine Mutter mit Kinderwagen über die Straße lief. Ein älterer Herr mit einem Dackel folgte ihr. Die Mitarbeiterin eines Cafés beschriftete eine Angebotstafel, die auf dem Bürgersteig stand. Diese Menschen lebten ihren normalen Alltag. Bis gerade eben hatte sie das auch noch getan. Eben noch waren eine Fünf in Mathe und eine Thunfischpizza ihre größten Probleme gewesen. Judith kam ihr in den Sinn. Sie würde im McDonald’s umsonst auf sie warten.
2. Kapitel
Antonia saß in einem Wartebereich der Klinik und starrte auf die gegenüberliegende Wand. Sie war allein. Alle anderen gelben Plastikstühle waren leer. Auf einem Tisch lagen Zeitungen, es gab einen Kaffeeautomaten. Immer wieder lief Klinikpersonal an ihr vorüber. Schwestern, Pfleger, Ärzte in weißen Kitteln. Ein älterer Mann in einem blau-grau gestreiften Bademantel schlurfte, seinen Tropf neben sich herziehend, an ihr vorbei. Sie kannte Kliniken wie diese von damals, als ihr Vater plötzlich krank geworden war, als er gegen den Krebs kämpfte, der von einem auf den anderen Tag ihr Leben veränderte. Drei Monate hatte sein Kampf gedauert. Lungenkrebs war es gewesen. Er hatte im fünften Stock gelegen, sein Bett hatte am Fenster gestanden. Mama hatte ihm immer Zeitungen und neue Krimis zum Lesen mitgebracht. Sie hatte in seiner Gegenwart stets versucht, gute Laune zu verbreiten. Nach den Besuchen hatte Mama geweint. Oftmals begann sie schon damit, wenn sie den endlos langen Flur hinuntergingen, und vor dem Aufzug hatte sie dann die Tränen von ihren Wangen gewischt und gequält gelächelt. Der Flur ähnelte diesem hier. Antonia erkannte den Geruch wieder, und sie hasste ihn. Sie kannte die Machtlosigkeit, die nun wieder von ihr Besitz ergriff.
Eine junge blonde Ärztin trat näher und fragte: »Guten Tag. Du gehörst zu Gabriele Saler?«
Antonia stand auf. Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Die Ärztin reichte ihr die Hand mit einem Lächeln.
»Ja, sie ist meine Mutter«, sagte Antonia.
Die Ärztin nickte. »Ich bringe dich zu ihr. Sie liegt auf Station fünf.« Sie bedeutete Antonia, ihr zu folgen.
Es ging den Flur hinunter zum Aufzug und in den sechsten Stock. Die Ärztin roch gut, nach irgendeinem Parfüm. Ihr blondes Haar hatte sie zu einem Zopf gebunden. Wie alt mochte sie sein? Dreißig vielleicht. Sie erreichten die Station. »Nicht erschrecken«, sagte die Ärztin. »Es ist eine unserer Intensivstationen. Du musst einen Schutzkittel tragen. Deine Mutter ist momentan ohne Bewusstsein.«
Sie betraten einen kleinen Raum im vorderen Bereich der Station. Antonia legte ihre Jacke ab und zog den grünen Kittel über, den eine Schwester ihr brachte.
Die Ärztin führte sie in eines der Krankenzimmer. Ihre Mutter lag allein darin am Fenster. Sie war an viele Geräte angeschlossen und wurde künstlich beatmet. Langsam trat Antonia näher an das Bett heran. Ihre Mutter hatte ein Pflaster auf der Stirn, eine Schramme zierte ihre Wange. Antonia blieb neben ihr stehen und berührte ihre Hand.
»Hallo, Mama«, sagte sie nach einer Weile. »Ich bin jetzt da, hörst du. Sie haben mich geholt. Bestimmt wird alles wieder gut.«
»Sie hat bei dem Unfall leider ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten«, sagte die Ärztin leise. »Wir müssen noch einige Tests machen.«
»Aber sie wird doch wieder gesund werden, oder?«, fragte Antonia, ohne den Blick von ihrer Mutter abzuwenden.
»Wir tun unser Möglichstes«, antwortete die Ärztin und berührte sie am Arm. »Hast du Angehörige? Möchtest du jemanden anrufen? Deinen Vater vielleicht, Großeltern?«
Antonia schüttelte den Kopf. »Nein, niemanden.«
»Freunde?«, fragte die Ärztin.
Antonia dachte an Judith. Die beste Freundin der Welt, die jetzt vermutlich sauer auf sie war, weil sie sie versetzt hatte. Aber was waren Marco und Simone schon gegen das hier? Sie sagte: »Meine Freundin Judith.«
»Möchtest du sie anrufen? Wir machen inzwischen unsere Tests.«
Antonia nickte.
»Ich komm gleich wieder, Mama. Ich ruf nur schnell Judith an. Ich hab sie versetzt, weißt du.« Antonia streichelte noch einmal die Hand ihrer Mutter, dann folgte sie der Ärztin aus dem Raum und in eines der Schwesternzimmer. Sie tippte Judiths Nummer ins Telefon. Es klingelte, einmal, zweimal. Judiths Stimme erklang, und Antonia begann zu heulen. Sie schluchzte laut und brachte kaum ein Wort heraus. Die Ärztin nahm ihr irgendwann den Hörer aus der Hand und fragte nach Judiths Mutter. Ihr erklärte sie mit wenigen professionellen Sätzen, was geschehen war. Danach legte sie auf, wandte sich an Antonia und sagte: »Ihre Mutter und sie kommen sofort.«
Sie nickte. Die Ärztin strich ihr über die Schulter und ging. Eine der Krankenschwestern – sie war schon älter und hatte etwas Mütterliches an sich – drückte Antonia auf einen Stuhl und wischte ihr mit einem Taschentuch die Tränen von den Wangen.
»Na, na«, sagte sie tröstend. »Wer wird denn gleich so weinen. Bestimmt wird alles gut. Deine Mama ist bei uns in den besten Händen.«
Antonia nickte und zog die Nase hoch.
»Der Test wird eine Weile dauern. Wir haben einen kleinen Warteraum. Komm. Ich bringe dich hin.«
Die Krankenschwester nahm Antonias Hand und führte sie zu dem Warteraum. Darin standen vier Stühle, und es gab auch hier einen Kaffeeautomaten.
»Der spuckt auch Kakao aus. Wenn du welchen möchtest. Ich sage dir sofort Bescheid, wenn die Tests beendet sind.« Die Schwester ließ Antonia allein.
Antonia setzte sich auf einen der Stühle, stand auf, trat ans Fenster, lief im Raum auf und ab, sah in den Flur. Jedes Mal, wenn sie Schritte hörte, beschleunigte sich ihr Herzschlag. Es dauerte quälend lang, bis endlich Judith und ihre Mutter in der Tür standen. Beide trugen ebenfalls grüne Kittel. Judith stürzte auf Antonia zu und umarmte sie, drückte sie so fest an sich, dass sie zu ersticken glaubte. Antonia weinte. Sie schluchzte laut. Judiths Nähe tat gut. In ihren Armen konnte sie sich fallen lassen. Amanda Gärtner, Judiths Mama, war in der Tür stehen geblieben. Nachdem sich die beiden Mädchen voneinander gelöst hatten, fragte sie: »Was sagen die Ärzte?«
»Sie hat ein schweres Schädel-Hirn-Trauma.«
Amanda nickte, ihre Miene war ernst.
»Sie machen gerade noch einige Tests, dann kann ich wieder zu ihr«, sagte Antonia. »Ich hab solche Angst. Was ist, wenn sie stirbt? Dann hab ich niemanden mehr.«
»Sie stirbt nicht«, sagte Judith. »Bestimmt nicht. Sie hat nur ordentlich eins auf den Kopf gekriegt. Das wird schon wieder.«
Antonia nickte. In diesem Moment betrat die Ärztin den Raum. Sie begrüßte Judith und Amanda, bedankte sich für ihr schnelles Kommen und sagte zu Antonia, dass die Tests beendet seien und sie wieder zu ihrer Mutter dürfe. War ihre Miene verändert?, überlegte Antonia. Sie schien noch ernster zu wirken. Auf dem Flur erkundigte sich die Ärztin nach Antonias Alter. Wieso war das plötzlich wichtig? Sie betraten erneut das Krankenzimmer. Eine Krankenschwester tauschte gerade einen Tropfbeutel aus, dann ging sie.
Antonia trat neben das Bett. Die Ärztin blieb im Raum. »Was war das für ein Test, den Sie gemacht haben?«, fragte Antonia.
»Wir haben die Hirnaktivität gemessen. Das machen wir häufig bei Diagnosen dieser Art«, erklärte die Ärztin.
Antonia nickte und fragte: »Und?«
Sie hörte, wie die Ärztin tief einatmete. Und da wusste sie es. Es gab schlechte Neuigkeiten. Niemand atmete auf diese Art ein, wenn es etwas Gutes zu berichten gab. Wieder begann es, in ihren Ohren zu rauschen, ihr Herz hämmerte wie verrückt.
»Ich muss dir leider mitteilen, dass deine Mutter hirntot ist.«
Antonia kannte den Begriff aus Filmen und wusste, was er bedeutete. Etwas in ihrem Inneren sträubte sich dagegen, die Worte der Ärztin zu akzeptieren.
Sie trat neben das Bett und legte ihre Hand auf die Brust ihrer Mutter. Sie fühlte, wie sie sich hob und senkte.
»Sie atmet, ich spüre ihren Herzschlag.«
»Sie lebt nur, weil sie an den Maschinen hängt«, erklärte die Ärztin.
Antonia nickte, erneut traten Tränen in ihre Augen.
»Soll ich deine Freundin und ihre Mutter zu dir holen?«, fragte die Ärztin.
»Was wird nun passieren?« Antonia ging nicht auf die Frage der Ärztin ein.
»Das müssen wir nicht jetzt entscheiden«, sagte diese und wiederholte ihre Frage erneut.
Antonia nickte. Sie war wie betäubt, selbst das Weinen ging nun nicht mehr. Die Ärztin verließ den Raum, und wenig später traten Amanda und Judith ein. Beide wirkten unsicher. Judith trat neben Antonia, Amanda blieb an der Tür stehen. Eine eigentümliche Art von Beklemmung lag im Raum. Antonia kannte das schon. Als ihr Vater starb, war es ähnlich gewesen. Der Tod hatte seine Hand nach ihm ausgestreckt und nun nach ihrer Mama.
»Was ist?«, fragte Judith. »Was sagen die Ärzte?«
Antonia hatte einen trockenen Mund, konnte jedoch nicht schlucken. Das Gefühl von Schmerz breitete sich in ihr aus, und sie beantwortete Judiths Frage nicht. Sie sah ihre Mutter an, wie sie in den Kissen lag, irgendwo zwischen Himmel und Erde schwebend.
Erst eben hatte sie sich wie üblich von ihr verabschiedet. »Bis heute Nachmittag, Toni«, hatte sie gesagt. Eine flüchtige Umarmung, ein Kuss auf die Wange. Niemals wieder würde es diese Form des Abschieds geben. Kein Schokoladeneis zur Versöhnung, keine Videoabende mit einer Unmenge von Knabberkram, keine Urlaube im Schwarzwald mehr.
»Sie wird sterben«, flüsterte Antonia.
»Was?«, fragte Judith.
Amanda trat näher und fragte: »Wie meinst du das?«
»Sie ist hirntot«, antwortete Antonia. Ihre Stimme hörte sich nicht wie die ihrige an. Sie klang wie die einer Fremden. »Das hat die Ärztin gesagt. Sie wird sterben. Ich muss sie gehen lassen. Wir haben darüber geredet, nach Papas Tod.«
Antonia erinnerte sich, wie sie in der Küche am Tisch gesessen hatten und ihre Mutter ihr die Papiere zeigte. Es war kurz nach dem Tod ihres Vaters gewesen. Sie sagte, jetzt haben wir nur noch uns. Der Tod hatte im Raum gestanden, war so plötzlich gekommen. Damals, als der Vater mit einem Husten zum Arzt gegangen und todkrank wieder nach Hause gekommen war. Der Tod war noch lange Zeit nach seiner Beerdigung in ihrer Nähe geblieben und hatte ihren Alltag gelähmt. Das erste Weihnachten, es war irgendwie vergangen. Ihr Geburtstag, der Hochzeitstag ihrer Eltern, an dem Mama geweint hatte. Trauer hat viele Gesichter. Es sind die dunklen Schatten, die einen immer wieder einholen. Einer dieser Schatten war die Patientenverfügung auf dem Küchentisch. Die Angst vor dem, was sein könnte. Plötzlich stand im Raum, dass es nicht immer so weitergehen würde. Dass die Mutter vorsorgen musste, damit Antonia im Ernstfall nicht mit der Entscheidung allein war. Sie hatte das Papier nicht lesen wollen. Sie hatte ihre Mutter angeschrien. Sie solle endlich aufhören, hatte sie geschimpft. Sie solle zu leben beginnen und nicht ständig ans Sterben denken. Sie war aus der Küche gerannt, aus der Wohnung und aus dem Haus in den Park, wo sie ihren Tränen freien Lauf ließ.
Es war besser geworden. Der Tod war Stück für Stück gegangen und hatte die dunklen Schatten weniger werden lassen. Das letzte Weihnachtsfest war schön gewesen. Sie hatten einen Baum gehabt, Mamas Freundin Biggi, geschieden, war mit ihren beiden Kindern, Susi und Andrea, acht und zehn Jahre alt, zu Besuch gewesen, und sie hatten gemeinsam gekocht. Erst neulich war Mama mit einem Kollegen ausgegangen. Sein Name war Thomas. Er hatte sie geküsst. Vor dem Haus, Antonia hatte es von ihrem Fenster aus gemeinsam mit Judith beobachtet, und sie hatten sich darüber gefreut. Und nun lag sie hier, umgeben von Schläuchen und blinkenden Maschinen, die bald nicht mehr blinken würden. Es würde wie bei ihrem Vater sein. Bald schon würden sie die Apparate ausschalten, und die blaue Linie auf dem Monitor würde keine gezackten Bögen mehr anzeigen, sondern zu einem Strich werden.
»Sie hat so eine Verfügung. Sie ist bei unserem Hausarzt hinterlegt.«
Amanda nickte. Sie trat neben Antonia und legte den Arm um sie. »Soll ich es der Ärztin sagen?«, fragte sie. Antonia nickte. Judith sagte nichts mehr. Sie schien wie erstarrt, war leichenblass. Es war zu viel für sie, das spürte Antonia. Judith kannte den Tod nicht. Keine Minute später verließ sie mit den Worten »Es tut mir leid. Es geht nicht« den Raum.
Amanda blieb noch einen Moment, dann fragte sie: »Kann ich dich für eine Weile allein lassen?«
»Ich bin nicht allein. Mama ist da. Geh ruhig und beruhige sie.«
Amanda ging, und Antonia trat näher ans Bett. Irgendwann legte sie sich seitlich neben ihre Mutter. Sie lauschte ihrem Herzschlag, spürte, wie sich ihre Brust hob und senkte. Ihre Nähe war so wunderbar vertraut. Antonia schloss die Augen. Als kleines Mädchen hatte sie oft eng an sie gekuschelt morgens im Bett gelegen und ihrem Herzschlag zugehört. Sie versuchte, eine Erinnerung aus jener Zeit in sich heraufzubeschwören. Wie sie unter der mit kariertem Flanellbezug bezogenen Bettdecke im Schlafzimmer lagen, wie das graue Licht eines Wintertages in den Raum fiel und vor dem Fenster Schneeflocken sacht auf die Erde sanken. Es war so still und friedlich gewesen. Bis Papa kam und lautstark verkündete, dass der Frühstückstisch gedeckt sei.
Sie wusste nicht, wie viel Zeit ihr noch blieb, bis jemand kam und die Maschinen abschaltete. Sie wünschte, es würde niemand kommen. Sie wünschte aufzuwachen, und alles wäre nur ein böser Traum.
3. Kapitel
Antonia saß im Wartebereich des Jugendamtes und starrte auf den blauen Linoleumboden. Sie hatte die Kopfhörer ihres Walkmans aufgesetzt. Es lief Roxette mit It must have been love. Die Beerdigung ihrer Mutter lag jetzt drei Tage zurück. Es war ein nebliger und kühler Tag gewesen. Sie wusste nicht mehr, wie sie ihn überstanden hatte. Es waren viele Menschen gekommen, Kollegen, Freunde der Familie, auch Judith, die die ganze Zeit über nicht von ihrer Seite gewichen war, was Antonia ihrer besten Freundin hoch anrechnete. Gesichter, Beileidsbekundungen, Worte, die an ihr vorüberflogen. Später war sie noch bei Judith gewesen, ihre Mutter hatte gekocht. Spaghetti. Keinen Bissen hatte sie hinuntergebracht. Am liebsten wäre sie für immer bei Judith geblieben. Doch das war nicht möglich. Das Jugendamt, das nun fürsorgepflichtig für sie war, war noch am Todestag ihrer Mutter in Form einer Betreuerin namens Sandra, einer blonden Sozialarbeiterin mit Schlaghosen und Lippenpiercing, in ihr Leben getreten. Sie hatte zu Hause ihre Sachen packen und in eine Wohneinrichtung des Jugendamtes umziehen müssen. Für den Nachlass ihrer Mutter gab es einen Nachlassverwalter. Er war Mitte fünfzig, kugelrund und trug altbacken aussehende Cordanzüge. Er hieß Hans-Dieter Gottwald und hatte stets ein Grinsen auf den Lippen. Eine solche Arbeit ertrug man wohl nur als hoffnungslose Frohnatur oder hartnäckiger Pessimist. Antonia war der Mann sympathisch, obwohl er ein bisschen nach Mottenkugeln roch. Er kümmerte sich um ganz profane Dinge, wie die Kündigung und Auflösung der Wohnung, die Organisation der Beerdigung und die Sicherung der Vermögensstände. Mama hatte für den Fall der Fälle eine Lebensversicherung abgeschlossen. Diese würde an Antonia an ihrem achtzehnten Geburtstag ausgezahlt werden.
Sie wusste nicht, weshalb sie heute aufs Jugendamt kommen sollte. Bisher hatte die Leiterin der Wohneinrichtung, in der sie nun lebte, alles Notwendige mit ihr besprochen. Die Einrichtung lag im Stadtteil Bierstadt in einem Neubau, und in jeder der acht sich darin befindenden Wohngemeinschaften wohnten maximal fünf Mädchen oder Jungen und eine Betreuerin. Zusätzlich gab es einen weiteren Sozialarbeiter, dazu die Leiterin, Frau Morgenthal, eine Mittfünfzigerin, die stinkende Zigarillos rauchte, und einen Hausmeister, den alle nur Didi nannten, weil er eine gewisse Ähnlichkeit mit Dieter Hallervorden aufwies. Nur eine von Antonias Mitbewohnerinnen war eine Waise wie sie selbst. Der Rest kam aus schwierigen sozialen Verhältnissen, wie man so schön sagte. Mutter oder Vater alkohol- oder drogenabhängig, eine war von ihrem Stiefvater misshandelt worden. Ein Mädchen – ihr Name war Sarah – war recht aggressiv. Sie war auf Antonia wegen einer Nichtigkeit gleich am ersten Abend losgegangen. Eine andere war ein Grufti und rannte ständig in schwarzen Klamotten herum. Schwarze Haare, das Gesicht blass geschminkt, schwarzer Lippenstift. Sie war Antonia unheimlich. Und was Sandra anging, hatte Antonia inzwischen erkannt, dass sie einen Hang zur Theatralik hatte und mit der Betreuung ihrer Schützlinge überfordert zu sein schien. Antonia hatte Glück und ein Zimmer für sich allein. Darin verkroch sie sich die meiste Zeit und kam nur zu den Mahlzeiten heraus. Sie weinte viel, starrte die kahlen Wände an, oft hörte sie bis tief in die Nacht hinein Musik und träumte sich in eine Welt, die es nicht mehr gab. Sie ging wieder zur Schule, nachmittags zu Judith. Dort war ihr Leben normal und fühlte sich wie früher an. Früher, das war erst vor zehn Tagen gewesen. Die Altbauwohnung mit den hohen Decken und der Flügeltür, die Ess- und Wohnzimmer miteinander verband. Das alte Klavier, auf dem Mama gern gespielt hatte. Die Wohnküche mit dem zum Innenhof führenden Balkon, auf dem sie im Sommer oft gesessen und gewürfelt hatten. Der Weihnachtsbaum im Erker des Wohnzimmers, den sie jedes Jahr am Abend des Dreiundzwanzigsten geschmückt hatten. Eine Fichte, deren Nadeln scheußlich pikten, rote und goldene Kugeln. Vertrautheit, Zuhause. Von früher konnte keine Rede sein, das alles lag nicht lange zurück.
Und nun saß sie hier, starrte auf den blauen Linoleumfußboden, Phil Collins begann, Another Day in Paradise zu singen, und sie fühlte diese unbeschreibliche Leere in sich. Sie war allein auf der Welt, zurückgeblieben, verlassen worden. Wie sollte sie das alles schaffen? Sie hasste die Wohngemeinschaft, hasste die Geräusche, Gerüche und fremden Stimmen um sich herum. Erneut wünschte sie sich, aus diesem Albtraum aufzuwachen.
Eine Berührung an der Schulter ließ Antonia zusammenzucken und aufblicken. Es war eine Mitarbeiterin des Jugendamtes, die sie freundlich anlächelte. Antonia nahm den Kopfhörer ab.
»Du kannst jetzt reinkommen«, sagte sie und ging in den Büroraum. Antonia folgte ihr. In dem Raum standen drei Schreibtische, Aktenschränke und einige Zimmerpflanzen. Die komplette Einrichtung wurde von Zigarettenrauch umwabert, den ein Mann mittleren Alters verursachte, der, eine Kippe im Mundwinkel, in einer Akte blätterte. Die Mitarbeiterin stellte sich als Frau Weber vor und bat Antonia auf einem Stuhl neben ihrem Schreibtisch Platz zu nehmen.
»Du fragst dich bestimmt, weshalb ich dich heute hierherbestellt habe«, sagte sie. »Wir konnten einen Angehörigen ausfindig machen.«
»Einen Angehörigen?«, fragte Antonia verdutzt.
»Ja, einen Angehörigen. Genauer gesagt, deinen Großvater. Sein Name ist Otto Schneider, und er wohnt im Taunus. Du kennst ihn nicht?«
Antonia schüttelte verwirrt den Kopf. Sie hatte keinen Großvater. Ihre Großeltern waren alle tot.
»Der Nachlassverwalter hat ihn ausfindig gemacht. Er lebt im Taunus, in einem Ort namens Finsternthal.«
»Finsternthal«, wiederholte Antonia, die noch immer nicht so recht glauben wollte, was Frau Weber da erzählte.
»Wir hatten ihn zu dem heutigen Termin eingeladen. Leider scheint er nicht zu kommen.«
»Wieso eingeladen?«, fragte Antonia.
»Nun ja, als Angehöriger könnte er das Sorgerecht für dich übernehmen. Das machen viele Großeltern. Du könntest bei ihm leben.«
»Bei meinem Großvater.« Antonia war wie vor den Kopf gestoßen. »Den ich gar nicht kenne und der zu diesem Termin offensichtlich nicht auftaucht. Er scheint ja großes Interesse an seiner Enkeltochter zu zeigen.« Ihre Stimme klang zynisch.
Frau Weber wirkte etwas hilflos. Sie schien sich die Situation anders vorgestellt zu haben.
Antonia war noch immer fassungslos. Sie hatte einen Großvater. In ihr keimte ein neuer Gedanke auf. Ein Großvater war Familie, jemand, zu dem man gehören konnte. Er wäre ein Ausweg aus dem betreuten Wohnen. Allerdings musste es einen guten Grund dafür geben, weshalb Mama keinen Kontakt zu ihm gehabt hatte. Was war geschehen? Ein Streit vielleicht. Mama selbst würde ihr diese Frage nicht beantworten. Und so wie es aussah, ihr Großvater auch nicht. Und wo zur Hölle lag dieses Finsternthal überhaupt? Davon hatte sie noch nie etwas gehört. Was für ein schrecklicher Name für einen Ort.
»Vielleicht ist er aufgehalten worden«, meinte Frau Weber und bemühte sich um ein Lächeln. »In meinen Unterlagen steht, dass er den Termin zugesagt hat. Ich werde das nachher gleich überprüfen.« Sie sah Antonia an. »Es tut mir leid, dass wir dich jetzt ganz umsonst hergebeten haben.«
»Schon okay«, antwortete Antonia und fragte: »Wie geht es jetzt weiter?«
»Wir werden ihn ein weiteres Mal kontaktieren und einen neuen Termin finden. Ich denke, es wird Zeit, dass ihr beiden euch kennenlernt. Oder was meinst du?«
»Ja, das glaube ich auch«, antwortete Antonia.
Frau Weber erhob sich und ging zur Tür. »Ich melde mich, wenn ich Neuigkeiten habe.« Sie reichte Antonia die Hand und nickte ihr lächelnd zu. Antonia bedankte und verabschiedete sich. Frau Weber verschwand in ihrem verrauchten Büro und schloss die Tür hinter sich.
Antonia trottete den langen Flur hinunter. Eine der Deckenlampen im Treppenhaus war kaputt, surrte und flackerte. Eine Putzfrau, die gerade die Stiegen feucht wischte, verdrehte die Augen, als sie an ihr vorüberlief. In der Eingangshalle lief Antonia in Richtung Ausgang. Als sie am Empfang vorüberkam, bemerkte sie einen alten Mann, der mit dem Empfangsmitarbeiter sprach.
»Zu einer Frau Weber. So steht es auf dem Wisch, den ihr mir geschickt habt. Weiß der Kuckuck, warum. Was soll ich alter Mann denn bitte schön auf dem Jugendamt? Das hätte einem ja mal jemand sagen können!«
Antonia blieb stehen und musterte den Mann von der Seite. Er trug braune Cordhosen, darüber eine dunkelblaue Jacke, die schon bessere Tage gesehen hatte. Seinen Kopf zierte eine schwarze Strickmütze, und auf seiner Nase saß eine Nickelbrille. Er bemerkte, dass Antonia ihn ansah.
»Was glotzt du so?«, fragte er ruppig.
Antonia zuckte zurück. Sein Gesichtsausdruck war grimmig, seine blauen Augen lagen unter buschigen Augenbrauen. Sie entschloss sich, die Flucht nach vorn anzutreten, und antwortete: »Ich bin der Grund dafür, dass Sie hier sind. Sie sind mein Großvater.«
Die Augen des alten Mannes weiteten sich. Der Mann hinter dem Empfang ließ den Telefonhörer sinken, den er soeben in die Hand genommen hatte. »Ich war gerade bei Frau Weber. Wir dachten schon, Sie kommen nicht.«
»Großvater, eine Enkelin«, stammelte er. »Aber wie, ich meine …«
»Meine Mutter hieß Gabriele Saler, Mädchenname Bach. Sie ist gestorben, Verkehrsunfall.«
»Eine Tochter. Mädchenname Bach«, wiederholte er. »Ich hatte eine Tochter. Dieses verdammte …« Er beendete den Satz nicht.
»Sie hat nie von Ihnen gesprochen«, sagte Antonia leise und machte einen Schritt auf den alten Mann zu.
»Wie auch«, antwortete er. »Sie kannte mich nicht.«
Antonia nickte. Sie wusste nicht, was sie noch sagen sollte. Der alte Mann gefiel ihr nicht. So einer sollte ihr Großvater sein? Bei ihm sollte sie leben? In Finsternthal?
»Und was soll das hier?«, fragte er. »Was soll ich denn mit dir? Hast du keinen Vater?«
Antonia spürte die aufsteigenden Tränen. Sie musste hier weg, sofort. Wie hatte sie auch nur einen Moment annehmen können, dass dieser verbitterte alte Mann ihr eine Familie bieten könnte. Sie ließ ihn stehen, rannte hinaus in den kalten Nieselregen und über die Straße davon.
4. Kapitel
Oktober 1990 – Finsternthal
Otto fuhr auf den Hof des alten, von Wiesen und Feldern umgebenen Fachwerk-Bauernhofes. Er hielt vor dem Wohnhaus, stellte den Motor aus und starrte auf die Eingangstür des Hauses. Noch immer konnte er das Geschehene kaum glauben. Er hatte eine Enkelin. Und seine Tochter, die er nicht hatte kennenlernen dürfen, war tot. Das waren eindeutig zu viele unschöne Neuigkeiten für einen Tag. Was sollte er mit einer Enkelin anfangen? Obwohl ihm die Kleine schon irgendwie leidgetan hatte. Zum ersten Mal seit Langem dachte er wieder an Geli. Seine Ex, die damals, in jener kalten Winternacht kurz vor Weihnachten nach einem schrecklichen Streit ihre Sachen gepackt hatte und regelrecht vor ihm davongelaufen war. Er hatte sie nie wirklich geliebt, trotzdem hatte er sie geheiratet. Warum, konnte er nicht genau sagen. Weil es dazugehörte, weil er sich gedrängt gefühlt hatte. Alle waren verheiratet oder hegten entsprechende Pläne. »Du willst doch nicht für den Rest deines Lebens Junggeselle bleiben«, hatte sein Kumpel Walter damals bei einem Bier am Stammtisch zu ihm gesagt. Und Geli war ganz nett und hübsch gewesen.
Anfangs war es gut gegangen zwischen ihnen. Doch dann waren der Streit und der Hass auf dem Hof eingezogen und geblieben. Er dachte daran, was sein Vater am Abend vor seiner Hochzeit zu ihm gesagt hatte. Sie ist kein schlechtes Mädchen, aber ich glaube, sie ist nicht die Richtige für dich. Er hatte recht behalten.
Otto seufzte, öffnete die Autotür und stieg aus. Schritte knirschten hinter ihm auf dem Kies. Er wandte sich um. Es war der Gemeinderatsvorsitzende, Moritz Grünberg, der hektisch winkend angerannt kam. Oh nein, der schon wieder. Den konnte er jetzt nicht auch noch gebrauchen. Otto rollte mit den Augen. Er hatte den Wichtigtuer mit der Halbglatze noch nie leiden können.
Etwas außer Puste blieb Moritz Grünberg vor ihm stehen.
»Grüß dich, Otto. Wir haben dich gestern in der Gemeinderatssitzung vermisst. Du weißt doch, es ging um die …«
»Ich hab dir schon hundertmal gesagt, dass du auf meinem Hof nix zu suchen hast«, blaffte Otto Moritz an. »Ich verkaufe mein Land nicht! Und zu euren dämlichen Sitzungen geh ich schon gar nicht. Und jetzt verschwinde.« Otto ließ Moritz stehen und ging zur Haustür.
Doch so schnell ließ sich Moritz Grünberg nicht abwimmeln. Immerhin ging es um etwas. Sie wollten ein Industriegebiet bauen, einen Supermarkt, eine Tankstelle. Nur leider benötigte die Gemeinde dafür den Acker von Otto Schneider, dem größten Griesgram des Ortes. Die anderen im Wirtshaus hatten ihm gleich gesagt, dass das nichts werden und Otto Schneider niemals verkaufen würde. Aber Moritz Grünberg wollte die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen. Finsternthal sollte sich weiterentwickeln und musste auch für Familien mit Kindern als Wohnort attraktiv werden. Und eine Einkaufsmöglichkeit am Ort, also eine anständige, nicht nur der kleine Dorfladen von Erna neben der Kirche, der nur bis um zwei geöffnet hatte, wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Moritz zuckte kurz zurück, dann startete er einen erneuten Versuch. Er lief Otto bis zum Hauseingang hinterher.
»Aber es ist doch nur eine Wiese. Die brauchst du doch eh nicht. Schau, wir könnten …«
»Bist du taub. Ich habe gesagt, du sollst dich vom Acker machen, und das flott!«, sagte Otto. Er ging ins Haus und schlug laut die Tür hinter sich zu.
»Ja, verkriech dich nur in der alten Hütte. Aber das letzte Wort ist in der Sache noch nicht gesprochen«, hörte er Moritz schreien. »Zur Not stelle ich einen Antrag auf Enteignung zum Wohle der Gemeinde. Hörst du, Otto! Dann siehst du keinen Pfennig für dein Land.«
Otto schloss die Augen und ließ Moritz’ Worte an sich abprallen. Das war doch alles nur Aufplusterei. Enteignung wegen eines Supermarkts und einer Tankstelle. So ein Schwachsinn. Er betrat die Wohnstube und beobachtete durchs Fenster, wie Moritz vom Hof lief. Hoffentlich kam der Idiot so schnell nicht wieder. Sein Blick wanderte zur alten, auf der anderen Seite des Grundstücks stehenden Scheune. Er beschloss hinüberzugehen. Nur mal kurz nach dem Rechten sehen.
Er trat auf den Hof und lief durch den Nieselregen zu der großen Scheune, in der der wichtigste Gegenstand seines Lebens stand. Sein altes Karussell. Ihm folgte der Kater Willi, der bereits dreizehn Jahre zählte. Das Tier strich ihm schnurrend um die Beine. Otto tätschelte ihm den Kopf. »Na, alter Freund. Du hast Hunger, oder? Gleich gibt es was zu essen. Lass uns nur schnell nach unserem alten Mädchen gucken.« Er trat näher an das Karussell heran, das im dämmrigen Licht aussah, als würde es schlafen. Wie gewohnt strich er über das Geländer, machte einen Schritt hinauf, ging durch den unteren Teil des Karussells, berührte jedes Pferdchen, strich über die Armlehne des Schlittenanhängers und drehte am Rondell. Er ging die Treppe in den oberen Bereich und tat dasselbe. Wehmütig strich er auch hier über die Köpfe der Pferdchen und setzte sich schließlich auf eine der Schaukelbänke. Hier kam er zur Ruhe. An diesem Ort, der für ihn mit so vielen Erinnerungen verbunden war. Und diese Erinnerungen brauchte er nun. Er wollte sie fragen, was er tun sollte. Antworten würden sie ihm keine geben. Die gaben sie ihm nie. Aber sie halfen ihm beim Nachdenken. Und zu denken gab es heute einiges. Eine Tochter, eine Enkelin. Was sollte er damit anfangen? Er war ein alter, ein einsamer Mann, den niemand gernhatte. In einer anderen Zeit, als sich das Karussell noch drehte und seine fröhlichen Melodien weithin zu hören waren, da war das anders gewesen. Da hatte ihn jemand gerngehabt, mehr als das sogar. Da hatte ihn jemand geliebt. Mein altes Mädchen. So hatte sein Vater das Karussell stets genannt. Er hatte ihn gebeten, gut darauf achtzugeben. Vermutlich würde ihm nicht gefallen, dass es seit Jahren in dieser Scheune stand. Er meinte immer, ein Karussell müsse funkeln und strahlen. Es müsse die Kinderaugen zum Leuchten bringen und dürfe niemals stillstehen. Und nun stand es schon so lange still. Bald würde die Weihnachtszeit beginnen, die stets die schönste Zeit für sie gewesen war. Viele Jahre war ihr Karussell der Mittelpunkt des Frankfurter Weihnachtsmarktes gewesen, ein Anziehungspunkt für Groß und Klein. Damals bedeutete es etwas, für einige Pfennige auf dem Karussell mitfahren zu dürfen. Der Vater hatte stets die Billetts verkauft, die er und sein Bruder, Gustav, später auf dem Karussell eingesammelt hatten. Gustav. In der Wohnstube hing eine Fotografie von ihnen beiden an der Wand. Arm in Arm und lachend waren sie vor dem Karussell stehend darauf abgebildet. Zwei junge Männer am Anfang ihres Lebens, den Kopf voller Träume, die sich niemals erfüllen würden. Gustav fehlte. Er war im Krieg gefallen, im Osten, nicht aus Stalingrad rausgekommen. Otto selbst war jahrelang in Sibirien in Gefangenschaft gewesen. Nach seiner Rückkehr war nichts mehr wie zuvor. Alles schien verloren, auch die einzige Frau, die er jemals geliebt hatte. Er strich wehmütig über das im dämmrigen Licht schimmernde Geländer, bis plötzlich eine Erinnerung in ihm aufstieg, die ihn doch zum Lächeln brachte.
5. Kapitel
Dezember 1938 – Frankfurt am Main
Otto hob ein kleines Mädchen mit blonden Locken – es war nicht älter als fünf – auf eines der Pferdchen und nickte ihm lächelnd zu. »Gute Fahrt, junge Dame. Und immer schön festhalten.« Sein Blick wanderte zu ihren Eltern, die vor dem Karussell mit Glühweintassen in den Händen standen und ihrer Tochter fröhlich zuwinkten. So einen wärmenden Glühwein hätte er jetzt auch gern gehabt, denn heute zog ein eisiger Ostwind über den Frankfurter Römerberg und ließ die Budenbetreiber des Weihnachtsmarktes zittern. Vor einigen Tagen hatte das Wetter umgeschlagen. Als sie das Karussell aufgestellt hatten, waren es deutliche Plusgrade gewesen, und es hatte geregnet, sogar regelrecht geschüttet. Sein Vater hatte missmutig gewirkt, denn bei Dauerregen lief das Geschäft schlecht. Aber Petrus oder wer auch immer hatte ein Einsehen mit ihnen gehabt, und pünktlich zu Beginn des Weihnachtsmarktes war das Wetter umgeschlagen. Nun war es jeden Tag sonnig, dafür jedoch windig und kalt. Schnee wäre schön gewesen, und Gustav hatte erst gestern Abend gesagt, das werde schon noch kommen. Weihnachten im Schnee, ein Wintertraum, so wünschten es sich viele. Die Realität sah zu den Feiertagen zumeist anders aus. Pünktlich zum Fest wurde es oftmals wärmer, und die zuvor gefallene weiße Pracht schmolz dahin. Aber Gustav war ein hoffnungsloser Optimist in dieser Hinsicht und erhoffte sich auch in diesem Jahr wieder ein Wintermärchen.
Das Karussell setzte sich in Bewegung, und Otto blieb sicherheitshalber in der Nähe des kleinen Mädchens auf dem Pferdchen stehen. Die Kleine, die einen hübschen blauen Wollmantel und eine passende Mütze trug, strahlte über das ganze Gesicht und winkte ihren Eltern fröhlich zu. Auch Otto genoss die Fahrt, obwohl er schon unendlich viele Runden mit dem nostalgischen Karussell gedreht hatte, das in diesem Jahr seinen achtunddreißigsten Geburtstag feierte. Es war von seinem Großvater erbaut worden und hatte seine ersten Runden auf dem immerwährenden Jahrmarkt in St. Pauli gedreht. Während des Ersten Weltkrieges starb der Großvater, und das Karussell wurde eingemottet. Ihr Vater hatte an der Somme gekämpft und davon eine Kriegsverletzung behalten. Er zog das rechte Bein nach, was ihn jedoch nicht daran hinderte, sofort nach Kriegsende die Familientradition wieder aufzunehmen und mit Kind und Kegel und dem Karussell von Jahrmarkt zu Jahrmarkt zu ziehen. Seine große Liebe, Constanze, ihre Mutter, seine Conny, wie er sie liebevoll nannte, stets an seiner Seite. Vor fünf Jahren war sie an Brustkrebs gestorben. Sie fehlte ihnen allen, doch ganz besonders seinem Vater. Die beiden waren über fünfundzwanzig Jahre verheiratet gewesen, eine Einheit, Conny und Günter keiner konnte ohne den anderen. Der Zurückgebliebene zu sein, war niemals einfach. Günter wirkte noch heute oftmals traurig und in sich gekehrt. Der fröhliche Mensch von früher, dem nicht einmal der Krieg sein Lachen hatte nehmen können, schien mit seiner Conny gegangen zu sein. Doch Otto gab die Hoffnung nicht auf, dass sein Vater irgendwann seine Fröhlichkeit wiederfinden würde. Es brauchte nur Geduld.
Der Platz auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt war etwas Besonderes. Die vielen Frankfurter Fachwerkhäuser und das Rathaus, das Römer genannt wurde, boten eine einmalig schöne Kulisse. »Hier wandeln wir auf den Spuren von Kaisern und Königen«, hatte Ottos Vater einmal scherzhaft gesagt. Schließlich waren in Frankfurt lange Zeit die deutschen Kaiser gekrönt worden, weshalb der hinter der Ostzeile aufragende Dom auch Kaiserdom genannt wurde. Dorthin gelangte man durch eine schmale Gasse, den Alten Markt. Diesen liebte Otto ganz besonders, denn an den Schirnen, wie die Verkaufsstände der Metzger genannt wurden, gab es leckere Fleischbrötchen und Würste zu kaufen. Nur allzu gern besorgte er an einem der Stände das Mittagessen, zu dem sie sich meistens einen heißen Apfelwein gönnten.
Nachdem das Karussell seine Runde beendet hatte, half Otto dem kleinen Mädchen vom Pferd und brachte es zu seinen Eltern, die sich für seine Hilfsbereitschaft bedankten und ihm ein frohes Fest wünschten. Gustav trat neben ihn. Er nieste laut und putzte sich die Nase mit einem karierten Stofftaschentuch. Seit Tagen schon plagte ihn ein scheußlicher Schnupfen.