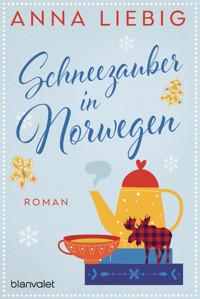
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Winter-Liebe
- Sprache: Deutsch
Eine ganze Stadt aus Lebkuchen. Sie erscheint wie ein magischer Traum und ist mit Liebe gebacken: der Wohlfühlroman für die schönste Zeit des Jahres.
Nina ist glücklich. Sie mag ihr Leben, ihren Beruf und vor allem liebt sie ihren Opa! Und der ist gerade ganz aus dem Häuschen, denn er hat eine Doku über die größte Lebkuchenstadt der Welt, die jedes Jahr in der Stadt Bergen aufgebaut wird, gesehen. Und da will er jetzt mit Nina unbedingt hin, denn die Mutter des Architekten ist seine alte Liebe Ingrid. So sitzt Nina alsbald im Flugzeug nach Norwegen, wo ihr Opa nicht nur ein großes Geheimnis über Ingrid erfährt, sondern Nina sich zwischen Lebkuchengewürz und Knetmaschine auch auf einen Flirt mit einem netten Norweger einlässt …
Warmherzig, zauberhaft, einfach wundervoll – der Feel-Good-Liebesroman für die schönste Zeit des Jahres!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Nina ist glücklich. Sie mag ihr Leben, ihren Beruf und vor allem liebt sie ihren Opa! Und der ist gerade ganz aus dem Häuschen, denn er hat eine Doku über die größte Lebkuchenstadt der Welt, die jedes Jahr in der Stadt Bergen aufgebaut wird, gesehen. Und da will er jetzt mit Nina unbedingt hin, denn die Mutter des Architekten ist seine alte Liebe Ingrid. So sitzt Nina alsbald im Flugzeug nach Norwegen, wo ihr Opa nicht nur ein großes Geheimnis über Ingrid erfährt, sondern Nina sich zwischen Lebkuchengewürz und Knetmaschine auch auf einen Flirt mit einem netten Norweger einlässt …
Autorin
Anna Liebig ist das Pseudonym von Nicole Steyer, einer erfolgreichen Autorin historischer Romane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus. Bereits mit acht Jahren begann sie, Geschichten zu erfinden und niederzuschreiben. Ihre Romane sind Liebeserklärungen an die schönste Zeit des Jahres: Weihnachten.
Anna Liebig
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Matthias Teiting
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
LH ∙ Herstellung: DiMo
ISBN 978-3-641-31037-0V001
www.blanvalet.de
1
Nina saß an ihrem Schreibtisch und ließ den Blick von ihrem Monitor weg über den im tristen Grau des Novembernachmittags versinkenden Firmenparkplatz schweifen. Das Laub der Buchen lag in den großen Pfützen und auf den Dächern der Autos, ein böiger Wind wehte einige Regentropfen gegen die Fensterscheibe. Schon allein der Anblick der nasskalten Welt dort draußen ließ sie frösteln, und sie verfluchte sich dafür, ihre dicke Strickjacke zu Hause gelassen zu haben. In diesem Leben würde sie es vermutlich nicht mehr erleben, dass die Heizung in dem aus den Achtzigerjahren stammenden Bürogebäude für angemessene Wärme sorgte. Fröstelnd griff sie nach ihrem dampfenden Teebecher und legte ihre kalten Hände um das angenehm wärmende Porzellan.
»Hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich heute eine Stunde früher losmuss«, riss ihre Kollegin Jessica sie aus ihren Gedanken. »Ich hab nachher noch eine Verabredung.«
Überrascht wandte sich Nina um.
»Du hast ein Date, heute Abend?«, hakte sie nach. »Aber vorgestern hast du dir wegen deinem Pascal doch noch die Augen ausgeheult. Ihr habt erst am letzten Wochenende offiziell Schluss gemacht – findest du nicht, dass das alles etwas zu flott geht?«
»Ja, aber gestern Abend hab ich spontan Tinder wieder aktiviert, und dieser Kevin klingt echt nett und sieht noch dazu gut aus. Und er will Familie und Kinder«, antwortete Jessica eifrig und hielt ihr das Bild eines braunhaarigen Mannes hin, der tatsächlich einen ganz passablen Eindruck machte. »Diese Chance möchte ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. In drei Wochen werde ich schließlich dreißig.« Sie begann, ihr halblanges blondes Haar zu bürsten. »Du weißt ja, wie das bei uns Frauen mit der biologischen Uhr ist. Am Ende bin ich zu spät dran, und es klappt nicht mehr. Ich meine, die erzählen zwar alle immer, dass die dreißig die neuen zwanzig wären, aber das ist doch alles Schönrederei.« Sie winkte ab, legte die Bürste zur Seite und begann, in ihrer Handtasche zu kramen. Auf ihrem Schreibtisch landeten eine Puderdose, ein Lippenstift und Wimperntusche.
»Aber das Leben lässt sich doch nicht vorausplanen«, warf Nina ein und nippte an ihrem Tee. »Und die Liebe gleich zweimal nicht, biologische Uhr hin oder her.«
Nina blickte versonnen auf den Ficus, der auf ihrer Fensterbank stand. Die Pflanze war ihr aktueller Büroproblemfall, täglich bekam er immer mehr gelbe Blätter, da half auch der Dünger nichts, den sie neulich im Gartencenter gekauft hatte. Ihr war dort ein gut aussehender Typ aufgefallen, groß, blond, breite Schultern. Bedauerlicherweise war er nur kurz allein gewesen – dann war seine Freundin zu ihm gestoßen, und die beiden hatten eine Diskussion über Gartenmöbel begonnen. Na, wenn schon. Nina hätte sich sowieso nicht getraut, ihn anzusprechen. Wenn es um Annäherungsversuche beim anderen Geschlecht ging, war sie schüchtern.
Bevor sie die Plauderei mit ihrer Kollegin wieder aufnehmen konnte, durchbrach das Läuten ihres Telefons die Stille, und Nina nahm den Hörer ab. Es war ihr Bereichsleiter, Daniel Köhler, der sie zu einem Gespräch in sein Büro bat.
»Der will dir bestimmt wieder zusätzliche Arbeit aufhalsen«, meinte Jessica. »Darin ist er gut.«
Nina antwortete nicht und erhob sich.
Im Flur empfing sie das kühle Licht der Neonlampen, und der graue und erst vor wenigen Tagen neu verlegte Linoleumboden verströmte noch immer diesen unangenehmen Chemiegeruch, der unter den Kollegen bereits zu allerlei Mutmaßungen geführt hatte. Am Ende waren Giftstoffe in die Auslegware eingearbeitet, und sie würden allesamt bald Atemprobleme, vielleicht sogar Krebs bekommen. Oder es würde gar nichts passieren und der Gestank einfach verfliegen. Nina hoffte auf Letzteres.
Sie lief an geöffneten Bürotüren vorbei, nicht jeder Schreibtisch war besetzt, einige Mitarbeiter waren wohl im Homeoffice. Seit bereits fünf Jahren arbeitete Nina als Buchhalterin für die Wohnungsbaugesellschaft BGA, die im Frankfurter Westend ihren Firmensitz hatte. Weshalb sie ausgerechnet im Bereich Buchhaltung hängen geblieben war, konnte sie heute gar nicht mehr genau sagen. Nach der Schule hatte sie eigentlich etwas Kreatives machen wollen. Modedesignerin oder vielleicht Konditorin. Sie liebte es, zu backen, kam aber viel zu selten dazu. Floristin hätte ihr auch gefallen, aber die Bezahlung war ihr zu schlecht gewesen. Auf Anraten der Berufsberatung hatte sie dann eine Ausbildung zur Industriekauffrau begonnen, und danach war sie hier in der Buchhaltung gestrandet. Das Gehalt war gut, die Kollegen nett, die Arbeitszeiten moderat, und es gab Weihnachtsgeld und andere Benefits wie etwa eine kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessstudio, was Nina zu ihrer Schande viel zu selten nutzte.
Die Tür zu Daniels Büro stand offen. Er winkte sie mit einem Lächeln herein und bat ihr sogleich einen Lebkuchen an. Nina lehnte das Angebot ab, ihr war nicht nach Süßem.
Daniel bat sie, sich zu setzen und schloss die Tür, was Nina seltsam vorkam, denn normalerweise tat er das nie. Sogleich befiel sie ein mulmiges Gefühl – hatte sie etwas verbockt?
Gerade als ihr auffiel, dass Daniel etwas humpelte, setzte er an, um seinen schleppenden Gang zu entschuldigen. »Ich hab am Wochenende an dem Halbmarathon rund um Königstein teilgenommen und mir glatt wegen einer dummen Wurzel den Fuß verknackst. Ich musste sogar aufgeben, so etwas ist mir schon ewig nicht mehr passiert.«
Nina bedauerte sein Missgeschick. Sie wusste, dass Daniel ein begeisterter Langstreckenläufer war. Von seiner Teilnahme am New York Marathon stand sogar ein Erinnerungsbild auf seinem Schreibtisch. Sein Äußeres passte zu seinem Hobby. Er war groß und schlaksig, fast schon hager, wie Nina befand. Sein dunkelbraunes Haar war leicht gelockt, und er trug gern auffällige Brillen, heute hatte er ein königsblaues Modell mit riesigen Gläsern gewählt.
»Wieso hast du die Tür zugemacht?«, fragte Nina. »Das machst du sonst nie. Ist alles in Ordnung?«
»Selbstverständlich ist es das«, erwiderte Daniel. »Sogar in bester Ordnung. Es gibt gute Neuigkeiten, die ich morgen in großer Runde verkünden werde. Ich habe noch niemandem davon erzählt, aber ich werde ab Dezember der neue Finanzvorstand sein, meine Bewerbung ist angenommen worden. Und nicht nur das: Mein Vorschlag, dich zur neuen Bereichsleiterin der Buchhaltung zu machen, ist ebenfalls begrüßt worden. Das bedeutet, dass ich dir hier und jetzt offiziell zu deiner Beförderung gratulieren darf.« Er schaute Nina breit grinsend an. »Ist das nicht super?«
Ninas Miene war jedoch versteinert. Sie hatte mit vielem gerechnet, aber niemals mit einer Beförderung. Bereichsleitung, du liebe Güte! Sie war sich nicht sicher, ob sie einen Job mit so viel Verantwortung wirklich wollte. Sie hatte in den vergangenen Jahren ihre kleine und geordnete Buchhaltungswelt mit den immer gleichen Abläufen durchaus lieb gewonnen, ebenso ihre Kollegin Jessica, die zu hundert Prozent verstimmt reagieren würde, wenn sie von den geplanten Veränderungen erfuhr. Jessica war einige Jahre länger im Unternehmen und hatte die Beförderung viel mehr verdient. Wieso nur hatte Daniel vorab nicht mit Nina über seine Idee gesprochen?
Ihm fiel auf, dass ihre Begeisterung gedämpft blieb.
»Du willst die Beförderung nicht«, deutete er ihre zurückhaltende Reaktion richtig. Immerhin kapierte er schnell, worauf es ankam.
»Sei mir nicht böse«, antwortete sie. »Es ist lieb gemeint, aber ich bin glücklich, wo ich bin. Es wäre besser gewesen, wenn du vorher mit mir geredet und nicht einfach über meinen Kopf hinweg entschieden hättest.«
Nina biss sich auf die Zunge. Ihr letzter Satz hatte etwas hart geklungen, Daniel meinte es schließlich nur gut. Jeder andere Mitarbeiter der Abteilung hätte sich über seine Bemühungen gefreut.
»Und was jetzt?«, fragte er. »Ich kann mein Wort schlecht zurücknehmen. Der Vorstand würde wenig Verständnis dafür haben. Wie steh ich denn jetzt da? Als ein Bereichsleiter, der seine eigenen Mitarbeiter nicht im Griff hat? Tu mir den Gefallen und nimm das Angebot an. Ja, der Job bedeutet mehr Verantwortung, aber ich hätte dich nicht vorgeschlagen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass du das hinbekommst. Wenn du magst, greife ich dir am Anfang ein bisschen unter die Arme. Du wirst sehen, es ist alles leichter als gedacht. Lass mich jetzt bitte nicht hängen.« Er sah sie flehend an.
Nina stieß einen tiefen Seufzer aus. Alles in ihrem Inneren sträubte sich gegen eine Zusage. Trotzdem antwortete sie: »Gut, ich überlege es mir.«
Nina war zu Hause in einer Altbauwohnung im Nordend. Vierter Stock, fünf Zimmer, bedauerlicherweise gab es keinen Aufzug. Dafür hatte sie gleich vier Mitbewohner. Drei davon mit Fell. Und die kamen ihr jetzt freudig entgegengelaufen und strichen aufgeregt maunzend und schnurrend um ihre Beine. Die drei Katzen gehörten ihrem menschlichen Mitbewohner Alex, der anscheinend mal wieder in der Küche werkelte, denn der gesamte lang gezogene Flur mit dem alten und immer etwas knarrenden Parkettboden war vom Geruch gebratener Zwiebeln erfüllt. Ninas Magen begann zu knurren. Sie hängte ihren Mantel an den überfüllten Garderobenständer, zog ihre Sneaker aus und schlüpfte in ihre Hausschlappen. Gemeinsam mit den drei Katzen ging sie in die Küche.
Alex stand tatsächlich am Herd. »Hi Nina. Du bist früh dran«, begrüßte er sie und fügte klein gehackten Knoblauch zu den Zwiebeln in der Pfanne.
»Ja, ich hab heute eher Schluss gemacht«, antwortete Nina und setzte sich auf die Küchenbank. »Du aber auch, wie ich sehe.«
Auf ihrem quadratischen Küchentisch herrschte das vertraute Durcheinander: Zeitungen, Post, gebrauchtes Geschirr. Ein Kürbiswindlicht auf einem Tablett, dem einige verschrumpelte Kastanien und vertrocknete Blätter Gesellschaft leisteten. Die Fensterbank teilten sich eine Stehlampe und ein Geldbaum, der grün und frisch aussah, denn Alex kümmerte sich hingebungsvoll um das Gewächs. Er war dem Volksglauben erlegen, dass jeder Haushalt eine solche Zimmerpflanze benötigte, denn sie versprach Glück und Wohlstand. Außerdem war sie ungiftig für Katzen. Was wichtig war, denn besonders Charly Brown hatte die Angewohnheit, alle Dinge anzuknabbern.
Der Kater sprang neben Nina auf die Bank und kuschelte sich laut schnurrend an sie. Er war wuschelig und hatte ein schwarz-weißes Fell. Die beiden anderen Katzen waren beide grau-weiß getigert und nur deshalb gut auseinanderzuhalten, weil Peppermint Patty eine komplett weiße Nase hatte. Alex war ein großer Fan der Peanuts, weshalb er die Katzen nach Figuren aus dieser Serie benannt hatte. Charly Brown, Peppermint Patty und Schröder.
»Ja, das neue Spiel ist früher fertig geworden als angenommen. Es läuft prima und wird noch diese Woche released«, sagte er.
»Du meinst das Spiel, wo man die bösen Schneemänner abschießen und die Geschenke einsammeln und zurück zum Weihnachtsmann bringen muss?«
»Richtig«, antwortete er. »Das perfekte Game für die Weihnachtszeit. Die Spieler werden es lieben. Und zur Feier des Tages, dachte ich, koche ich meine allseits geliebte Lasagne.« Er wandte sich vom Herd ab, in der Hand ein Glas Rotwein. »Auch eins? Du siehst aus, als könntest du einen Schluck gebrauchen.«
Alex, der als Softwareprogrammierer die meiste Zeit im Homeoffice arbeitete, war gut darin, Ninas Stimmungslagen zu erkennen. Das musste sie ihm lassen. Mit seinem Feingefühl wäre er der perfekte Partner für jede Frau gewesen, allerdings war er homosexuell. Nina fand, dass er wie eine jüngere Version der Figur Stanford aus der Serie Sex and the City aussah. Er hatte ein rundliches Gesicht und trotz seiner gerade einmal fünfunddreißig Jahre nur noch wenige Haare auf dem Kopf, und er war mit seinen ein Meter siebzig ähnlich groß wie der Schauspieler, der den Stanford spielte. Nur im Kleidungsstil ähnelte er dem Darsteller weniger. Alex liebte auffällige Hoodies mit Aufdrucken aller Art. Da am Vorabend Halloween gewesen war, trug er heute einen Sweater mit einem schief grinsenden Kürbis darauf.
Nina stimmte zu, obwohl sie ahnte, dass ihr der staubtrockene Rotwein nicht schmecken würde. Alex und fruchtiger Wein würden in diesem Leben nicht mehr zueinanderfinden.
Er schenkte ihr ein Glas ein, reichte es ihr und fragte: »Willst du darüber reden? Du bist hoffentlich nicht entlassen worden.«
»Nein, natürlich nicht«, erwiderte Nina und nippte an ihrem Glas. Der Wein brannte im Hals, sie verzog das Gesicht. Himmel, die Plörre war schlimmer als befürchtet. Sie stellte das Glas auf den Tisch und erläuterte, was im Büro vorgefallen war.
»Eine Beförderung«, wiederholte Alex. »Aber das ist doch eigentlich etwas Gutes. Oder sehe ich das falsch?«
»Schon, wenn man Bereichsleiterin werden will. Aber ich habe keine Lust darauf, denn dann müsste ich Verantwortung für mein Personal übernehmen, in Sitzungen herumhängen und all so ein Zeug. Mir gefällt mein aktueller Job ganz gut.«
»In dem du den ganzen Tag Rechnungen einbuchen musst«, meinte Alex.
Nina verdrehte die Augen. »Ja, ich weiß. Du findest meine Arbeit öde und mein Leben auch. Eine graue Buchhaltungsmaus, die seit einer gefühlten Ewigkeit Single ist und nach zwanzig Uhr kaum noch das Haus verlässt.« Sie klang angegriffen und wusste, dass sie überreagierte.
»Ich habe nie gesagt, dass du grau bist«, entgegnete Alex trocken. Er nahm die Pfanne von der Herdplatte, damit die Zwiebeln nicht anbrannten. »Aber deinem Leben fehlt ein bisschen Würze. Du bist doch jung, da gibt es mehr als immer nur Arbeit. Männer zum Beispiel. Ich hab dir schon hundertmal gesagt, dass du dir Tinder runterladen sollst. Ich helfe dir auch bei der Auswahl.«
»Bloß nicht«, winkte Nina ab. »Jeder weiß doch, dass sich auf dieser App nur Typen rumtreiben, die nix Festes suchen. Jessica hat vorhin auch damit angefangen. Was ist aus dem Kennenlernen im Supermarkt, beim Spaziergang mit dem Hund oder auf einer Party von Freunden geworden?«
»Du hast keinen Hund, gehst nie auf Partys, und im Supermarkt an der Fleischtheke kannst du lange auf deinen Traummann warten«, merkte Alex an.
»Dann stell ich mich eben an die Käsetheke«, gab Nina patzig zurück. Die Dauersingle-Diskussion führte sie nicht zum ersten Mal mit Alex, der sich zwar ebenfalls in keiner festen Partnerschaft befand, aber durchaus kein Kind von Traurigkeit war. Wo er sich genau mit wem an den Wochenenden herumtrieb, wollte Nina gar nicht wissen. Manchmal brachte er einen seiner Aufrisse mit nach Hause. Erst vor zwei Wochen war sie aus dem Bad geflohen, weil ein fremder, nackter Mann auf der Toilette gesessen hatte.
Ninas Handy, das vor ihr auf dem Tisch lag, piepte. Es war eine WhatsApp-Nachricht, die sie aufstöhnen ließ.
»Huhu Nina, bleibt es bei nachher? Wir wollten doch Karten spielen. Ich hab deine Lieblings-Kürbissuppe gekocht.«
»Das ist Opa, ich hab ganz vergessen, dass ich heute zu ihm wollte«, sagte sie. »Allerheiligen ist für ihn kein leichter Tag. Wegen Oma, die heute vor acht Jahren gestorben ist.«
»Also kein Abend mit Greys Anatomy in Dauerschleife und Lasagne«, meinte Alex. Ihm war die Enttäuschung anzusehen.
»Es tut mir leid«, entschuldigte sich Nina. »Ich mach es wieder gut. Fest versprochen.«
»Versprich nichts, was du nicht halten kannst«, entgegnete Alex, lenkte dann jedoch ein. »Aber dein alter Herr geht natürlich vor. Ich versteh das schon. Ist halt Familie, und dann auch noch so ein spezieller Tag. Grüß ihn schön von mir. Ich heb dir was von der Lasagne auf.«
Nina stand auf und umarmte ihn kurz, sogar ein Küsschen drückte sie ihm auf die Wange.
»Bist der Beste«, sagte sie. »Und vielleicht können wir ja später am Abend noch schauen, wie es so läuft bei McDreamy und Co. Opa wird gegen neun immer müde.«
Als sie wenige Augenblicke später die Wohnung verließ, verspürte sie ein bedrückendes Gefühl, das sie nur allzu gut kannte. Ist halt Familie, hatte Alex lapidar gesagt. Für sie war dieser Begriff mit einem tiefsitzenden Kummer behaftet. Alex besaß reichlich Verwandtschaft. Drei ältere Schwestern, die allesamt verheiratet waren und Kinder hatten. Seine Eltern wohnten nicht weit von Frankfurt entfernt in dem Örtchen Liederbach in einem Einfamilienhaus. Hinzu kamen seine Großeltern sowie eine ganze Horde an Onkeln und Tanten. Weihnachten war bei ihm ein riesiges Familienfest. Er verschwand über die Feiertage stets komplett und tauchte zwischen den Jahren mit einem Sammelsurium an Standardgeschenken wieder auf. Pullover, gestrickte Socken, Tassen, Schlafanzüge, die er meist abscheulich fand. Nina beneidete ihn jedoch um seine lebhaften und fröhlichen Feiertage, denn bei ihr war Weihnachten eine schwierige Angelegenheit.
Ihr Opa Uwe war die einzige Familie, die ihr noch geblieben war, nachdem ihre Eltern vor zwölf Jahren bei einem Autounfall verunglückt waren. Geschwister gab es keine, Onkel und Tanten auch nicht, keine Großeltern väterlicherseits. Die waren irgendwann nach Australien ausgewandert, und das Verhältnis zu ihrem Sohn war zerrüttet gewesen, weshalb hatte Nina nie erfahren. Sie kannte nicht einmal ihre Namen und wusste nicht, ob sie überhaupt noch lebten. Ihr Opa mütterlicherseits, Uwe, war ein rüstiger, vierundsiebzigjähriger Rentner, der in einer Altbauvilla in Sachsenhausen im ersten Stock lebte und dank seiner beachtlichen Beamtenpension ein angenehmes Leben führte. Er hatte früher im Straßenverkehrsamt im gehobenen Dienst gearbeitet.
Der Tod ihrer Eltern war für sie beide eine Tragödie. Die eigenen Kinder sollte niemand beerdigen müssen, hatte Uwe Jahre später einmal zu ihr gesagt. Ninas Großmutter Thea hatte den Verlust ihrer Tochter nie verkraftet, nach dem Unfall hatte sie nur noch selten gesprochen. Die Stille in der Wohnung ihrer Großeltern war für Nina oftmals unerträglich gewesen, wie ein Dröhnen hatte sie ihren Schmerz darin empfunden.
Theas Krebs war bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden, zu weit fortgeschritten. Nur acht Wochen hatte es gedauert, bis sie in einem Hospiz gestorben war. Opa Uwe war nur rasch heimgefahren, um sich umzuziehen. Er hatte geahnt, dass es so kommen würde. Die wichtigen Dinge im Leben hatte seine Thea immer mit sich selbst ausgemacht. Also war sie auch allein gegangen.
Vielleicht war es die Angst vor dem Verlust, die Nina daran hinderte, sich einem anderen Menschen zu öffnen. Durch die Tragödie ihrer Familie war sie verwundet, nicht bindungsfähig, so würde es vermutlich ein Seelenklempner formulieren. Aber immerhin, ihr Opa Uwe war ihr noch geblieben, und er freute sich jedes Mal über Ninas Besuch und zockte sie stets gnadenlos beim Kartenspielen ab. Es galt darauf zu hoffen, dass er die Kürbissuppe nicht wie im letzten Jahr versalzen hatte.
Der Gedanke daran zauberte Nina ein Lächeln auf die Lippen. Wenn sie Glück hatte, gab es Äppler, damit ließ sich die salzige Suppe ganz gut runterspülen.
2
Nina drückte auf den Lichtschalter, und die stets surrende Treppenhausbeleuchtung sprang an. Ihr stieg der vertraute Geruch des Hausflurs in die Nase, es roch nach Haka-Seife, Zigarettenrauch und Küchendüften. Für die ersten beiden Duftmarken war Else Merlinger verantwortlich, Uwes achtzigjährige und im Erdgeschoss wohnende Nachbarin. Sie wischte zweimal pro Woche die Treppen und rauchte nach getaner Arbeit am geöffneten Fenster auf dem ersten Treppenabsatz ihr Kippchen. Heute schien mal wieder ihr Putztag gewesen zu sein.
Vor Uwes weiß gestrichener Wohnungstür angekommen, kramte Nina den Wohnungsschlüssel aus ihrer Handtasche. Sie hatte ihn auch nach ihrem Auszug behalten, schon wegen der Sicherheit. Außerdem war ihr Großvater gut darin, sich auszusperren. Allein im vergangenen Monat hatte er dieses Kunststück zweimal hinbekommen.
Der Flur der Wohnung war rechteckig und ziemlich geräumig. Platzverschwendung, wie Uwe zu sagen pflegte. An der hohen Decke gab es sogar eine Stuckverzierung – das dreistöckige Haus war um die Jahrhundertwende errichtet worden, da waren solche Verzierungen noch in Mode gewesen. Auf dem Parkettboden lagen persische Teppiche, zudem gab es behäbige Garderobenmöbel aus dunklem Holz, die den Charme der Vierzigerjahre verbreiteten. Auf einer schweren Kommode stand Opas Telefon, ein grüner, aus der Zeit gefallener Festnetzapparat mit Wählscheibe, neben dem stets sein Adressbuch lag.
Nina betrat das Wohnzimmer. Zu ihrer Verwunderung stand Opa Uwe mitten im Raum, was er sonst nie tat. Er trug seine übliche Kleidung, eine braune, von Hosenträgern gehaltene Cordhose, dazu ein blau-rot kariertes Hemd. Ihr Großvater war schon immer schlank gewesen, auch jetzt hatte er für sein Alter noch eine annehmbare Figur, es zeigte sich lediglich ein kleines Wohlstandsbäuchlein. Sein weißes und noch recht volles Haar war lang geworden und stand heute etwas wirr vom Kopf ab. Der Fernseher, der in der Mitte der großen Eichenschrankwand stand, war laut gedreht.
»Nina, Schatz«, sagte er aufgeregt, ohne sie zu grüßen. »Siehst du die Frau da in der Sendung? Die kenne ich. Ist das nicht unglaublich? Meine Güte, das ist ewig her. Ingrid hat sich überhaupt nicht verändert.«
Verdutzt schaute Nina auf den Bildschirm. Wie gewohnt, lief das Hessische Fernsehen. Es wurde ein Bericht gezeigt, der schon in die Weihnachtszeit passte. Ins Bild kam eine riesige Lebkuchenstadt, überall blinkten und funkelten Lichter. Laut der Sprecherin befand sich dieses Backwunderwerk in der norwegischen Stadt Bergen. Eine ältere Frau mit einem blonden Pagenkopf kam ins Bild und beantwortete die Fragen des Journalisten auf Englisch.
Aufgeregt deutete Uwe auf die Frau. »Das ist meine Ingrid. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sie noch einmal wiedersehe. Und sie ist so engagiert und hilft bei einer großartigen Sache mit! Das ist die größte Lebkuchenstadt der Welt. Das muss man sich mal vorstellen, da backen keine großen Firmen, sondern die Einwohner von Bergen. Ist das nicht großartig? Und sie ist noch immer so hübsch! Wie ein Engel sieht sie aus.«
Nina war dermaßen überrascht, ihr fehlten die Worte. Wie gebannt starrte ihr Großvater auf den Bildschirm. Niemals zuvor hatte sie seine Augen auf eine solche Weise leuchten sehen.
Die Frau verschwand aus dem Bild, und das Kamerateam befand sich nun bei einer norwegischen Familie und filmte, wie in deren Stube eines der Lebkuchenhäuser entstand. Zwei Kinder, Nina schätzte sie auf acht und zehn Jahre, waren gemeinsam mit ihrer Mutter gewissenhaft bei der Sache. Vor dem Fenster war ein Fjord zu sehen, Schnee lag allerdings keiner. Aber gewiss würde bald welcher fallen. Wenn nicht in Norwegen, wo sonst konnte man noch auf weiße Weihnachten hoffen? In Frankfurt hatte es diese zuletzt vor vierzehn Jahren gegeben.
Nina setzte sich aufs Sofa.
»Woher kennst du denn eine Ingrid in Norwegen?«, fragte sie schließlich.
Der Beitrag kam zu seinem Ende, noch einmal wurde die Lebkuchenstadt gezeigt, abschließend verkündete die Moderatorin der Sendung, dass selbstverständlich auch in diesem Jahr pünktlich zum Beginn der Adventszeit die größte Lebkuchenstadt der Welt in Bergen wieder ihre Tore öffnen werde. Die Internetseite wurde eingeblendet.
»Mein Mädchen, es scheint ihr gut ergangen zu sein«, sagte Uwe leise, und Nina glaubte, Tränen in seinen blauen Augen zu erkennen. In diesem Moment wurde ihr endgültig klar, dass diese Ingrid irgendwann einmal eine bedeutende Rolle im Leben ihres Großvaters gespielt haben musste. Sie wusste, dass er bei seiner Hochzeit fünfundzwanzig Jahre alt gewesen war. Ihr Blick fiel auf das im Schrank stehende Hochzeitsfoto ihrer Großeltern. Er war ein attraktiver Mann gewesen. Es war durchaus möglich, dass er vor der Heirat die eine oder andere Romanze gehabt hatte. Aber mit einer Norwegerin? Wie war es denn dazu gekommen?
Der Beitrag endete und auch die Sendung. Es folgten regionale Nachrichten.
Nina stellte ihre Frage erneut.
Ihr Großvater stieß einen Seufzer aus und antwortete: »Das ist eine längere Geschichte. Wenn du magst, erzähle ich sie dir beim Essen. Die Kürbissuppe hab ich auf dem Herd warm gehalten. Ich hab auch Kürbisöl und Baguette zum Tunken.« Er nahm die Fernbedienung zur Hand und schaltete den Fernseher aus.
»Das klingt großartig«, sagte Nina, als sie in die Küche hinübergingen, die schon immer Ninas absoluter Lieblingsraum in der Wohnung ihrer Großeltern gewesen war.
Die Einrichtung war bunt zusammengewürfelt, eine normale Einbauküche suchte man vergebens. Aber gerade das verlieh diesem Raum nach Ninas Meinung einen charmanten Charakter. Es gab einen Standherd mit vier Herdplatten, weiß getünchte, rustikale Hängeschränke und eine Arbeitsplatte aus hellem Holz, die ihr Opa vor Jahren selbst zugeschnitten und angebracht hatte. Darunter befanden sich einige Regale, die durch einen rot-weiß karierten Vorhang abgedeckt wurden. Von der Küche gelangte man durch eine altmodische Doppelkastentür auf den großen Balkon mit dem steinernen Geländer. Im Sommer saß Nina mit ihrem Großvater an lauen Sommerabenden gern dort draußen. Es fehlten allerdings die Geranien, denn er besaß, im Gegensatz zu Thea, keinen grünen Daumen.
Uwe schaltete das Radio ein. Bei ihm lief immer ein Oldie-Sender, gerade wurde irgendeine Ballade aus den Siebzigern gespielt. Die Melodie mitsummend, holte er die Teller mit dem altmodischen Blümchendekor aus dem Küchenbüfett. Nina fischte Besteck aus der Tischschublade, währenddessen machte sich ihr Großvater auf die Suche nach den gerippten Apfelweingläsern. In einem der Hängeschränke wurde er fündig. Es folgten eine Flasche Äppler und ein gut gefüllter Brotkorb. Nina entzündete die auf dem Tisch stehende Kerze. Der Suppentopf wurde auf einem Korkuntersetzer platziert, und Uwe begann die Teller zu füllen. Die Suppe duftete köstlich, Nina lief das Wasser im Mund zusammen. Sie kostete und stellte erfreut fest, dass Uwe sie dieses Mal nicht überwürzt hatte. Sogleich lobte sie seine Kochkünste und griff nach einem Stück Baguette.
»Ja, sie ist schon ganz gut geworden«, antwortete er. Wie gewohnt hatte er sich seine Stoffserviette in den Ausschnitt gesteckt. In weiser Voraussicht, denn er war schon immer gut darin gewesen, sich zu bekleckern. »Aber ich glaube, ich hab den Ingwer vergessen – den gilt es jetzt zu verschmerzen.«
Er nahm sich ebenfalls ein Stück Baguette und begann, es in die Suppe zu bröckeln.
»Erzählst du mir jetzt von dieser Ingrid?«, fragte Nina.
»Ich kann es immer noch nicht glauben. Meine Ingrid im Fernsehen. Jedes Mal, wenn ich irgendetwas von Norwegen gehört habe, hab ich mich an sie erinnert und mich gefragt, wie es ihr ergangen ist. Wohl ganz gut. Obwohl ich damals ein dummer Hornochse gewesen bin. Aber es war auch alles nicht so einfach in diesen Zeiten.« Wehmut schwang in seiner Stimme mit.
»Jetzt will ich aber mal alles wissen«, warf Nina ungeduldig ein. »Weshalb warst du ein Hornochse, und was war nicht einfach?«
»Das war damals Mitte der Sechzigerjahre. Ich bin mit meinem Kumpel Jochen nach dem Abitur auf die spontane Idee gekommen, in den Norden Europas zu reisen. Es war eine verrückte Tour in einem orangen VW Käfer. Erst waren wir eine Weile in Dänemark unterwegs, dann setzten wir mit der Fähre nach Kristiansand in Norwegen über. Es war Ende Juni und Mittsommer. Wir hatten Glück mit dem Wetter, selten Regen, viel Sonnenschein, dazu die hellen Nächte. Es war ein Traum. Wir sind einfach losgefahren, die Küste entlang, haben oft irgendwo gezeltet, wir waren in Stavanger, an einsamen Fjorden. In der Nähe von Bergen sind wir in einem kleinen Dorf in einer Pension mit nur drei Gästezimmern untergekommen, die Ingrids Eltern gehörte. Sie hat dort gearbeitet, hat uns unser Zimmer gezeigt. Sie war so wunderschön, langes blondes Haar, strahlend blaue Augen, dazu ihre zarte Figur. Ich war sofort wie verzaubert. Am Abend gab es in dem Dorf ein Fest, und dort sind wir uns dann nähergekommen. Wir haben stundenlang am Ufer eines Fjords gesessen und geredet. Zum Glück sprachen wir beide gut Englisch. Auch Jochen lernte an dem Abend ein Mädchen kennen, und wir sind länger in dem Dorf geblieben. Es war ein unvergesslicher Sommer. Wir vier waren so verliebt!«
Nina fiel auf, wie sehr er während seiner Erzählung in der Erinnerung versank. Seine Augen strahlten regelrecht, so hatte sie ihn noch nie gesehen. Oder war dieser Eindruck gegenüber ihrer verstorbenen Großmutter ungerecht? Sie tat den Gedanken ab. Uwe war Jahrzehnte mit seiner Thea verheiratet gewesen, ihr Miteinander war natürlich irgendwann alltäglich geworden. Das Strahlen seiner Augen galt einer Zeit des Glücks, als er noch jung und frei gewesen war. In diesem Moment wünschte sich Nina, sie könnte ebenso freudig auf die Zeit nach ihrem Schulabschluss zurückblicken. Doch der Tod ihrer Eltern hatte einen düsteren Schatten über alles gelegt, Unbeschwertheit oder gar eine erste Liebe hatte sie in jenen Jahren nicht erlebt. Dazu war sie, gefangen in ihrer Trauer, gar nicht in der Lage gewesen.
Sie schob die traurigen Gedanken zur Seite. Sie wollte sich stattdessen darüber freuen, von einem bisher unbekannten Kapitel im Leben ihres Großvaters zu erfahren. Es war schön zu sehen, wie sehr ihn der Rückblick in die Vergangenheit freute. Mit ihrer nächsten Frage sorgte sie jedoch dafür, dass das Leuchten in seinen Augen erlosch.
»Und wieso bist du ein Hornochse gewesen?« Sie biss sich auf die Zunge. Zu oft war sie in Gesprächen ein wenig vorschnell. Sie hätte ihn noch eine Weile in seinen Erinnerungen schwelgen lassen sollen.
»Weil ich sie zurückgelassen hab. Ich hätte sie einfach einpacken und mit nach Deutschland nehmen sollen. Aber damals war das alles nicht so leicht. Die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs waren noch deutlich zu spüren, uns Deutschen wurde nicht von jedem die Freundschaft angeboten, was ja auch verständlich war. Ich hab mich von Ingrids Bruder einschüchtern lassen. Er und seine Kumpels haben Jochen und mich eines Abends überfallen und verprügelt. Sie haben gesagt, dass sie uns umbringen, wenn wir nicht sofort abhauen und die Finger von ihren Frauen lassen würden. Wir haben ganz schön was abbekommen und waren total in Panik. Noch in derselben Nacht haben wir unsere Sachen gepackt und sind gefahren. Ich habe mich nicht einmal von ihr verabschiedet. Das wird sie mir niemals verziehen haben.« Er stieß einen tiefen Seufzer aus. »Nach unserer Rückkehr habe ich darüber nachgedacht, ihr einen Brief zu schreiben und alles zu erklären. Aber ich hab es immer vor mir hergeschoben, und nach einem halben Jahr kam es mir dumm vor. Trotzdem ist es schön zu wissen, dass es ihr gut ergangen ist. Sie sah im Fernsehen richtig glücklich aus.«
»Ja, das sah sie«, bestätigte Nina. »Und diese Lebkuchenstadt scheint wirklich beeindruckend zu sein.«
»Ja, wirklich!«, stimmte Uwe ihr zu. »Eine ganze Stadt aus Lebkuchen. Das ist schon eine Meisterleistung. Thea hätte sie geliebt. Deine Großmutter hätte bestimmt auch ein Haus beigesteuert, und es wäre perfekt gewesen. Sie war eine meisterhafte Bäckerin. Am besten waren ihre Bethmännchen. Kein Konditor in ganz Frankfurt bekommt sie so gut hin wie sie.«
»Von ihr stammt auch die Regel, dass vor dem ersten November kein Weihnachtsgebäck gegessen werden darf. Bis heute halte ich mich daran«, warf Nina ein. In ihr stieg Wehmut auf. Es war jedes Mal schön, die Erinnerungen an ihre Oma aufleben zu lassen, doch der Rückblick brachte auch die Traurigkeit darüber mit sich, sie verloren zu haben. Sie hätte sie so gern noch eine Weile länger bei sich gehabt.
»Davor schmeckt es doch gar nicht«, erwiderte Uwe und schenkte sich Äppler nach. »Jedes Jahr stehen die Lebkuchen früher in den Geschäften. Die ersten Spekulatius hab ich schon Mitte August im Supermarkt gesehen. Da hatten wir dreißig Grad. Da ist man doch noch gar nicht in Stimmung für so ein Gebäck!«
»Wir könnten dieses Jahr doch auch ein Lebkuchenhaus backen«, schlug Nina spontan vor. »Das wird bestimmt lustig. Im Internet finden sich dafür gewiss Anleitungen. Oder wir schauen uns nach einem Backset um, so etwas hab ich neulich irgendwo gesehen.«
»Ich weiß nicht recht. Backen war noch nie meine Stärke«, sagte Uwe zögerlich. »Ich hab es ja nicht einmal hinbekommen, auf Theas Plätzchen im Ofen anständig aufzupassen, wenn sie zum Telefonieren ins Wohnzimmer gegangen ist. Jedes Mal sind sie Briketts geworden, und ich hab Schelte bekommen.«
»Daran kann ich mich noch gut erinnern«, antwortete Nina und lachte. »Es war meist Inge, die angerufen hat. Wenn die an der Strippe war, hat man Oma für mindestens zwei Stunden nicht mehr gesehen. Aber wenn wir gemeinsam backen, können wir ja achtsamer sein.« Nina gefiel die Idee. Sicher würde ihre Backaktion in einem heillosen Chaos enden und ihr Lebkuchenhaus vermutlich einer Bruchbude ähneln. Aber das war nicht wichtig. Das Backen bedeutete, dass sie gemeinsame Zeit mit ihrem Opa verbringen würde. Und sie würden ausnahmsweise mal nicht Karten spielen – da verlor sie sowieso andauernd.
»Dann lass uns eben ein Lebkuchenhaus bauen«, gab er nach. »Das könnte tatsächlich spaßig werden. Nur schade, dass wir nicht in Bergen wohnen. Dort hätten wir es zu Ingrids Lebkuchenstadt beisteuern können.«
»Ja, das hätten wir machen können«, antwortete Nina lächelnd und nahm sich noch ein Stück von dem Baguette, um es in den Rest ihrer inzwischen nur noch lauwarmen Suppe zu tunken. »Dann schau ich mich mal nach Rezepten um.«
Und als hätte der Oldie-Sender ihr Gespräch belauscht, spielte er in diesem Augenblick doch tatsächlich zum allerersten Mal in diesem Jahr das Lied Last Christmas von Wham.
3
Uwe stellte den alten, etwas mitgenommen aussehenden Schuhkarton auf den Küchentisch. In einem anderen Leben befanden sich darin Herrenschuhe, die vierzig Mark gekostet hatten. So stand es jedenfalls auf dem Preisschild, das immer noch an dem Karton klebte. Den Schuhladen auf der Zeil gab es längst nicht mehr, selbst das Haus war irgendwann abgerissen worden. An dieser Stelle befand sich jetzt die MyZeil, ein riesiges, modernes Einkaufszentrum, in dem es lauter Geschäfte und Fressläden gab, die Uwe nicht interessierten. An die Schuhe konnte er sich noch erinnern. Sie waren nach mehrmaligem neu Besohlen vor vielen Jahren kaputtgegangen. Für den niedrigen Preis war auch keine lebenslange Haltbarkeit erwartbar gewesen.
Nachdem Nina gegangen war, hatte er sich vor den Fernseher gesetzt, es wurde ein alter hessischer Tatort wiederholt, den Mörder kannte er längst. Er schweifte in Gedanken ab, zurück zu Ingrid und in die Vergangenheit. Zu diesem einen Sommer, in dem er die erste Liebe seines Lebens kennengelernt hatte. In irgendeinem kitschigen Schmalzfilm hatte mal jemand gesagt, dass man die erste Liebe niemals vergaß. So war es wohl. Trotzdem musste er sich eingestehen, dass er in all den Jahren kaum an sie gedacht hatte. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland hatte er sein alltägliches Leben begonnen, bald darauf hatte er Thea kennengelernt, die große Liebe seines Lebens, die er jeden Tag schmerzlich vermisste. Er hatte ihr nie von Ingrid erzählt, von jenen Sommertagen in Norwegen. Vielleicht deshalb, weil diese unbeschwerte und glückerfüllte Zeit ein so schmerzhaftes Ende gefunden hatte und er Thea damit nicht belasten wollte. Außerdem war er der Meinung, dass man seiner aktuellen Herzensfrau nichts von einer alten Liebe erzählen sollte. Das könnte den Eindruck erwecken, dass man die andere Frau mehr geliebt hatte. Thea hatte nie Fragen nach vorherigen Liebschaften gestellt, und sie hatte, so nahm es Uwe jedenfalls an, nie in diesen Schuhkarton geblickt. Fotos, stand in seiner krakeligen Schrift darauf. Hinter den zahlreichen Kisten voller Dias hatte der Karton in einem alten Kellerschrank gestanden, eine dicke Staubschicht darauf.
Mit klopfendem Herzen öffnete er den Deckel. Seine Hände zitterten etwas. »Was ich mich aufrege. Als würden sich darin wertvolle Wunderfitzchen befinden«, sagte er zu sich selbst.
In dem Karton lagen mehrere Fotoumschläge mit der Aufschrift Photo Porst. Allein die Umschläge brachten die Vergangenheit zurück. Heutzutage war es so einfach, Fotos mit dem Smartphone immer und überall anzufertigen. Damals hatte man einen einzigen Film mit einer begrenzten Anzahl von Fotos, den es zu entwickeln galt. Er nahm die Umschläge heraus und öffnete einen nach dem anderen. Es dauerte nicht lange und der gesamte Küchentisch war mit den Schwarz-Weiß-Aufnahmen übersät. Die Bilder aus Norwegen waren noch nicht darunter. Die Fotos zeigten ihn und seine Freunde meist bei irgendwelchen Treffen in ihren ehemaligen Wohnungen. Bierflaschen und übervolle Aschenbecher auf den Tischen, scheußliche Tapeten, außerdem hatte Uwe diese schreckliche Pilzkopffrisur getragen. Auf einem Bild waren sie alle verkleidet, er als Cowboy, an das Kostüm konnte er sich gut erinnern. Die Beatles und die Rolling Stones, Partys, Beatclubs, Demos gegen den Vietnamkrieg und für den Frieden. Das war damals seine Welt gewesen.
Die meisten Bilder hatte sein Freund Jochen mit seiner kleinen Agfa-Kamera gemacht, die er immer und überall dabeihatte. Jochen, der nach ihrer Rückkehr aus Norwegen bald zum Studium nach Hamburg umgezogen und im Alter von nur zweiundfünfzig Jahren an Krebs verstorben war. Seine Witwe, Uwe hatte die Frau nie kennengelernt, hatte ihm erst vier Wochen nach der Beerdigung eine Todesanzeige zukommen lassen. So war das manchmal im Leben. Nicht jede Freundschaft hielt für immer. Außerdem musste man dazusagen, dass damals ein Umzug nach Hamburg dem Abschied auf einen anderen Planeten gleichkam. Telefonate wurden als teure Ferngespräche abgerechnet, Briefe hatten die beiden Freunde nie geschrieben. So war nachvollziehbar, dass der Kontakt abriss.
Uwe nahm einen weiteren Fotoumschlag aus dem Karton und öffnete ihn. Jetzt fand er, was er suchte. Die Aufnahmen von ihrer Sommerreise nach Nordeuropa. Mit zittrigen Händen nahm er die Abzüge heraus und begann, sie durchzusehen. Die Bilder zeigten sie beide in kurzen Hosen und mit T-Shirts bekleidet vor ihrem VW-Käfer. Irgendwo am Strand, ein Bild zeigte ihn an einer Tankstelle. Fotos aus Kopenhagen – seltsamerweise waren ihm nur noch wenige Erinnerungen an die dänische Hauptstadt geblieben. Ein Bild zeigte sie auf der Fähre nach Norwegen. Sie trugen Regenjacken, im Norden bedeutete Sommer nicht alle Tage Sonnenschein und Wärme. Ein Bild zeigte ihn vor ihrem Zelt auf einer Wiese mit wogendem Gras. Wie er damals ausgesehen hatte. So komplett anders. Viel dünner, er hätte als junger Mann gern breitere Schultern gehabt. Ein richtiges Milchbubigesicht hatte er gehabt, dazu die halblangen Haare. Er hätte sich heute selbst nicht mehr auf der Straße erkannt. Gott, was waren sie jung gewesen.
Dann fand er die Fotografie, nach der er gesucht hatte, und sein Herz begann höherzuschlagen. Es zeigte seine Ingrid. Genauso hatte er sie in Erinnerung behalten. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto trug sie ein wadenlanges Sommerkleid mit Streublümchen darauf. Er wusste, dass es hellblau gewesen war, die Blümchen rosa. Darüber eine offene Strickjacke. Ihr blondes Haar hatte sie zu einem langen Zopf geflochten. Sie stand am Ufer eines Sees auf einem flachen Stein und lächelte sanft in die Kamera. Sie sah aus wie eine zarte Elfe, glich einer Figur aus dem Märchen. Ihr Anblick sorgte dafür, dass sein gesamter Körper von einer Wärme geflutet wurde, die er sehr lange Zeit nicht mehr empfunden hatte. Ein Lächeln umspielte seine Lippen, und er strich mit den Fingerspitzen über die Fotografie.
»Wie konnte ich alter Dummkopf bloß so lange Zeit nicht mehr an dich denken«, murmelte er. »Du wirst mir mein Fortgehen ohne Abschied bestimmt niemals verziehen haben. Vielleicht hätten wir doch mutiger sein und kämpfen sollen. Verzeih mir meine Feigheit.« Sein Lächeln verschwand, und in seine Augen stiegen Tränen. »Ich weiß, ich hätte dir wenigstens schreiben und dir alles erklären können. Ich war ein solcher Trottel.«
Er seufzte und betrachtete das Bild einen Augenblick lang stumm. Noch immer lief das Radio. Gerade wurden die Verkehrsmeldungen verlesen, eine Landstraße im Taunus war wegen eines schweren Unfalls gesperrt. Das Licht in der Lampe am Fenster flackerte. Jedes Mal, wenn das passierte, nahm er an, dass seine Thea auf eine wundersame Weise anwesend war. Auch jetzt glaubte er, ihre Gegenwart zu spüren.
»Du denkst, ich kann ihr immer noch schreiben und mich bei ihr entschuldigen?« Er glaubte zu wissen, was sie ihm geraten hätte. »Aber nach all den Jahren? Ist das denn nicht unsinnig? Was würde es jetzt noch bringen? So ein Wiedersehen reißt doch nur die alten Wun





























