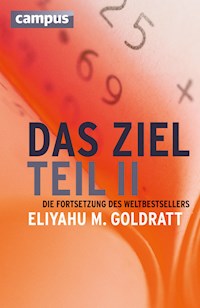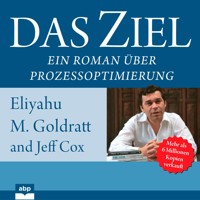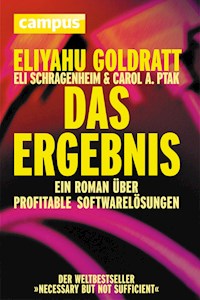Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox
Das Ziel
Ein Roman über Prozessoptimierung
Campus Verlag Frankfurt/New York
Über das Buch
Ein Roman über Prozessoptimierung? Geht das? Das geht nicht nur – das liest sich auch spannend von der ersten bis zur letzten Seite.
Eliyahu M. Goldratts »Das Ziel« ist die Geschichte des Managers Alex Rogo, der mit ungewöhnlichen und schlagkräftigen neuen Methoden in seinem Unternehmen für Aufsehen sorgt. Der Klassiker unter den Wirtschaftsbüchern, der das Managementdenken weltweit umkrempelt, wurde jetzt erweitert um den wichtigsten Aufsatz des Autors, »Standing on the Shoulders of Giants«: Pflichtlektüre für Manager – und fesselnder Lesestoff.
Über den Autor
Dr. Eliyahu M. Goldratt (1948–2011) war Autor und Managementberater. Das von ihm gegründete Unternehmen berät weltweit agierende Firmen wie Ford, General Motors oder Boeing. Seine THEORY OF CONSTRAINTS ist eine der innovativsten Managementmethoden der letzten Jahrzehnte, seine Wirtschaftsromane sind internationale Bestseller.
Im Campus Verlag erschienen DAS ZIEL, DAS ZIEL TEIL II, DAS ERGEBNIS und DIE KRITISCHE KETTE.
Jeff Cox ist Autor und Koautor mehrerer Romane, darunter aus dem Goldratt Institute VELOCITY (Campus Verlag 2010).
Vorwort
In diesem Roman wird ein wichtiges Prinzip der Produktionsorganisation dargestellt. Die Geschichte handelt von Personen, die begreifen wollen, wie die Abläufe in einem Unternehmen wirklich funktionieren. Sie möchten die Produktion besser verstehen, damit sie ihre Sache in Zukunft besser machen können. Da sie logisch über ihre Probleme nachdenken, gelingt es ihnen, bestimmte Ursache-Wirkungs-Relationen zwischen ihren Handlungen und den sich daraus ergebenden Veränderungen festzustellen. So leiten sie nach und nach grundlegende Prinzipien ab, die sie dann einsetzen, um ihr Unternehmen zu sanieren und schließlich zum Erfolg zu führen.
Für mich ist Wissenschaft letzten Endes nichts anderes als ein Weg, zu verstehen, wie die Welt beschaffen ist und weshalb sie so ist. Dabei stellt die Summe unserer wissenschaftlichen Kenntnisse zu jedem beliebigen Zeitpunkt nichts anderes dar als den gegenwärtigen Stand unseres Verstehens. Ich glaube also nicht an absolute Wahrheiten. Im Gegenteil, ich fürchte mich geradezu vor solchen Überzeugungen, weil sie uns nur zu leicht den Weg der Suche nach einem besseren Verstehen verbauen können. Wann immer wir denken, zu endgültigen Antworten gelangt zu sein, ist es mit Fortschritt, Wissenschaft und einem besseren Verständnis der Probleme vorbei. Das Verstehen unserer Welt ist jedoch nicht etwas, was man als Selbstzweck anstreben sollte. Wissen sollte gesucht werden, um unsere Welt immer besser – und unser Leben immer erfüllter – zu machen.
Es gibt mehrere Gründe dafür, dass ich einen Roman gewählt habe, um meine Auffassung von der Produktionsorganisation zu erklären – wie Produktion funktioniert (also die Realität) und warum sie so funktioniert. Erstens möchte ich wichtige Prinzipien der Produktionsorganisation allgemein verständlicher machen und zeigen, wie sich Ordnung in das Chaos bringen lässt, das nur zu oft in unseren Unternehmen herrscht. Zweitens mache ich anschaulich, welche Kraft Sie aus diesem Verständnis gewinnen können und welche Vorteile sich dadurch erschließen. Wenn hier von bestimmten Ergebnissen gesprochen wird, handelt es sich keineswegs um Fiktion; diese Resultate werden in tatsächlich existierenden Fabriken erzielt. Wenn es uns gelingt, die richtigen Prinzipien zu begreifen und anzuwenden, können wir es mit jeder Konkurrenz aufnehmen. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie die Gültigkeit und den Wert dieser Prinzipien in anderen Organisationsbereichen wie Banken, Krankenhäusern, Versicherungsgesellschaften und unseren Familien erkennen. Wahrscheinlich gibt es in jeder Organisationsform dasselbe Wachstums- und Erfolgspotenzial.
Was mir letztendlich das Wesentliche ist: Ich möchte zeigen, dass es uns allen möglich ist, hervorragende Wissenschaftler zu werden. Das Geheimnis eines guten Wissenschaftlers liegt nicht in der Kapazität seines Gehirns. Wir müssen der Wirklichkeit ins Auge sehen und dann logisch und präzise über das nachdenken, was wir dabei zu sehen bekommen. Die Kernfrage ist nur, ob wir auch den Mut haben, uns mit dem Abgrund auseinanderzusetzen, der sich zwischen dem, was wir sehen und was wir daraus schließen, und der immer noch vorhandenen Realität unserer industriellen Produktion auftun wird. Das erfordert ein radikales Infragestellen der eigenen grundlegenden Axiome, ist aber unerlässlich, wenn man einen Durchbruch erzielen will. Fast jeder, der einmal in einem Unternehmen gearbeitet hat, hat Bedenken, was die Effizienz der Kostenrechnung für die Steuerung unserer Handlungen betrifft. Aber nur sehr wenige haben diese heilige Kuh auch direkt infrage gestellt. Wenn wir unsere Welt und die Prinzipien, die ihren Lauf regeln, besser verstehen lernen, werden wir besser leben.
Deshalb wünsche ich Ihnen viel Glück bei Ihrer Suche nach diesen Prinzipien und für Ihr persönliches Verständnis des Ziels.
Eliyahu M. Goldratt
Kapitel 1
Heute Morgen passiere ich die Einfahrt um exakt 7.30 Uhr, und da sehe ich es schon von weitem: Der rote Mercedes parkt neben der Fabrik, gleich bei den Büroräumen. Und zwar genau auf meinem Parkplatz. Wer sonst würde so etwas tun als Bill Peach? Ganz abgesehen davon, dass um diese Zeit praktisch der ganze Parkplatz leer ist. Ganz abgesehen davon, dass es Parkplätze gibt, die deutlich mit »Besucher« gekennzeichnet sind. Nein, Bill muss natürlich genau auf dem Platz parken, der für mich reserviert ist. Er liebt subtile Aussagen dieser Art. Na gut, er ist schließlich der Vizepräsident des Unternehmensbereichs, und ich bin bloß ein einfacher Werksdirektor. Meinetwegen kann er seinen verdammten Mercedes parken, wo er will.
Ich stelle meinen Wagen auf den Nebenplatz, wo »Rechnungsprüfer« steht. Ein Blick auf das Nummernschild, während ich um den Wagen herumgehe, überzeugt mich endgültig, dass es sich um Bills Wagen handelt: Da steht »Nr. 1«. Und wie wir alle wissen, ist das genau das, worauf es Bill immer ankommt. Er braucht einfach seine Boss-Allüren. Aber manchmal brauche ich die auch. Und es ist einfach zu ärgerlich, dass ich heute darauf verzichten muss.
Einerlei, ich steige zur Tür des Bürotrakts hinauf. Der Adrenalinspiegel steigt. Ich wundere mich, was zum Teufel Bill hier sucht. Die Hoffnung, heute Morgen noch irgendetwas zu schaffen, habe ich jedenfalls längst aufgegeben. Normalerweise komme ich früh ins Büro, um all den Mist aufzuarbeiten, für den ich tagsüber keine Zeit habe; ich kann wirklich ganz schön was wegschaffen, bevor das Telefon zu klingeln anfängt, die Meetings losgehen und es zu brennen beginnt. Aber heute ist da wohl nichts zu machen.
»Mr. Rogo!«, ruft mich irgendwer.
Als vier Leute aus einer Tür an der Seite der Werkshalle herausstürzen, bleibe ich stehen. Da ist Dempsey, der Schichtleiter; Martinez, der Betriebsrat; irgendein Arbeiter und ein Maschinenmeister namens Ray. Und alle vier reden gleichzeitig. Dempsey sagt, wir hätten ein Problem. Martinez zischt irgendetwas von einem bevorstehenden Streik. Der Arbeiter spricht von einer Störung, und Ray schreit, wir könnten irgendein verdammtes Drecksding nicht fertig machen, weil wir nicht alle Teile dafür hätten. Und plötzlich bin ich in diesem Hexenkessel mittendrin. Ich sehe sie an, sie sehen mich an, und ich habe heute Morgen noch nicht einmal einen Kaffee gehabt.
Als ich schließlich jeden der vier so weit beruhigt habe, dass ich fragen kann, was eigentlich los ist, höre ich, dass Mr. Peach etwa eine Stunde vor mir eingetroffen ist, mein Werk betreten und verlangt hat, man möge ihm sofort zeigen, wie es mit dem Auftrag Nummer 41427 stehe.
Na ja, ein böses Schicksal wollte es, dass zufällig kein Mensch irgendetwas von dem Auftrag Nummer 41427 wusste. Also jagte Peach alle Leute herum und ließ sie nachsehen, was wir darüber für Unterlagen haben. Dabei stellte sich heraus, dass das ein ziemlich großer Auftrag ist, mit dem wir außerdem im Rückstand sind. Na ja, keine wirklich neuen Nachrichten, denn in dieser Fabrik ist schließlich alles im Rückstand. Aufgrund meiner Beobachtungen würde ich sagen, wir haben hier vier Prioritätsklassen für Aufträge: Dringend … Sehr dringend … Allerdringendst – und Auf der Stelle zu erledigen! Wir können einfach nichts zur rechten Zeit fertig kriegen.
Kaum hat er herausgefunden, dass 41427 noch nicht versandfertig ist, beginnt Peach den Terminjäger zu spielen. Er rast durch die Gegend und brüllt Dempsey Befehle zu. Schließlich zeigt sich, dass fast alle benötigten Teile fertig sind und bereitliegen – stapelweise. Aber sie können nicht zusammengebaut werden. Ein Teil einer Komponente fehlt; das muss erst noch durch einen anderen Prozess laufen. Wenn die Leute das Teil nicht haben, können sie nicht zusammenbauen, und natürlich können sie nicht versenden, bevor sie nicht zusammengebaut haben.
Dann finden sie heraus, dass die Teile für die fehlende Untereinheit bei einer der NC-Maschinen liegen und darauf warten, dass man sie durchschickt. Aber als der Trupp in die entsprechende Abteilung kommt, finden sie dort die Einrichter, die gerade die Maschine nicht für die Produktion des betreffenden Teils rüsten, sondern für irgendeinen anderen auf der Stelle zu erledigenden Job, den ihnen jemand für ein anderes Produkt aufgetragen hat.
Peach kümmert sich nicht einen Deut darum. Alles, was ihn interessiert, ist, 41427 so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen. Deshalb verlangt er von Dempsey, er müsse seinen Vorarbeiter Ray anweisen, dem Meister aufzutragen, er solle das andere brandeilige Zeug vergessen und alles für die Produktion des fehlenden Teils für 41427 vorbereiten. Daraufhin blickt der Meister von Ray zu Dempsey und von Dempsey zu Peach, wirft seinen Schraubenschlüssel zu Boden und schreit sie an, sie würden wohl alle spinnen. Er habe gerade erst anderthalb Stunden mit seinem Helfer daran gearbeitet, die Maschine für das andere Teil zu rüsten, das angeblich so verzweifelt dringend gebraucht wurde. Und jetzt solle er das alles vergessen und wieder auf was anderes umrüsten. Zum Teufel mit dem ganzen Zeug! Und Peach, der ja immer besonders diplomatisch ist, stellt sich daraufhin vor meinen Schichtleiter und meinen Vorarbeiter und erklärt dem Meister, dass er auf der Stelle gefeuert werde, wenn er nicht tue, was man ihm sagt. Es kommt zu einem Wortwechsel. Der Meister droht mit der Kündigung, der Betriebsrat taucht auf. Alle sind komplett durchgedreht. Kein Mensch arbeitet mehr. Und ich stehe vier wütenden Leuten gegenüber, die mich in aller Frühe in einer Fabrik empfangen, in der alles stillsteht.
»Und wo ist Bill Peach jetzt?«, frage ich.
»In Ihrem Büro«, antwortet Dempsey.
»Okay, würden Sie bitte hinaufgehen und ihm sagen, ich wäre in einer Minute bei ihm?«
Dempsey rennt dankbar zum Eingang des Bürotrakts. Ich wende mich an Martinez und an den Maschinisten, und sage ihnen, dass es, soweit ich das bestimmen kann, weder Kündigungen noch Entlassungen geben wird und dass das Ganze ein Missverständnis ist. Martinez ist damit zunächst nicht ganz zufrieden, und der Maschinist will eine Entschuldigung von Peach. Darauf lasse ich mich nicht ein. Ich weiß, dass Martinez nicht die Machtbefugnis hat, einen Streik auszurufen. Deshalb sage ich, wenn die Gewerkschaft eine Beschwerde einbringen wolle, wäre das okay, ich würde jederzeit gerne zu einem späteren Zeitpunkt mit dem örtlichen Gewerkschaftsvorsitzenden Mike O’Donnell sprechen, und wir könnten dann alles ordnungsgemäß erledigen. Martinez sieht ein, dass er nichts tun kann, ohne mit O’Donnell gesprochen zu haben; so akzeptiert er meine Erklärung und zieht mit dem Arbeiter in Richtung Fabrikhalle ab.
»So, jetzt müssen wir die Leute wieder an die Arbeit kriegen«, sage ich zu Ray.
»Ja sicher, aber woran sollen wir jetzt arbeiten?«, fragt Ray zurück.
»An dem Job, den wir eingestellt haben, oder an dem, den Peach will?«
»Macht den fertig, den Peach will.«
»Okay, aber dann haben wir einmal umsonst gerüstet.«
»Dann ist das eben so! – Ray, ich weiß nicht einmal, was los ist. Aber wenn Bill hierher kommt, dann muss es ein Notfall sein. Erscheint Ihnen das nicht logisch?«
»Ja sicher«, murmelt Ray. »Ich – ich wollte ja nur wissen, was wir tun sollen.«
»Okay, ich weiß schon, dass Sie da nur hineingeraten sind«, sage ich, um ihm ein besseres Gefühl zu geben. »Wir wollen jetzt versuchen das Teil so schnell wie möglich zu produzieren.«
»Gut«, sagt er.
Drinnen treffe ich Dempsey auf seinem Weg zurück in die Fabrikhalle. Er kommt gerade aus meinem Büro und sieht so aus, als hätte er es eilig, möglichst schnell da wegzukommen. Er nickt mir zu.
»Hals- und Beinbruch«, zischt er aus dem Mundwinkel.
Die Tür zu meinem Büro steht weit offen. Ich trete ein. Bill Peach sitzt hinter meinem Tisch. Er ist ein stämmiger, stiernackiger Typ mit dichtem, stahlgrauem Haar und Augen, die beinahe Funken sprühen. Als ich meinen Aktenkoffer abstelle, fixieren mich diese Augen mit einem Blick, der mir deutlich zu sagen scheint: Jetzt geht’s um deinen Kopf, Rogo.
»Okay, Bill, was ist los?«
»Wir haben ein paar Dinge zu besprechen. Setzen Sie sich.«
»Würde ich ja gerne, aber Sie sitzen auf meinem Stuhl.« Mag sein, das war das falsche Wort am falschen Platz.
»Interessiert es Sie, warum ich hier bin?«, sagt er. »Ich bin hier, um Ihren verdammten Kopf zu retten.«
»Also angesichts des Empfangs, den Sie mir bereitet haben, sieht es eher so aus, als wären Sie hier, um das Arbeitsklima in der Belegschaft kaputtzumachen.«
Er blickt mich unverwandt an: »Wenn Sie hier nicht ein paar Dinge zum Funktionieren bringen, dann brauchen Sie sich bald um kein Arbeitsklima mehr zu kümmern. Denn Sie werden dann keine Fabrik mehr haben, um die Sie sich kümmern müssen. Ja, mein lieber Rogo, es könnte sogar sein, dass Sie dann nicht einmal mehr einen Job haben werden, um den Sie sich kümmern müssen.«
»Okay, Moment mal, nicht gleich so hitzig«, lenke ich ein. »Wir können ja über alles reden. Um was geht es eigentlich?«
Zunächst erzählt mir Bill, dass er gestern Abend gegen zehn zu Hause einen Anruf vom lieben alten Bucky Burnside bekommen habe, dem Generaldirektor eines der größten Kunden der UniCo. Scheint so, als hätte sich dieser Bucky mächtig darüber aufgeregt, dass einer seiner Aufträge, nämlich 41427 seit sieben Wochen überfällig ist. Er machte Peach eine gute Stunde lang die Hölle heiß. Anscheinend hatte sich Bucky gewaltig bemüht, um uns den Auftrag zuzuschanzen, obwohl alle ihm einreden wollten, er solle lieber zur Konkurrenz gehen. Nun hatte er gerade mit ein paar Kunden zu Abend gegessen, und die haben sich bei ihm beklagt, weil ihre Aufträge in Verzug waren, was offenbar unsere Schuld war. Bucky war stinksauer und wahrscheinlich auch ein wenig beschwipst. Peach konnte ihn nur dadurch beruhigen, dass er ihm versprach, die Sache persönlich in die Hand zu nehmen, und ihm garantierte, der Auftrag würde noch heute Abend zum Versand gehen – und wenn er dafür Berge versetzen müsste.
Ich versuche Bill zu erklären, wir wären sicher im Unrecht, weil wir diesen Auftrag liegen gelassen hätten, und ich würde das jetzt selber regeln, aber musste er denn deshalb heute Morgen hier einfallen und meine ganze Fabrik durcheinander bringen?
Wo ich denn gestern Abend gewesen wäre, will er wissen, als er mich zu Hause anrief? Unter diesen Umständen kann ich ihm ja schlecht entgegenhalten, ich hätte auch ein Privatleben. Ich kann ihm nicht erzählen, dass ich das Telefon mehrmals klingeln ließ, weil ich mitten in einer Auseinandersetzung mit meiner Frau war, wobei es auch in diesem Fall darum ging, dass ich mich zu wenig um sie kümmerte.
So erzähle ich Peach, ich wäre einfach spät nach Hause gekommen. Er bohrt nicht weiter. Stattdessen will er wissen, wieso ich denn nicht wüsste, was in meinem Werk vor sich ginge. Er habe die Nase voll von den dauernden Klagen über Lieferverzögerungen. Wieso könnte ich die Dinge nicht unter Kontrolle bringen?
»Also eines weiß ich«, sage ich bescheiden. »Nach der zweiten Entlassungswelle, die Sie uns vor drei Monaten gemeinsam mit dem Auftrag zu einer zwanzigprozentigen Einsparung aufgezwungen haben, sind wir schon froh, wenn wir hier irgendetwas rechtzeitig rauskriegen.«
»Al«, sagt er ganz ruhig, »Sie sollen einfach Ihre verdammten Produkte herstellen, sonst nichts, verstanden?«
»Dann geben Sie mir die Leute, die ich dazu brauche!«
»Sie haben genug Leute hier! Denken Sie an Ihre Effizienzen, zum Donnerwetter. Sie haben genug ungenütztes Potenzial, Al. Heulen Sie mir nicht vor, Sie hätten nicht genug Leute, ehe Sie nicht bewiesen haben, dass Sie die, die sie haben, effizient einsetzen können.«
Ich will gerade zurückschießen, da bedeutet mir Peach, ich solle den Mund halten. Er steht auf und schließt die Tür von innen. Mist, denke ich. Er dreht sich zu mir um und sagt: »Setzen Sie sich.«
Ich war die ganze Zeit über stehen geblieben. Jetzt setze ich mich auf einen der Besucherstühle vor dem Schreibtisch. Peach kehrt wieder hinter den Schreibtisch zurück.
»Sehen Sie, Al, es ist Zeitverschwendung, darüber zu debattieren. Ihr letzter Tätigkeitsbericht spricht Bände.«
»Okay, Sie haben Recht«, gebe ich zu. »Wir müssen schleunigst Burnsides Auftrag ausliefern …«
Da explodiert Peach endgültig. »Nein, zum Teufel, es geht nicht um Burnsides Auftrag! Burnsides Auftrag ist nur ein Symptom des ganzen Problems hier! Denken Sie vielleicht, ich komme extra herübergefahren, um einen verspäteten Auftrag zum Versand zu bringen? Glauben Sie vielleicht, ich hätte nicht genug zu tun? Nein, ich bin hierher gekommen, um Ihnen und allen hier im Werk Feuer unterm Hintern zu machen. Hier geht es nicht nur um Dienst am Kunden. Ihre Fabrik schreibt Verluste.«
Er stockt einen Moment, als wolle er das erst sickern lassen. Dann schlägt er mit der Faust auf den Schreibtisch und richtet seinen Zeigefinger auf mich.
»Und wenn Sie nicht imstande sind, die Aufträge rauszubekommen«, setzt er hinzu, »dann werde ich Ihnen eben zeigen, wie man so was macht. Und wenn Sie es dann immer noch nicht schaffen, dann habe ich keine Verwendung mehr – weder für Sie noch für diese Fabrik.«
»Na, jetzt machen Sie mal eine Minute Pause, Bill …«
»Verdammt nochmal, ich habe keine Minute zu verschenken!«, brüllt er. »Ich habe keine Zeit mehr für Ausreden. Und ich brauche keine Erklärungen. Ich brauche Leistung. Ich brauche Lieferungen. Ich brauche Einnahmen!«
»Ja, das weiß ich, Bill.«
»Aber was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass dieser Unternehmenszweig gegenwärtig die ärgsten Verluste in seiner Geschichte macht. Wir sind dabei, in einem Loch zu versinken, das so tief ist, dass wir vielleicht nie wieder rauskommen, und Ihre Fabrik ist das Senkblei, das uns in die Tiefe zieht!«
Jetzt bin ich schon ziemlich geschafft. Mit müder Stimme frage ich ihn: »Na gut, was wollen Sie eigentlich von mir? Ich bin erst sechs Monate hier. Ich gebe zu, es geht schlechter anstatt besser, seit ich diesen Posten habe. Aber ich bemühe mich, mein Bestes zu geben.«
»Gut, wenn Sie eine Frist haben wollen, Al, hier ist sie: Sie haben drei Monate Zeit, das Steuer herumzuwerfen«, sagt Peach.
»Angenommen, das wäre in der Zeit nicht möglich, was geschieht dann?«
»Dann gehe ich in den Vorstand mit der Empfehlung, das Werk stillzulegen.«
Jetzt bin ich sprachlos. Das ist tatsächlich schlimmer als alles, was ich an diesem Morgen erwartet hätte. Und dennoch kommt es nicht so überraschend. Ich schaue aus dem Fenster. Der Parkplatz füllt sich mit den Autos der Leute, die zur ersten Schicht kommen. Als ich zurück blicke, ist Peach aufgestanden und geht um den Schreibtisch herum. Er setzt sich auf den Stuhl neben mir und beugt sich zu mir herüber. Jetzt kommt die Aufbauphase, das Beruhigungsgewäsch.
»Al, ich weiß ja, dass die Situation, die sie hier übernommen haben, nicht eben die beste war. Ich habe Ihnen diesen Job gegeben, weil ich dachte, Sie wären der Einzige, der dieses Werk von einem Verlustgeschäft zu … na ja, sagen wir, zu einem bescheidenen Gewinnobjekt machen könnte. Und ich glaube das noch immer. Aber wenn Sie in dieser Firma weiterkommen wollen, dann müssen Sie Ergebnisse auf den Tisch legen.«
»Aber dazu brauche ich Zeit, Bill.«
»Tut mir leid, Sie haben eben nur drei Monate. Und wenn die Sache sehr viel schlechter läuft, dann werde ich Ihnen nicht mal das garantieren können.«
Ich bleibe erschöpft sitzen, als Bill auf die Uhr blickt und aufsteht. Diskussion beendet, heißt das.
»Ich muss jetzt los. Sonst verpasse ich auch noch meinen nächster Termin.«
Ich stehe auf. Er geht zur Tür.
Die Hand bereits auf dem Türknopf, dreht er sich noch einmal um und sagt grinsend: »Nun, wo ich Ihnen ein bisschen geholfen habe, den Lahmärschen hier Dampf zu machen, werden Sie es wohl schaffen, Buckys Auftrag für mich heute noch auf den Weg zu bringen, nicht wahr?«
»Wir liefern ihn aus, Bill.«
»Gut«, sagt er, öffnet die Tür und winkt mir noch ein mal zu.
Eine Minute später sehe ich ihn vom Fenster aus in seinen Mercedes steigen und durch das Tor hinausfahren.
Drei Monate. Das ist alles, was ich im Augenblick denken kann.
Ich erinnere mich nicht mehr daran, vom Fenster weggegangen zu sein. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Urplötzlich finde ich mich hinter meinem Schreibtisch wieder, ins Leere starrend. Und da beschließe ich, ich sollte jetzt wohl besser einmal selbst nachsehen, was draußen im Werk vorgeht. Ich hole also den Schutzhelm und die Schutzbrille vom Regal bei der Türe und stürme hinaus, an meiner Sekretärin vorbei.
»Fran, ich gehe mal kurz ins Werk«, rufe ich ihr im Vorbeigehen zu.
Fran blickt von einem Brief auf, den sie gerade tippt, und lächelt mir zu.
»Okay, okay«, sagt sie. »Übrigens, war das Peachs Wagen, den ich da heute Morgen auf Ihrem Parkplatz gesehen habe?«
»Ja.«
»Toller Schlitten«, sagt sie lachend. »Dachte im ersten Augenblick schon, es wäre Ihrer.«
Diesmal muss ich lachen. Sie lehnt sich über den Schreibtisch zu mir herüber.
»Sagen Sie, wie viel kann so ein Wagen kosten?«
»Ich weiß nicht genau, aber ich denke, so um die einhunderttausend Dollar.«
Fran hält den Atem an: »Sie nehmen mich wohl auf den Arm! So viel? Ich hatte ja keine Ahnung, dass ein Wagen so teuer sein kann. Na, ich schätze, so schnell werde ich meinen Chevette wohl nicht gegen so was eintauschen können.«
Sie lacht und tippt weiter.
Fran ist ein richtiger Kumpel. Wie alt ist sie eigentlich? Anfang vierzig würde ich sagen, mit zwei Teenager-Kindern, um die sie sich kümmert. Ihr Ex-Mann ist Alkoholiker. Sie sind seit langem geschieden. Seitdem will sie nichts mehr von Männern wissen. Na ja, beinahe nichts mehr. Fran hat mir all das selbst erzählt, an meinem zweiten Tag im Werk. Ich habe sie gern. Ich mag auch ihre Arbeit. Wir zahlen ihr ein gutes Gehalt … das heißt, bis jetzt tun wir das. Na, auf jeden Fall bleiben ihr noch drei Monate.
Die Fabrikhalle zu betreten, das ist, als käme man in ein Reich, in dem Teufel und Engel sich verbündet haben, um eine Art graue Magie zu produzieren. Vieles ist so geheimnisvoll. Und doch ist die Tätigkeit in einem Unternehmen so nüchtern real. Ich habe Fabriken immer faszinierend gefunden – schon rein vom Visuellen her. Aber viele Leute sehen sie ganz anders.
Nach einer Reihe von Doppeltüren, die den Bürotrakt vom Werk trennen, gelangt man in eine andere Welt. Ganz oben ein Gerüst mit Lampen, die von den Deckenbalken hängen und alles in die warmen, orangefarbenen Töne des Natrium-Jod-Lichtes tauchen. Da steht ein riesiger Maschendrahtverschlag, in dem Reihe für Reihe vom Boden bis zur Decke ragende Regale mit Kisten und Kartons stehen, die mit all unseren Produkten gefüllt sind. In einem engen Gang zwischen zwei Regalen fährt ein Mann im Korb eines Gabelstaplerkrans, der sich an einer in der Decke eingelassenen Schiene entlangbewegt. Unten am Boden wickelt sich eine blitzende Stahlrolle langsam in eine Maschine hinein, die alle paar Sekunden dazu »Kaaa-Tschunk« macht.
Maschinen. Die ganze Fabrik ist im Grunde ein einziger großer Raum, eine riesige Fläche voller Maschinen. Diese Maschinen sind in Blocks aufgestellt, die durch Gänge voneinander getrennt sind. Die meisten Maschinen sind in den schönsten Popfarben angestrichen – Orange, Purpurrot, Gelb, Blau. Auf einigen neueren Maschinen leuchten rote Ziffern von den Digitaldisplays. Roboterarme vollführen vorprogrammierte mechanische Tänze.
Da und dort, fast versteckt zwischen all den Maschinen, sind die Menschen. Sie schauen zu mir herüber, wenn ich vorbeigehe. Einige winken; ich winke zurück. Ein Elektrokarren fährt quietschend rückwärts, ein Fleischkloß am Steuer. An den langen Tischen arbeiten Frauen mit Kabeln in allen Farben des Regenbogens. Ein schmutziger Typ in einem formlosen Umhang richtet sich seine Gesichtsmaske und zündet seinen Schweißbrenner. Hinter einer Glaswand hämmert eine toll aussehende Rothaarige auf die Tasten eines Computerterminals mit rauchgetöntem Schirm ein.
Und in diese Momentaufnahmen mischt sich der Lärm, ein heftiges Getöse mit einem begleitenden Chor aus dem Gesurre der Propeller, der Motoren, der Luft in den Ventilatoren – klingt alles wie ein nie enden wollender Atemzug. Plötzlich wird dieses Konzert von einem lauten Geräusch unterbrochen. Hinter mir läuten die Alarmglocken eines Deckenkrans, der seine Schiene entlangrumpelt. Relais schnappen ein. Die Sirene springt an. Über dem ganzen Krach spricht aus dem Lautsprechersystem, mit Pausen und völlig unverständlich, eine körperlose Stimme wie der liebe Gott persönlich.
Trotz allen Lärms höre ich die Pfeife. Ich drehe mich um und erblicke die unverwechselbare Silhouette von Bob Donovan, der den Gang entlangkommt. Er ist noch ein Stück entfernt. Bob ist das, was man einen Berg von einem Mann nennen könnte. Er wiegt wohl an die 250 Pfund, wozu seine Leidenschaft fürs Bier mächtig beigetragen hat. Er ist nicht eben der schönste Mann der Welt … Sein Haarschnitt lässt darauf schließen, dass sein Frisör bei der Marine gelernt hat. Gewählte Ausdrücke gehören nicht unbedingt zu seinem Wortschatz. Ich vermute, das ist so eine Art Stolz von ihm. Aber trotz seiner rauen Seiten, die er wohlweislich verborgen hält, ist er ein feiner Kerl. Er ist seit neun Jahren Produktionsleiter. Wenn man irgendetwas braucht, muss man nur mit Bob darüber reden, und wenn es möglich ist, wird er die Sache so schnell wie möglich über die Bühne bringen.
Es dauert etwa eine Minute, bis wir einander erreichen. Als er näher kommt, sehe ich, dass er nicht gerade sehr fröhlich dreinblickt. Ich nehme an, er sieht mich genauso.
»Guten Morgen«, sagt Bob.
»Weiß nicht, was an dem Morgen gut sein sollte«, knurre ich zurück.
»Haben Sie schon von unserem Besucher gehört?«
»Ja, da spricht doch die ganze Fabrik von.«
»Dann wissen Sie auch, wie dringend wir einen gewissen Auftrag 41427 ausliefern müssen?«
Er läuft rot an. »Ja, genau darüber muss ich mit Ihnen reden.«
»Warum? Was ist los?«
»Ich weiß nicht, ob Sie es schon gehört haben, aber Tony, der Maschinist, den Peach angebrüllt hat, hat heute Morgen gekündigt«, berichtet Bob.
»Verdammt«, murmle ich.
»Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass solche Leute wie er nicht auf der Straße herumstehen. Wir werden uns ziemlich anstrengen müssen, um einen Ersatz zu finden.«
»Können wir ihn nicht zurückholen?«
»Ja, es könnte nur sein, wir wollen ihn gar nicht zurückholen«, setzt Bob hinzu. »Bevor er abgehauen ist, hat er nämlich noch die Maschine auf Rays Anordnung umgerüstet und auf Automatik gestellt, damit der Produktionszyklus abläuft. Nur leider hat er dabei zwei Justiermuttern nicht angezogen. Jetzt ist der ganze Boden voll mit kleinen Stücken von Geräteteilen, die uns um die Ohren geflogen sind.«
»Wie viele Teile müssen wir abschreiben?«
»Nicht sehr viele. Die Maschine ist nur kurz gelaufen.«
»Bleiben uns genug, um den Auftrag fertig zu machen?«
»Da muss ich erst nachsehen«, sagt er. »Aber wissen Sie, das Problem ist, dass die Maschine selbst kaputt ist und wohl für einige Zeit ausfallen wird.«
»Welche ist es denn?«, frage ich.
»Die NCX-10.«
Ich muss die Augen schließen. Mir ist, als kralle sich eine kalte Hand um meinen Magen. Diese Maschine ist die einzige ihres Typs in der Fabrik. Ich frage Bob, wie arg der Schaden denn wäre, aber er antwortet nur: »Keine Ahnung. Sie haben das Zeug halb zerbrochen herausgeholt. Wir sind jetzt eben dabei, den Hersteller anzurufen.«
Ich gehe schneller. Ich will das selbst sehen. Gott, in was für einen Schlamassel sind wir da wieder geraten. Ich schiele hinüber zu Bob, der mit mir Schritt hält.
»Glauben Sie, dass es Sabotage war?«
Bob wirkt überrascht. »Tja, das kann ich nicht sagen. Ich denke, der Typ war einfach so aufgeregt, dass er nicht mehr klar denken konnte. So hat er die Muttern einfach aufgeschraubt anstatt zu.«
Mein Gesicht fängt an zu glühen. Die kalte Hand im Magen ist weg. Jetzt habe ich so eine Schweinewut auf Bill Peach, dass ich mit dem Gedanken spiele, ihn anzurufen und ihm ins Ohr zu brüllen. Alles seine Schuld, verdammt noch mal! Und im Geiste sehe ich ihn vor mir. Ich sehe ihn hinter meinem Schreibtisch sitzen und mir erzählen, er würde mir jetzt mal zeigen, wie man Aufträge auf den Weg bringt. Ja, ganz richtig, Bill. Sie haben mir wirklich gezeigt, wie man so was macht.
Kapitel 2
Ist es nicht ein seltsames Gefühl, wenn die eigene Welt plötzlich in Trümmer geht, während die Welt der Leute rundherum unversehrt bleibt? Und man kann nicht begreifen, dass sie nicht genauso betroffen sind wie man selbst. Gegen halb sieben verlasse ich die Fabrik, um nach Hause zu fahren und schnell irgendein Abendbrot hinunterzuschlingen. Als ich in der Tür stehe, sieht Julie vom Fernseher auf.
»Hallo«, sagt sie. »Gefällt dir meine neue Frisur?«
Sie dreht ihren Kopf. Wo immer dickes, glattes Haar war, ist nun ein Meer von geringelten Löckchen. Und die Farbe ist auch nicht mehr dieselbe. Einige Stellen sind deutlich heller geworden.
»Ja, sieht großartig aus«, sage ich automatisch.
»Der Frisör meinte, es würde meine Augen besser zur Geltung bringen«, sagt sie und blinzelt mir mit ihren langen Wimpern zu. Sie hat große, wunderschöne, blaue Augen; die brauchen meiner Meinung nach nicht »Zur Geltung gebracht« zu werden, aber was verstehe ich schon davon?
»Schön«, sage ich.
»Na, du bist aber nicht sehr begeistert.«
»Entschuldige, ich habe einen harten Tag hinter mir.«
»Ach, du Armer. Aber ich habe eine großartige Idee! Wir gehen jetzt zum Essen aus, und du vergisst das alles.«
Ich schüttle den Kopf. »Tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss schnell was essen und dann wieder in die Fabrik zurück«.
Sie steht auf und stemmt die Hände in die Hüften. Ich merke, dass sie einen neuen Anlauf nimmt.
»Na du bist aber gut!«, sagt sie. »Jetzt, wo ich’s endlich einmal geschafft habe, die Kinder loszuwerden.«
»Julie, ich sitze ganz tief in der Tinte. Eine unserer teuersten Maschinen ist heute früh kaputtgegangen, und ich brauche sie, um einen Bestandteil für einen ganz dringenden Auftrag zu produzieren. Ich muss das irgendwie in den Griff kriegen«, teile ich ihr mit.
»Okay. Fein. Leider ist nichts zu essen da, weil ich gedacht habe, wir würden ausgehen. Gestern Abend hast du das nämlich noch gesagt.«
Jetzt erinnere ich mich. Sie hat Recht.
»Es tut mir leid. Sieh mal, vielleicht können wir für eine Stunde oder so weggehen.«
»So stellst du dir also einen Abend in der Stadt vor? Ach, vergiss es doch, Al!«
»Hör mal zu«, versuche ich ihr zu erklären. »Bill Peach tauchte heute Morgen ganz unerwartet auf. Er sprach davon, die Fabrik zu schließen.« Ihr Gesichtsausdruck ändert sich plötzlich. Ob er sich wohl etwas aufgehellt hat?
»Die Fabrik schließen … wirklich?«, fragt sie.
»Ja, es sieht ziemlich schlimm aus.«
»Habt ihr darüber gesprochen, was dann dein nächster Job sein wird?«
Eine Sekunde lang traue ich meinen Ohren nicht. »Nein, ich habe mit ihm nicht über meinen nächsten Job gesprochen. Meine Aufgabe ist hier – in dieser Stadt, in dieser Fabrik.«
»Ja, aber wenn die Fabrik geschlossen wird, interessiert es dich dann nicht, wo du danach leben sollst? Mich schon.«
»Ja aber das ist doch erst mal nur Gerede.«
Ich merke, dass ich sie anstarre. »Du möchtest wohl so schnell wie möglich aus dieser Stadt weg, nicht wahr?«
»Es ist nicht meine Heimatstadt, Al. Ich habe keine so sentimentalen Gefühle für sie wie du«, sagt sie.
»Wir sind doch erst sechs Monate hier.«
»Ist das alles, was du zu sagen hast? Nur sechs Monate?«, gibt sie zu rück. »Al, ich habe hier keine Freunde. Es gibt niemanden außer dir, mit dem ich reden kann, und du bist fast nie zu Hause. Deine Familie ist ja sehr nett, aber eine Stunde Zusammensein mit deiner Mutter und ich werde verrückt. Für mich waren das mehr als nur sechs Monate.«
»Aber was soll ich denn tun? Ich habe ja nicht darum gebeten, hierher versetzt zu werden. Meine Firma hat mich hergeschickt, um einen Job zu erledigen. Es war einfach Zufall«, sage ich.
»Ein wirklich glücklicher Zufall.«
»Julie, ich habe keine Zeit, schon wieder mit dir zu streiten«, sage ich zu ihr.
Sie beginnt zu weinen.
»Na schön! Geh und verschwinde! Ich bleibe eben wieder allein hier«, heult sie. »Wie jeden Abend.«
»Ach, Julie.«
Schließlich gehe ich auf sie zu und lege meine Arme um sie. Ein paar Minuten bleiben wir so stehen.
»Es tut mir leid«, sagt sie. »Wenn du wieder in die Fabrik musst, solltest du lieber gehen.«
»Warum gehen wir nicht morgen aus?«, schlage ich vor. Sie zuckt die Achseln. »Ja, gut … wie du willst.«
Ich drehe mich um, dann schaue ich nochmals zurück. »Alles in Ordnung mit dir?«
»Ja sicher. Ich werde im Kühlschrank schon was zu essen finden«, sagt sie.
Ich habe inzwischen das Essen ganz vergessen. »Okay, vielleicht kaufe ich mir schnell was auf dem Rückweg in die Fabrik. Bis später.«
Als ich im Auto sitze, merke ich, dass mir der Appetit vergangen ist.
Seit wir in Bearington sind, geht es Julie nicht gut. Immer wenn wir von der Stadt sprechen, beklagt sie sich über sie, und ich verteidige sie dann.
Es stimmt, ich bin in Bearington geboren und aufgewachsen, und daher fühle ich mich hier zu Hause. Ich kenne alle Straßen. Ich weiß, wo man am besten einkauft, ich kenne die guten Bars und die Lokale, wo man lieber nicht hingehen sollte, und so weiter. Ich habe so eine Art Besitzerstolz dieser Stadt gegenüber, und sie bedeutet mir mehr als irgendeine andere Stadt an der Landstraße. Sie war eben achtzehn Jahre lang mein Zuhause. Aber ich glaube nicht, dass ich sie mir schönmache. Bearington ist eine ganz gewöhnliche Fabrikstadt.
Jemand, der einfach durchfährt, würde wahrscheinlich nichts Außergewöhnliches an diesem Ort finden. Wenn ich so durch die Stadt fahre und mich umsehe, geht es mir ähnlich. Die Gegend, in der wir wohnen, sieht wie jeder andere amerikanische Vorort aus. Die Häuser sind ziemlich neu. Es gibt Geschäfte in der Nähe, eine Menge Fast-Food-Restaurants und weiter drüben, ganz in der Nähe der Autobahn, ein großes Einkaufszentrum. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen diesem und den anderen Vororten, in denen wir gelebt haben.
Wenn man ins Stadtzentrum kommt, ist es tatsächlich etwas deprimierend. Die Straßen werden von Backsteinhäusern gesäumt, die schmutzig und verfallen wirken. Viele Geschäfte stehen leer oder sind mit Sperrholz abgedeckt. Es gibt unzählige Eisenbahnschienen, aber kaum Züge. An der Straßenkreuzung Main und Lincoln ragt Bearingtons einziges Hochhaus, ein einsamer Büroturm, aus der Häuserzeile heraus. Als er vor rund zehn Jahren gebaut wurde, glaubte man, dass das Gebäude mit seinen vierzehn Stockwerken ein Riesengeschäft für die Gegend werden würde.
Die Lokalpatrioten wollten in dem neuen Büroturm sofort etwas Symbolisches für die Vitalität Bearingtons sehen, ein Zeichen der Wiedergeburt einer alten Industriestadt. Und dann hat vor einigen Jahren die Gebäudeverwaltung am Dach ein riesiges Schild anbringen lassen, auf dem in roten Blockbuchstaben steht: »Zu verkaufen«. Daneben steht eine Telefonnummer. Von der Autobahn aus hat man den Eindruck, als ob die ganze Stadt zu verkaufen wäre. Und das ist gar nicht so fern ab der Realität.
Jeden Tag fahre ich auf meinem Weg zur Arbeit an einer anderen Fabrik vorbei. Sie liegt hinter einem rostigen Maschendrahtzaun, der oben mit Stacheldraht versehen ist. Vor der Fabrik ist ein riesiger Parkplatz – zwanzigtausend Quadratmeter Beton mit Büscheln von braunem Gras, das zwischen den Ritzen hervorlugt.
Seit Jahren parkt hier kein Auto mehr. Die Farbe auf den Mauern ist verblichen. Sie sehen kreidig aus. Ganz oben an der langen Frontseite kann man noch den Firmennamen entziffern; an den Stellen, wo früher die Buchstaben und das Firmenzeichen waren, ist die Farbe nämlich noch besser erhalten.
Das Unternehmen ist nach Süden gezogen und hat irgendwo in North Carolina eine neue Fabrik gebaut. Man sagt, sie hätten auf diese Weise versucht, den Schwierigkeiten mit ihrer Gewerkschaft davonzulaufen. Und man sagt auch, dass die Gewerkschaft sie höchstwahrscheinlich in so etwa fünf Jahren wieder erwischen wird. Aber in der Zwischenzeit haben sie fünf Jahre mit niedrigeren Löhnen und vielleicht weniger dicker Luft mit der Belegschaft gewonnen, was heutzutage beinahe eine Ewigkeit bedeutet. So wurde Bearington also um eine weitere riesige Industrieleiche am Stadtrand reicher, und rund 2000 Leute saßen auf der Straße.
Vor einem halben Jahr hatte ich Gelegenheit, eine der zahlreichen stillgelegten Fabriken Bearingtons von innen zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade auf der Suche nach einem billigen Warenlager in der Nähe. Nicht, dass das gerade mein Job gewesen wäre, aber ich ging doch mit ein paar anderen hin, um mir die Geschichte mal anzusehen. Als ich das erste Mal hierher kam, habe ich alter Träumer doch tatsächlich gedacht, wir würden vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen, um zu expandieren. Wie lächerlich das heute doch klingt! Es war die Stille dort, die mich faszinierte. Alles war so ruhig. Man hörte das Echo seiner eigenen Schritte. Richtig unheimlich war das. Alle Maschinen waren längst entsorgt. Es war einfach nur ein riesiger, leerer Raum. Wenn ich jetzt daran vorbeifahre, muss ich unwillkürlich denken, bei uns könnte es in drei Monaten genauso aussehen.
Ich kriege ein mulmiges Gefühl.
Und ich hasse es, diesen Wahnsinn mit ansehen zu müssen. Die Stadt hat seit Mitte der Siebzigerjahre so etwa einen großen Unternehmer pro Jahr verloren. Entweder gehen sie völlig bankrott oder sie hauen einfach ab und ziehen woanders hin. Da scheint kein Ende in Sicht. Und jetzt sind vielleicht wir an der Reihe. Als ich zurückkam, um diese Fabrik zu übernehmen, schrieb der »Bearington Herald« einen Artikel über mich. Na, immerhin, ich weiß. Aber ich war eine Zeit lang hier eine lokale Berühmtheit. Der Junge aus der Stadt, der seinen Weg gemacht hatte. So eine Art Schülertraum, der Wirklichkeit geworden war. Ich möchte nicht daran denken, dass das nächste Mal, wenn mein Name in der Zeitung steht, der Artikel von der Schließung der Fabrik handelt. Langsam fühle ich mich allen gegenüber wie ein Verräter.
Als ich in die Fabrik zurückkomme, winkt Donovan wie ein nervöser Gorilla. Er ist den ganzen Tag so viel herumgelaufen, dass er wohl gut fünf Pfund verloren hat. Als ich die Halle zur NCX-10 entlanggehe, bemerke ich, wie er sein Gewicht von einem Bein auf das andere verlagert, dann geht er ein paar Schritte und bleibt gleich wieder stehen. Plötzlich stürzt er quer durch die Halle, um mit jemandem zu sprechen. Und dann rennt er wieder los, um irgendwas zu prüfen. Ich pfeife ihm mit zwei Fingern nach, aber er hört mich nicht. Ich muss ihm durch zwei Abteilungen nachlaufen, bevor ich ihn einhole – wieder vor der NCX-10. Er scheint überrascht, mich zu sehen.
»Schaffen wir’s?«, frage ich ihn.
»Wir versuchen es.«
»Ja, aber wird es uns gelingen?«
»Wir geben unser Bestes.«
»Bob, werden wir heute Nacht den Auftrag erledigen oder nicht?«
»Vielleicht.«
Ich drehe den Kopf und betrachte die NCX-10. Und da gibt es eine ganze Menge zu sehen. Es ist ein ziemlicher Haufen Elektronik, unsere teuerste NC-Maschine. Und sie ist in schreiendem Lavendel blau gestrichen. Fragen Sie mich nicht, warum. Auf der einen Seite befindet sich ein Schaltpult mit roten, grünen und gelben Lämpchen, leuchtenden Kippschaltern, einer pechschwarzen Tastatur, einer Magnetbandspule und einem Computerbildschirm. Die Maschine sieht richtig sexy aus. Der Mittelpunkt ist die Metallbearbeitung im Zentrum des Gehäuses, wo gerade ein Stahlstück im Schraubstock eingeklemmt ist.
Ein Messer hobelt eine Menge Metallspäne ab, der gleichmäßige Fluss eines türkisfarbenen Schmiermittels ergießt sich über das Werkstück und reißt die Späne mit sich fort. Das verfluchte Ding arbeitet zumindest wieder.
Wir haben heute Glück gehabt. Der Schaden war nicht so schlimm, wie wir am Anfang gedacht hatten. Aber bis der Mann vom Kundendienst beginnen konnte, sein Werkzeug wieder einzupacken, war es halb fünf Uhr nachmittags. Und da war schon die zweite Schicht dran.
Wir ließen alle Leute in der Montageabteilung Überstunden machen, obwohl das gegen die gegenwärtige Politik des Unternehmensbereichs verstößt. Ich weiß nicht, wo wir diese Ausgaben unterbringen werden, aber wir müssen diesen Auftrag heute Nacht noch rausbekommen. Ich habe heute vier Anrufe von Johnny Jons, unserem Marketingdirektor, erhalten. Der hat sich auch einiges anhören müssen – von Peach, von seinen eigenen Leuten im Verkauf und von Kunden. Wir müssen diesen Auftrag einfach heute Nacht expedieren.
Es bleibt also nur zu hoffen, dass es jetzt keine Zwischenfälle mehr gibt. Sobald ein Teil fertig ist, wird es weitertransportiert und für die Vormontage vorbereitet. Nach beendeter Vormontage lässt der Vorarbeiter jede Komponente zur Endmontage hinunterbringen. Wer redet da noch von Effizienz? Leute, die einzelne Teile schleppen, vor und zurück … unsere Stückausbringung pro Mann muss geradezu lächerlich sein. Es ist verrückt. Eigentlich frage ich mich, wo Bob all die Leute her hat.
Ich schaue um mich. Es arbeitet kaum jemand in der Abteilung, der nicht irgendetwas mit 41427 zu tun hat. Donovan hat alle Leute abgezogen, die er auftreiben konnte, und alle arbeiten an diesem einen Auftrag. Das ist nicht unbedingt die Art und Weise, wie es laufen sollte.
Aber der Auftrag geht raus.
Es ist eine knappe Stunde vor Mitternacht. Wir stehen auf der Verladeebene. Die Türen an der Rückseite des Sattelschleppers werden geschlossen, er fährt in die Nacht.
Ich sehe Donovan an. Er sieht mich an.
»Gratuliere«, sage ich.
»Danke, aber fragen Sie mich bloß nicht, wie wir das geschafft haben.«
»Nein, tu ich nicht. Was halten Sie davon, wenn wir versuchen, noch irgendwo was zu essen zu bekommen?«
Zum ersten Mal an diesem Tag lächelt Donovan. In einiger Entfernung schaltet der LKW einen Gang höher.
Wir nehmen Donovans Wagen, weil er um die Ecke geparkt hat. Die ersten beiden Lokale, die wir anpeilen, sind geschlossen. Darauf schlage ich Donovan vor, meinen Anweisungen zu folgen. An der 16. Straße überqueren wir den Fluss und fahren die Bessemer Straße hinunter und dann die South Flat bis zur Mühle. Dort sage ich Donovan, er solle rechts abbiegen, und wir bahnen uns einen Weg durch die Seitenstraßen. Die Häuser hier hinten stehen Wand an Wand, es gibt keine Höfe, kein Gras, keine Bäume. Die Straßen sind eng und zugeparkt, sodass einige umständliche Manöver notwendig sind. Aber schließlich bleiben wir vor Sednikks »Bar and Grill« stehen.
Donovan schaut das Lokal an und sagt: »Sicher, dass wir hierher wollten?«
»Ja, ja. Nun kommen Sie schon. Hier gibt es die besten Hamburger in der ganzen Stadt«, sage ich zu ihm. Wir setzen uns hinten in eine Nische. Maxine erkennt mich und kommt herüber, um uns willkommen zu heißen. Wir unterhalten uns ein bisschen, dann bestellen wir Hamburger, Pommes Frites und Bier.
Donovan schaut sich um. »Woher kennen Sie denn dieses Lokal?«
»Nun ja, ich habe dort drüben an der Bar einen prima Longdrink probiert. Ich glaube, ich saß auf dem dritten Hocker von links, aber es ist schon eine Weile her.«
»Stammen Sie aus Bearington? Sie kennen sich hier so gut aus.«
»Ich bin nur ein paar Blocks von hier aufgewachsen. Mein Vater hatte ein Lebensmittelgeschäft an der Ecke. Das führt heute mein Bruder.«
»Wusste gar nicht, dass Sie aus Bearington sind«, sagt Donovan.
»Mit all meinen Umzügen hat es auch fünfzehn Jahre gedauert, bis ich wieder zurückgekommen bin.«
Das Bier kommt.
Maxine sagt: »Die zwei spendiert Joe.«
Sie deutet auf Joe Sednikk, der hinter der Bar steht. Donovan und ich winken dankend hinüber.
Donovan hebt sein Glas: »Darauf, dass wir 41427 ausgeliefert haben«.
»Darauf trinke ich auch«.
Ein paar Schlucke später sieht Donovan schon viel erholter aus. Aber ich muss immer noch darüber nachdenken, was da heute Nacht gelaufen ist.
»Sie wissen schon, dass wir einen unglaublichen Preis für diese Lieferung gezahlt haben«, sage ich schließlich. »Wir haben einen guten Maschinisten verloren. Dann ist da die Reparaturrechnung für die NCX-10. Und außerdem noch die Überstunden.«
»Und dann noch die Zeit, die wir verloren haben, während die NCX-10 stillstand«, fügt Donovan hinzu. »Aber Sie müssen zugeben: Sobald einmal alles lief, haben wir wirklich viel geschafft. Ich würde mir wünschen, dass es jeden Tag so wäre.«
Ich lache. »Nein danke. Mir genügt ein solcher Tag wie heute.«
»Ich meine ja nicht, dass Bill Peach jeden Tag in die Fabrik kommen sollte. Aber immerhin haben wir den Auftrag ausgeliefert«, sagt Donovan.
»Ich bin vollkommen dafür, dass wir Aufträge ausliefern, Bob, aber nicht so, wie wir das heute Nacht angestellt haben.«
»Aber wir haben doch ausgeliefert, nicht?«
»Ja. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass es auf diese Art und Weise geschieht.«
»Ich hab einfach geschaut, was zu tun war, und hab alle für den Auftrag eingesetzt. Auf die Vorschriften pfeif ich.«
»Bob, wissen Sie auch, wie ihre Effizienzen aussähen, wenn wir die Fabrik jeden Tag so führen würden wie heute?«, frage ich. »Wir können schließlich nicht die ganze Fabrik gleichzeitig nur für einen einzigen Auftrag einsetzen. Der ganze Mengenvorteil wäre weg. Unsere Kosten würden in die Höhe schnellen – obwohl sie ohnehin schon zu hoch sind. Wir können die Fabrik ja nicht so führen, dass wir ständig die letzten Reserven mobilisieren.«
Donovan wird ruhig. Schließlich sagt er: »Vielleicht habe ich einfach zu viel falsches Zeugs gelernt, als ich früher Terminjäger war, und einzelnen Eilaufträgen hinterherrecherchierte – und immer viel Dampf machen musste.«
»Hören Sie, Bob, Sie haben heute einen Wahnsinnsjob gemacht. Das meine ich ernst. Aber wir haben unsere Politik ja nicht ohne Grund festgelegt. Und ich sage Ihnen: Trotz all der Schwierigkeiten, die Bill Peach uns gemacht hat, damit wir den Auftrag raus bringen, würde er am Ende des Monats wieder kommen und uns die Köpfe einschlagen, wenn es uns nicht gelingt, die Fabrik effizient zu führen.«
Er nickt langsam, dann fragt er: »Also, was machen wir dann, wenn es das nächste Mal passiert?«
Ich lächle: »Wahrscheinlich denselben verfluchten Mist.« Dann drehe ich mich um und bestelle: »Maxine, noch zwei Bier bitte. Oder nein, bring uns gleich zwei Maßkrüge, damit du nicht so oft laufen musst.«
So haben wir es heute also geschafft. Um Haaresbreite. Und jetzt, wo Donovan gegangen ist und die Wirkung des Alkohols nachlässt, weiß ich eigentlich gar nicht, was wir da gefeiert haben. Es ist uns gelungen, einen sehr verspäteten Auftrag endlich zu liefern. Na prima. Das eigentliche Ergebnis ist jedoch, dass meine Fabrik auf der roten Liste steht. Peach hat uns noch drei Monate gegeben, bevor er dichtmacht.
Das heißt, ich habe zwei, vielleicht noch drei Monatsberichte, um ihn umzustimmen. Danach wird Folgendes passieren: Er wird in den Konzernvorstand gehen und die Zahlen vorlegen. Jeder der Herren rund um den Tisch wird Granby anschauen. Granby wird eine Reihe von Fragen stellen, noch einmal einen Blick auf die Zahlen werfen und mit dem Kopf nicken. Und das wird’s dann gewesen sein. Wenn die Entscheidung einmal getroffen ist, dass die Fabrik geschlossen wird, dann ist da nicht mehr dran zu rütteln.
Sie werden uns gerade die Zeit geben, unseren Lieferverzug aufzuarbeiten. Und dann werden sich 600 Personen in die Schlange der Arbeitslosen einreihen, wo sie ihre Freunde und früheren Arbeitskollegen – die anderen 600 Leute, die wir bereits entlassen haben – wiedertreffen werden.
Auf diese Weise wird der Unternehmensbereich einen weiteren Markt aufgeben, auf dem wir nicht wettbewerbsfähig sind. Was bedeutet, dass die Menschheit in Zukunft unsere tollen Produkte nicht mehr kaufen kann, weil wir sie nicht billig genug oder rasch genug oder gut genug oder sonst etwas genug herstellen können, um mit den Japanern zu konkurrieren. Weil wir ja nicht einmal mit irgendjemand sonst in der Branche konkurrieren können. Und das macht uns zu einem guten Unternehmensbereich unter vielen anderen in der UniCo-Unternehmens»familie«, die gegenwärtig einen enormen Gewinnzuwachs verzeichnet, und daher werden wir nur eine unter vielen guten Firmen in der Was-weiß-ich-denn-Gruppe sein, wenn die Macher in der Zentrale erst mal eine Fusion mit irgendeiner anderen Verlustfirma beschlossen haben. Das scheint der Kern der derzeitigen Firmenstrategie zu sein.
Was ist nur mit uns los?
Alle sechs Monate sieht es so aus, als ob eine Gruppe aus der Gesellschaft irgendein neues Programm herausbringt, das das Allheilmittel für alle unsere Probleme sein soll. Einige davon scheinen zu funktionieren, aber keines bringt die Lage wirklich in Ordnung. Wir siechen Monat für Monat dahin, und es wird und wird nicht besser. Meistens sogar schlechter.
Okay. Genug gemeckert, Rogo. Reg dich ab. Versuch mal, vernünftig darüber nachzudenken. Es ist niemand mehr da. Es ist spät. Ich bin endlich allein hier im begehrten Eckbüro, Thronsaal meines Reiches. Meine Arbeit wird nicht unterbrochen. Das Telefon klingelt nicht. Also analysieren wir die Lage. Warum können wir nicht in kontinuierlicher Form ein Qualitätsprodukt zeitgerecht und zu wettbewerbsfähigen Kosten liefern?
Irgendetwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendetwas läuft völlig falsch.
Was ich da führe, müsste eigentlich eine gute Fabrik sein. Verdammt, es ist eine gute Fabrik. Wir haben die nötige Technologie. Wir haben ein paar der besten NC-Maschinen, die überhaupt auf dem Markt sind. Wir haben Roboter. Wir haben ein Computersystem, das angeblich alles kann außer Kaffeekochen.
Wir haben gute Leute. Zumindest in den meisten Bereichen. Okay, in einigen sind wir ein bisschen knapp, aber die Leute, die wir haben, sind zum Großteil erstklassig, auch wenn wir sicher noch mehr davon gebrauchen könnten. Und ich habe keine allzu großen Probleme mit der Gewerkschaft. Manchmal sind sie zwar lästig wie die Fliegen, aber auch die Konkurrenz hat Gewerkschaften. Und die Arbeiter haben in letzter Zeit einige Zugeständnisse gemacht – nicht so viele, wie wir wollten, aber wir haben einen Tarifvertrag, mit dem man leben kann.
Ich habe also die nötigen Maschinen. Ich habe die nötigen Leute. Ich habe alles Material, das ich brauche. Ich weiß, dass da draußen ein Markt vorhanden ist, weil die Konkurrenz ihre Waren verkauft. Was zum Teufel ist also los?
Es ist die verdammte Konkurrenz. Das ist es, was uns umbringt. Seit die Japaner auf dem Markt sind, ist der Wettbewerb unerträglich hart geworden. Vor einigen Jahren haben sie uns bei Qualität und Produktdesign abgehängt. Da haben wir aufgeholt. Aber jetzt unterbieten sie unsere Preise und Lieferzeiten. Ich wünschte, ich würde ihr Geheimnis kennen.
Was kann ich denn tun, um wettbewerbsfähiger zu werden?
Ich habe die Kosten gesenkt. Kein anderer Manager in diesem Unternehmensbereich hat die Kosten in dem Ausmaß reduziert wie ich. Es ist nichts mehr zu kürzen übrig.
Und trotz allem, was Peach sagt, sind meine Effizienzen verdammt gut. Er hat andere Fabriken, mit schlechteren Werten, das weiß ich. Und die besseren haben nicht die Konkurrenz, die ich habe. Vielleicht könnte ich die Effizienz noch etwas steigern, aber … ich weiß nicht. Das wäre, wie wenn man einem Pferd die Sporen gibt, das ohnedies schon so schnell läuft, wie es kann.
Wir müssen nur etwas tun gegen den Lieferverzug. Nichts in dieser Fabrik wird ohne Druck geliefert. Wir haben Unmengen von Beständen. Wir geben das Rohmaterial laut Zeitplan frei, aber am Ende geht nichts dann heraus, wann es soll.
Das ist nicht so ungewöhnlich. Die meisten Fabriken, die ich kenne, haben Terminjäger. Wenn man in irgendeine andere Fabrik vergleichbarer Größe kommt, wird man auch dieselbe Menge von Umlaufbeständen finden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Einerseits ist diese Fabrik nicht schlechter als die meisten anderen, die ich gesehen habe – eigentlich ist sie sogar besser als viele davon. Aber wir machen dauernd Verluste.
Wenn wir nur unseren Lieferrückstand aufholen könnten. Manchmal ist es, als ob kleine Kobolde hier ihr Unwesen trieben. Immer wenn wir beginnen, alles richtig in den Griff zu bekommen, schleichen sie herum, zwischen den Schichten, wenn niemand zusieht, und verändern alles gerade nur ein bisschen, sodass alles schief läuft. Ich möchte schwören, es sind Kobolde.
Oder vielleicht reichen meine Kenntnisse einfach nicht aus. Aber verflucht, ich bin doch Diplomingenieur. Ich habe doch meinen Betriebswirt gemacht. Peach hätte mir diesen Job nicht gegeben, wenn er mich nicht für qualifiziert gehalten hätte. Also kann es nicht an mir liegen. Oder doch?
Mensch, wie lange ist es schon her, seit ich da draußen in der Arbeitsvorbereitung angefangen habe, als smarter Junge, der alles im kleinen Finger hatte – vierzehn oder fünfzehn Jahre? Wie viele lange Tage hab ich seit damals erlebt?
Früher dachte ich, wenn ich nur hart arbeitete, könnte ich alles schaffen. Seit meinem zwölften Geburtstag habe ich gearbeitet. Ich arbeitete nach der Schule im Laden meines Alten. Ich arbeitete während der High School. Als ich alt genug war, arbeitete ich im Sommer in den Mühlen in der Umgebung. Immer wieder sagten mir die Leute, wenn ich nur hart genug arbeitete, würde es sich letzten Endes lohnen. Das ist doch wahr, oder? Nehmen wir zum Beispiel meinen Bruder; er hat es als der Älteste leichter gehabt. Nun hat er einen Laden in einem miesen Vorort am anderen Ende der Stadt. Ich dagegen, ich habe hart gearbeitet. Ich habe mich durchs Ingenieurstudium gekämpft. Ich habe einen Job bei einem großen Konzern ergattert. Ich bin für meine Frau und meine Kinder ein Fremder geworden. Ich habe jede Aufgabe und jeden Zusatzjob angenommen, den UniCo mir anbot, und habe dann noch gebrüllt: »Heda! Ich kann nicht genug bekommen! Gebt mir noch mehr davon!« Junge, bin ich froh, dass ich das gemacht habe.
Hier sitze ich jetzt, bin achtunddreißig Jahre alt und ein lausiger Werksdirektor. Ist das nicht wundervoll? Ich habe jetzt doch wirklich ein vergnügliches Leben.
Es ist Zeit, hier endlich herauszukommen. Für heute habe ich schon genug Vergnügen gehabt.
Kapitel 3
Als ich aufwache, liegt Julie auf mir. Leider will sie keinen Sex. Sie streckt sich bloß zum Nachttisch hinüber, wo der Digitalwecker sechs Uhr drei zeigt. Der Alarmsummer dröhnt seit drei Minuten. Julie drückt auf den Knopf, um ihn abzustellen. Mit einem Seufzer rollt sie wieder von mir herunter. Ein paar Momente später höre ich, dass sie regelmäßig atmet; sie ist wieder eingeschlafen. Ein neuer Tag bricht an.
Eine dreiviertel Stunde später fahre ich mit dem Auto rückwärts aus der Garage. Draußen ist es noch dunkel. Aber wenige Meilen weiter auf der Landstraße wird der Himmel schon heller. Auf halbem Weg in die Stadt geht dann die Sonne auf. Aber ich bin zu sehr ins Nachdenken vertieft, als dass ich es gleich merken würde. Ich schaue zur Seite, und dort kommt sie hinter den Bäumen hervor. Manchmal macht es mich wütend, dass ich in dieser ewigen Tretmühle stecke – wie die meisten anderen, nehme ich an – und keine Zeit finde, auf all die täglichen Wunder zu achten, die rund um mich geschehen. Anstatt mich an dem schönen Morgenrot zu erquicken, starre ich auf die Straße und zerbreche mir den Kopf über Peach. Er hat in der Zentrale eine Konferenz mit allen Leuten einberufen, die ihm direkt unterstehen – im Wesentlichen also seine Werksdirektoren und sein Stab. Das Meeting, so wurde uns gesagt, solle pünktlich um acht Uhr morgens beginnen. Das Komische daran ist nur, dass Peach nicht sagt, worum es bei dieser Konferenz gehen wird. Es ist ein großes Geheimnis – Sie wissen schon: Pst, pst! –, klingt, als gäbe es Krieg oder etwas Ähnliches. Er hat uns eingetrichtert, um acht Uhr da zu sein und unsere Berichte sowie alle anderen Unterlagen mitzubringen, damit wir eine genaue Bewertung der einzelnen Operationen im Rahmen des Unternehmensbereichs vornehmen können.
Natürlich haben wir alle herausgefunden, worum es in dem Meeting gehen soll. Zumindest haben wir eine recht genaue Ahnung davon. Wenn man den Gerüchten glauben darf, wird Peach die Konferenz dazu benutzen, uns zu eröffnen, wie schlecht die Ergebnisse des Bereichs im ersten Vierteljahr waren. Danach wird er uns mit der Order einer neuen Ankurbelung der Produktivität kommen, mit Sollzielen für jede Fabrik und verpflichtenden Normen und all dem Zeug. Ich nehme an, das ist auch der Grund dafür, dass wir um Punkt acht Uhr, mit Zahlenmaterial ausgerüstet, antreten müssen; Peach muss gedacht haben, das würde den Berichten einen besonderen Anstrich von Disziplin und Dringlichkeit verleihen.
Die Ironie daran ist, dass die Hälfte der Leute schon in der Nacht zuvor mit dem Flugzeug angereist sein musste, um diesen Termin wahrnehmen zu können. Was so viel heißt wie Hotelrechnungen und zusätzliche Mahlzeiten. So wird Peach, damit er uns auch richtig erklären kann, wie schlecht die Abteilung arbeitet, ein paar Tausender mehr ausgeben, als es ihn gekostet hätte, wenn die Konferenz ein oder zwei Stunden später angesetzt worden wäre.
Peach scheint die Nerven zu verlieren. Nicht, dass ich glaube, er würde auf einen Zusammenbruch zusteuern oder so. In den letzten Tagen reagiert er allerdings etwas heftig. Wie ein General, der sieht, dass er den Kampf verliert, und der in dem verzweifelten Bemühen, doch noch zu siegen, seine Strategie völlig vergisst.
Vor einigen Jahren war er noch ganz anders. Da hatte er noch Vertrauen. Er hatte keine Angst davor, Verantwortung zu delegieren. Er ließ dich jederzeit deine eigene Show abziehen – solange du nur einen respektablen Gewinn nach Hause brachtest. Er versuchte, ein »aufgeklärter« Manager zu sein. Er wollte für neue Ideen offen sein. Wenn da ein Berater gekommen wäre und gesagt hätte: »Die Mitarbeiter müssen sich bei der Arbeit wohlfühlen, damit sie produktiv sind«, hätte Peach versucht zuzuhören. Aber damals waren die Verkaufszahlen besser und die Budgets höher.
Und was sagt er heute?
»Es interessiert mich einen Dreck, ob sie sich wohlfühlen«, sagt er.
»Wenn uns das auch nur einen Pfennig mehr kostet, dann machen wir es nicht.«
Genau das hat er nämlich zu einem Manager gesagt, der versuchte, Peach die Idee eines Fitnesscenters zu verkaufen, in dem die Angestellten Sport treiben können, wobei er davon ausging, dass dann alle bessere Arbeit leisten würden, weil gesunde Mitarbeiter glückliche Mitarbeiter sind und so weiter und so weiter. Peach hat ihn kurzerhand aus seinem Büro hinausgeworfen.
Und nun kommt er in meine Fabrik und schlägt alles kurz und klein, angeblich, um den Kundenservice zu verbessern. Es war nicht die erste Auseinandersetzung, die ich mit Peach hatte – es gab schon eine Reihe anderer, freilich noch keine so ernste wie die gestrige. Was mich wirklich stört, ist, dass ich früher sehr gut mit Peach ausgekommen bin. Es gab eine Zeit, wo ich dachte, wir wären Freunde. Als ich noch zu seinem Stab gehörte, saßen wir oft am Ende des Tages zusammen und plauderten stundenlang miteinander. Ab und zu gingen wir auch aus und nahmen miteinander ein paar Drinks. Jeder glaubte, ich würde ihm in den Hintern kriechen. Aber ich bin mir sicher, er hatte mich gerade deshalb gern, weil ich kein Kriecher war. Ich leistete bloß gute Arbeit für ihn. Wir mochten uns eben.
Vor langer Zeit gab es da diese verrückte Nacht in Atlanta bei dem jährlichen Verkaufsmeeting, wo Peach, ich und ein Haufen von Marketingfritzen das Klavier aus der Hotelbar stahlen und im Aufzug ein Ständchen gaben. Andere Hotelgäste, die auf den Aufzug warteten, sahen die Aufzugtüren aufgehen, und da hockten wir, schmetterten gerade im Chor ein irisches Sauflied, und Peach haute dazu mächtig in die Tasten – er ist übrigens ein sehr guter Klavierspieler. Nach einer Stunde erwischte uns dann der Hoteldirektor.
Zu diesem Zeitpunkt waren wir längst schon zu viele für die Aufzugkabine, saßen auf dem Dach und erfreuten mit unseren Liedern die ganze Stadt. Ich musste Bill aus einem Kampf mit zwei Rausschmeißern hauen, die der Hoteldirektor geschickt hatte, um unsere Party zu killen. Was für eine Nacht! Bill und ich, wir prosteten einander im Morgengrauen in irgendeinem schmierigen Selbstbedienungsrestaurant am anderen Ende der Stadt mit Orangensaft zu.
Peach war es dann auch, der mir zu verstehen gab, dass ich in dieser Firma wirklich eine Zukunft vor mir hätte. Er war es, der mir die ersten Lichter aufsteckte, als ich noch ein kleiner Projektingenieur war, nichts wusste und mich ausnehmen ließ. Er war es, der mich schließlich in die Zentrale holte. Und es war wieder Peach, der alles so arrangierte, dass ich zurück an die Uni gehen und meinen Betriebswirt machen konnte. Und nun brüllen wir einander an. Ich kann das einfach nicht fassen.
Um sieben Uhr fünfzig parke ich mein Auto in der Garage unter dem UniCo-Gebäude. Peach und der Stab seines Unternehmensbereichs sind in drei Stockwerken des Gebäudes untergebracht. Ich steige aus dem Auto und nehme meine Aktentasche. Sie wiegt heute ungefähr fünf Kilo, voll mit Berichten und Computerausdrucken. Nicht anzunehmen, dass ich einen schönen Tag vor mir habe. Mit einem Stirnrunzeln gehe ich zum Aufzug.
»Al!«, höre ich jemanden hinter mir rufen.
Ich drehe mich um; es ist Nathan Selwin. Ich bleibe stehen und warte.
»Wie geht’s?«, fragt er.
»Alles okay. Schön, dich mal wieder zu sehen«, antworte ich. Wir gehen zusammen weiter. »Ich hab das Memo mit deiner Beförderung gelesen. Gratuliere.«
»Danke«, sagt er. »Ich weiß natürlich nicht, ob es momentan gerade der beste Ort ist, hier zu sein, bei all dem, was da läuft.«
»Was heißt das? Lässt Bill euch die Nächte durcharbeiten?«
»Nein, das ist es nicht«, sagt er. Dann macht er eine Pause und sieht mich an. »Hast du denn das Neueste noch nicht gehört?«
»Was denn?«
Er bleibt stehen und sieht sich um. Es ist niemand in der Nähe.
»Über den Unternehmensbereich«, sagt er dann leise.