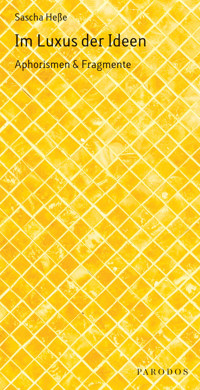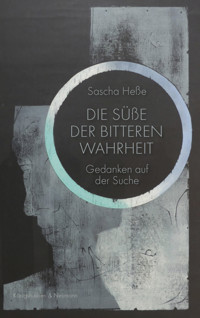Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Reflexionen und Aphorismen von Sascha Heße präsentieren im besten Sinne freies philosophisches Denken ohne Netz und doppelten Boden. Dabei entfaltet Heße einen äußerst vielfältigen Blick auf die conditio humana. Die großen Themen wie Vergänglichkeit, Tod, Unsterblichkeit, Liebe, Freundschaft oder Religion werden in luziden Gedanken reflektiert und seziert. Besonderes Augenmerk legt Heße auf den schöpferischen Menschen, der sich z.B. als Schriftsteller, Komponist oder bildender Künstler dem Strom der Zeit und seiner eigenen Vergänglichkeit entgegenstemmt und zur Besessenheit und Hybris verdammt scheint, um etwas Besonderes zu schaffen. Wie nebenher entwickelt Heße dabei eine eigene ästhetische Theorie, welche die Subjektivität des Künstlers, Autors oder Komponisten wieder in ihr Recht setzt, ohne die ein herausragendes, die Zeit überdauerndes Werk nicht zu haben ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dass die Strömung uns nicht forttrage …
Sascha Heße, geboren 1976 in Magdeburg. Studium der Komposition, Philosophie, Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft sowie der Kulturwissenschaften in Weimar und Leipzig. Zahlreiche Buchpublikationen seit 2004. Lebt und arbeitet als Schriftsteller, Komponist und Musikpädagoge in Leipzig.
Sascha Heße
Dass die Strömunguns nicht forttrage …
Gedanken über Vergängnis und Schöpfertum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
Taschenbuch: © Parodos Verlag Berlin 2016 ISBN 978-3-938880-85-2 Alle Rechte vorbehalten
E-Book: © Parodos Verlag Berlin 2023 ISBN 978-3-96024-039-6
https://parodos.de
IWortwörtliches
Als Menschen sind wir stets bestrebt, etwas haltbar zu machen, um der Vergänglichkeit zu trotzen. Haltbar, das heißt, dem Strom der Zeit standhaltend, der alles mit sich fortreißen will. Der Schriftsteller leidet daran, sprachlos zu sein, weil das, was er fühlt, nur durch Sprache befestigt werden kann. Worte sind wie Wurzeln, die sich im Erdreich festklammern. In äußere Worte, geschriebene bestenfalls, muss sich das Innere verwandeln, um nicht zu verschwinden.
Die Zeit anzuhalten würde bedeuten, auch das Leben zum Stillstand zu bringen. Insofern könnte das Bestreben des Schreibenden, in Worte zu fassen und somit haltbar zu machen, was sonst vorübergehen, verschwinden würde, als eine Art Todestrieb bezeichnet werden. Das tönt unheimlich, ist aber im Grunde nur das Sich-Stemmen gegen die Vergängnis. Den Menschen bekümmert es, dass alles, was sein Leben ausmacht, mit der Zeit zu nichts wird. Dagegen steht er auf, indem er versucht, dem für ihn Kostbaren auf irgendeine Weise, zum Beispiel durch Sprache, Halt zu geben – so wie man ein Boot am Ufer befestigt, damit es die Strömung nicht forttrage.
Das Gedicht stemmt sich gegen den Fluss der Zeit, bringt ihn durch die Form, zu der es selbst geronnen ist, zum Stehen. Es verleiht dem Moment Dauer, aber nicht nur dem Moment, wie er die Außenwelt bestimmt, sondern ebenso, wie er den Dichter, den Verfasser des Gedichts, offenbart. In diesem Sinn ist das Gedicht auch ein Augenblicksentwurf dessen, der es schreibt. Es zeigt ihn, wie er zu dem Zeitpunkt war, da er sich mühte, irgendetwas, sei es, was es sei, in Worte zu fassen.
Der Schriftsteller befindet sich in einer ausweglosen Lage: Das Schreiben, die Arbeit des Formulierens und Aufzeichnens der Gedanken, ist ihm häufig so qualvoll, dass er nichts sehnlicher wünscht, als die Bürde seiner Berufung von sich zu werfen. Aber dieser Befreiungsschlag würde die Negation seiner selbst, die Auslöschung seiner Identität bedeuten. Das Leben vergehen zu lassen, ohne etwas davon festzuhalten, wäre nur eine andere Art von Qual für ihn – ein Leid, vor dem er sich schützen kann einzig und allein durch die Tätigkeit des Schreibens.
Wir sollten es uns zur täglichen Übung machen, dasjenige, was wir gedacht, gefühlt, erfahren und erlebt haben, niederzuschreiben – nicht anders, als man sich beispielsweise angewöhnt, jeden Tag einen Spaziergang zu unternehmen oder Gymnastik zu treiben. Wie diese Dinge der körperlichen Gesundheit dienen, ist das Schreiben dem Geist zuträglich, da es dem Menschen Klarheit schenkt, indem es ihn dazu anhält, sich seine Gedanken zu vollem Bewusstsein zu bringen, sie zu Ende zu führen und auszuformulieren. Daneben hat es den nicht zu unterschätzenden Vorteil, alles, was sonst vorübergehen und dem Vergessen anheimfallen würde, festzuhalten, zu bewahren und der Erinnerung zugänglich zu machen. So kann das gelebte Leben, ohne die Disziplin des Niederschreibens in nichts zergehend, nach und nach zu einem regelrechten Schatz anwachsen.
Das Schreiben ist eine Weise, sich zu zeigen. Im Leben zeigen wir uns in der Regel nur unvollständig – aus den verschiedensten Gründen, zum Beispiel aus Scham. Das Bedürfnis, sich einmal vorbehaltlos und vollständig zu zeigen, ist aber da, und wer schreibt, tut es meist – vielleicht nur unbewusst – um dieses Bedürfnis zu stillen.
Wer sein Leben verbergen wolle – so könnte man meinen –, brauche es nur zu unterlassen zu schreiben oder sich irgendeines anderen Ausdrucksmittels zu bedienen. So einfach ist es indessen nicht! Es gibt Dichter, denen die paradoxe, darum aber auch faszinierende Verhaltensweise eigentümlich ist, sich zugleich verbergen und offenbaren zu wollen. Die Subjektivität soll verborgen bleiben, aber das Verborgene sichtbar sein, und es soll als Verborgenes, darin oder dahinter das nackte Leben zittert, fühlbar werden. Gerade diese Gebrochenheit, nicht das ungehemmte Sich-Mitteilen und ungenierte Plaudern von sich, kann großartig wirken.
„Schriftsteller“ – jemand also, der Schriften erstellt? Dass er schreibt, ist in Wahrheit gar nicht das Wichtigste an einem Schriftsteller! Viel wichtiger ist, was vor dem Schreibprozess geschieht. Denn darin kommt die Haltung, die ein solcher Mensch einnimmt, erst eigentlich zum Ausdruck. Bevor er ans Schreiben geht, sammelt er nämlich. Er sammelt im Grunde alles, Großes und Kleines, Schönes und Hässliches. Seine besondere Gabe liegt darin, die Kostbarkeit auch im Unscheinbarsten zu erkennen.
Alle Dinge besitzen ein poetisches Potential, selbst jene, die uns gänzlich profan erscheinen – zum Beispiel der Plan zum Bau einer Plattenbausiedlung oder der Streit darum, welche Geschmacksrichtungen künftig in der Schulmilch angeboten werden sollen. Voraussetzung dafür, dass dieses Potential – das freilich oft tief verborgen liegt – zur Entfaltung kommt, ist aber das Dasein eines Menschen, der mit der besonderen Fähigkeit ausgestattet ist, die Poesie der Dinge zu erkennen – sie zu sehen, indem er alles mit Aufmerksamkeit und tiefer Zuneigung betrachtet.
Die Worte sind wie ein untaugliches Netz, darin der Schriftsteller die Welt und das Leben mit mangelhaftem Erfolg einzufangen versucht.
Das stumme Erleben der Schönheit – etwa wenn an einem Sommertag der Wind durch die hohen Gräser geht und sie wogen lässt – hat etwas Qualvolles! Wir wollen aussprechen, beschreiben können, was wir erleben! Aber so wenig die Farben des Malers den lebendigen Menschen oder die wirkliche Landschaft zu formen vermögen, so wenig sind die Worte, das Material, mit dem der Schriftsteller arbeitet, in der Lage, mehr zu geben als den bloßen Abglanz der Dinge. Eine Beschreibung kann gelungen sein, als solche aber niemals das einholen, worauf sie sich bezieht: die Realität.
Dass nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die die Dichter an den Rand des Verstummens führten, wieder so geschrieben werden könnte, wie es dem Klischee des Poeten entspricht, der schöne und gehobene Worte wählt, deren viele macht und dabei zuweilen an die Grenze zur Geschwätzigkeit gerät, schien bis vor einiger Zeit noch unmöglich. Die Wirklichkeit hat uns eines Besseren belehrt, und vielleicht kommt darin nur die Ehrlichkeit einer jungen Generation zum Ausdruck, die jene Katastrophen nicht hat erleben müssen.
Nicht die Rede ist das Entscheidende an einem Gedicht, sondern das Schweigen. Die Worte gruppieren sich gewissermaßen um die Stille herum, damit diese vernehmbar werde. Wo sie fehlt, oder besser: wo sie zugeschwatzt ist, fehlt das Eigentliche.
Ein Gedicht darf nicht um originelle sprachliche Bilder bemüht sein – das ermüdet. Es ist, wie einem Artisten im Zirkus zuzuschauen, der seine Saltos vor uns macht und immerzu um Applaus wirbt. Wozu es dabei überdies kommen kann, ist Sinnüberfrachtung – als Hineinlegen, „Andichten“ von Bedeutungen und Bezügen, die übertrieben oder ausgedacht scheinen. Der prosaische Mensch mag die Dinge oft zu nüchtern sehen, doch ebenso unangemessen ist es, die Welt über Gebühr zu poetisieren.
„Besessenheit von der Sprache“ – dies könnte ein treffender Ausdruck für die Eigenart zeitgenössischer Literatur sein, insbesondere wo es sich um das lyrische Genre handelt. Denn offenbar geht die Tendenz dahin, die Sprache selbst zum Substrat zu machen, sie gewissermaßen zu verabsolutieren, so als wäre sie allein dasjenige, womit es die Poesie zu tun haben dürfe. Statt um Inhalte soll es um Wörter gehen, ihre Verwandtschaften und Verhältnisse zueinander. Gegenüber solcher Fixierung ist daran zu erinnern, dass Sprache auch innerhalb der Dichtung, wo die Art und Weise des Ausdrucks freilich das Schwergewicht erhält, ein Medium bleibt. Worauf es ankommt, ist letztlich, was durch dieses Medium zu uns gelangt. Spielt hingegen nur noch das sprachliche Wie eine Rolle, ist mit Krishnamurti berechtigterweise die Frage zu stellen: „Wozu Wörter aneinander reihen, wenn man nichts zu sagen hat?“
Manche Dichter sind wie Schmetterlinge, die von Blüte zu Blüte gaukeln und naschen, ohne von Schmerz zu wissen. Bei allen Dingen der Welt, die sie meisterlich zu beschreiben verstehen, mangelt es ihnen an Welt selbst, an demjenigen, was Eingang ins Gedicht fände allein durch ein leidendes Ich.
Man darf sich vom Schein der Innerlichkeit, den Poesie oft verbreitet, nicht täuschen lassen: Jedes Gedicht ist letzten Endes ein Objekt, dem Subjektivität nicht von sich aus zukommt, sondern vom Autor künstlich eingepflanzt werden muss.
Angesichts eines Bildhauers, der eine Skulptur bearbeitet und bemüht ist, ihr einen bestimmten Gefühlsausdruck zu verleihen, würde kaum jemand meinen, dieser Gefühlsausdruck müsse in dem Bildhauer selbst liegen, müsse seinen subjektiven Zustand ausmachen. Man weiß in diesem Fall ziemlich deutlich zwischen dem Subjekt des Künstlers und dem Objekt seines Werks zu unterscheiden. Ganz anders bei Musik und Lyrik! Hier wird vielfach geglaubt, es handle sich um Übertragungen des Subjektiven ins Objektive. Dass etwas vom Künstler in sein Werk übergeht, ist unbestreitbar. Doch auch bei Kompositionen und Gedichten müssen wir das Gestaltete vom Gestaltenden grundsätzlich trennen! Das Werk ist ein Objekt, das von einem Menschen so geformt wird, dass es einen bestimmten emotionalen Ausdruck erhält. Dieser Ausdruck ist aber der des Werks, nicht der des Menschen!
Ein Schriftsteller mag trinken und rauchen, wie er will – die eigentliche Sucht, der er verfallen ist, besteht darin, die Welt permanent in Worte verwandeln zu müssen.
Seine Gedanken waren aufgebraucht – unglücklicherweise lange bevor ihm die Tinte ausging.
Will man das Bedürfnis, Gedichte zu schreiben, verstehen, muss man verstehen, was Gedichte sind. Das versteht jedoch nur, wer selbst welche schreibt. Um den Durst zu begreifen, muss ich wissen, wie es ist, etwas zu trinken, und muss das Verlangen der trockenen Kehle gespürt haben, die nach Wasser lechzt. Also eine Sache der Erfahrung. Wem sie fehlt, der kann nicht wirklich erfassen, worum es geht.
Schreibe nichts, du schreibst sonst alles!
Die Präzision der Wahrnehmung ist es, die den Dichter nicht anders als den Wissenschaftler auszeichnet. Verschieden ist nur, welchem Zweck das genaue Hinschauen, Hinhören, Hinfühlen und Hindenken am Ende dient.
Wissenschaft und Poesie schließen einander keineswegs aus. Im Gegenteil: Je mehr einer auf einem bestimmten Gebiet bewandert ist, desto eher ist er auch in der Lage, den Zauber, der den Gegenständen dieses Gebietes eigen ist, zu erkennen, zu würdigen und angemessen zum Ausdruck zu bringen.
Es ist etwas Seltsames und fast Trauriges, dass die Menschen den Klang ihrer eigenen Muttersprache, die Schönheit, die darin liegt, deshalb nie recht erfahren können, weil sie diese Sprache verstehen, weil der Sinn, der ihnen erschlossen ist, über den reinen Klang sich lagert und ihn verdeckt! Könnte man seine Muttersprache doch zeitweilig verlernen, um einmal in die Lage zu kommen, sie zu vernehmen!
Der Sinn eines Gedichts liegt nicht in diesem selbst, sondern im Leser, der ihn durch seinen auffassenden Geist herausbildet und hinzubringt. Angesichts einer Poesie, die in einer uns verständlichen Sprache verfasst ist, merken wir das kaum, da wir, sie rezipierend, Sinn erzeugen und dies so erfahren, als wäre er den Worten inhärent. Stoßen wir jedoch auf Fremdsprachliches, erkennen wir, was das Gedicht in Wahrheit ist: Klang im Raum oder Tinte bzw. Druckerschwärze auf Papier. Dies soll freilich nicht bedeuten, es sei beliebig, welcher Sinn in welchen Text gelegt werde. Wäre dem so, hätte Sprache ihre semantische Funktion verloren. Was aber behauptet werden kann, ist, dass sich der Nexus zwischen Sinn und Text nicht hundertprozentig determiniert zeigt, sondern Schwankungen unterworfen bleibt, die von den verschiedenen Erfahrungs- und Bildungshorizonten der Leser herrühren. Dies umso mehr, je poetischer der Text ist, je deutungsreicher er erscheint. Ein Gedicht könnte somit als „Sinnbildungsangebot“ bezeichnet werden – als Offerte, die den Prozess der Semantisierung anregt und in eine bestimmte Richtung lenkt, in seiner Entfaltung aber weitestgehend frei lässt.
Schreiben ist eine Form der Selbsterkenntnis. Schreibend objektiviert der Mensch sein innerstes Wesen, um es hernach betrachten zu können, als wäre es etwas Abgesondertes, Eigenes. Das Subjekt ist nicht imstande, sich als solches zu erfassen. Doch kann es sich sehen, indem es sich durch den Vorgang des Aufzeichnens seiner Gedanken selbst zum Objekt macht.
Es gibt Schriftsteller, die alle Vorstufen, alle Arbeitsschritte, die zum fertigen Text führten, aufheben, sie als etwas immens Wichtiges bewahren, während andere, im Gegenteil, alles, was nur Weg war, nicht Ziel ist, gnadenlos von sich stoßen. Ein interessanter Unterschied, der psychologisch auszudeuten wäre! Zur Erklärung der letzteren Einstellung, die allein das Ergebnis gelten lassen will, sei Folgendes vermerkt: Jener Prozess, der den gültigen Text hervorbringt, kann als ein Makel erscheinen, wie etwas Allzumenschliches, das den Glanz des Endstadiums schmälert, solange es nicht von diesem abgetrennt und vernichtet ist, als wäre es nie gewesen. Wer auf dem Gipfel steht, muss die Leitern, Seile und Haken, mit deren Hilfe er hinaufgelangt ist, in den Abgrund werfen: Nur so ist der Triumph vollkommen!
Für den Schriftsteller sind die Bücher, die er schreibt, ein Weg – der Weg seiner geistigen Entwicklung, den er mühsam von Anfang bis Ende abschreiten muss und auf dem sich sein aktuales, authentisches Selbst immer nur an einem bestimmten Punkt befindet. Daher fällt es ihm oft schwer, dem Publikum aus zurückliegenden Büchern vorzutragen, da diese gar nicht mehr seinen jetzigen Stand repräsentieren. Er muss dann so tun, als wäre er mit demjenigen identisch, der das jeweilige Buch geschrieben hat. Das ist aber nur bedingt wahr, denn eigentlich ist er über diesen Autor, der er da zu sein vorgeben muss, schon hinaus! Für das Publikum ist das freilich kein Problem: Ihm ist der Schriftsteller einfachhin mit dem gesamten Weg identisch, den er bislang abgeschritten hat. Und in einem höheren Sinn hat es mit dieser unwillkürlich gehegten Ansicht sogar recht.
Das Schreiben ist eine Art des Sprechens, und da die Sprache zum Zweck der Kommunikation, der Verständigung zwischen Menschen entstanden ist, setzt zu sprechen immer ein Gegenüber voraus, auch wenn in Wirklichkeit niemand da ist, der zuhört und antwortet. Wer schreibt, versucht also möglicherweise, die Einsamkeit, unter der er leidet, durch den schriftlichen Ausdruck seiner Gedanken erträglicher zu machen, indem er dabei jemanden imaginiert, der vernimmt, was er aussendet, und darauf erwidert.
Denken ist an Sprache gebunden – Sprache hier im ganz grundlegenden Sinn eines Systems von Symbolen verstanden, die sinnlich fassbar sind. Diese Gebundenheit besteht und ist unauflöslich, weil Denken selbst nichts anderes ist als das Operieren mit derartigen Symbolen. Die natürliche Sprache, deren wir uns täglich bedienen, ist allerdings ein vieldeutiges Symbolsystem. Geht es dem Menschen um Eindeutigkeit, da nämlich, wo er bestrebt ist, das Wahre zu erkennen und zu formulieren, genügt sie nicht. Darum hat er künstliche Symbolsysteme – jene der Logik und Mathematik – geschaffen, die seinem Bedürfnis nach Präzision entgegenkommen. Auf der anderen Seite kann die Vieldeutigkeit der natürlichen Sprache auch als Vorzug betrachtet werden. Wo sich das Sprachliche nämlich emanzipiert, wo es nicht mehr nur um das äußerlich Wahre und Wirkliche geht, sondern um alles Vorstellbare, Erträumte, Phantasierte, da tritt die Poesie in ihre Rechte ein und macht ein Symbolsystem erforderlich, das, je vieldeutiger, desto besser ist.
Poesie fängt erst da zu leben an, wo sie auf das wirkliche Leben, das außerhalb von Buchdeckeln stattfindet, Einfluss auszuüben vermag, wo sie zu einer existenziellen Grundeinstellung wird, die wesentlich mitbestimmt, welchen Verlauf das Dasein eines Menschen nimmt.
Mit Recht lässt sich darüber staunen, wie die Sprache einerseits, als alltägliches Kommunikationsmittel, ganz in ihrem Zweck aufgeht, sich ausstreut, verschleudert und verflüchtigt, andererseits, in ihrer Funktion als Medium künstlerischen Ausdruckswillens, feste Struktur gewinnt, dauerhaft wird, von den Menschen als besonderer Wert geschätzt und bewahrt sein will.
Kaum jemand würde behaupten, die notenschriftliche Aufzeichnung eines Musikstückes sei dieses selbst, stelle das eigentliche Wesen der Komposition dar. Die meisten dürften die Ansicht vertreten, wonach Musik nur im Erklingen real werde, erst durch die hörbare Ausführung