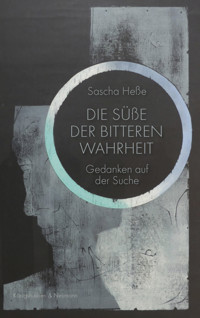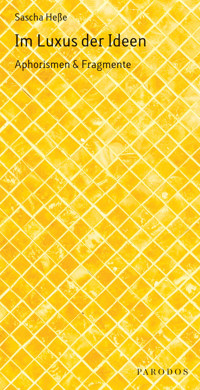
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sacha Heßes neueste Aphorismen und Reflexionen zu Themen wie Glück, Erfüllung, Tod, Zeit und Gott umkreisen den Sinn: den Sinn des Lebens im Allgemeinen wie den Sinn unserer täglichen Lebenspraxis. Dabei wird deutlich, dass Ersteres ohne Letzteres nicht zu haben ist, dass ein Lebenssinn nur aus unseren konkreten Handlungen und Erfahrungen geschöpft werden kann, ob in Liebe, Freundschaft, Arbeit oder freier geistiger Tätigkeit, für die der Autor Sascha Heße mit seinen aphoristisch-essayistischen Arbeiten seit vielen Jahren im besten Sinne einsteht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sascha Heße
Im Luxus der Ideen
Aphorismen und Fragmente
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© Parodos Verlag, Berlin 2018
ISBN der Printausgabe: 978-3-938880-92-0
ISBN der E-Book-Ausgabe: 978-3-96024-045-3
I. Das Gegenglück des Geistes
Alles ist, wie es ist – problemlos. Probleme entstehen nur dort, wo der Mensch sich denkend reibt und stört daran. Zur Problemlosigkeit findet er jedoch nicht dadurch zurück, dass er die Probleme zu lösen versucht – denn bei diesem zum Scheitern verurteilten Versuch produziert er nur immer noch mehr Probleme –, sondern indem er sie als solche zum Verschwinden bringt oder gar nicht erst entstehen lässt. Warum aber ist dies so schwer einzusehen und zu leben? Woher nur der stete Wille zur Lösung und Bewältigung von Problemen? Weshalb das Gefühl, der problemlos lebende Mensch drücke sich um die entscheidend wichtige Aufgabe herum und sei im wahrhaften Sinne nicht eigentlich als Mensch zu bezeichnen?
Unsere Hand greift wohl zu und spürt, wirkliches Begreifen jedoch übersteigt ihr Vermögen. Ebenso ist unser Verstand von wahrem Verständnis weit entfernt, wie sehr er sich auch auf vieles verstehen mag, was nicht mehr als mechanisches Operieren von ihm verlangt.
Der Wahrheit eignet Offenbarungscharakter. Dies ist nicht so zu verstehen, als läge es in der Natur der Wahrheit, stets offenbar zu sein oder der Offenbarung zuzustreben. Nach dieser Hinsicht müsste angesichts der offensichtlichen Tendenz der Wahrheit, sich eher zu verbergen als zu offenbaren, sogar bestritten werden, dass ihr Offenbarungscharakter zukomme. Im vorliegenden Zusammenhang ist Offenbarung jedoch anders, nämlich als Erleuchtung begriffen und meint, dass, wenn die Wahrheit sich zeigt, sie im Sinne einer erleuchtenden Enthüllung dort, wo sie sich zeigt, als solche auch erkannt wird. Dies zu erleben ist erstaunlich: Wie der für undurchdringlich gehaltene Irrtum, wird ein Wort der Wahrheit nur gesprochen, gleich einem trüben Schleier hinwegsinkt – und wie es dann scheint, als wäre ein Bann vom Menschen fortgenommen, der ihn daran hinderte, das, was Mensch zu sein eigentlich heißt, zu fassen und zu leben.
Geist ist immer ein Inhalt, eine Ideologie gewissermaßen – sofern man sich der negativen Konnotation dieses Begriffs, wie sie heute üblich ist, entschlagen könnte. Alles wahrhaft Geistige fordert etwas, ruft zu etwas auf: Wir sollen uns disziplinieren, unser Leben verändern, uns zu Höherem, Größerem fortentwickeln. Wo diese agitatorische Komponente fehlt, gleichgültig, wie angeblich „geistreich“ dasjenige sein mag, was uns geboten wird, da kann es sich letztlich nur um Unterhaltung handeln. Alles bloß Unterhaltende will seinem Wesen nach den Status quo bewahren. Wir sollen uns wohlfühlen in dem Zustand, in dem wir sind, uns behaglich darin einrichten. Und damit uns dies umso leichter gelinge, werden wir rund um die Uhr mit „Interessantem“, „Spannendem“ und „Schönem“ beliefert.
Mit all jenen, die dir zu denken geben, kannst du bedenkenlos gut Freund sein. Doch habe Bedenken beim Nahen solcher, die dir zu denken nehmen wollen!
Wer zweifelt, der verzweifelt nicht.
Sein Wesen der Alldurchdringung verwirklicht der Geist erst dadurch ganz, dass er zum feinmaschigsten aller Siebe wird, in dem selbst das Kleinste zurückbleibt.
Gottfried Benn spricht in einem seiner bekanntesten Gedichte vom Geist als dem „Gegenglück“. Es wäre zu kurz gegriffen, in dieser Wortprägung nur einen besonderen Ausdruck für das unglückliche Empfinden desjenigen zu erblicken, der, einsam in seinem Zimmer sitzend und einer geistigen Arbeit nachgehend, mit Sehnsucht und Schmerz auf das Glück der anderen da draußen schaut, die „im Weingeruch, im Rausch der Dinge“ den Blick und die Ringe tauschen. Denn „Gegenglück“ meint auch: das Gegenstück zum gewöhnlichen Glück – das Glück des Geistes im Gegensatz zum Glück der Sinne.
Solange sie von uns nicht wieder gedacht und so mit neuem Leben erfüllt sind, bleiben die Gedanken, die große Geister vor uns dachten, tot. Es genügt jedoch nicht, sie bloß nachzudenken – sie müssen immer wieder und stets aufs Neue vorgedacht werden!
Unseren Geist beginnen wir erst da wahrhaft zu gebrauchen, wo wir nicht mehr nur – wie umfassend und zeitintensiv auch immer – die Gedanken anderer nachvollziehen, sondern uns in ein unabhängiges, ganz und gar eigenständiges Denken hineinwagen.
Mögen die Formulierungen auch variieren – die Anzahl der möglichen Gedanken ist begrenzt. Nach dem zweiten, spätestens dritten Durchlauf sollte man dies realisiert haben.
Man hält einen Menschen heute für geistreich, wenn er genug Geist besitzt, um einen geistreichen Menschen der Vergangenheit zitieren zu können.
Geist ist nur da, wo sich einer mit Händen und Füßen gegen dessen Herrschaftsanspruch zur Wehr setzt.
Gedanken auf Reisen. Dein Kopf die billige Herberge für eine Nacht.
Gedanken reisen um die ganze Welt – und kommen doch nicht aus dem Kopf dessen heraus, der sie denkt.
Die Leichtigkeit, mit der er dachte, war dem Umstand geschuldet, dass er alle seine Ideen kurzerhand aus der Luft griff.
Sich Denksplitter ins Hirn einziehen – prickelndes Gefühl, das aphorismensüchtig macht.
Ist der Gedanke vielleicht nichts anderes als eine besondere Art der Sinnesempfindung? Einem Geschmack vergleichbar, auf den manche Menschen – Denkende zumeist von Berufs wegen – mehr versessen sind als auf süß oder salzig?
Denkgaben – die Geschenke der Wissenschaft.
Es ist die erschreckende Erfahrung eines jeden Forschers und Wissenschaftlers, dass sich, je höhere Gipfel des Wissens er erreicht, umso tiefere Abgründe des Nicht-Wissens unter ihm auftun.
Die Herzenswahrheit des Mathematikers offenbart sich in der Richtigkeit seiner Berechnungen.
Wunschtraum eines jeden Physikers: einmal gründlich hinters Licht geführt zu werden.
Fachidiot – geglückter Versuch des Menschen, den Menschen zu überwinden.
Dem Beweis geht die intuitive Einsicht in dasjenige voraus, was bewiesen werden soll. Beweisen ist Verifizieren von Gefundenem, nicht Finden. Etwas gefunden werden kann allein aufgrund von Intuition – durch jenes gedankliche Wähnen, das über die bloß sinnliche Anschauung hinausgeht.
In vielen Situationen des Alltags meinen wir, eine Begründung zu geben, wo wir in Wahrheit nur einen anderen sprachlichen Ausdruck für das zu Begründende einsetzen. Grund einer Sache sein, das heißt diese tragen, kann nur, was weder sie selbst ist noch in irgendeiner Weise ihr zugehört. Wirklich zu begründen heißt demnach, den Grund in etwas zu suchen, das vom zu Begründenden strikt unterschieden ist.
Der an die Disziplin der Logik gerichtete Vorwurf, das Inhaltliche im Sinne des Individuellen zugunsten des Formalen zu vernachlässigen, vermag insofern nicht zu treffen, als er übersieht, dass die Möglichkeit der Vernachlässigung einer Sache allein aufgrund von deren irgendwie gearteter Behandlung bestehen kann. Individualität wird innerhalb der Logik jedoch überhaupt nicht behandelt. Wohl bedeutete es eine Vernachlässigung des Individuellen, würde über Individuen – konkrete Menschen zum Beispiel – in einer Weise gesprochen, die das ausklammerte, was sie Individuen sein lässt. Derart verfährt die Logik aber keineswegs. Vielmehr bewahrt sie die Individualität der Wesen und Dinge gerade dadurch, dass sie diese nicht ansatzweise thematisiert.
Der Mensch gestaltet seine Lebenswelt zunehmend selbst. Eine vollkommen künstliche Umgebung, die sich seinen Bedürfnissen perfekt anschmiegt, ist schon längst keine Utopie mehr, sondern vereinzelt bereits Realität. Welchen Einfluss übt diese Tatsache auf die menschliche Evolution aus? Anzunehmen ist, dass ein Organismus, der nicht mehr sich den Umweltverhältnissen, sondern die Umweltverhältnisse sich anpasst, evolutiv zum Stillstand gelangt. Ist dies also das Schicksal des Menschen: Stillstand? Was seinen Körper betrifft, sicherlich. Sein Geist hingegen wird sich auch weiterhin fortentwickeln. In welche Richtung? Vermutlich hin zu einer immer besseren Anpassung an dasjenige, was man die „Wahrheit“ nennen könnte: an die Wirklichkeit der Welt, wie sie sich innerhalb der Erkenntnis repräsentiert zeigt. Der „Kampf ums Dasein“ wird sodann nicht mehr unter Leibern ausgefochten, sondern unter Geistern in Gestalt miteinander konkurrierender wissenschaftlicher Theorien.
Wir stellen in Hinblick auf eine uns realitätsfremd erscheinende Philosophie die zweifelnde Frage, wo denn das alles wirklich geschehen solle, was sie beschreibt und erklärt – und erhalten von ihrem Schöpfer die verblüffende Antwort: In ihr!
Falls ein Philosoph am Strand nichts anderes zu tun bekäme, könnte er sich der Frage widmen, ob und aus welchem Grund man der Behauptung, das einzelne Sandkorn liege im Sand, beipflichten oder widersprechen müsse.
Philosoph, verurteilt wegen Irrtumstrunkenheit am Schreibgerät.
Etwas Zutreffendes mit und in ihrem Denken gefunden zu haben, ist den meisten ernsthaften Denkern ohne Frage zuzugestehen. Vorgeworfen werden muss ihnen aber in der Regel, dies Zutreffende, das sie gefunden, ungebührlich verabsolutiert, umwillen der Eindeutigkeit und Konsequenz einer Idee gegen alles Anderslautende ausgespielt zu haben und so einer unfruchtbaren und unrealistischen Reduktion der Mannigfaltigkeit der Welt anheimgefallen zu sein.
Von jeder Lehre, philosophischer oder religiöser Art, muss, wenn sie sich über lange Zeiträume hinweg unter den Menschen behauptet hat, vorausgesetzt werden, dass sie ihren Ursprung aus einer echt lebendigen Wirklichkeit genommen habe. Denn die Kraft, die für ein langes Überdauern erforderlich ist, kann dem, was bloßem Räsonnement entspringt, nicht zukommen. Festzustellen ist allerdings, dass mit der Zeit, die den Anfang einer Sache in immer weitere Ferne rückt, sie verblassen und an Energie verlieren lässt, in der Regel deren Verfall einhergeht, der, wenn es sich um etwas Geistiges handelt, in einer Theoretisierung und Dogmatisierung zum Ausdruck kommt. Dadurch steht, was einmal ein die Herzen ergreifendes Leben war, nun als starre Behauptung da, der es nicht mehr gelingen will, auf die Menschen irgend berührend zu wirken. Viel mehr jedoch, als darüber zu trauern, gilt es, den Versuch zu unternehmen, dem so in Verfall geratenen Geistigen dadurch einen Hauch des alten Lebens zurückzugeben, dass man seiner Anfänglichkeit nachspürt und somit auf lebendige Weise seines ursprünglichen Wesens inne wird.
Sich konsequent der Philosophie zu widmen, muss notwendigerweise ein tieftrauriges Dasein nach sich ziehen, sofern man es als Aufgabe und Kennzeichen des Philosophen betrachtet, allen vermeintlichen „Sinnangeboten“ zu widerstehen und das Spiel des Lebens, anstatt es mitzuspielen, aus einer erhabenen Perspektive zu analysieren und schließlich in seiner ganzen Zwecklosigkeit zu begreifen.
Philosophie: Überlegenstraining in der Wildnis der Gedanken.
Dass er an den einfachen Dingen des Lebens scheitern muss – darin findet der komplizierte Geist seine größte Schmach und zugleich seine Widerlegung.
Das Tor des Unheils, der Absonderung des Geistes vom Leben, tut sich auf, sobald der Mensch beginnt, sich von einem Gedanken mehr zu versprechen als von einer Wahrnehmung, einem Erlebnis, einer Handlung.
Das Hirn stirbt zuerst – also befreie dich aus dieser Todeszelle, in der du seit Jahren gefangen sitzt!
Von dem, was ich jetzt denke, werde ich einmal leben. Und an das, was ich jetzt lebe, werde ich einmal zurückdenken.
Das höchste überhaupt Denkbare? – Nichts zu denken.
Die Gedanken streben danach, ein Ende zu erreichen. Nicht die Verewigung der eigenen Rastlosigkeit ist das Ziel des Denkens, sondern eines Tages zu ruhen in ewigem Frieden.
Das Letzte, was dem von der Philosophie Abschied nehmenden Menschen argumentativ zu tun übrig bleibt, ist, sich selbst überzeugende Gründe dafür zu liefern, weshalb der Weg, den er künftig zu beschreiten hat, kein philosophischer mehr sein kann.
Wenn Blumenberg formuliert, dass Husserl „dem Immer-Fertigen das Immer-Anfangende des philosophischen Denkens“ entgegengesetzt habe, so ist damit zugleich ein Wink für das Verständnis der wohl seit jeher bestehenden Affinität der Philosophie zur Kunst gegeben.
Dem höchsten Menschenmöglichen bietet der Alltag wenig Raum. Kunst und Wissenschaft hingegen sind die Orte, die eigens für dieses sich auftaten. Wo im äußeren Leben findet sich zum Beispiel eine Sanftmut, die sich mit der in Dichtung und Musik bezeugten, wo eine Strenge, die sich mit der in Logik und Mathematik vollzogenen messen könnte?
Grundsätzlich unterscheiden sich Wissenschaft und Kunst in ihrem Verhältnis zur Mannigfaltigkeit der Welt: Erstere erträgt sie nicht, Letztere bewundert sie.
II. Poetische Flaschenpost
Wie sich die Dunkelheit erhellen lässt? – Einerseits wissenschaftlich erklärend, indem ihr das Dunkle genommen, andererseits poetisch beschreibend, indem sie als Dunkelheit in bessere Sicht gerückt wird.
Was irgend verstanden wird, kann nicht individuell im strengsten Sinn heißen, denn verstehen heißt teilen, das Individuelle aber ist das Ungeteilte. Wenn die dichterische daher schwerer verständlich ist als die Alltagssprache, so deshalb, weil sie dem Individuellen stärker sich angenähert hat als jene.
Wer eine unnütze Sprache zu erlernen für unnütze Mühe hält, den braucht es nicht wunderzunehmen, wenn er mit seinem Latein schon von Anfang an am Ende ist.
Heutzutage sind Redewendungen nur noch redegewendet zu ertragen.
Die ungeschickteste Formulierung kann die Wahrheit treffen, die geschickteste sie verfehlen.
Poesie entsteht vorzüglich im Umgang mit einer nicht völlig fremden, doch auch nicht ganz vertrauten Sprache, wenn die Bedeutung gewisser Worte und Wortverbindungen, statt zweifelsfrei verstanden zu werden, nur einer annäherungsweisen Ahnung unterliegt.
Poetisch ist eine Sprache dann für uns, wenn wir sie nur ansatzweise verstehen, wenn wir aufgrund des Umstandes, dass wir über die Kenntnis nicht aller, sondern bloß einiger Wortbedeutungen verfügen, ihren Sinn lediglich erahnen. Das Verständnis unserer Muttersprache ist vollkommen, darum macht sie leicht einen profanen oder banalen Eindruck auf uns und muss sich zu Poesie im hohen dichterischen Sinn aufschwingen, um uns poetisch zu erscheinen. Nicht so im Fall einer Fremdsprache, die wir nur unzulänglich beherrschen. Diese entzündet unsere Phantasie allein durch ihre Dunkelheit und ist uns aus diesem Grund schon an sich selbst poetisch, insbesondere da, wo sie in Verbindung mit Musik auftritt und so ein noch gesteigertes Maß an emotionaler Intensität gewinnt.
Paul Celan spricht vom Gedicht als einer Flaschenpost, „aufgegeben in dem – gewiss nicht immer hoffnungsstarken – Glauben, sie könnte irgendwo an Land gespült werden, an Herzland vielleicht.“ Wohl lässt sich mit gleicher Berechtigung vom Herzen des Dichters selbst als einer Flaschenpost sprechen, die unterwegs ist in der Hoffnung, einmal dem Meer der Fremdheit zu entrinnen, aufzutauchen aus der sie umgebenden Flut von Beurteilung und Klassifizierung, anzulanden am rettenden Ufer einer Küste, deren Bewohner sie zu lesen und auszudeuten verstehen.
Wie entsteht ein Gedicht? – Die Frage ist formuliert, als könnte sie im Allgemeinen beantwortet werden. In Wahrheit entstehen alle Gedichte, auch diejenigen ein und desselben Dichters, auf sehr verschiedene Weise, so dass, soll Antwort möglich sein, immer nur im Blick auf ein bestimmtes Gedicht gefragt werden kann: Wie ist dieses Gedicht entstanden? – Gleichwohl mag als Gemeinsamkeit gelten, dass die Entstehung eines jeden Gedichts einen höchst komplexen Vorgang darstellt, der, um sich vollziehen zu können, sowohl äußerer Gegebenheiten und Ereignisse bedarf als auch des vollen Einsatzes einer menschlichen Person, die fähig und willens ist, mit Körper, Geist und Seele schöpferisch auf das zu antworten, was ihr widerfährt.
Vorhersehbare Reime sind die Peinlichkeit, die Lieder und Gedichte vor Scham erröten lassen.
Nach wie vor zieht Lyrik uns an wie ein starker Magnet. Stets noch hat der verdichtete Text etwas Magisches an sich, das seine Provenienz aus den religiösen Ritualen unserer Vorfahren bezeugt. Wie ein Zauberspruch ruft und bannt das Gedicht noch heute – und ist so fern der alltäglichen Kommunikation, dass selbst dann, wenn es sich umgangssprachlicher Ausdrücke bedient, diese in ihm verwandelt, aufgewertet, geheiligt erscheinen.
Jim Morrison wollte das letzte Gedicht des letzten Dichters hören. Er hat es nicht gehört. Doch würde er es gehört haben – ganz gleichgültig, wie es gewesen wäre –, es hätte ihm das Herz zerrissen.
Schreibend wie in einem Ozean des Unsinns nach Perlen tauchen.
Wollen wir etwas gesehen haben, so müssen wir es, nachdem wir es gesehen haben, beschreiben.
Wer heute schreibt, um der Welt eine Botschaft zu übermitteln, gehört einer kleinen Minderheit an. Dabei sollte es für alle selbstverständlich sein, dass einzig der Inhalt dessen zählt, was einer schreibt, nicht das Schreiben selbst. Was wir jedoch zunehmend beobachten, ist die Stilisierung der schreibenden Tätigkeit zum Selbstzweck, so als wäre es an und für sich schon von höchster Bedeutsamkeit, irgendetwas zu Papier zu bringen.
Einen Kursus in kreativem Schreiben absolvieren, um sich sodann, mit dem Zertifikat in der Tasche, als Zulieferer der Unterhaltungskultur ins Joch nehmen zu lassen, von dem man erwartet, dass er Romane verfasst wie der Bäcker Brote bäckt ...
Man hält den eigenen Untergang dadurch, dass man ihn zu beschreiben versucht, nicht auf. Es genügt jedoch, dass er sich in der Beschreibung nicht mehr so sehr wie ein Untergang anfühlt.
Um gänzlich leere Worte zu machen, ist Meisterschaft erforderlich. Zumeist bleibt etwas Unrat in ihnen zurück.
Auch Dichter sind Menschen – nachdem sie ihr Redegewand abgelegt haben.