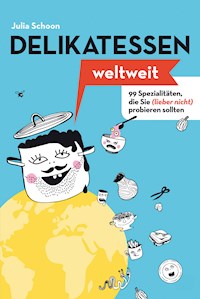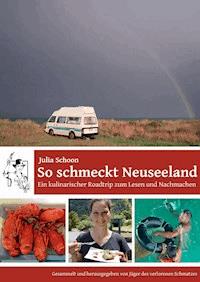Impressum
Texte und Fotos (soweit nicht anders angegeben)
(c) Julia Schoon
Cover: Nina Eggemann
Alle Rechte vorbehalten.
1. Auflage: September 2013 als broschiertes Taschenbuch im CONBOOK Verlag.
2. Auflage: April 2018 als eBook auf www.JaegerDesVerlorenenSchmatzes.de
Vorwort
Warum Essen manchmal psychologische Kriegsführung ist und die Autorin auf Reisen auch Stierhoden und Gammelhai probiert
Eine Theorie besagt, jedes Land habe mindestens eine Speise, die auf jeden, der nicht dort aufgewachsen ist, seltsam oder gar abstoßend wirkt. Für die Einheimischen hingegen ist sie identitätsstiftend und eine Leckerei, die Heimat bedeutet. Auf dem Teller (oder auch im Glas) entscheidet sich sozusagen, wer dazu gehört und wer nicht. In früheren Zeiten war das vermutlich überlebensnotwendig, um Feinde sofort identifizieren zu können, eine Art psychologische Kriegsführung. Seit der Erfindung des Tourismus allerdings geht die Entwicklung langsam aber sicher in Richtung Unterhaltungsprogramm für Einheimische. Ich meine, wer muss nicht schmunzeln, wenn eine Busladung Japaner in Schräglage aus dem Hofbräuhaus kommt, obwohl jeder nur eine einzige Mass getrunken hat?Aber natürlich wollen wir im Urlaub Land und Leute kennenlernen und das geht meiner Erfahrung nach am besten beim gemeinsamen Essen und Trinken. Ich habe in Kanada »Prärieaustern« bestellt und war überrascht, dass die Stierhoden, die sich hinter dem hübschen Namen verbergen, gar nicht glibberig und noch dazu sehr appetitlich zubereitet waren. In Kirgistan habe ich so viel Fleisch vorgesetzt bekommen, wie ich normalerweise in einem Jahr nicht esse, und mein Magen, meine Nase und Zunge mussten mit so fettigem, intensiv schmeckendem Hammel zurechtkommen, dass mir anschließend sogar der Geruch unseres Schaffells zuhause eine Zeit lang Übelkeit verursachte. Ob mein Freund, der Vegetarier, es da besser getroffen hat, ist allerdings fraglich: Jedes Mal, wenn er das von unseren Gastgebern angebotene Fleisch höflich ablehnte, musste er Unmengen Wodka trinken, um seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen. In Island habe ich »Gammelhai« probiert, dessen Ammoniakaroma durch meine Nasennebenhöhlen fegte und meinen Kreislauf auf 180 peitschte, und plötzlich verstanden, warum diese fermentierten Fleischhappen in einem so kalten Land sogar Leben retten können.Viele der in diesem Buch beschriebenen Speisen habe ich selbst probiert und es werden noch einige dazukommen. Manches gibt es sogar in meiner Heimatstadt Berlin. Auf Reisen, wenn ich mit kleinem Rucksack und ohne vorher festgelegte Reiseroute für ein paar Wochen oder Monate unterwegs bin, lasse ich mir keinen Markt entgehen und liebe es, den Leuten in die Töpfe zu schauen. Dabei habe ich schon einiges entdeckt, was das Zeug zum Lieblingsessen hätte, wenn man es nur in Deutschland bekommen könnte. Mehr als einmal habe ich mich dazu überwunden, etwas zu probieren, das für mich unappetitlich oder gruselig aussah. Manchmal war ich überrascht, wie gut es schmeckte – die Hühnerfüße zum Beispiel. Anderes habe ich unter »Erfahrung« verbucht, den rohen Seeigel etwa. Ich würde allerdings nichts, das mir total widerstrebt, aus reiner Höflichkeit probieren - und da ich nicht in diplomatischer Mission unterwegs bin, muss ich das zum Glück auch nicht.Bei jedem verlaufen die Grenzen natürlich anders, aber wenn man sich in einer anderen Kultur bewegt, kommt man immer wieder in Situationen, die fremd sind und manchmal schwer auszuhalten. Das gilt bestimmt auch für die eine oder andere in diesem Buch vorgestellte Speise.Vielleicht schüttelt es Sie bei der Vorstellung, sich Buschmaden zwischen die Zähne zu schieben oder einen Schlangenblutcocktail zu kippen. Vielleicht ist es für Sie auch undenkbar, einen lebendigen Oktopus zu essen oder ein Meerschweinchen. Vielleicht ziehen Sie Ihre persönliche Grenze aber auch zwischen sich und einem Stück labbrigem Weißbrot, das mit Erdnussbutter und sehr zuckriger Marmelade bestrichen ist.Dieses Buch will kein Ratgeber sein. Ich sage Ihnen nicht, was Sie essen dürfen oder sollen. Diese Entscheidung liegt bei jedem selbst.Bewusst haben wir dieses Buch »99 Spezialitäten, die Sie (lieber nicht) probieren sollten« untertitelt. Was Sie probieren möchten und was nicht, kann ich ja auch gar nicht wissen, ich kenne Sie ja nicht. Der Titel ist genauso mit Augenzwinkern zu verstehen wie jedes einzelne Kapitel.Ich würde mich freuen, wenn dieses Buch Sie nicht nur gut unterhält, sondern Ihnen auch den einen oder anderen Aha-Effekt schenkt und, so widersinnig das jetzt vielleicht klingen mag, hier und da beim Lesen Appetit macht. Es kommt auch nur ein einziges Mal der Vergleich »schmeckt wie Hühnchen« vor. Versprochen.Julia SchoonBerlin, im April 2018
Gerichte für Neugierige
1 Wenn das Essen die Zähne bleckt: Gegrillter Piranha
Name: Piranha, PirañaRegion: Südamerika im Amazonas-Gebiet Verzehr: Gegrillt, gekocht, gebacken
(c) Lwp Kommunikacio unter CC Lizenz
Spätestens seit dem James Bond-Film "Man lebt nur zweimal" haben Piranhas ihren Ruf weg: Tier gewordene Schredder sind sie, die einen Menschen mit ihren fiesen kleinen Rasiermesserzähnen innerhalb von Sekunden mit Haut und Haar fressen können. Unvergessen die Szene, in der Bösewicht Blofeld das Bond-Girl in einen Pool mit den blutrünstigen Biestern stürzen lässt und seelenruhig seine weiße Katze krault, während es vor seinen Augen im brodelnden Wasser verschwindet. Übrig bleibt: nichts. Furchteinflößender bekam das auch der 70er-Jahre-Schocker Piranha nicht hin oder die 2010er Version Piranha 3D. Nur blutiger.
Schon Naturforscher Alexander von Humboldt notierte bei seiner Venezuela-Reise 1799, der Piranha falle Menschen beim Schwimmen im Fluss an und beiße Stücke von ihnen ab. 1914 schrieb Ex-Präsident Theodore Roosevelt über die brasilianische Wildnis, die er im Jahr zuvor besucht hatte, dort gebe es die grausamsten Fische der Welt. Später stellte sich heraus: Die Einheimischen wollten dem hohen Besuch etwas bieten. Einige Tage zuvor trennten sie daher ein Stück Gewässer ab, in dem die Piranhas nichts zu fressen fanden. Als sie vor den Augen Roosevelts eine tote Kuh hineinwarfen, stürzten sich die ausgehungerten Tiere natürlich darauf. Die Szene dürfte der im James-Bond-Film in nichts nachgestanden haben.
Umso überraschter sind Touristen, wenn sie im Südamerika-Urlaub Menschen in Gewässern baden sehen, aus denen kurz vorher jemand Piranhas geangelt hat. Wer für die nächsten Jahre der Held jeder Party sein möchte, tut es ihnen nach – neben so einer Erfahrung sehen all die Bungeespringer, Wildwasser-Rafter oder Mit-Delphinen-Schnorchler blass aus. Der eine oder andere trägt von seinem Abenteuer sogar noch eine kleine Narbe davon, die er zum Beweis vorzeigen kann.
Denn Piranhas mit ihrem sagenhaften Unterbiss, bei dem es jedem Kieferorthopäden sofort in den Fingern juckt, können durchaus gefährlich werden – müssen sie aber nicht, wenn man ein paar Regeln beachtet. Übrigens kann es auch in Deutschland nicht schaden, sich mit den exotischen Schuppenträgern auszukennen: Überraschte Angler haben sie nämlich auch schon aus Alster und Erft gefischt, wo sie von Aquarienbesitzern ausgesetzt wurden. Offensichtlich können sich die Tiere auch an kühlere Wassertemperaturen anpassen. In erster Linie fressen sie tote und verletzte Tiere und übernehmen damit eine wichtige Funktion als Gesundheitspolizei der Gewässer.
Für Südamerika gilt: Am größten ist die Gefahr einer Piranha-Attacke in der Trockenzeit, wenn der Pegel der Flüsse immer weiter sinkt und sich in den Überschwemmungsgebieten im Amazonasbecken Pools bilden, die irgendwann zu Pfützen werden. Wer nicht die Erfahrung Roosevelts machen möchte, steigt hier besser nicht ins Wasser. Außerdem sollte man nicht blutend oder in trüben Gewässern zwischen Essensresten schwimmen – zwei Vorsichtsmaßnahmen, die sicher keine allzu große Einschränkung bedeuten.
Und schließlich lockt es die kleinen Monster an, wenn man beim Baden kreischend herumplantscht. Oft sind es deshalb Kinder, die von Piranhas verletzt werden. Diese Neugierde der Tiere kann man sich aber beim Angeln zunutze machen: Erst schlägt man mit einem Stock aufs Wasser, dann wirft man Haken aus, an die man saftige Rindfleischstücke hängt. Je nachdem wie ausgehungert die Fische sind, muss man allerdings sehr schnell reagieren – sonst ist der Köder abrasiert, bevor man den Fang eingeholt hat.
Die größte Gefahr, zwischen die Zähne eines Piranhas zu geraten, besteht übrigens genau dann: Wenn man ihn vom Haken nimmt oder er mit geblecktem Gebiss und wild mit der Schwanzflosse schlagend im Boot herumhüpft. Man muss ihn aber gar nicht selbst fangen, um ihn probieren zu können: In vielen Restaurants entlang des Amazonas steht der schmackhafte Fisch, der je nach Art bis zu 40 Zentimeter groß werden kann, auf der Karte. Da er einen starken, würzigen Eigengeschmack hat, wird er oft nur mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Meist wird er im Ganzen gebraten oder gegrillt und fletscht noch auf dem Teller sein imposantes Gebiss. Leider besitzt er unangenehm viele Gräten. Man sollte ihn daher schön vorsichtig essen, denn mit der Story, wie man einmal fast an Piranha-Gräten erstickt wäre, gewinnt man beim Party-Smalltalk keinen Blumentopf.
2 Patatje Oorlog: Kriegserklärung an den Magen
Name: Patatje oorlog, Friet oorlogRegion: Niederlande Verzehr: Frisch aus der Fritteuse
(c) www.snack-nieuws.nl unter CC Lizenz
Blicken wir der traurigen Wahrheit ins Auge: Wir leben in einem Land der Fast-Food-Einfallslosigkeit. Offenbar setzt die Kreativität aus, wenn keine Schraube dran oder kein Motor drin ist. Pommes sind ein gutes Beispiel. Was könnte man mit diesen knusprig frittierten Kartoffelstangen, die sich nie mit zu viel Eigengeschmack in den Vordergrund drängen, alles anstellen! Stattdessen erleben wir: rot-weiße Tristesse. Oder in Jägersoße ertränkte Labberigkeit. Bestenfalls mal eine Prise Currypulver, aber auch nur als Dreingabe zur Currywurst.
Dabei liegt die Inspiration gleich auf der anderen Seite der Grenze, in Belgien und den Niederlanden. Gut, man könnte jetzt einwenden: Das Leben besteht nicht nur aus Mahlzeiten beim Schnellimbiss. Es gibt aber im Leben eines jeden Menschen Momente, in denen nur eine Frittierbude sofortige Bedürfnisbefriedigung bieten kann. Nach einer Alkohol getränkten Nacht im Club, zum Beispiel, morgens, auf dem Heimweg. Wenn nach dem Coffeeshop-Besuch der Fressflash zuschlägt. Oder wenn Ballauf und Schenk mal wieder einen Fall gelöst haben.
Unsere Nachbarn im Nordwesten haben in solchen Momenten die große Auswahl. Vielleicht liegt es daran, dass Pommes dort oft der Mittelpunkt einer Mahlzeit sind. Sie werden sogar derart geschätzt, dass viele Niederländer sie nicht sofort an der Snackbar herunterschlingen, sondern wie einen guten Freund zum Essen mit nach Hause nehmen. Das Geheimnis, wie man sie so lange knusprig hält, bis man am heimischen Esstisch angekommen ist, wurde dort allerdings auch noch nicht entdeckt.
Bestellt man Patat (bzw. Friet) saté, manchmal heißen sie auch Patat pindasaus, dann bekommt man den Traum in Gold-Gelb mit süßlich-pikanter, heißer Erdnuss-Soße. Ein Souvenir aus jener Zeit, als Indonesien eine niederländische Kolonie war. Patat speciaal peppt die bei uns so beliebten Pommes Schranke mit Curryketchup und rohen, gehackten Zwiebeln auf. Und wer etwas wirklich Spezielles möchte, bestellt eine Kombination aus beiden. Die heißt dann Patat oorlog, was man am Tresen wie »Ohrloch« aussprechen sollte, und heißt übersetzt: Pommes Krieg.
Warum, weiß keiner so genau. Nur, dass sich der Name in den 1980er Jahren schneller in Holland verbreitete als eine Magen-Darm-Infektion – trotz des Widerstandes, den einige Snackbar-Betreiber leisteten. Wer möchte schon ständig bei der Essensbestellung an Mord und Totschlag denken müssen? Ronald Consten, Inhaber der Frituur Reitz, dienstältester Frittiersalon der Niederlande, vermutet, der Name sei vom Aussehen der Spezialität inspiriert: »Alle Zutaten werden auf einen Haufen geschmissen – das sieht aus wie auf einem Schlachtfeld.« Vielleicht beschreibt »Pommes Krieg« aber auch das, was eine geballte Ladung Fett mit scharfer Soße und rohen Zwiebeln im Verdauungssystem anrichtet, wenn man es noch nicht auf Fast-Food-Diät umgestellt hat.
In Holland hat noch eine weitere Schnellimbiss-Revolution ihren Anfang genommen, und zwar in Form von Automaten, die frisch frittierte Snacks verkaufen. Diese Automatieken verbinden wirklich das Beste aus allen Welten: Man sieht, was man bekommt, und zwar lebensechter als auf jeder bebilderten Speisekarte. Niemand muss anstehen und warten – man wirft einfach Geld ein, öffnet eine Klappe und zieht den gewünschten Snack heraus. Und das Allerbeste: Die schnelle Mahlzeit wurde nicht von einer Maschine zubereitet, sondern von einem Menschen, der an den Fritteusen im hinteren Teil des Imbisses hantiert. Genial. Oder auch völlig absurd und echt eklig – heißes, fettiges Essen aus dem Automaten?! In jedem Fall aber bieten die Automatieken das perfekte Preis-Kalorien-Verhältnis weit und breit. Auf Niederländisch sagt man dazu »eten uit de muur«: Essen aus der Mauer.
Nicht irritieren lassen darf man sich, wenn die Patat plötzlich Patatje heißen. Der Holländer verniedlicht Namen eben gerne. Auf die Portionsgröße der »Pommes Krieg« hat das aber keinerlei Auswirkungen. Genau so wenig darauf, was nach dem Genuss der Mahlzeit möglicherweise in den Eingeweiden abgeht.
3 Frittierte Butter: Fettiger wird’s nimmer
Name: Deep-fried butterRegion: USAVerzehr: Heiß und fettig
(c) David Nestor unter CC Lizenz
Dass man so ziemlich alles Essbare (und noch so manches mehr) frittieren kann, ist nichts Neues. Es gibt Menschen, die sich der Illusion hingeben, etwas in kochendes Fett zu werfen sei dasselbe wie kochen, und daher dieses weite Feld für den Rest der Menschheit experimentell erforschen. Ihren großen Auftritt haben sie auf nordamerikanischen Jahrmärkten, dem Himmel für Junk-Food-Jünger. Frittiertes Snickers? Selbst hierzulande schon ein alter Hut – aber einst vermutlich irgendwo in Iowa uraufgeführt. Neuere Kreationen der Heiß-und-Fettig-Fraktion, die europäische Besucher noch überraschen könnten: Käsekuchen und Cola aus der Fritteuse.
Wie um alles in der Welt frittiert man ein Getränk? Eigentlich egal. Die Frage müsste lauten: Warum?!
Die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Barbara J. Rolls von der Pennsylvania State University liefert nun eine überraschende Erklärung für das Essverhalten ihrer Landsleute: Sie seien alle unglaublich gestresst und wollten sich etwas gönnen, glaubt sie – erklärt jedoch nicht, warum gerade schlechtes Essen eine Belohnung darstellt. Das Zentrum im Gehirn, das bei zu viel Fett und Zucker Alarm schlägt, hat bei jenen Menschen vermutlich längst den Betrieb eingestellt. Derartige Reflexe in den Griff zu bekommen, sei schwierig, glaubt die Forscherin, denn heutzutage wüssten viele Menschen nicht, ob sie im nächsten Monat überhaupt noch einen Job haben. Da interessiere es natürlich weniger, ob das, was sie essen, für sie in fünf oder zehn Jahren schädlich sei.
Abel Gonzales Jr. aus Dallas gebührt die Ehre, das wohl öligste, zuckrigste Essen auf diesem Planeten erfunden zu haben: Frittierte Butter. Fett, das man in flüssigem Fett erhitzt? Darauf muss man erst mal kommen. Natürlich wäre es echt eklig, einfach so in ein Stück Butter zu beißen. Daher spießt man einen 60-Gramm-Brocken (gerne auch mehr) auf ein Stäbchen und taucht ihn in einen Teig, bevor er drei Minuten lang brutzelt. Das Ergebnis: Frittierter Teig, der nicht nur außen, sondern auch innen vor Fett trieft. Die Butter schmilzt natürlich und läuft einem beim Reinbeißen über Kinn und Hände. Mit seinem Originalrezept, für das der texanische Arterien-Killer vier Geschmacksrichtungen erdachte (Natur, Knoblauch, Kirsche und Traube), gewann er 2009 auf dem State Fair in Texas den 1. Preis in der Kategorie »Kreatives Essen«.
Auf Jahrmärkten quer durch die USA und auch in Kanada wurde das Rezept seitdem begeistert adaptiert. Eine Frittierbude auf der State Fair in Iowa (deren Maskottchen seit über 100 Jahren eine lebensgroße, aus Butter gearbeitete Kuh-Skulptur ist) verfeinerte den Herzinfarkt-Lutscher um einen Zimtteig, der nach dem Ölbad mit einer süßen Soße übergossen wird, Schoko zum Beispiel. Auf Wunsch gibt es Schlagsahne dazu.
Das Problem sei gar nicht die Butter, meinte eine Kundin aufklären zu müssen, sondern der Teig drum herum – wegen der Kohlenhydrate. Für diejenigen, die trotzdem ihren Fettkonsum reduzieren möchten, wird es bestimmt bald auch »diet«-deep-fried butter geben. Die hat dann pro Portion wahrscheinlich nur noch 500 statt 1.000 Kalorien.
4 Marmite: Geteerter Toast zum Frühstück
Name: Marmite, VegemiteRegion: England, Neuseeland, AustralienVerzehr: Auf Toast gestrichen
(c) Jäger des verlorenen Schmatzes
Typischer Anfängerfehler: Beim Frühstück in England, Neuseeland oder Australien nach dem Glas mit dem fröhlichen gelben Etikett greifen und die zähe, schwarzbraune Paste darin allzu üppig aufs Toast schmieren – das hier ist schließlich keine Marmelade und kein Nutella! Und dann auch noch enthusiastisch hineinbeißen, schließlich will man den freundlichen Briten, sympathischen Neuseeländer oder lässigen Australier nicht enttäuschen, der hier gerade seine Kindheitserinnerungen und seinen allerliebsten Frühstücksaufstrich mit einem teilt. Ein bis zwei Sekunden später, wenn der unerwartete, intensive Geschmack nach Brühwürfeln sich auf der Zunge breit macht, rutscht den meisten Marmite-Neulingen das Gesicht aus und nur die Tapfersten schaffen es, den Bissen höflich herunterzuschlucken. Der sympathische Kiwi oder lässige Aussie schaut derweil mitfühlend. Oder prustet los – auch die millionste Live-Wiederholung von »ahnungsloser Tourist probiert Marmite« scheint brüllend komisch zu sein.
Beleidigt ist er hingegen selten, denn an Marmite oder Vegemite scheiden sich schon immer die Geister – sogar unter den eigenen Landsleuten. In England, dem Land des schrägen Humors, in dem der Aufstrich aus Hefeextrakt 1902 erfunden wurde, wird Marmite sogar mit »Love it or hate it«-Kampagnen beworben. Ein Werbeclip zeigt beispielsweise eine Mutter, die beim Stillen genüsslich in ein Marmite-Sandwich beißt, woraufhin das Baby im Strahl kotzt. Dank Youtube verpasst man auch solche Perlen nicht mehr.
Fans schwärmen von der zart-cremigen Konsistenz der Paste und ihrem unvergleichlichen Geschmack (immerhin darin sind sie sich mit den Hassern einig), loben ihren hohen Vitamin-B-Gehalt und ihre Wirksamkeit gegen Kater, ein vor allem in England nicht zu unterschätzender Pluspunkt. Begeistert kaufen die Briten auch Sondereditionen wie etwa Marmite Gold, dem anlässlich der Olympischen Spiele 2012 in London echte Goldflocken untergerührt wurden, oder jene Lippenpomade, die aus einem Joint Venture zwischen Marmite und Vaseline entstand. Noch Fragen?
Wer gerade seinen ersten (und womöglich letzten) Marmite-Happen heruntergewürgt hat, findet den Vergleich mit Schmieröl oder den Kosenamen »tar in the jar« (Teer im Glas) vermutlich passender. Die Hasser-Fraktion weist auch gerne darauf hin, dass es sich um ein Abfallprodukt handelt, denn die Hefe, Grundzutat für den köstlichen Frühstücksaufstrich, bleibt bei der Herstellung von Bier übrig. Für manche ist es auch einfach ein Konzentrat der ältesten Vorurteile, die über die britische Küche in Umlauf sind.
Garantiert tödlich beleidigt sind sowohl Marmite- als auch Vegemite-Liebhaber allerdings, wenn man behauptet, das sei doch beides dasselbe. Gleiches gilt für die jeweiligen Ländereditionen: auch wenn der Aufstrich in England und Neuseeland den gleichen Namen trägt, liegen selbstverständlich Welten zwischen beiden. Der Beweis lässt sich natürlich nie führen: Alle Rezepturen sind streng geheim. Fest steht: Das Original aus dem Mutterland wurde 1910 erst in der einstigen britischen Kolonie Neuseeland kopiert (Kennern zufolge schmeckt es dort süßer) und 1923 dann in Australien auf den Markt gebracht, wo es Vegemite heißt und die Rezeptur viel schwächer sein soll (was natürlich, je nach Standpunkt, auch von Vorteil sein kann). Trotzdem ist letzteres das wohl berühmteste der drei, seit die Men at Work es in ihrem 80er-Jahre-Hit Down Under besangen.
Als die Marmite-Fabrik in Christchurch durch das schwere Erdbeben Anfang 2011 beschädigt wurde und die Produktion monatelang einstellen musste, war den Kiwis trotzdem das Mitleid der Konkurrenz sicher. »Flippt nicht aus«, flehten die neuseeländischen Zeitungen ihre Leser an, während die britische BBC die Marmite-Knappheit schlicht als »Marmageddon« bezeichnete.
5 Brennivín: In Island ist der Tod schwarz, flüssig und hochprozentig
Name: Brennivín Region: IslandVerzehr: Eiskalt getrunken
(c) Dennis Yang unter CC Lizenz
Schwarzer Tod – das klingt nach einem sehr hässlichen Lebensende und erinnert noch dazu an eine mittelalterliche Seuche, die Teile Europas nahezu leerfegte. Wenn es sich bei dem so Bezeichneten allerdings um Hochprozentiges handelt, scheinen andere Regeln zu gelten, ganz nach dem Motto: je krasser, desto besser. Jedenfalls ist der Plan gründlich gescheitert, dem isländischen Brennivín (Branntwein) ein so abschreckendes Label zu verpassen, dass sich die Leute auch nach Abschaffung der Prohibition in Island davon fernhalten würden. Das schlichte schwarze Etikett, auf dem sich zeitweise ein Totenschädel mit überkreuzten Knochen und das Logo der staatlichen isländischen Alkohol-Verkaufsgesellschaft ÁTVR befand und mittlerweile ein Umriss der Insel, wurde vielmehr zum Markenzeichen: Es verschaffte dem Kartoffel-Kümmel-Schnaps Kultstatus und eben jenen Spitznamen.
Brennivín ist mittlerweile das inoffizielle Nationalgetränk der Isländer und gehört untrennbar zum Verzehr von Hákarl – jenem fermentierten Haihappen, dessen Ammoniakaroma schneller die Nasennebenhöhlen durchfegt als man ihn herunterschlucken kann. Dankbar kippt man Brennivín hinterher, denn der schmeckt wenigstens nur intensiv nach Kümmel und brennt mit seinen 37,5 Prozent Alkohol alle Haiüberreste aus der Kehle. Auch beim Wikingerfest þorrablót (sprich: Thorrablot), das Island traditionell Ende Januar, Anfang Februar feiert, darf das Todesgesöff nicht fehlen, um Spezialitäten wie gekochten Schafskopf, eingelegte Widderhoden und fermentierte Seehundeflossen das letzte Geleit zu geben.
Trotzdem wird Brennivín von den Isländern nicht ständig und in großen Mengen getrunken: etwa 70.000 Liter werden pro Jahr verkauft, und zwar bereits inklusive der Exporte ins (überwiegend skandinavische) Ausland. Das änderte sich auch nicht, als in Tarantinos Kill Bill 2 Brennivín getrunken wurde und die Foo Fighters in Skin and Bones davon sangen. Auch die Nachfrage aus Deutschland, wohin Bestellungen seit Anfang 2011 geliefert werden (dem Jahr, in dem Island Gastland der Frankfurter Buchmesse war), hält sich in Grenzen.
Es ist noch gar nicht so lange her, da war Island eine arme Nation von Fischern und ihr Hauptexportartikel Lebertran. Das Leben am Polarkreis war und ist hart, mehrere Monate im Jahr dauert die Nacht auch beinahe den ganzen Tag. Der Sonnenmangel schlägt vielen aufs Gemüt. Dagegen helfen das im Lebertran enthaltene D-Vitamin – und Alkohol. Früher, so erzählt es ein alter Fischer auf der Insel, wurden daher die Lebertranfässer auf dem Rückweg nach Island mit Branntwein befüllt. Der praktische Import-Export-Kreislauf hatte nur einen Nachteil: Der Hochprozentige färbte sich schwarz und bekam einen merkwürdigen Beigeschmack. So mancher Isländer, der sich mit dem aromatisierten Branntwein den langen, dunklen Winter schöngetrunken hat, ist dabei wohl einen (kleinen) schwarzen Tod gestorben.
6 Ackee: köstlich, aber giftig
Name: AckeeRegion: Jamaika, WestafrikaVerzehr: Gekocht
(c) Patrick Grace unter CC Lizenz
Im Grunde sollten wir dem Ackee-Baum dankbar sein: Er zwingt uns dazu, seine Früchte genau dann zu essen, wenn sie die perfekte Reife erreicht haben: nämlich wenn sie sich öffnen und drei große schwarze Kerne entblößen, die von weichem Fruchtfleisch umgeben sind. Allerdings sind seine pädagogischen Methoden ein wenig brachial. Isst man Akkee nämlich unreif oder überreif oder den falschen Teil der Frucht, vergiftet man sich selbst.
Im harmlosen Fall verursacht die sogenannte Jamaican vomiting sickness (jamaikanische Kotz-Krankheit) einfach nur das: zwei bis sechs Stunden nach Verzehr kommt das Ganze oben schwallartig wieder heraus. Hat man viele Früchte gegessen oder handelt es sich bei dem Patienten um ein Kind oder einen geschwächten Menschen, kann der Brechreiz jedoch bis zum Koma und Tod führen. Wie viele Menschen diese Erfahrung machen mussten, bis sich Ackee and Saltfisch (Ackee mit gepökeltem Kabeljau) zum Nationalgericht entwickelt hat, ist nicht überliefert. Vielleicht kam dieses Wissen auch schon zusammen mit der Frucht (vermutlich auf einem Sklavenschiff) aus Westafrika auf die Karibikinsel.
Die Wahrscheinlichkeit, sich beim Verzehr dieses Gerichts zu vergiften, ist zum Glück nicht besonders groß. Die meisten Einheimischen wissen, wie sie mit der Frucht umzugehen haben, und im Ausland erhält man sie ohnehin nur in der Konservenbüchse, wo die Gefahr bereits gebannt ist. Heikel wird es allerdings, wenn Uneingeweihte Jamaika besuchen und die appetitlich aussehenden, birnenförmigen, hellroten bis gelb-orangefarbenen Früchte am Baum entdecken.
Richtig zubereitet, ist das herzhafte Frühstück jedoch äußerst nahrhaft und recht gesund. Der essbare Teil der Ackee ähnelt dem der Avocado: Es ist weich, cremefarben bis gelblich-weiß und reich an Eisen, Vitaminen, Calcium und ungesättigten Fettsäuren. Zusammen mit dem über Nacht in Wasser eingeweichten und zerkleinerten Pökelfisch, mit gehackten Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten und Kräutern wird es in der Pfanne gebraten und zum Beispiel mit Yamswurzel, grüner Banane und jamaikanischen Klößen gegessen. Lässt man den Fisch weg, wird daraus plötzlich ein Überraschungsgericht für Veganer: Die gebratene Ackee erinnert nämlich an Rührei.
7 Baklava: Mokka und Zuckerschock zum Dessert
Name: BaklavaRegion: Naher Osten, BalkanhalbinselVerzehr: Gebacken
(c) Joe Lanman unter CC Lizenz
Es gibt süßes Gebäck, es gibt sehr süßes Gebäck – und es gibt Baklava: eine Kalorienbombe aus Butter und Zucker (oder Honig), bestreut mit gehackten Nüssen, die von hauchdünnem Teig zusammengehalten wird. Wer die vermeintlich kleinen Happen zum ersten Mal angeboten bekommt, wird nur ein oder zwei Bissen schaffen, bevor er einen schweren Zuckerschock erleidet. Und auch das ist nur schaffbar, wenn kräftig mit rabenschwarzem Mokka nachgespült wird.
Fragt man einen Türken, Griechen, Armenier, Aserbaidschaner, Araber oder Perser, aus welchem Land Baklava ursprünglich stammt, wird man mindestens sechs verschiedene Antworten erhalten. Auf die oben genannten Basiszutaten können sich alle gerade noch so einigen, die Kür sieht jedoch in jeder Region anders aus: Mal wird Rosenwasser verwendet, mal mit Zitronensaft und Zimt abgeschmeckt, die einen bevorzugen gehackte Pistazien und Mandeln, die anderen Walnüsse.
Und es gibt einen heißen Wettbewerb darum, wer den Teig am dünnsten auszurollen schafft und die meisten Schichten übereinanderstapelt. In der Gegend um Gaziantep, wo es die besten Baklava-Konditoren der Türkei geben soll, liegt die Messlatte ziemlich hoch: Durch den Teig hindurch muss man eine Zeitung lesen können.
Der Unterschied zum in Deutschland bekannten Blätterteig liegt darin, dass letzterer mit viel Butter zubereitet wird, während der für Baklava verwendete Filoteig zunächst nur aus Wasser, Mehl und etwas Öl besteht. Wenn der Bäcker ihn in die Form schichtet, wird er jedoch umso großzügiger mit geschmolzener Butter bestrichen und nach dem Backen noch einmal mit reichlich Sirup übergossen.
Legenden zufolge gibt es trotzdem eine Verbindung zwischen beiden: Die türkischen Belagerer sollen den Filoteig 1529 mit nach Wien gebracht haben, wo weltoffene Konditoren sofort das Potenzial erkannten und Apfelstrudel daraus machten. Österreichische Hausfrauen dürften die Entstehungsgeschichte ein wenig anders erzählen. Der Duden definiert Baklava trotzdem einfach mal als »stark ölhaltiges, türkisches Strudelgebäck«.
Wer mit der orientalischen Süßspeise aufgewachsen ist, verfügt bereits über eine Zuckertoleranzgrenze, die einen uneingeschränkten Baklava-Genuss ermöglicht. Trotzdem gilt es, das richtige Maß zu finden: Ein paar Speckröllchen dürfen es gerne sein, die braucht man schließlich auch zum Bauchtanzen. Diabetes hingegen braucht kein Mensch. Kluge Konditoren haben deshalb sogar eine Diät-Variante des Gebäcks entwickelt. Ob die aber wirklich genauso gut schmeckt? Vielleicht ist doch die Touristen-Variante gar nicht so dumm: Zwei Bissen auf der Zunge zergehen lassen, dann ist der Kanal voll.
8 Gazpacho: Kalte Suppe für heiße Sommertage
Name: Gazpacho Region: Spanien Verzehr: Kalt gelöffelte oder getrunkene Suppe
(c) Marco Verch unter CC Lizenz
Gazpacho – davon hat der eine oder andere deutsche Spanienurlauber schon mal gehört und sie womöglich auch schon vor Ort probiert. Falls Sie noch nicht die Gelegenheit hatten: Bitte nicht verwechseln mit dem, was hiesige Kochzeitschriften manchmal anbieten! Die fassen den Begriff gerne ein bisschen weiter und jubeln dem ahnungslosen Leser Rezepte für Kaltschalen als hochsommerliches Spanien-Special unter. »Gazpacho«, das klingt doch gleich viel rassiger.
Probiert man den Suppenklassiker, der eigentlich Gazpacho Andalus heißt, in seinem Heimatland, unterlaufen einem leicht zwei peinliche Fehler. Irrtum Nummer eins: Das Gericht ist nicht kalt, weil der Kellner es auf dem Küchentresen vergessen hat, sondern weil es aus rohem, püriertem Gemüse zubereitet wird. Die Suppe war also noch nie heiß. Es soll tatsächlich Menschen geben, die sich deswegen schon beschwert haben. Warm wird sie höchstens, wenn der Camarero sie tatsächlich nicht schnell genug an den Tisch bringt, schließlich isst man sie bevorzugt im Hochsommer, wenn es im Süden Spaniens Temperaturen hat, die dieser Region den Spitznamen »Die Pfanne« eingebracht haben.
Fettnäpfchen Nummer zwei: Die spanische Aussprache. In den Namen der Gemüsesuppe verirrt sich bei der Bestellung bitte kein Katzen-Z, sondern höchstens ein scharf gesprochenes Gassen-S. Profis lispeln an Stelle des z ein Englisches th, aber die damit einhergehende, meist feuchte Aussprache ist ja auch nicht jedermanns Sache.
Gazpacho gilt als so spanisch wie Paella oder Stierkampf, vermutlich aber basiert das Rezept auf einer kalten Suppe, die die maurischen Besatzer im Mittelalter aus Nordafrika nach Al Andalus mitbrachten. Die Grundzutaten – Knoblauch, Olivenöl, Essig, Salz, Pfeffer, Brotbröckchen und Wasser – sind bis heute dieselben. Im Laufe der Jahrhunderte haben die spanischen Bauern, die sie als simple aber sättigende Mahlzeit für sich entdeckten, jedoch verändert. Zuerst kamen vermutlich Gurken hinzu, die bereits seit der Zeit als römische Provinz in Spanien bekannt waren, und mit der Entdeckung der Neuen Welt dann auch Tomaten und Paprika, die die Conquistadores auf ihren Schiffen mit zurück in die Heimat brachten.
Wer also bislang dachte, grüne Smoothies seien neumodischer Blödsinn, den sich irgendwelche New Age Hippies oder Diät-Gurus ausgedacht haben, lag völlig falsch. Zuerst waren es die spanischen Campesinos, die die pikante Sommerfrische während der Feldarbeit in den heißen Monaten schätzen lernten. Erst viel später kam die Bourgeoisie und entdeckte den als Suppe getarnten Salat als leichte, gesunde Mahlzeit. Womöglich war es gar Sancho Panza, jener zum Wegbegleiter des leicht verrückten Landadeligen Don Quijote ernannte Bauer, der der Gemüsesuppe zum Durchbruch verhalf: In dem Anfang des 17. Jahrhunderts erschienenen literarischen Meisterwerk wünscht er sich eine Gazpacho, um ihn vor dem Hungertod zu retten.
Das eine Rezept für Gazpacho Andaluz gibt es übrigens nicht, vermutlich gibt es sogar so viele Variationen wie Familien in Andalusien leben. Die einen mögen die Suppe fein püriert, andere stückig, die einen löffeln, die anderen trinken sie, es gibt rustikale und elegante Versionen und sogar solche mit Einlage, zum Beispiel gekochte Eier, Chorizo (spanische Paprikawurst) oder Meeresfrüchte. Tendenziell enthält die Gemüsesuppe im Westen Südspaniens viele Tomaten, ist also rot. Für Màlaga, Córdoba und Granada ist die helle Gazpacho typisch, die stattdessen mehr Gurke und Joghurt oder auch fein gemahlene Mandeln enthält. Und in den Bergen (Sierra Morena, Siera de Huelva) gibt es Rezepturen, die eher ins Grünliche gehen.
Spätestens seit der EXPO, die 1992 in Sevilla, der Hauptstadt Andalusiens, stattfand, ist der Suppensalat weit über die Grenzen Spaniens hinaus bekannt. Wie praktisch, dass ein cleverer Geschäftsmann sie kurz darauf pasteurisiert und im Tetrapak in die Kühlregale brachte. Dass durch das Haltbarmachen ein Teil der Vitamine und Antioxidantien flöten gehen, tut dem Erfolg keinen Abbruch. Wer schon mal bei über 40 Grad im Schatten einer geregelten Arbeit nachgehen musste, weiß, wie bereitwillig man sich schweißtreibende Beschäftigungen wie etwa Kochen abgewöhnt. Dass man aber Gazpacho im Sommer sogar bei amerikanischen Fast-Food-Ketten in andalusischen Städten bekommt, geht dann doch einen Schritt zu weit.
9 Algen: Gesundes Lieblingsessen statt Sommerplage
Name: Wakame, Miyog Region: Japan, Korea, ChinaVerzehr: Roh oder gegart
(c) mroach unter CC Lizenz
Algensalat – das beschwört Bilder von Urlaubsstränden, die mit angespültem, glitschigem Grünzeug gesäumt sind, welches in der Sonne vor sich hin trocknet und erst intensiv nach Fisch und dann nach Verwesung riecht. Es erinnert auch an die jeden Sommer wiederkehrenden Meldungen von der »Algenpest«, die sich so stark vermehrt hat, dass sie das ökologische Gleichgewicht des nächsten Badesees hat kippen lassen. Dabei sind Algen der Ursprung allen Lebens. Vor drei Milliarden Jahren waren sie die ersten Sauerstoff produzierenden Organismen auf unserem Planeten und verwandelten die giftige Ursuppe in eine lebensfreundliche Atmosphäre. Heute gehören zur großen Algenfamilie, die alle Klimazonen und Lebensräume unseres Planeten besiedelt, Exemplare in ganz unterschiedlichen Farben, vom mit dem bloßen Auge unsichtbaren Einzeller bis zum hundert Meter langen Seetang.
Die Alge ist der Ursprung unserer Nahrungskette – und in Asien steht sie bis heute auch an deren Ende. Vor allem in Japan, Korea und China landet die vielseitige Wasserpflanze mit dem leichten Meeresaroma gerne in Töpfen, Tellern und Schüsseln, denn sie hat von Natur aus so viele Supereigenschaften, wie sie sich kein verrückter Professor oder Gentechniker jemals hätte ausdenken können.
Auch in der traditionellen chinesischen Medizin werden sie deshalb schon seit tausenden von Jahren verwendet, etwa um den Blutdruck und Cholesterinspiegel zu senken, das Blut zu reinigen, den Körper zu entgiften, die Immunabwehr zu stärken und Magen und Darm zu regenerieren. Meeresalgen enthalten mehrfach ungesättigte Fettsäuren, lebenswichtige Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine in hoher Konzentration. Hierzulande kennt man sie immerhin schon als Bestandteil der Thalasso-Therapie, bei der Packungen mit Algen und Schlick unter anderem bei Rheuma, Neurodermitis, Stress und Rückenschmerzen helfen sollen.
In Asien ist Algensalat eine Lieblingsspeise, die zum Beispiel mit Glasnudeln, Sojasoße, Essig, Sesam, Chili, Knoblauch und Koriander angemacht gegessen wird. Auf dem Teller sieht das aus wie ein grüner Berg aus Wackelpudding, den jemand zu Fäden gesponnen hat. Ganz so glibberig ist die Konsistenz aber nicht, eher eine seltsame Mischung aus erst weich und wabbelig auf der Zunge und wenn man dann kaut, doch irgendwie mit Biss.
Auf deutschen Tellern findet man diesen speziellen Wackelpudding noch eher selten, obwohl er doch so gesund und Götterspeise ja durchaus beliebt ist. Aber ein Anfang ist gemacht, denn Sushi ist hierzulande inzwischen fast so weit verbreitet wie Cocktails mit Schirmchen und das leicht salzig-bittere grüne Papier rings um die Reisröllchen besteht ebenfalls aus Alge – Nori heißt sie und ist die am häufigsten verzehrte Art. Wer sich auf der Karte schon bis zur Miso-Suppe vorgetastet hat, kennt sogar bereits die Wakame-Alge. Die spinatähnlichen Fetzen in der Suppe stammen nämlich genau wie der Glibbersalat von jener Pflanze, die Platz zwei auf der asiatischen Algen-Verzehr-Rangliste einnimmt.