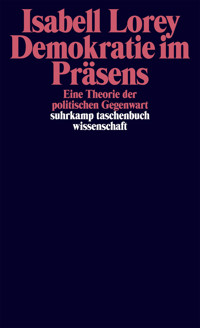
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Inmitten der Krisen und Bedrohungen der liberalen Demokratie entwickelt Isabell Lorey eine Demokratie im Präsens, die politische Gewissheiten ebenso aufbricht wie lineare Vorstellungen von Fortschritt und Wachstum. Mit ihrer queer/feministischen politischen Theorie formuliert sie eine grundlegende Kritik an maskulinistischen Konzepten von Volk, Repräsentation, Institution und Multitude. Und sie entfaltet einen originellen Begriff von präsentischer Demokratie, der auf Sorge und Verbundenheit, auf der Unhintergehbarkeit von Verantwortlichkeiten beruht – und ohne vergangene Kämpfe und aktuelle Praktiken sozialer Bewegungen nicht zu denken ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
3Isabell Lorey
Demokratie im Präsens
Eine Theorie der politischen Gegenwart
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Demokratie im Präsens. Eine Einleitung
1 Rousseau. Versammlung statt Repräsentation
2 Derrida. Demokratie im Kommen
3 Benjamin. Sprünge der Jetztzeit
4 Foucault. Infinitive Gegenwart
5 Negri. Demokratie und konstituierende Macht
6 Präsentische Demokratie. Sorgepraxis und queere Schulden
Literaturverzeichnis
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
7Demokratie im Präsens
Eine Einleitung
Die liberale Demokratie fällt auseinander, sie erodiert, sie implodiert. Einschätzungen dieser Art sind seit langem zu hören – nicht erst seit der Ausrufung der »illiberalen« Demokratie oder der Finanz- und Schuldenkrise von 2008 und der anschließenden EU-Austeritätspolitik. Entgegen der Annahme bloß temporärer Krisen eines grundsätzlich immer weiter fortschreitenden Erfolgsprojekts war die liberale repräsentative Demokratie nie intakt. Sie war nie die Verwirklichung der besten aller möglichen Regierungswelten, die Freiheit und Gleichheit für alle garantiert. Seit der Herausbildung ihrer modernen, europäischen Form ist sie von Herrschaftsverhältnissen durchzogen, gegen die immer wieder Widerstand geleistet wurde. Was sich in der Gegenwart krisenhaft zuspitzt, ist der aktuelle Stand einer immer schon umkämpften Regierungsform.
Zugleich erwies sich die liberale Demokratie in den vergangenen Jahrzehnten als erstaunlich stabil und anpassungsfähig. Soziale Bewegungen, die sich parteiförmig organisiert hatten, wie vielerorts in Europa grüne oder linke Parteien, konnten im Zuge von demokratischen Erneuerungsprozessen zu parlamentarischer Vertretung und bisweilen sogar zu Regierungsverantwortung gelangen. Dieser Prozess kann als potenziell unendliche Bewegung der Demokratisierung und Erweiterung von Rechten interpretiert werden – oder auch als andauernde Zähmung und Integration des Protestpotenzials von sozialen Bewegungen.
Seit den 2000er Jahren erhalten vermehrt autoritär-populistische Kräfte Zulauf. Die Dynamiken repräsentativer Demokratie werden weniger zur weiteren Demokratisierung genutzt als zum Stillstellen, Aufkündigen und Zurückdrehen der bereits erreichten Demokratisierung. Es ist die Funktionsweise der liberalen repräsentativen Demokratie selbst, die auch für anti-liberale Kräfte die Möglichkeit birgt, durch Wahlen in Parlamente und an die Regierung zu kommen. Zur Herrschaftsform der repräsentativen Demokratie gehört die Ambivalenz zwischen der schrittweisen Ausweitung von Rechten und sozialer Anerkennung für Diskriminierte auf der einen Seite und dem konservativen bis reaktionären Abbau 8von Rechten wie Einwanderungs- und Asylrechten, Abtreibungs- und Arbeitsrechten auf der anderen. Was gerade als Zerstörung liberaler Demokratie durch den Rechtspopulismus verhandelt wird, entsteht aus ihrer Mitte und ist ihr zutiefst zu eigen.
Autoritär-populistische und illiberale Kräfte bauen also gerade auf den konstitutiven Ungleichheiten und Herrschaftsmustern moderner liberaler Demokratie auf. Es sind die Ungleichheiten durch Rassisierungen und jene zwischen den Geschlechtern, den sexuellen Orientierungen, den Eigentümer*innen und den Nichtbesitzenden, den vermeintlich unterentwickelten Kolonien und den zivilisierten Zentren, den Staatsbürger*innen und denen, die an den Orten, an denen sie leben, keine (staats-)bürgerlichen Rechte haben. Liberale repräsentative Demokratie ist in ihren grundlegenden Institutionen paradoxerweise zutiefst undemokratisch. Die heterogenen Vielen des demos können gar nicht repräsentiert werden.
In der Verwaltung dieses grundlegenden Mangels sind Parteien und Parlamente keine neutralen Instrumente der Interessenvertretung, sondern selbst Herrschaftsinstrumente zur Aufrechterhaltung geschlechtlicher, rechtlicher, besitz-, bildungs- und rassisierungsbedingter Ungleichheiten. Parteien als die wichtigsten Repräsentations- und Willensbildungsorgane verlieren zudem mehr und mehr Mitglieder, diese werden nur an wenigen ausgesuchten parteiinternen Entscheidungen beteiligt und stellen nur einen Bruchteil der Bevölkerung dar. Schlecht oder nicht repräsentierte »Minderheiten« werden mehr oder weniger integriert und geschützt. Frauen*, Arbeiter*innen und Migrant*innen sind weiterhin schlecht vertreten. Es ist eine der zentralen Aporien liberaler Demokratie, dass Demokratisierungsprozesse stattfinden, ohne diese Form von Demokratie in ihrer maskulinistischen, bürgerlichen und ausschließenden Grundkonstitution zu verändern.
Unter dem Eindruck des »Thatcherismus« Ende der 1970er Jahre entwickelte Stuart Hall den Begriff des »autoritären Populismus«.[1] Er beschrieb damit, wie sich in einer Krise der Repräsentation das Bürgertum als herrschende Klasse neu ordnet, um Repräsentations9angebote für die Unzufriedenen zu machen und zugleich die Repräsentationskrise gemäßigten liberal-demokratischen Kräften anzulasten. »Autoritärer Populismus« entsteht nicht aus dem Nichts, er hat lange Kontinuitäten und erneuert sich aus der bürgerlichen Mitte heraus. In den vergangenen Jahrzehnten hat durch ideologische Verschiebungen, Umbenennungen und Neugründungen von Parteien wiederum eine solche Erneuerung stattgefunden. Wiederkehrende Mittel autoritär-populistischer Mobilisierung sind »moralische Paniken«,[2] geschürt durch Themen wie Sicherheit, Migration und sexuelle Liberalisierung.
Autoritärer Populismus richtet sich gezielt gegen eine freiere Gestaltung von Geschlechterverhältnissen und Sexualitätsregimen. Hieran wird grundlegend deutlich, dass es sich beim Erstarken autoritär-populistischer Diskurse und illiberaler Politiken nicht um eine Negation oder das Andere der liberalen Demokratie handelt, sondern um eine erneute Zuspitzung der konstitutiven Geschlechterungleichheit und des Sexismus dieser Form von Demokratie in kapitalistischen Gesellschaften.[3] Geschlecht und Sexualität sind nicht einfach Themen oder inhaltliche Argumente zur rechten Mobilisierung. Mit dem Propagieren einer »natürlichen« Geschlechterdifferenz geht im autoritär-populistischen Diskurs eine (Re-)Traditionalisierung von patriarchal-heteronormativen Geschlechterverhältnissen einher, was im Übrigen auch nicht im Widerspruch zu einem rechten »Feminismus« steht, der sich in diffamierender Absicht von dem Konstrukt des »Genderismus« abgrenzt.[4] Gleichberechtigung gilt als erreicht, was sich nicht zuletzt an weiblichem und homosexuellem Führungspersonal zeigt, und dient in einer nationalistischen und anti-europäischen Haltung zugleich dazu, 10jede Gleichstellungspolitik zu delegitimieren.[5] In der Verbindung zwischen Nationalismus, neoliberaler Politik und biologistischem »Feminismus« wird ein »Femonationalismus«[6] begründet, der rassistische und Anti-Migrationspolitiken mit naturalisierenden und kolonialistischen Geschlechterdiskursen rechtfertigt, die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern in einer Politik der Angst in die »Anderen« verlagert.[7] Zugleich zementiert die biologistisch-naturalisierte Auffassung von Geschlecht soziale Ungleichheiten in der Mehrheitsgesellschaft, die zur Stabilisierung einer reformulierten hegemonialen Männlichkeit notwendig sind.[8] Gewalt gegen Frauen wird im rechten Diskurs auf patriarchale Gewaltverhältnisse der (im)migrierten »Anderen« externalisiert, vor denen die »eigenen« Frauen geschützt und die eingewanderten muslimischen Frauen in ihrer vermeintlichen sexuellen patriarchalen Unterordnung gerettet werden müssen.[9] Rechte femonationalistische Diskurse reduzieren heterosexuelle Frauen zu Opfern, die von den zur Mehrheitsgesellschaft gehörenden Männern oder von einem autoritären Staat zur Erhaltung der Nation geschützt werden müssen. In diesem patriarchal-heteronormativen Angebot kann sich Männlichkeit mithilfe eines rechten »Feminismus« zugleich überlegen und aufgeklärt-modern imaginieren.[10] Eine solche Überlegenheitsmännlichkeit ist untrennbar mit einer nationalistischen Refigurierung von Weißsein verbunden, was in der Reformulierung eines biopo11litischen Rassismus aus dem 19. Jahrhundert die über Fragen von »Geschlecht«, »Familie« und »Identität« vermittelte Anrufung eines »gesunden«, »reinen«, »weißen« ›Volkes‹ ermöglicht.[11] Dieses identitäre, ethnisierte ›Volk‹ wird als vorpolitisch gegeben naturalisiert. Auf der Grundlage des diskursiven Antagonismus zwischen »Sie« versus »Wir« oder »die Eliten« versus »das Volk«[12] behauptet der autoritäre Populismus, mit dem »wahren Volk« eine Identität zu bilden. Die autoritäre Wende stützt sich wesentlich auf Diskurse des Identitären und Authentischen, und Repräsentation kulminiert so idealerweise in einer Führerfigur. Solche diskursiven Strategien von »Volksidentität« erhalten die repräsentative Form der Demokratie und suggerieren Lösungen für ihre Krise.
Dem identitär konstruierten ›Volk‹ stehen aktuell nicht mehr nur »politische Eliten« und Migrant*innen gegenüber. Vor allem »Genderisten« und Feminist*innen, LGBTI*- und Menschenrechtsaktivist*innen werden als »Feinde des Volkes«[13] markiert, weil sie die Reproduktion im Sinne der patriarchal-rassisierten Stärkung der Nation verweigern. Die in sich völlig widersprüchliche weltweite politische Bewegung des autoritären Populismus gegen gleichgeschlechtliche Ehen, Abtreibungsrechte und »politische Korrektheit« wird ideologisch aus dem Vatikan befeuert, der die Begrifflichkeit der »Gender-Ideologie« erfunden hat und erfolgreich viral verbreitet.[14] Der weit ins Bürgertum reichende Anti-12Gender-Diskurs macht es zugleich möglich, Gewalt gegen Frauen in der breiten Öffentlichkeit weiterhin als Verfehlungen Einzelner, als »Beziehungstaten« im Privaten zu betrachten und strukturell als Effekte eines unaufgeklärten Patriarchats der »Anderen« zu externalisieren.[15]
Statt diesen Fokus auf Geschlecht und Sexualität autoritär-populistischer Kräfte und Diskurse zu analysieren, wird außerhalb feministischer Forschung für das Erstarken des Rechtspopulismus häufig die soziale und ökonomische Prekarisierung im Neoliberalismus angeführt.[16] Prekarisierung wird nicht nur auf verunsicherte hegemoniale Männlichkeiten reduziert, sondern auch suggeriert, sie sei ein rein klassenspezifisches Phänomen. Die strukturelle vergeschlechtlichte Prekarisierung sowie eine rassifizierte Prekarität von Migrant*innen werden nicht berücksichtigt. Doch Prekarisierung ist weder ein ausschließlich neoliberales noch ein homogenes Phänomen. Soziale, ökonomische und rechtliche Verunsicherungen gestalten sich so unterschiedlich, dass sie nicht zum kollektiven Interessensubjekt eines »Prekariats« zusammengefasst werden können. Statt eine gemeinsame Arbeitserfahrung ist Prekarisierung vielmehr eine in unterschiedlichen Weisen die gesamte Gesellschaft betreffende politische Herrschaftsform, die sich in den 1990er Jahren klassenübergreifend durchzusetzen beginnt.[17] Um- und Abbau13ten von Sozialstaaten und Arbeitsmärkten sowie Finanzderegulierungen waren die Voraussetzung dafür, dass sich in der Finanz- und Schuldenkrise – in der EU verstärkt durch Austeritätspolitiken – Prekarisierung weiter ausbreitete und zu einem normalisierten Regierungsinstrument geworden ist.[18] Dies geht einher mit einer autoritären neoliberalen Reorganisierung bürgerlich-kapitalistischer Herrschaft, in der ausgelotet wird, inwieweit einem Segment der Bevölkerung die Reformierung patriarchal-heteronormativer, naturalisierter Geschlechterverhältnisse mitsamt einem entsprechenden Konzept von Familie zur Kompensation politisch-ökonomischer Transformationen angeboten werden kann. Anders als bis in die 1970er Jahre in bürgerlich-liberal-kapitalistischen Gesellschaften angenommen, haben die ersten Jahrzehnte neoliberaler Politiken allerdings deutlich gezeigt, dass patriarchal-heteronormative Geschlechterverhältnisse, die auf der Prekarisierung vor allem von (Ehe-)Frauen basieren, zum Erhalt der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft keineswegs notwendig sind. Im Kontext der Normalisierung von Prekarisierung konnten Geschlechterverhältnisse weitgehend liberalisiert, plurale Lebenskonzepte und Diversität kapitalisiert und für neoliberale Staatskonzepte nutzbar gemacht werden.[19]
Mit dem autoritär-neoliberalen Turn wurde die grundlegende Krisenhaftigkeit der liberalen Demokratie erneut offensichtlich.[20] Noch in den 1990er und 2000er Jahren war es in sozialen Bewegungen undenkbar, sich positiv auf Begriff und Praxis der Demokratie zu beziehen. Doch inmitten erstarkender autoritärer 14Politiken und EU-Austeritätsmaßnahmen entstanden am Beginn der 2010er Jahre vor allem in Südeuropa massive und nachhaltige emanzipatorische Demokratiebewegungen. Sie weigerten sich, klassische Forderungen nach mehr Demokratisierung aufzustellen und Repräsentant*innen zu wählen. Sie wollten eine andere, neue Form von Demokratie erfinden, praktizieren und leben. »Democracia real ya« (»Reale Demokratie jetzt sofort«) hieß der Slogan, der am 15. Mai 2011 viele Tausende erstmals auf der Puerta del Sol, dem zentralen Platz in Madrid, zusammenbrachte. Davor schon fingen die Versammelten auf dem Tahrir-Platz in Kairo an, neue Formen von radikaler Inklusion und Organisierung zu erproben, und danach dann auch jene auf dem Syntagma-Platz in Athen, auf den Plätzen der Occupy-Bewegungen in den USA, jene der Gezi-Bewegung in der Türkei und an vielen weiteren Orten. Sie bezogen sich emphatisch auf Demokratie als Weise, miteinander zu leben. Sie kämpften um neue Formen von Demokratie, für ein zutiefst demokratisches Leben, für eine neue Gesellschaft, die sie erfinden, erleben und in der Gegenwart herbeiführen wollten. Dieses vielfältige, andauernde, diskontinuierliche Erproben von neuen demokratischen Praxen war es, das vor einigen Jahren den Anlass gab, auch auf einer politisch-theoretischen Ebene über Alternativen zur liberalen repräsentativen Form von Demokratie nachzudenken. Aus den Aporien der liberalen repräsentativen Demokratie heraus entfaltet sich eine Demokratie im Präsens: die präsentische Demokratie.
Autoritärer Populismus stützt sich dagegen gerade auf die Widersprüche der liberalen Demokratie, verschärft sie teilweise, und unterminiert zugleich das zentrale liberale Versprechen einer fortschreitenden, in die Zukunft gerichteten Demokratisierung. Dieses Versprechen basiert auf der Notwendigkeit von Anerkennungskämpfen und lässt die grundlegenden Herrschaftsverhältnisse repräsentativer Demokratie immer wieder als notwendig und diese Form der Demokratie als alternativlos erscheinen. Autoritärer Populismus will die Aporien liberaler Demokratie nicht in Demokratisierungsprozessen verändern, sondern als unveränderbar festlegen.
Zu den konstituierenden Aporien, in denen die liberale repräsentative Demokratie gefangen ist, gehören folgende sechs Widersprüche: Erstens ist Repräsentation immer ausschließend, nie werden alle repräsentiert. Der Anspruch auf Gleichheit ist mit diesem 15Instrument nicht erreichbar. Anliegen der Nichtrepräsentierten kommen, wenn überhaupt, in den hierarchischen Institutionen der Repräsentation nur stark verformt an. Horizontale Entscheidungsstrukturen und offene Willensbildung werden in der Regel blockiert.
Zweitens basiert liberale Demokratie auf einer konstitutiven Trennung zwischen dem Politischen und dem Sozialen, zwischen Staat und (Zivil-)Gesellschaft. Aus der Autonomie des Politischen erwächst die Notwendigkeit von politischer Repräsentation, die die Grundlage des uneinlösbaren Versprechens liberaler Normen von Gleichheit und Gerechtigkeit darstellt.
Drittens unterstellt die Idee der Volkssouveränität die Einheit eines Volkswillens, der die Verfassung trägt. Die Vorstellung der juridischen konstituierenden Macht des souveränen ›Volkes‹ verlangt, dass es einen allgemeinen, einheitlichen Willen herausbildet. Der demos als ›Volk‹ darf nicht unbestimmt, vielheitlich und heterogen sein. Er zeigt sich im Bereich des Juridisch-Politischen als Maskulinistisch-Allgemeines und grenzt sich von einer zerstreuten, partikularen und weiblich konnotierten Multitude im Bereich des Sozialen ab.
Viertens ist liberale Demokratie immer eine begrenzte, eine eingegrenzte Demokratie. Die Volkssouveränität agiert immer im Rahmen eines Nationalstaats. Diejenigen, die in diesen Gesellschaften ankommen, können nur in bestehende, ethnisierte Verhältnisse integriert werden. Fühlt sich die liberale Demokratie bedroht, werden Grenz- und Migrationsregime zur Schließung eingesetzt. Die Freiheit wird im Namen der Freiheit eingeschränkt.
Fünftens konstituiert sich die bürgerliche liberale Demokratie durch die vergeschlechtlichte Trennung zwischen einer öffentlichen und einer privaten Sphäre. Die patriarchale Ordnung von naturalisierter heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit und Kleinfamilie gewährleistet die kapitalistisch profitable unbezahlte Sorge- und Reproduktionsarbeit von Frauen. Soziale Verbundenheiten, Prekärsein, Reproduktion und Sorge werden feminisiert, abgewertet und depolitisiert.
Sechstens zeigt sich in der Normalisierung von Prekarisierung und sozialer Verunsicherung die neoliberale autoritäre Wende anhand eines verstärkten Sicherheitsapparats. Kontrolle und Überwachung nehmen zu, soziale Sicherung nimmt ab. Prekari16sierung, Austeritäts- und Schuldenpolitiken führen zu steigenden individuellen und staatlichen Verschuldungen. Das ist im Interesse der Restabilisierung bürgerlich-kapitalistischer Herrschaft, denn Schulden und Kredit dienen einem berechenbaren, in die Zukunft gerichteten konformistischen Verhalten.
Die Logik liberaler Demokratie zeigt sich darüber hinaus in spezifischer Weise an zwei grundsätzlichen Problemen ihrer Konzeption von Zeit und Geschichte. Das eine Problem ist, dass eine bürgerliche Konstruktion von Geschichte stets fortschrittsgläubig ist und an einem linearen Zeitverständnis festhält. Es ist die kontinuierlich erzählte Geschichte der Sieger, der Zivilisierung, der Entwicklung, der (liberalen) Demokratie. Der Glaube und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft im Rahmen dieser Form von Demokratie bleiben unerschütterlich. Dieses Versprechen auf die Zukunft treibt nicht nur die Kämpfe um Anerkennung an, denen das Begehren anhaftet, sich in die Geschichte der Sieger einzuschreiben. Das Versprechen der linearen Zeit beeinflusst auch die Form politischer Organisierung. Das liberale politische Verständnis von kontinuierlicher Dauer und Durchsetzungsfähigkeit ist untrennbar mit dem Festhalten an Institutionen der Repräsentation verbunden. Kämpfe von sozialen Bewegungen gelten so lange als spontaneistisch, unpolitisch, naiv oder ineffektiv, auf Präsenz und Unmittelbarkeit fixiert, solange sie sich nicht in einem zweiten Schritt der Formierung als Partei oder als eine andere Organisation der Interessenvertretung institutionalisieren. Keine Forderungen zu stellen und keine Vertreter*innen zu wählen irritiert das auf Repräsentation fokussierte chrono-politische Diskursregime.
Das zweite Problem besteht in einem beschränkten Verständnis der Gegenwart und dessen Geschichtsblindheit. Im liberalen Zeit- und Geschichtsverständnis bleibt die Gegenwart jenseits des Politischen, ist der Kontingenz und der Empfindung vorbehalten, einem als authentisch verstandenen Gefühl im Hier und Jetzt. Subjektivistisch und untauglich für Reflexion und Allgemeinheit, gilt die Gegenwart nur dem Partikularen und dem Moment. Sie ist der Dauer der Repräsentation entgegengesetzt, die sie in ihrer momenthaften Intensität auch nur verfälschen kann. Die Affirmation dieser Konstruktion der Gegenwart als einer authentisch-identitären findet sich nicht nur in autoritär-populistischen Ideologien, sondern auch als Sehnsucht nach dem Authentischen und Ekstatischen im 17»Jetzt« einer gewissen Form von maskulinistischer linker Militanz. »Wahrheit« gilt hier als »volle Präsenz bei sich selbst und der Welt«, als »vitaler Kontakt mit der Wirklichkeit«, die die politische Aktion ausmache.[21] Freundschaften entstehen als »irreversible Bindungen« in der Gewalt.[22]
Präsentische Demokratie hat mit solchen authentizistischen Unmittelbarkeiten nichts zu tun. Sie entfaltet sich in einem völlig anderen Verständnis von Gegenwart. Die Zeit der präsentischen Demokratie ist die Jetztzeit, wie Walter Benjamin sie entworfen hat, und sie lässt sich als infinitive und ausgedehnte Gegenwart begreifen. Die Jetztzeit ist eine historisch-materialistische Zeit, in der die Kämpfe in der Gegenwart nicht ohne Bezüge zum Vergangenen sind. Diese Kämpfe aktualisieren minoritäre Geschichtsfragmente, entreißen sie dem Vergessen und stellen Verbindungen mit den in Gewaltverhältnissen Verstummten her – Beziehungsgeflechte, um von Neuem gemeinsam die Kraft zu erlangen, Herrschaftsverhältnisse wie Sexismus, Klassismus, Rassismus und Kolonialismus zu zerschlagen. Sie wissen, dass die »Wirklichkeit« nicht unmittelbar ist, sondern ein Gefüge aus Herrschaftsverhältnissen, und sie nutzen die Gegenwart, um mit den Sprüngen in minoritäre Vergangenheiten die Konstellationen der Gegenwart neu zusammenzusetzen. Sie unterstützen die Demokratisierungsprozesse der liberalen Demokratie, die Kämpfe um Anerkennung und die Ausweitung von Rechten. Aber sie gehen darüber hinaus. Sie verlassen die liberale Logik der linearen Zeit und praktizieren präsentische demokratische Politiken.
Das Präsentische steht nicht in einem dichotomen Verhältnis zur Re-Präsentation, es entsteht vielmehr in einem Exodus aus der doppelten Problematik von linearen, kontinuierlichen Erzählungen und authentisch-identitären Gegenwartsfetischismen. Das Präsentische ist die politische Gegenwart, in der ein unzeitgemäßes und unaufgeschobenes Werden der Demokratie praktiziert wird. Dieses Werden von neuen Formen der Demokratie entfaltet sich in einem konstituierenden Prozess, der nicht einfach auf konstitutionelle Neuordnung, auf eine Verfassung im Sinne eines Grundgesetzes gerichtet ist. Viel grundlegender ist der konstituierende Prozess der präsentischen Demokratie in das Entstehen neuer Subjekti18vierungen verwickelt. Präsentische Demokratie hält die Aporien liberaler Demokratie nicht für unveränderbar, sondern bricht sie auf. Keine identitären Konfrontationen von »Wir« und »Sie«, keine Dichotomien von Konsens und Konflikt oder Bewegung und Partei. Präsentische Demokratie ist ohne ›Volk‹ und ohne Nation. Statt Grenz- und Migrationsregimen sind ihre Grenzen Sexismus und Rassismus, Homo- und Transphobie, Kolonialismus und Extraktivismus.[23]
Zu den wichtigsten aktuellen Kämpfen präsentischer Demokratie gehören die transnationalen queer-feministischen Streikbewegungen, die sich seit 2015 gegen Gewalt gegen Frauen* und autoritär-populistische Politiken gebildet haben.[24] An vielen Orten war der Auslöser ein Femizid, eine Frau* zu viel, die der Gewalt von Männern zum Opfer fiel, weil sie sich weigerte, patriarchal-heteronormative Geschlechterrollen zu bedienen.
2016 bildete sich in Polen gegen den regierenden autoritären Populismus die breite emanzipatorische Frauenbewegung des »Schwarzen Protests«, die sich erfolgreich gegen die versuchte Verschärfung des ohnehin strengsten Abtreibungsrechts zu Wehr setzte. Inspiriert von diesem Erfolg, riefen kurze Zeit später die Frauen* in Argentinien erneut zum feministischen Massenstreik auf: »#NiUnaMenos« (»#Nicht eine weniger«). Die Welle des Protests wird seitdem weltweit immer größer. Die queer-feministischen Streiks wenden sich nicht allein gegen Gewalt gegen Frauen*, Autoritarismus und Antifeminismus, Homo- und Transphobie, sondern gegen die lebensfeindliche Allianz von patriarchaler Ordnung und neoliberaler kapitalistischer Ausbeutung und Plünderung. Die feministische Welle bricht Rekorde, wie am 8. März 2018, als allein in Spanien in 300 Städten und Gemeinden sechs Millionen Menschen am bislang größten Streik in Europa teilnahmen. Weltweit gab es feministische Massenstreiks in über 50 Ländern.[25]
19Der queer-feministische Streik ist ein politischer und sozialer Streik. Er zielt auf mehr ab als einfach nur auf Lohnarbeit. Er braucht kein vereintes Subjekt, das geschlossen streikt. Er geht stattdessen von nicht-identitären Verbundenheiten und Affizierungen aus. »Tocan a una, tocan a todas« (»Rühren sie eine an, rühren sie alle an«), sagen sie in Argentinien. Die Streikbewegungen beziehen sich nicht nur auf queer-feministische Genealogien, sondern auch auf die repräsentationskritischen Besetzungs- und Demokratiebewegungen der 2010er-Jahre, auf deren transversale Praxen der Organisierung. Sie verstehen sich als »anti-rassistisch, anti-imperialistisch, anti-heterosexistisch und anti-neoliberal«,[26] auch deshalb, weil der Angriff auf Frauen* und alle Arbeitenden mit der Herausbildung von Neoliberalismus, Finanzialisierung und unternehmensorientierter Globalisierung in extremer Weise zugenommen hat, vor allem für Women of Color, arbeitslose und migrantische Frauen.
Die gegenwärtigen queer-feministischen Kämpfe sind nicht nur vielheitlich und mannigfaltig in ihrer geopolitischen Ausdehnung und transversalen Ausrichtung, sie ziehen auch Linien durch die Zeit – so im auf vielen Demonstrationen in Lateinamerika und zunehmend auch in Europa gesungenen Lied: »Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar, pero es el momento de alzar nuestra voz y gritarle al mundo ¡NI UNA MAS!« (»Wir sind die Enkelinnen all der Hexen, die sie nicht verbrennen konnten, aber es ist Zeit, unsere Stimme zu erheben und in die Welt zu schreien NICHT EINE MEHR!«).[27]
20In Zeitsprüngen werden vergangene Kämpfe erinnert. Die aktuelle Streikwelle ist ihren Praxen und Organisierungen gegenüber verschuldet.[28] Wo es wie in Spanien seit vielen Jahren eine Demokratiebewegung gibt, schließt diese Welle an, um der liberalen Form von Demokratie von Neuem über Grenzen und Begrenzungen hinweg Praxen präsentischer Demokratie entgegenzusetzen. Von der Gewalt gegen Frauen* als Ausdruck struktureller Gewalt auszugehen, von der strukturellen Abwertung von Sorge und Reproduktion, von ökonomischen und sozio-politischen Herrschaftsverhältnissen der Diskriminierung, Ausgrenzung und Abschiebung, bedeutet, die aktuellen queer-feministischen Kämpfe, die Bündnisse so vieler Bewegungen und Initiativen umfassen, immer als intersektionale und transversale Kämpfe zu verstehen. Das ist der Gewinn des Streiks als transnationales queer-feministisches Instrument, das für eine Vielfalt an Akteur*innen offen ist, nicht allein für Frauen*, sondern etwa auch für prekäre und migrantische Arbeitende.
Die queer-feministische Streikwelle nimmt die Herausforderung 21an, die die politische Theorie der Multitude seit Jahrhunderten zuschreibt, nämlich die Gegenfigur zu einer auf der Souveränität eines ›Volkes‹ basierenden Form von liberaler Demokratie zu sein. Es handelt sich nicht einfach um eine neuerliche Emanzipationsbewegung, die sich aus den Fängen des Patriarchats befreit, um endlich zu einem politischen Subjekt zu werden.[29] Die vielen queer-feministischen Konfluenzen verstehen sich als weltweite Multituden: Sie sind unterschiedlich und vielfältig und nicht reduzierbar auf einen Staat, eine Partei oder ein ›Volk‹.[30] In diesem Sinn ist die multitudinäre Streikwelle die Aktualisierung und Vervielfältigung der alten Figur, die als Pendant des ›Volkes‹ durch die moderne politische Theorie geistert, zu zerstreut und zu abhängig voneinander, um zu einem maskulinen politischen Subjekt zu werden, das allein nach Parametern der Repräsentation und Souveränität in der Lage ist, politisch zu handeln.
Wenn die Multitude in der Gegenwart als Alternative zu ›Volk‹ und Populismus auftritt, dann ist sie zutiefst in den sozialen Beziehungen verankert, in den Verbundenheiten und Affizierungen mit anderen; sie durchkreuzt die liberalen Logiken der Repräsentation, weil diese ihre Vielfältigkeit nicht garantieren können. Sie basiert auf »situierte[n] Versammlungen […] zur Produktion der kollektiven Intelligenz, der taktischen Diskussion und der erweiterten Vernetzung«.[31]
Die feministische Multitude streikt gegen das ›Volk‹, gegen die international agierenden reaktionären Allianzen und gegen das Amalgam aus liberaler Demokratie und Neoliberalismus. Immer von Neuem wendet sie sich gegen Kräfte, die das Leben zerstören, und kämpft für die Wertschätzung der Verbundenheit mit Menschen, Dingen und Umwelten.
22Die Überlegungen dieses Buches sind ein Anfang, der diese Kämpfe aufnimmt, Vergangenes aktualisiert und zu einer Konstellation als Demokratie im Präsens zusammenfügt. Das erste Kapitel zeigt, wie ein maskulinistisch konzipiertes souveränes ›Volk‹ auf der Depolitisierung der Multitude basiert. Jean-Jacques Rousseau entwirft als Erster eine demokratische Regierungskunst, die Foucault später mit dem Begriff der Gouvernementalität gefasst hat. In Rousseaus Neufassung einer modernen politischen Ökonomie verliert die Familie mitsamt der patriarchalen Geschlechterordnung ihren Modellcharakter für die Lenkung eines Staates und wird zum Scharnier für die Regierung einer multitudinären Bevölkerung. Wenn die Vielheit sich versammelt und ein Fest feiert, geht es nicht um die unmittelbare Präsenz der Feiernden, sondern um Austausch und den gemeinsamen Überfluss.
Das zweite Kapitel zeigt, wie vehement die Dichotomie zwischen Repräsentation und Präsenz auch Jacques Derridas frühen Entwurf einer Dekonstruktion und damit poststrukturalistisches Denken geprägt haben, denn sie ist in Abgrenzung zu Rousseau entwickelt. Für Derrida vertritt Rousseau nichts als eine Metaphysik der Präsenz, geschichtslose Unmittelbarkeit und Selbstbezogenheit. Diese Kritik gilt allerdings vielmehr G.W. F. Hegels Verständnis von Gegenwart. Wenn sich Derrida in Schurken erneut Rousseau zuwendet, ist sein Urteil ein milderes. Mithilfe von Rousseaus Verständnis von Demokratie entfaltet er nun die kommende Demokratie und die im Kommen bleibende Gegenwart. Es ist eine Demokratie im Werden, in der Bewegung, die nicht in die Zukunft verschoben ist: unbestimmt, entgrenzt und offen für die unberechenbare Ankunft des und der Kommenden.
Mit Walter Benjamin zeigt sich im dritten Kapitel das messianisch Kommende als eine historisch materialistische Figur, mit der Gegenwärtiges und Vergangenes zu einer Konstellation in der Jetztzeit werden. Benjamin bricht die Geschichte der Sieger auf und lässt sein materialistisches Verständnis von Zeit auf Affekt und Sorge basieren. In der Sorge um das Vergangene erklingen die Stimmen der Verstummten, die in Beziehungsgeflechten im Jetzt eine Rolle spielen, situiert in den Widerständen und Kämpfen. Mit Benjamin und Marx wird die soziale Revolution der Pariser Commune aktualisiert, ihre mikropolitischen Praxen, das nicht-repräsentationistische Experimentieren, die unzähligen Versammlungen 23und alternativen Organisationsformen, die Sorgebeziehungen der Nachbarschaften.
Das vierte Kapitel entfaltet eine politische Neukonzeption von Gegenwart mithilfe von Michel Foucaults marginalem Begriff der »infinitiven Gegenwart«. Aus ihm erwachsen die sechs Komponenten der Gegenwart der präsentischen Demokratie: Werden, Dauer, Unbestimmtheit, Wiederholung, Sprung und Organisation.
Das fünfte Kapitel entwickelt das Konzept der konstituierenden Macht der Multitude bei Antonio Negri weiter, aus der eine demokratische soziale Revolution entsteht, die die Frage von Reproduktion und Sorge neu stellt. Die vielfältigen diskontinuierlichen Zyklen der spanischen Demokratiebewegung werden in ihren queer-feministischen Färbungen aktualisiert – von den Platzbesetzungen der 15M-Bewegung bis zur munizipalistischen Bewegung der Regierung der Rathäuser.
Für die abschließende Konzeptualisierung präsentischer Demokratie zeichnet das sechste Kapitel die moderne Genese der Figur des autonomen Individuums nach, ihre Verstrickung in Schulden und ihre Abgrenzung von Sorgebeziehungen. Diese maskulinistische Figur prägt die Regime der Prekarisierung sowie die Geschlechterverhältnisse bis heute und erschwert die positive Belegung von Prekärsein und sozialer Verschuldung. Sie ist zutiefst verstrickt in die Allianz von Kapitalismus und Rassismus, was sich bis in die Ursachen der Finanzkrise von 2008 zeigt. Stehen dagegen Sorgepraxen und ein schwarzes und queeres Verständnis von Schulden im Zentrum, zeigt sich die Demokratie im Präsens.
241
Rousseau
Versammlung statt Repräsentation
Die Form von Demokratie, die wir heute als selbstverständlich betrachten, ist das Ergebnis von Auseinandersetzungen und Kämpfen, die sich im 18. Jahrhundert in Europa zuspitzten. Es waren Kämpfe um Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen, die sich seit dem 17. Jahrhundert auch in Rechtskodizes manifestierten. Die englische Habeas-Corpus-Akte aus dem Jahr 1679, die das Recht einer*s Verhafteten auf unverzügliche Haftprüfung durch einen Richter festschrieb, gilt in der europäischen Freiheits- und Rechtsgeschichte als entscheidender Schritt zu einer rechtsstaatlichen Verfassung: einer juridisch konstituierten Macht.[1] Zehn Jahre später wurden in der Bill of Rights die Rechte des englischen Parlaments festgeschrieben, 1787 wurde die US-amerikanische Verfassung mit den Anfangsworten »We, the people« verabschiedet und 1789 sollten im Verlauf der Französischen Revolution in der Erklärung der universellen Menschen- und Bürgerrechte die individuellen Rechte jeder einzelnen Person garantiert werden.
Die ersten bürgerlichen Verfassungen gehören allerdings zur Geschichte der Sieger, der besitzenden Männer, und nicht zu der der Frauen, der Bauern, der Sklav*innen und all derjenigen, deren Kämpfe nicht dermaßen erfolgreich waren, dass sie sich konstitutionell niederschlugen. Es waren Kämpfe, wie jene in den Federalist Papers von 1787/1788 im Zuge der US-amerikanischen Verfassungsgebung, in denen um die Notwendigkeit der Repräsentation des people, des demos gestritten wurde. Die Vertreter der repräsentativen Demokratie, die eine bundesstaatliche, präsidiale Exekutive favorisierten, setzten sich gegen die Verfechter einer Konföderation durch. Demokratie wurde als »Tyrannei der Mehrheit« diskreditiert, die Republik als gerechtere repräsentative Form dagegengestellt.[2] 1791 gab Olympe de Gouges ihre Erklärung der Rechte der 25Frau und Bürgerin in Druck, in der sie gegen die männlichen Privilegien protestierte, die durch die Französische Revolution in Verfassungsrang erhoben werden sollten. Sie bezeichnete das neue bürgerliche Regime als »Tyrannei« der Männer und verlangte in ihrer feministischen Verfassungsschrift eine neue egalitär-revolutionäre Konstitution.[3] Ohne auch nur eine Verfassungsänderung erreicht zu haben, wurde sie zwei Jahre später durch die Guillotine hingerichtet. Im gleichen Jahr, als de Gouges’ revolutionär-feministische Erklärung erschien, begann – inspiriert von der Revolution in Frankreich, die Menschen- und Bürgerrechte versprach – in der französischen Kolonie Saint-Domingue die haitianische Revolution der Sklav*innen. Erst dreizehn Jahre später, 1804, konnte die napoleonische Armee besiegt und die Republik Haiti durch seine nun freien schwarzen Bürger ausgerufen werden. Es war der erste unabhängige Staat in Lateinamerika.[4] Auch in Haiti waren die Bürgerrechte nur Männern vorbehalten.[5] Doch schon die Ermächtigung der schwarzen Männer war nicht nur für die damaligen weißen französischen Bürger eine »undenkbare Geschichte«, die in der europäischen Siegerhistorie bis in die Gegenwart bagatellisiert wird.[6]
Nur die aus den »westlichen« Revolutionen hervorgegangenen US-amerikanischen und französischen Verfassungen der männlichen und weißen Bürger gelten in der politischen Theorie als entscheidende Ereignisse zur demokratischen Implementierung von allgemeinen Normen wie Freiheit und Gleichheit. Auch wenn diese nicht für alle galten, war – so die dominante Erzählung – 26mit den jeweiligen Verfassungen ein konstitutioneller Anfang einer bürgerlichen Gesellschaft gemacht, der mit dem Fortschrittsversprechen verbunden werden konnte, dass Demokratie sich verändert und auch auf diejenigen ausgeweitet werden kann, die am Anfang nicht gemeint waren, nicht gezählt und nicht vertreten wurden, denen die Demokratie nicht zugetraut wurde, wenn es um Rechte und Partizipation, um Freiheit und Gleichheit ging. Einem verbreiteten Verständnis von demokratischer Entwicklung zufolge zeigt die Geschichte, dass obwohl die Konstitutionen des 18. Jahrhunderts voller Ausschlüsse und voller Legitimationen von Domestizierung und Hierarchisierung waren, die anfänglich Ausgeschlossenen in den folgenden Jahrhunderten für ihre fortschreitende Inklusion kämpfen konnten.[7] Repräsentative Demokratie ist in diesem Verständnis dynamisch, nicht ein für alle Mal bestimmt, sie verändert sich aufgrund gesellschaftlicher Transformationen und Auseinandersetzungen. Es ist ein Verständnis von repräsentativer Demokratie, dem nicht nur Europa und der »Westen« als Maß von Fortschritt und Entwicklung eingeschrieben sind, sondern auch weiße und maskulinistische Vorherrschaft. Das Paradigma dieses Fortschrittsverständnisses ist noch immer dermaßen hegemonial, dass die grundlegenden Parameter liberaler Demokratie – wie Repräsentation, ›Volk‹ oder die Figur des autonomen Individuums – bis heute nicht ausreichend dekonstruiert wurden, um den bürgerlichen Herrschaftsrahmen nachhaltig aufzubrechen.
Stellen wir deshalb erneut grundlegende Fragen: Wenn Demokratie die Macht oder Herrschaft des demos meint, was bedeutet es, dass der demos (selbst) herrschen soll? Ist der demos das ›Volk‹? Wer gehört dazu und wer nicht? Wie soll diese Form der (Selbst-)Regierung vonstattengehen? Wer soll wie partizipieren? Sollen alle, die als Bürger gelten, direkt teilnehmen oder vermittelt über Repräsentation? Wer war der demos im 18. Jahrhundert und als was galten all die anderen, die nicht dazugehörten und dennoch regiert werden mussten? Wie konstituieren die aus der Politik Ausgeschlossenen die Parameter der rechtlichen Verfasstheit einer bürgerlichen Ge27sellschaft? Lässt sich die einmal festgelegte Verfassung durch kontinuierliche Inklusion der Ausgeschlossenen aufbrechen? Oder muss die maskulinistische Verfasstheit nicht vielmehr grundlegend und als zugrunde liegende Strukturierung infrage gestellt werden?
Zur Legitimation von Demokratie als Herrschaft und Selbstregierung des demos wurden in der modernen europäischen politischen Philosophie vielfältige Überlegungen angestellt. Die zentrale Frage von Demokratie war schon in der Zeit der Aufklärung nicht nur die nach der Selbstregierung des demos, sondern auch jene, in welcher Form die ungezählten Vielen vom Aufstand abgehalten, beherrschbar und regierbar gemacht werden können. Die Zerstreuten und schwer Regierbaren, jene, die den Herrschenden immer wieder als bedrohlich und tendenziell unbeherrschbar erschienen, wurden in der Geschichte der politischen Theorie nicht selten mit dem lateinischen Wort multitudo bezeichnet, im Französischen und Englischen als multitude, Vielheit.
Ein wiederkehrender Topos, der die Auseinandersetzungen seit den Kämpfen um bürgerliche Verfassungen durchzieht, ist der des Verhältnisses von Zahl und Versammlung. Wer zählt, wenn der demos sich versammelt? Wer zählt zum demos? Wer zählt nicht dazu? Ist der demos überhaupt zählbar? Als ideale Praxis der Selbstregierung des demos gilt in der politischen Philosophie jene Praxis, die aus der griechischen Antike bekannt ist: Alle freien Bürger einer Stadt oder eines Reiches versammeln sich auf dem Marktplatz, debattieren und entscheiden über die gemeinsamen Angelegenheiten. Doch als im 18. Jahrhundert um die Aktualisierung dieser Form der (Selbst-)Herrschaft gestritten wurde, überwogen die Zweifel an der Umsetzbarkeit einer »direkten« oder »absoluten« Demokratie für größere Staatsgebilde. Der demos der Bürger galt allein schon aufgrund seines zahlenmäßigen Umfangs als nicht versammelbar und damit als nicht unmittelbar in der Lage, sich selbst zu regieren. Doch wenn der Bürger sich nicht selbst regieren konnte, drohte er in der Multitude verloren zu gehen unter jenen, die gar nicht gezählt wurden, wenn es um die Bürgerversammlung ging: die Frauen, die Kinder, die Armen, die Sklav*innen und die Fremden, die nicht in der Lage waren, als ein souveränes Subjekt zu agieren.[8]
28Diese Fragen zur Zahl des demos, bei denen es um die Möglichkeit seiner Versammlung oder die Notwendigkeit seiner Repräsentation geht, verdecken ein weiteres Spannungsverhältnis, das die Debatten um Formen von Demokratie durchzieht, aber selten in den Vordergrund gerückt wird: jenes zwischen dem vereinten ›Volk‹ der männlichen Bürger und all den heterogenen Vielen der Multitude. Mit der Fokussierung auf das Verhältnis von ›Volk‹ und Multitude geht es mir weniger darum, einen Beitrag zu den Debatten um Masse und Macht zu leisten, als um die Analyse von vergeschlechtlichten Konstruktionen von Volkssouveränität, den grundlegenden politischen Formationen der bürgerlichen Gesellschaft und den damit einhergehenden Formen von Demokratie als der Herrschaft des demos.
Im Absolutismus hatte schon Thomas Hobbes wesentliche Aspekte seiner angstgetriebenen Staatstheorie in Abgrenzung zu einer bedrohlichen multitudo im »Naturzustand« verfasst, vor der die politische Ordnung der Repräsentation schützen muss, die diese aber fortwährend bedroht. Der multitudo entspricht die »natürliche Freiheit« vor der Repräsentation und vor dem Staat.[9] Als negative Folie für das Prinzip des Eigenen und Einen existiert die multitudo ohne bestimmte Zahl und ohne klares politisches Ziel. Hobbes versteht sie als zerstreut und unregierbar. Sie lässt sich nicht durch Gehorsam und Repräsentation im Leviathan vereinen, sondern führt zum Aufruhr im politischen Körper, macht ihn krank und kann ihn sogar zerstören. »Eintracht ist Gesundheit, Aufruhr Krankheit und Bürgerkrieg Tod.«[10] Aber nicht nur die nicht vereinheitlichten Zerstreuten an sich waren dem ersten modernen Sicherheits- und Staatstheoretiker eine Bedrohung der Souveränität, sondern auch deren Austausch in unkontrollierten Zusammenkünften, die immer der Verschwörung gegen die Repräsentation verdächtig waren. Hobbes warnte vor den irregulären politischen Bewegungen der multitudo: »Unregelmäßige Vereinigungen sind ihrer Natur nach 29nur Bündnisse oder bisweilen bloße Volksansammlungen, ohne zu einem bestimmten Zweck vereint zu sein, und kommen nicht durch gegenseitige Verpflichtung, sondern allein durch die Ähnlichkeit von Willen und Neigung zustande.«[11] Die multitudo versammelt sich ohne Zweck, ist durch Neigung und Affekt verbunden, zum Aufstand gegen die Souveränität bereit. Nicht politisch und juridisch gebändigt, wird sie als potenzieller Bürgerkrieg, als Krieg aller gegen alle konstruiert, um die Angst der Einzelnen vor der schutzlosen Verwundbarkeit mit der Angst vor einem bedrohlichen, das Eigentum zerstörenden Anderen zu verbinden. Der bedrohliche Austausch der multitudo in der unregierbaren Ansammlung korrespondiert mit der als tödliche Bedrohung fantasierten Abhängigkeit von Anderen im »Naturzustand«. Hier muss das Individuum ein unsicheres, prekäres Leben führen, dem Anderen schutzlos ausgeliefert und ohne bürgerliche Rechte.
Die multitudo zur Legitimation politischer Herrschaft als Schreckensszenario des unregierbaren Austauschs zu konzipieren, zieht sich durch die abendländische politische Theorie und prägt bis heute das dominierende Verständnis von Demokratie. Es ist ein Szenario, das zutiefst vergeschlechtlicht ist und ausschließt, was als fremd betrachtet wird. Hobbes’ sicherheitszentrierte Staatstheorie stellt das erste moderne Versprechen dar, dass Gesetz und Souverän Schutz vor diesen Sorgen garantieren. Die Konstruktion des ursprünglichen Naturzustands dient als Voraussetzung für einen juridischen Sicherheitsstaat, der die gefährliche Gleichheit und Freiheit der multitudo beendet und Ungleichheit durch das bürgerliche Gesetz und den Leviathan legitimiert.[12] Der auf diese Weise vor (gewaltsamer) Umverteilung (im Naturzustand) geschützte Einzelne soll schließlich von anderen unabhängig werden, indem er nicht mehr gleich mit ihnen ist. In der Ungleichheit und Selbstunterwerfung unter den Gesellschaftsvertrag wird zugleich das Eigentum geschützt.[13] Hobbes löst die besorgniserregende Verbundenheit im Naturzustand zugunsten des individualisierten Schutzes im bürger30lichen Gesellschaftsvertrag auf, der individuelle Freiheit und Eigentum als patriarchales Recht sichert.[14]
Die Konzeption der modernen politischen Demokratie basiert auf dieser Aufteilung zwischen dem zusammengeschlossenen vereinheitlichten ›Volk‹, das sich repräsentieren lässt, auf der einen Seite und der sich bedrohlich ansammelnden Multitude, den heterogenen Vielen, den nicht in der Einheit Gebändigten auf der anderen. Es handelt sich um die Unterscheidung zwischen denen, die im Rahmen einer juridischen Ordnung zur bürgerlichen Selbstregierung (mittels Repräsentation) fähig sind, und denen, die sich unkontrolliert ansammeln, austauschen, verbinden, die zum Aufruhr neigen und regiert werden müssen. Obwohl von der Bürgerschaft ausgeschlossen, existiert die unberechenbare Multitude in der Logik der traditionellen politischen Theorie nicht jenseits der Staatsgrenzen. Sie birgt im Inneren der Ordnung die Gefahr 31von revolutionären Zusammenrottungen, von wildem Diskutieren und Feiern, von Aufruhr und Bürgerkrieg. In Abgrenzung zu dieser imaginierten Bedrohung konstituiert die politische Theorie den juridisch maskulinistischen populus seit der Antike, und dies prägt noch die Debatten um die moderne Volkssouveränität.[15]
Um im 18. Jahrhundert politische Repräsentation als unabdingbar zu begründen, wird die Multitude für die moderne Demokratie immer wieder in doppelter Weise als zu zerstreut dargestellt: Zum einen sind die zu ihr gehörenden männlichen Bürger zu viele und zu sehr auf einem Territorium verteilt, um eine Versammlung möglich erscheinen zu lassen. Aufgrund ihrer Verteilung wird ihnen die direkte Mitbestimmung an der Aufteilung des Raums, an der Gestaltung von Politik, Recht und Ökonomie verwehrt. Die antike Idee der Versammlung der freien Bürger trifft auf die Problematik der Regierung einer Bevölkerung, jener Vielen, die über ein Territorium zerstreut sind.
Die Multitude wird aber auch aus einem anderen Grund als zu zerstreut verstanden: Sie wird als zu emotional bewertet. Demokratische Praxen – so wird unterstellt – können die heterogenen Vielen nur als Stimmung, als Leidenschaft, als affektive Zerstreuung ausüben; es mangelt ihnen an Sammlung, Beherrschung und Vernunft. Für die Vertreter der repräsentativen Demokratie birgt die umfassende Teilhabe der Multitude die Gefahr von wechselseitigem Affekt, Austausch und Aufstand, ihre Zerstreutheit muss durch Repräsentation gebändigt werden.
Im 18. Jahrhundert wurde heftig darum gestritten, ob sich der nationale, kulturalistische und patriarchale demos der bürgerlichen Hausväter in einem großen Staatsgebilde wie Frankreich oder in einem noch größeren wie den USA für politische Entscheidungen auch ohne Repräsentation versammeln kann oder muss. Die Befürworter der Repräsentation – wie John Locke, Montesquieu, James Madison und Alexander Hamilton – plädierten mit unterschiedlichen Gründen dafür, dass die Bürger sich durch Parlament und Abgeordnete vertreten lassen müssen.[16] Um der Gefahr einer 32»Tyrannei der Mehrheit« (Madison) und von Aufständen des ungebändigten demos als Multitude entgegen- und dennoch für eine Pluralität der Interessen einzutreten, galt für die amerikanischen Föderalisten die repräsentative Demokratie als einzig mögliche Herrschaftsform des people, de facto die Regierung der Minderheit über die Mehrheit, der Besitzenden über die weniger Besitzenden und Armen, der bürgerlichen Männer über die Frauen, der Weißen über die Schwarzen. Die föderalistischen Gründer der USA sahen in der Teilhabe und Affizierung der Multitude die Stabilität des Gemeinwesens bedroht; demokratische Leidenschaften sollten nicht unmittelbar und ungelenkt das politische Tagesgeschäft bestimmen.[17]
Einige Jahrzehnte vor den Federalist Papers und vor der Französischen Revolution, aber bereits inmitten der Auseinandersetzungen darum, wie eine bürgerliche Selbstregierung konzipiert werden kann, rückt Jean-Jacques Rousseau dezidiert von der Notwendigkeit politischer Repräsentation zum Zweck der Vereinigung des demos und der Bändigung der Multitude ab. Rousseau sieht sich in seinem Gesellschaftsvertrag zu einer unmissverständlichen Gegenrede veranlasst. In seiner eigenwilligen, repräsentationskritischen Position schlägt er sich aber nicht einfach auf die Seite der nicht repräsentierbaren Multitude. Zwar sind aus seiner Perspektive die (männlichen) Bürger zunächst Teil der Multitude, die er entsprechend seinen politisch-theoretischen Vorgängern ebenfalls als unzählbar, unbestimmt und im politischen Sinne als »blind«[18] versteht. Doch wenn die Bürger sich versammeln und so in gewis33sem Sinne aus der Multitude heraustreten, spielt für Rousseau die Anzahl der Versammelten keine Rolle. Sobald die Bürger versammelt sind, können sie ohne Repräsentanten den Souverän bilden. Die Zerstreutheit der Bürger auf einem Territorium ist für ihn kein Verhinderungsgrund für ein Zusammenkommen. Gegen seine zeitgenössischen Kritiker verweist er auf die römische Republik, in der es trotz ihrer zahlenmäßigen Größe auch gelungen sei, »das Volk von Rom« oft und regelmäßig zu versammeln.[19]
Rousseau weiß, dass zum populus in Rom nur jene Männer gehörten, die das Bürgerrecht hatten: Nur sie sind relevant für die Frage nach der Größe des ›Volkes‹, die die Debatten um mögliche oder unmögliche Versammlungen der Bürger bestimmt. Er ist sich vollkommen darüber im Klaren, dass in Rom noch viel mehr Menschen lebten: nicht nur diejenigen, die (noch) kein Bürgerrecht erhalten hatten – es aber potenziell erhalten konnten (wie freigelassene Sklav*innen und Bürger*innen besiegter Gemeinden[20] ), sondern auch »Unterworfene, Fremde, Frauen, Kinder und Sklaven«.[21] In dieser genauen Aufzählung der Ungezählten nennt er diejenigen, von denen er weiß, dass sie neben dem populus in Rom leben. Diese vielen Anderen ohne Bürgerstatus tauchen im Gesellschaftsvertrag immer wieder auf und gehören, je nachdem ob sie unbestimmt oder bestimmt sind, entweder zur multitude oder zur Gesellschaft. Nie gehören sie aber zum Souverän, nie zu denen, die politisch agieren und sich Gesetze geben können.
Es ist oft hervorgehoben worden, dass Rousseau kein konsistentes Theoriegebäude vorgelegt hat, dass die widersprüchlichen Interpretationen in seinen Texten selbst angelegt seien, vor allem, weil sie das Verhältnis zwischen Individualismus und Kollektivismus nicht deutlich genug machten, ebenso wenig wie jenes zwischen 34dem Partikularen und dem Allgemeinen.[22] Anders als diese Lesarten haben feministische Rousseau-Lektüren in unterschiedlicher Weise die für alle seine Werke grundlegende heteronormative Geschlechterdifferenz herausgestrichen.[23] Die Dichotomien, die sein Werk durchziehen, weisen zum Teil gerade aufgrund seiner derart vergeschlechtlichten politischen Theorie Inkonsistenzen auf. Am Beginn der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft wird in Rousseaus Schriften deutlich, welche theoretischen Widersprüch35lichkeiten in Kauf genommen wurden, um Frauen und Nicht-Bürger*innen aus der Sphäre des Politischen herauszuhalten. Der politisch agierende, souveräne peuple, der in der Lage ist, sich selbst Gesetze zu geben, verkörpert alles andere als die volonté générale, den allgemeinen Willen, sondern ist zutiefst maskulinistisch reduziert und selbst partikular.





























