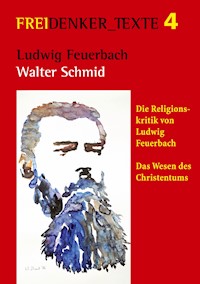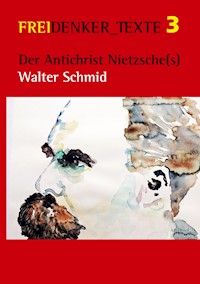
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: FREIDENKER_TEXTE
- Sprache: Deutsch
Friedrich Nietzsches Gedanken beeinflußten nicht nur die europäische Philosophie massiv. Nietzsche war ein "Freigeist", der dem Christentum und anderen "gottgegebenen" Religionen nur Verachtung entgegenbrachte. Seine Abrechnung mit dem Christentum ist in seinem Werk "Der Antichrist" verschriftlicht, das nicht umsonst den Untertitel "Fluch auf das Christentum" trägt. Die Figur des Antichristen hat eine lange Tradition. Nietzsche sieht sich selbst und seine Philosophie in dieser Tradition. Dies soll u. a. anhand vieler Stellen aus "seinem" Antichrist aufgezeigt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 53
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Antichrist Nietzsches(s)
Die Schwaben sind die besten
Lügner in Deutschland.
(F. Nietzsche)
Für Nietzsche heißt Gott töten:
selber Gott töten – das heißt:
schon auf Erden
das ewige Leben verwirklichen,
von dem das Evangelium spricht.
(A. Camus)
Inhaltsverzeichnis
Prolog (aber nicht im Himmel!!)
Nietzsches Antichrist
Fazit
Zur Aktualität des Antichrist
Zitierweise
Literatur
Appendix
Wille zur Macht
Der Antichrist – Kapitel 48
Die Fröhliche Wissenschaft – Kapitel 125
Prolog (aber nicht im Himmel!!)
Nietzsche ist so etwas wie das “Schmuddelkind” unter den Philosophen. Und mit solch einem soll man ja, so zumindest Franz-Josef Degenhardt, nicht spielen, also, auf Nietzsche bezogen, sich nicht mit seiner Philosophie beschäftigen.
Das “Warum” begründen die selbsternannten Verfechter der political, hier: philosophical correctness mit der angeblichen Frauenfeindlichkeit sowie dem angeblichen Antisemitismus Nietzsches.
Als Beispiel für seine “Frauenfeindlichkeit” wird immer wieder die wohl berühmteste Sentenz aus “Also sprach Zarathustra” bemüht, die da lautet: »“Du gehst zu Frauen?« Vergiss die Peitsche nicht! — “« (Za I, Weiblein) Übersehen wird dabei, daß es »Frauen« und nicht “Weiber” heißt, zudem stammt dieser Spruch im Zarathustra von einem alten Weiblein, die Einleitung des Satzes lautet: »Und also sprach das alte Weiblein«.
Ein weiterer “Grund”, vom “Schmuddelkind” Nietzsche die Finger und anderes zu lassen, ist sein angeblicher Antisemitismus.
Nietzsche hat aber, wenn man eine Gesamtschau seines umfangreichen Werkes unternimmt, eine eindeutig ablehnende Haltung gegenüber dem Antisemitismus eingenommen, der zu seiner Zeit als politische Bewegung aufkam. In Jenseits von Gut und Böse schreibt er beispielsweise, es wäre »vielleicht nützlich und billig, die antisemitischen Schreihälse des Landes zu verweisen.« (JGB Nr. 251) Wenn das nicht eindeutig ist! Auch beim Bruch mit Freunden spielte für Nietzsche deren Antisemitismus keine untergeordnete Rolle. In seiner Schrift Nietzsche contra Wagner, gemeint ist der Komponist Richard Wagner, heißt es: »Ich vertrage nichts Zweideutiges; seitdem Wagner in Deutschland war, kondeszentierte er Schritt für Schritt zu allem, was ich verachte — selbst zum Antisemitismus ... « (NcW, Wie ich von Wagner loskam, Nr. 1)
In einem Fragment Nietzsches, verfaßt zwischen Ende 1886 und Frühjahr 1887, heißt es: »Neulich hat ein Herr Theodor Fritsche aus Leipzig an mich geschrieben. Es giebt gar keine unverschämtere und stupidere Bande in Deutschland als diese Antisemiten. Ich habe ihm zum Danke einen ordentlichen Fußtritt versetzt. Dieses Gesindel wagt es, den Namen Zarathustrain den Mund zu nehmen.« (KSA 12, S. 321)
Eine nicht unbedeutende Rolle für die Sicht auf Friedrich Nietzsche als Antisemit spielte seine Schwester Elisabeth, die sich Adolf Hitler andiente, und deren sehnlichster Wunsch, mit Hitler zusammentreffen zu können, in Erfüllung ging. Sie gab eine Kompilation von Nietzsche-Zitaten unter dem Titel Der Wille zur Macht heraus, die eindeutig dazu dienen sollte, die Philosophie ihres Bruders den Faschisten “schmackhaft” zu machen.
Walter Kaufmann schreibt in seinem Buch Nietzsche: Philosoph
– Psychologe - Antichrist (S. 2 f.):
Während der Autor des Antichrist [sc. Friedrich Nietzsche; W. S.] unheilbar krank im Hause seiner Mutter dahindämmerte, stellte unter demselben Dach seine Schwester [sc. Elisabeth Förster-Nietzsche; W. S.] ihre bemerkenswerten propagandistischen Fähigkeiten in den Dienst jenes teutonischen »Christentums« und des chauvinistischen Rassismus, die Nietzsche als »Herzenskrätze« (FW § 377; MA, VM § 304) verabscheut, und um derentwillen er Wagner und – seine Schwester so heftig angegriffen hatte. Ihr Mann, Bernhard Förster, war einer der führenden Leute der deutschen antisemitischen Bewegung gewesen, veranlaßt durch die wachsende Flut des Kolonialismus, hatte das Paar in Paraguay eine teutonische Kolonie gegründet. Nun, da Förster durch Selbstmord geendet hatte, verwendete sie ihre Zeit teils für geschäftliche Aktivitäten in Südamerika, teils für propagandistische Bemühungen zuhause. Sie versuchte, aus ihrem Mann einen Nationalhelden zu machen, freilich ohne Erfolg. Sie provozierte mit diesem Versuch nur immer heftigere Angriffe von ernüchterten Kolonisten, die glaubten, daß die Försters sie betrogen und ruiniert hätten. Da merkte sie plötzlich, daß inzwischen der Stern ihres Bruders seinen steilen Aufstieg begonnen hatte – und Frau Förster verwandelte sich in Elisabeth Förster-Nietzsche, wurde ihres Bruders Erzjünger und begann, die Nietzsche-Legende zu entwerfen.
Die Interpretationen, die sie von dem Denken ihres Bruders vorlegte, wurden fast überall sofort anerkannt; auch in Büchern, die das Erbe ihres Mannes entschieden verwerfen, wird bis zum heutigen Tage oft versäumt, die Berechtigung ihrer Verquickung dieses Erbes mit dem Nietzsches in Frage zu stellen. Heute würde sie zwar kaum noch ein Autor als eine Interpretin zitieren, auf die man sich berufen kann; aber wenn ihr Einfluß auch unbemerkt bleibt, so ist er nach wie vor sehr groß.
Weil es sich so verhält, hat man Grund zu der Frage, ob sie mit dem Denken ihres Bruders vertraut war, als sie in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts [gemeint sind die Neunziger des 19. Jahrhunderts; W. S.] seine Sache in die Hand nahm. Der Goethe-Forscher und spätere Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, berichtet, sie habe ihn gebeten, ihr “Privatstunden über die Philosophie ihres Bruders” zu geben, und fährt dann wörtlich fort: “Die Privatstunden ... belehrten mich vor allen Dingen über das Eine: Daß Frau Förster-Nietzsche in allem, was die Lehre ihres Bruders angeht, vollständig Laie ist. … [Ihr] fehlt aller Sinn für feinere, ja selbst für gröbere Unterscheidungen; ihrem Denken wohnt auch nicht die geringste logische Folgerichtigkeit inne; es geht ihr jeder Sinn für Sachlichkeit und Objektivität ab. … Sie glaubt in jedem Augenblicke, was sie sagt. Sie redet sich heute selbst ein, daß gestern rot war, was ganz sicher blaue Farbe trug.” Man könnte ihr Werk im Rückblick mit Hilfe eines Zitates aus Nietzsches sarkastischem Urteil über Paulus charakterisieren: durch ihre fruchtbare Tätigkeit als Autorin und Herausgeberin hat sie die Philosophie ihres Bruders “zu einer heidnischen Mysterienlehre umgedreht, welche endlich sich mit der ganzen staatlichen Organisation vertragen lernt … und Kriege führt … foltert … haßt” (NF November 1887 – März 1988; KSA 13, 11 [282].
Ein letztes, nicht unerhebliches Statement zugunsten Nietzsches haben Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in ihrem Werk Dialektik der Aufklärung abgegeben. Dort heißt es in der Vorrede: »[Z]u den unerbittlichen Vollendern der Aufklärung« gehören »Kant, Sade und Nietzsche«.
Friedrich Nietzsche war der Sohn eines Pastors, der jung verstarb. Der Einfluß des Vaters auf den Sohn läßt sich leicht aufzeigen. Im Jahre 1858, also mit 14 Jahren, schrieb Nietzsche (Jugendschriften 1854 – 1861, S. 31):