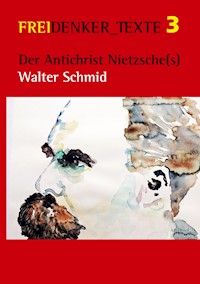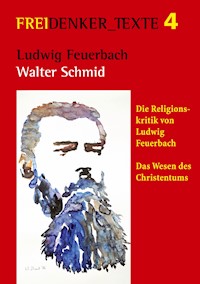
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es wird versucht die Feuerbachsche Religionskritik und die ihr zugrundeliegende Philosophie ihrerseits zu kritisieren und zwar von marxistischer Warte aus. Als Grundlage bieten sich die bekannten elf Thesen von Marx zu Feuerbach an, durch Interpretationen von Ernst Bloch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgeber: Freidenkerinnen & Freidenker Ulm/Neu-Ulm e.V. Postfach 1667, [email protected]
Satz und Gestaltung: Siegfried Späth, [email protected]
Titelseite unter Verwendung eines Aquarells von Walter Schmid
Inhaltsverzeichnis
Herausgeber
Die Religionskritik von Ludwig Feuerbach
1. Die Voraussetzungen
2. Die Religionskritik
3. Die Kritik an Feuerbach
4. Schluß
175 Jahre „Das Wesen des Christentums“
Die Voraussetzungen
Das Wesen des Christentums
»Die sozialen Prinzipien des Christentums
Nachwort
Die Religionskritik von Ludwig Feuerbach
Die Religionskritik von Ludwig FeuerbachVortrag in der Volkshochschule Ulm (20.4.2004)
Die Ausführungen gliedern sich wie folgt:
Zunächst wird versucht, das geistige Klima, in dem sich Ludwig Feuerbach bewegen mußte, zu charakterisieren. Dabei wird notwendigerweise auch die Philosophie Hegels eine gewisse Rolle spielen.
Danach erfolgt die Darstellung der wesentlichen Merkmale der Feuerbach‘schen Religionskritik.
In einem dritten Abschnitt wird versucht werden, die Feuerbach‘sche Religionskritik und die ihr zugrundeliegende Philosophie ihrerseits zu kritisieren, und zwar von marxistischer Warte aus. Es bietet sich an, als Grundlage dazu die bekannten 11 Thesen von Marx zu Feuerbach zu nehmen, wobei ich mich hierzu auf die Interpretation der Thesen durch Ernst Bloch beziehe.
1. Die Voraussetzungen
„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produkduktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“
Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie, MEW 13, 8 f.“
Ludwig Feuerbach wurde 1804 in eine Zeit hineingeboren, der man die Bezeichnung „Biedermeier“ gegeben hat. Der Begriff „Biedermeier“ assoziiert Idylle, eine vordergründige, fadenscheinige Idylle fürwahr, wie wir gleich sehen werden.
Von 1799 bis 1814 überzog Napoleon Europa mit Kriegen, was u. a. zu einer „politischen Flurbereinigung“ im Flickenteppich Mitteleuropa führte. Im „Wiener Kongreß“ 1814/15 sollten die europäischen Fürsten nach dem Sieg über Napoleon die politischen Verhältnisse in Europa neu ordnen. Die deutschen Fürsten widersetzten sich dem Gedanken, ein deutsches Kaiserreich zu gründen: sie wollten selbständig bleiben. So einigte man sich auf die Errichtung des „Deutschen Bundes“, dessen Teilstaaten sich u. a. verpflichteten, ihren Ländern eine Verfassung zu geben. Aber die beiden Großmächte Österreich und Preußen hielten sich nicht an das Verfassungsversprechen. Als Antwort auf die Gründung der deutschen Burschenschaft in Jena am 12. Juni 1815 schlossen der Kaiser von Österreich, der Zar von Rußland und König Friedrich Wilhelm III. von Preußen die sogenannte „Heilige Allianz“ gegen die revolutionären Bestrebungen, was u. a. bedeutete, daß in Preußen Zeitungen, Zeitschriften und Flugblätter nicht „ohne Vorwissen und Genehmigung der Landesbehörden zu Druck befördert werden“ durften. Als am 23. März 1819 Staatsrat August Friedrich Ferdinand von Kotzebue vom Studenten Karl Ludwig Sand ermordet wurde, kam es zu den Karlsbader Beschlüssen: Errichtung einer Zentraluntersuchungskommission in Mainz, Verbot der Burschenschaften, Verfolgung der sogenannten „Demagogen“, Überwachung der Presse und der Universitäten. Diese Beschlüsse wurden 1820 Bestandteil der Wiener Schlußakte und damit der Bundesverfassung.
Seit 1818 hatte Georg Friedrich Wilhelm Hegel als Nachfolger Johann Gottlieb Fichtes den Philosophielehrstuhl in Berlin inne. 1821 erschien seine Rechtsphilosophie unter dem Doppeltitel „Grundlinien einer Philosophie des Rechts“ und „Naturrecht und Staatswissenschaft“, deren Vorrede traurige Berühmtheit erlangen sollte. Rudolf Haym, neben Karl Rosenkranz der zweite zeitgenössische Hegelbiograph, nennt sie eine „wissenschaftlich formulierte Rechtfertigung des Karlsbader Polizeisystems und der Demagogenverfolgung“ und fährt dann fort:
„[G]eradezu [...] macht die Philosophie [Hegels] mit der Polizei gemeinschaftliche Sache, und von Angriff und Anschuldigung schreitet sie zu persönlicher Denunciation und zur Aufhetzung der öffentlichen Gewalten fort.“1
Der berühmteste Satz aus der Vorrede, der Hegel verdächtig machte, preußischer Staatsphilosoph zu sein, lautet: „Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig.“ Das reaktionäre politische System Friedrich Wilhelm III. wird, da real, somit als vernünftig erklärt, und Hegelbiograph Rudolf Haym merkt an: „Die Gottesgnadentheorie und die Theorie von der oboedientia absoluta ist unschuldig und gefahrlos im Vergleich mit der furchtbaren Doctrin, welche das Bestehende als Bestehendes heilig spricht.“2 Bloch nennt den zweiten Teil des Satzes „reaktionär“3. Friedrich Engels hingegen sah das ganz anders.4
1824 kommt Ludwig Feuerbach nach Berlin, um bei Hegel zu studieren. Der Theologiestudent aus Heidelberg wechselt 1825 gegen den Willen des Vaters in die philosophische Fakultät, und damit beginnt, was er später einmal seinen „zweiten Gedanken“ nennen sollte: „Gott war mein erster Gedanke, die Vernunft mein zweiter, der Mensch mein dritter und letzter Gedanke.“5 Mit „Gott war mein erster Gedanke“ spielt Feuerbach auf sein Theologiestudium an, mit „der Mensch mein dritter und letzter Gedanke“ auf seinen anthropologischen Materialismus.
Ab etwa den 1820er Jahren kann man davon sprechen, daß sich eine Hegelschule bildete, die sich nach Hegels Tod 1831 allmählich aufspaltete in Rechtshegelianer und Linkshegelianer. (Die Bezeichnungen stammen von David Friedrich Strauß, einem Zeitgenossen Feuerbachs.) Die Namen der Rechtshegelianer sind heute mehr oder weniger vergessen: Daub, Gabler, Göschel, von Henning, Hinrichs, Marheinke, die der Linkshegelianer sind (zumindest teilweise) bekannt: Bruno Bauer (der „heilige Bruno“), Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Arnold Ruge, Max Stirner (der „heilige Max“), David Friedrich Strauß.
Zum Bruch kam es über die Frage, wie die christliche Religion zu deuten sei. Hegel hatte sie in der Philosophie „aufgehoben“, und der Streit ging darum, was „Aufhebung“ hier bedeuten solle: Bedeutet Aufhebung lediglich, daß Religion aufhört zu existieren, oder aber, daß sie in einem neuen Zustand aufbewahrt, erhalten bleibt, indem sie auf eine höhere Stufe hin“aufgehoben“ wird. Der Rechtshegelianismus hielt den biblischen Bericht für vereinbar mit philosophischer Erkenntnis, der Linkshegelianismus nicht. Allerdings verblieben, außer Marx und Feuerbach, die Linkshegelianer in einer „inneridealistische[n] Kritik an Hegel“6. Bei Feuerbach mündete der Linkshegelianismus in eine fundamentale Religionskritik.
2. Die Religionskritik
Feuerbach betrachtet die Welt von einem sensualistischen Standpunkt aus, will sagen: er leitet alle Erkenntnis aus Sinneswahrnehmungen ab. So heißt es beispielsweise in der „Vorrede zur zweiten Auflage“ von „Das Wesen des Christentums“ aus dem Jahre 1843: „[I]ch brauche zum Denken die Sinne, vor allem die Augen, gründe meine Gedanken auf Materialien, die wir uns stets nur vermittelst der Sinnentätigkeit aneignen können, erzeuge nicht den Gegenstand aus dem Gedanken, sondern umgekehrt den Gedanken aus dem Gegenstande, aber Gegenstand ist nur, was außer dem Kopfe existiert.“ (197)
Von daher erklärt sich das methodische Vorgehen Feuerbachs in seiner Religionskritik, das er folgendermaßen beschreibt: „Ich tue daher der Religion - auch der spekulativen Philosophie oder Theologie - nichts weiter an, als daß ich ihr die Augen öffne oder vielmehr nur ihre einwärts gekehrten Augen auswärts richte, d. h. ich verwandle nur den Gegenstand in der Vorstellung oder Einbildung in den Gegenstand in der Wirklichkeit.“ (26, Vorrede zur zweiten Auflage)
Der erste Gegenstand in der Wirklichkeit, auf den der philosophierende Mensch trifft, ist der Mensch, und damit ist der wirkliche Ausgangspunkt allen Philosophierens nun nicht mehr Gott, sondern eben der Mensch (vgl. 146). Anders ausgedrückt: es geht um „kein abstraktes, nur gedachtes oder nur eingebildetes, sondern ein wirkliches oder vielmehr das allerwirklichste Wesen, das wahre Ens realissimum: den Menschen.“ (21, Vorrede zur zweiten Auflage)
Damit ist gemeint: es geht um den wahren, den wirklichen, den ganzen, den konkreten, den sinnlichen und leiblichen Menschen, und zwar nicht als isoliertes Individuum, sondern um den Menschen in seiner Beziehung zu anderen Menschen, zum Gesamt der Menschen, zur menschlichen Gattung - es geht Feuerbach um den allgemeinen Menschen.
Feuerbach bestimmt Religion allgemein als das „Verhalten des Menschen zu sich selbst, oder richtiger: zu seinem Wesen, aber das Verhalten zu seinem Wesen als zu einem andern Wesen. Das göttliche Wesen ist nichts andres als das menschliche Wesen oder besser: das Wesen des Menschen, abgesondert von den Schranken des individuellen, d. h. wirklichen, leiblichen Menschen, vergegenständlicht, d. h. angeschaut und verehrt als ein andres, von ihm unterschiednes, eignes Wesen - alle Bestimmungen des göttlichen Wesens sind darum Bestimmungen des menschlichen Wesens.“ (54 f.)
„[D]as Wesen des Menschen, abgesondert von den Schranken des individuellen, d. h. wirklichen, leiblichen Menschen“ – das ist nichts anderes als der allgemeine Mensch, der Mensch als Gattungswesen.