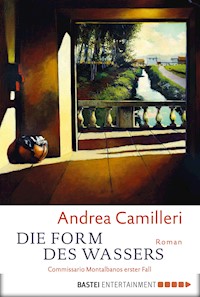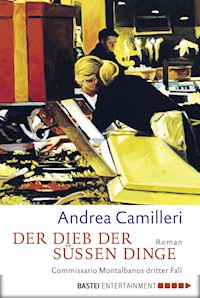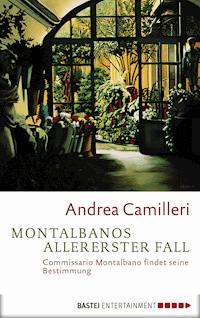8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Metamorphosen-Trilogie
- Sprache: Deutsch
«‹Der Bahnwärter› ist eine leidenschaftliche Parabel auf blinden Schmerz und wahre Liebe.» La Repubblica An der abgelegenen Eisenbahnstrecke zwischen Vigàta und Castellovitrano liegt das Häuschen von Nino, dem Bahnwärter, und seiner Frau Minica. Nur zwei Mal am Tag kommt ein Zug vorbei. Sonntags gibt Nino mit seinem Freund Totò ein kleines Konzert beim Friseur des Ortes, einer auf der Mandoline, einer auf der Gitarre, um sich fünf Lire zu verdienen; oder er klemmt sich zwei Stühle unter den Arm und setzt sich mit seiner Frau ans Meeresufer. Als Minica nach vielen vergeblichen Versuchen endlich ein Kind erwartet, ist das Glück perfekt. Doch mit dem Krieg kommt die Gewalt und zerstört das Idyll. Nun muss Nino um Minicas Leben und um ihre Liebe kämpfen. «Camilleri ist mehr als Montalbano. Seine Fabeln sind faszinierend, geheimnisvoll und voller Liebe, durchwoben von zauberhafter Phantasie.» Liberal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Andrea Camilleri
Der Bahnwärter
Roman
Aus dem Italienischen von Moshe Kahn
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Eins
Die Schmalspurbahn, die von dem winzigen Bahnhof in Vigàta-Cannelle nach Castellovitrano fuhr, dem letzten von dieser Linie angefahrenen Ort, brauchte über einen halben Tag, um ihr Ziel zu erreichen, denn die vorgesehenen Stationen zählten gut zwanzig, gar nicht zu reden von den unvorhergesehenen Unterbrechungen, die durch die Gleise überquerende Schaf- und Ziegenherden erzwungen wurden oder von der einen oder anderen Kuh, die es sich hatte einfallen lassen, zwischen den Gleisen einzuschlafen.
Die Züge, die diese Strecke befuhren, waren wie Zwillingsbrüder: die Dampflokomotive mit dem Kohlewagen, die drei Personenwaggons zog, jeder mit einem Perron, der im Sommer an den Seiten mit grün-rot gestreiften Vorhängen gegen das grelle Sonnenlicht versehen wurde.
Die dritte Klasse mit den hölzernen Sitzbänken bestand aus dem ersten und dem letzten Waggon, während der mittlere Waggon mit den gepolsterten Sitzen aus rotem Samt und den spitzenumsäumten weißen Lätzchen für die Köpfe die erste Klasse darstellte. Eine zweite Klasse gab es nicht.
Jeden Morgen um sechs Uhr fuhr ein Zug von Vigàta ab und genau zur gleichen Zeit einer von Castellovitrano, und nachdem sie sich am Bahnhof von Sicudiana gekreuzt hatten, fuhren sie um zehn Minuten vor eins in die jeweiligen Zielbahnhöfe ein.
Nachmittags um drei fuhr jeder der beiden Züge dann wieder an den Ort zurück, von dem er morgens abgefahren war.
Sie waren ungeheuer langsam. Und zwar so langsam, dass die jüngeren Reisenden im Sommer, wenn die Lokomotive in der Nähe der Scala dei Turchi[1] die Steigung anging, oft die Zeit nutzten, sich auszuziehen – die Unterwäsche hatten sie bereits zuvor gegen ihre Badekostüme eingetauscht –, ein schnelles Bad im Meer zu nehmen und wieder zum schnaubend auf halber Höhe hinaufzuckelnden Zug zurückzukehren, um sich dann auf dem Perron von der Sonne trocknen zu lassen.
Denn die Gleise verliefen, mit Ausnahme eines Stücks von zehn Kilometern, das über Land führte, während der gesamten Strecke fast in unmittelbarer Ufernähe. Und auch auf dem Stück über Land sprangen die Jüngeren herunter und versorgten sich mit dem Obst und Gemüse, das es zur jeweiligen Jahreszeit gab – mal grüne Kichererbsen, mal frische Saubohnen, mal Orangen und Zitronen, dann wieder Mispeln, Trauben und Aprikosen. Die Landbesitzer wurden mitunter äußerst wütend und brachten die Jungen dazu, schnell wieder aufzuspringen, indem sie ein paarmal in die Luft schossen.
Die Reisenden waren fast immer dieselben: Händler, Angestellte, Lehrer, Schüler und Familienangehörige von Knastbrüdern. Die beiden letzteren Gruppen stiegen in Vigàta aus, um dort einen Bus oder einen anderen Zug zu nehmen, der sie nach Montelusa bringen sollte, wo die höheren Schulen waren und das Gefängnis von San Vito.
Unter den Reisenden befanden sich auch Leute aus den Dörfern, die den Zug mit Säcken und Körben bestiegen, um in den größeren Ortschaften Eier, Ricotta, Käse und manchmal auch ein Huhn oder ein Kaninchen zu verkaufen.
Untereinander kannten sie sich alle, und jeder kannte die Heizer und die Zugführer, die auch die Schaffnerpflichten übernahmen.
Gelegentlich fuhren die Züge mit leichter Verspätung ab, weil einer der regelmäßig Reisenden nicht rechtzeitig am Bahnhof war und der Zugführer in Erwartung der Verspäteten das Signal zur Abfahrt noch nicht geben wollte. Das hatte zu dem Brauch geführt, dass man den Zugführern Bescheid gab, sofern man am nächsten Tag nicht mitreisen konnte, damit er nicht vergebens wartete.
Einmal erschien zur Abfahrt um sechs Uhr von Vigàta Don Jachino Marzo nicht, ein Mann von sechzig Jahren, der ein Stoffgeschäft in Sicudiana hatte.
Nachdem der Zugführer zehn Minuten gewartet hatte, fragte er die Reisenden, was er denn nun machen solle. Die Mehrheit war der Ansicht, noch ein bisschen zu warten. Doch Don Aitano Fazio, einer der sieben, die immer in der ersten Klasse mit Don Jachino reisten, machte den Vorschlag, jemand solle zu Marzos Haus gehen, der vier Schritt vom Bahnhof entfernt wohnte, um in Erfahrung zu bringen, was Marzo denn nun tun wolle. Ein Freiwilliger ging hin und kam mit tiefernstem Gesicht zurück: Jachino Marzo war in der Nacht an einem Schlaganfall gestorben. In einem der Waggons der dritten Klasse betete die Lehrerin Iacolino während der ganzen Fahrt gemeinsam mit den Anwesenden Rosenkränze und Gebete für den just Verstorbenen. Am Tag seiner Beerdigung befand sich unter den Kränzen auch einer mit dem Schriftband «In seligem Gedenken von den Mitreisenden im Zug».
Mit Ausnahme der Schüler, die ihren Unterrichtsstoff noch einmal durchgingen, und der Lehrer, die eine Zeitung bei sich hatten, waren die anderen Reisenden keine Leser und verbrachten die Fahrt entweder mit Plaudereien oder mit Kartenspielen.
Daher hatten sich die Reisenden stillschweigend aufgeteilt und sich feste Plätze gesucht, sodass beispielsweise die Kartenspieler sich immer in Vierergruppen gegenübersitzen konnten.
Es gab auch zwei Güterzüge, die auf derselben Strecke fuhren und auch sonst den Personenzügen in fast allem ähnelten, nur dass sie aus einer Lokomotive und fünf Waggons bestanden und ihren Dienst um vier Uhr in der Frühe aufnahmen.
Sonntags waren die Züge nahezu leer, bis auf ein paar Leute, die zum großen Markt in irgendeinen Ort fuhren, oder, wenn die Jagdsaison eröffnet war, ein halbes Dutzend Jäger, die alle an der Station von Vo’ Marino ausstiegen, einem gottverlassenen Kaff, wo es jedoch von Wachteln, Kaninchen und Hasen nur so wimmelte.
Bevor man, von Vigàta kommend, Sicudiana erreichte, gab es drei Stationen, und man begegnete drei Bahnwärterhäuschen. Die ersten beiden befanden sich in unmittelbarer Nähe des jeweiligen Bahnübergangs, das dritte hingegen lag abseits, vor ihm das Schotterbett mit dem einzigen Gleis, dann der Strand und danach das Meer, während sich hinter ihm das offene Land ausbreitete und in einiger Entfernung ein weiteres Haus lag. Wenn der, der für dieses Bahnwärterhäuschen zuständig war, seine Einkäufe im nächsten Ort erledigen wollte, benutzte er eine Lore, die vier Räder und vier Plätze hatte und mit Hilfe von Pedalen betrieben wurde. Sie stand auf einem toten Gleis. Man musste nur die Weichen stellen, und schon befand sich die Lore auf dem Hauptgleis. Jedes Bahnwärterhäuschen hatte eine solche Lore; sie dienten den Arbeitern für die Instandhaltung der Eisenbahnstrecke. Natürlich musste man auf die Zeit achten, zu der man die Lore für die Hin- und Rückfahrt verwendete, wollte man nicht Gefahr laufen, plötzlich einen Güter- oder einen Personenzug vor sich auftauchen zu sehen.
Die Bahnwärterhäuschen wirkten, als wären sie nach Schablone gebaut worden. Gelb angemalt, ein Stockwerk. Im Erdgeschoss befanden sich das Esszimmer, die Küche und die Toilette. Außer der Eingangstür hatte jedes Häuschen ein Seitenfenster. Eine Treppe führte ins obere Stockwerk, wo das Schlafzimmer lag und eine Kammer. Das Schlafzimmerfenster befand sich genau oberhalb der Eingangstür. Neben jedem Bahnwärterhäuschen gab es einen gemauerten Abstellraum, in dem die Instandhaltungsgeräte untergebracht waren.
Die Schmalspurbahn, die in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gebaut worden war, gehörte einem privaten Unternehmen, doch mit Auftreten des Faschismus wurde sie zwangsweise in die Ferrovie dello Stato eingegliedert. Und zu den ersten Dingen, die unter dem neuen Regime geschahen, gehörte die Kündigung von Tausenden von Eisenbahnern, und zwar mit dem Vorwurf, sie wären Kommunisten oder Sozialisten. Nicht selten geschah es, dass die weniger arbeitsaufwendigen und von daher attraktiveren Bahnwärterstellen als Prämien denjenigen Arbeitern oder Handlangern zugesprochen wurden, die sich als Faschisten der ersten Stunde erklärt hatten.
Und so wurde das dritte Bahnwärterhäuschen – das beste, weil man hier nicht einmal die Mühe hatte, die Kurbel zum Öffnen oder Schließen der Schranken drehen zu müssen und sich hinter dem Haus zudem ein Trinkwasserbrunnen befand – dem Kameraden und Exrangierer Concetto Licalzi zugewiesen, der sich dadurch besonders ausgezeichnet hatte, dass er vier seiner Kollegen der kommunistischen Propaganda bezichtigt und somit der faschistischen Polizei ausgeliefert hatte.
Als Concetto Licalzi 1930 das Bahnwärterhäuschen in Besitz nahm, fühlte er sich so, als wäre er ins Paradies gekommen.
Eine Woche darauf zäunte er ein beträchtliches Stück Land ein, ohne den rechtmäßigen Eigentümer um Erlaubnis zu fragen, und legte einen Gemüsegarten an, der es ihm ersparte, Geld auf dem Markt auszugeben. Und mit dem Brunnen fehlte es ihm ja auch nicht an Wasser.
Zwei Jahre darauf arrangierte eine Heiratsvermittlerin für ihn die Ehe mit einem hübschen Mädchen aus Montereale, Àgata Pùrpura. Im Jahr darauf kam ein Junge zur Welt, und sie nannten ihn Benito. Noch einmal zwei Jahre später kam ein Mädchen zur Welt, und sie gaben ihr den Namen Rachele.
Das glückliche Leben des Concetto Licalzi erfuhr zweimal am Tag zu genau festgelegten Zeiten eine leichte Verfinsterung, ausgenommen sonntags. Nämlich am Morgen, wenn der Zug von Castellovitrano bei ihm vorbeifuhr, und am späten Nachmittag, wenn der Zug, nun wieder auf dem Rückweg nach Castellovitrano, erneut bei ihm vorbeifuhr.
Immer am selben Zugfenster, sommers wie winters, stand ein ärmlich gekleideter Mann um die vierzig, der, sobald er ihn vor dem Bahnwärterhäuschen sah, die Brust vorschob und ihm den Römischen Gruß erwies. In der ersten Zeit erwiderte Concetto Licalzi den Gruß der Faschisten. Doch dann fing er an, sich zu befragen, wieso der Mann nicht eine einzige Vorüberfahrt ausließ, ohne dabei jedes Mal diesen Gruß zu wiederholen. Er wusste nicht einmal, wer der andere war.
So überließ er eines Tages seiner Frau die Aufsicht über das Häuschen, machte sich auf den Weg zur Station von Sicudiana und bat den Bahnhofsvorsteher um Auskunft. Und der sagte ihm, dass der bewusste Vierzigjährige Antonio Schillàci heiße, Langusten in Fiacca fange und sie an ein Restaurant in Montelusa verkaufe. So konnte er rechtzeitig noch den Zug erreichen, der um drei Uhr wieder von Vigàta losfuhr.
«Hat dieser Schillàci denn einen Bruder bei der Eisenbahn?»
«Er war selbst mal Eisenbahner. Die Faschisten haben ihn rausgeschmissen.»
Da wurde ihm plötzlich alles klar: Ciccio Schillàci, Antonios Bruder, war einer der vier Kommunisten, die er denunziert hatte. Antonio hatte also herausgefunden, dass er der Verräter gewesen war, und grüßte ihn nun absichtlich mit dem Römischen Gruß, um ihn zu verhöhnen und ihm gewaltig auf die Nerven zu gehen.
Ab sofort erwiderte Concetto Licalzi den Gruß nicht mehr. Dann, eines schönen Morgens, hielt er es nicht mehr aus, nahm die Lore und denunzierte Antonio Schillàci beim Commissario.
Der sah ihn am Ende völlig verblüfft an.
«Zieht er beim Römischen Gruß denn Grimassen, sagt er irgendwelche Dinge?»
«Nein. Er grüßt einfach nur römisch, und basta.»
«O nein, nichts basta!», sagte der Commissario.
«Aber wenn seine Absicht doch die ist, mir auf die Nerven zu gehen, indem er mich verspottet!»
«Das behauptest du. Aber beweis das erst einmal!»
Concetto Licalzi kehrte zurück und schnaubte Feuer aus seinen Nüstern wie ein wütender Stier. Als der Zug nachmittags wieder vorbeikam, stand er mit einem doppelläufigen Jagdgewehr im Arm bereit. In dem Moment, als Schillàci grüßte, schoss er. Er traf ihn nicht, und Schillàci zeigte ihn wegen versuchten Mordes an. Concetto Licalzi verteidigte sich, indem er behauptete, der Schuss habe sich von selbst gelöst. Und der Commissario verfügte Schillàci gegenüber: Wenn der Zug an dem Bahnwärterhäuschen vorbeifahre, habe er die Pflicht, sofern er sich zeigen wolle, sich an dem zum Meer hin liegenden Zugfenster zu zeigen. Wenn ihn dann der Drang überkomme, den Römischen Gruß auszuführen, würden ihn so nur die Möwen bemerken.
Im Juni 1940 erklärte Mussolini Frankreich den Krieg. Und zwei Tage darauf kamen ein paar französische Tiefflieger übers Meer gejagt und bombardierten den gesamten Küstenabschnitt.
An ebendiesem Morgen hatte Concetto seine beiden Kinder genommen, um sie nach Sicudiana zum Arzt zu bringen. Sie starben alle drei im Kugelhagel eines Jagdbombers, der die Lore ins Visier genommen und sie wohl mit wer weiß was verwechselt hatte.
Àgata Pùrpura kehrte mit einer guten Pension ins Haus ihrer Eltern zurück. Nach nicht einmal einem Jahr heiratete sie erneut.
Zum neuen Bahnwärter wurde Pippino Muscarà ernannt, doch der blieb nur bis zum Ende des Jahres 1941 dort, nachdem es ihm endlich gelungen war, zu einem in den Monti Madonie gelegenen Bahnwärterhäuschen versetzt zu werden, genau zwischen zwei Berge. Dort konnte seine Frau Giuvannina endlich ihren Frieden finden: Sie war nämlich auf dem Land bei Enna in achthundert Metern Höhe geboren und dort aufgewachsen; und jeden Tag, den sie in dem Bahnwärterhäuschen am Meer verbracht hatte, war sie von morgens bis abends aufs Dach geklettert, in der festen Überzeugung, dass früher oder später das Wasser steigen und mindestens das gesamte Erdgeschoss überfluten würde.
Im März 1942 kam Nino Zarcuto in besagtes Bahnwärterhäuschen, ein gutaussehender junger Mann von dreißig Jahren mit tintenschwarzen Haaren und Augen. Er konnte nicht mehr den Beruf des Rangierers ausüben, weil seine linke Hand beim Ankoppeln zweier Waggons zwischen die Stoßdämpfer geraten war und er dabei den Ring- und den kleinen Finger verloren hatte.
Aus demselben Grund wurde er auch nicht eingezogen und als Soldat in den Krieg geschickt.
Doch der Unfall hatte ihn nicht daran gehindert, weiterhin wie ein Gott auf der Mandoline zu spielen. Mit seinem engen Freund Totò Cozzo, der ebenso hervorragend die Gitarre spielte, hatte er ein Duo gebildet, das an Sonn- und Feiertagen im Friseursalon des besten Barbiers von Vigàta, nämlich bei Don Amedeo Vassallo, aufzutreten pflegte.
Oft blieben die Kunden noch im Friseursalon, nachdem sie sich hatten rasieren oder die Haare schneiden lassen, um sich weiter an der Musik zu erfreuen.
Als Nino in den Besitz des Bahnwärterhäuschens kam, war er schon seit zwei Jahren mit Minica Oliveri verheiratet, die weder schön noch hässlich war; sie hatte zwar das Gesicht einer gut versorgten Ehefrau, aber sie arbeitete hart. Das Haus glänzte immer wie ein blankgeputzter Spiegel. Sie kochte gut und wusste auch, wie sie den Garten ertragreicher machen konnte. Mehr noch, sie ließ sich von Nino einen Stall neben dem Garten bauen und setzte ein paar Hühner hinein. Auf diese Weise konnten sie stets auch frische Eier essen.
Nino und Minica hatten nur eine einzige Sorge: Der liebe Herrgott schenkte ihnen keine Kinder, sosehr die beiden sich auch übten.
Jeden Sonntagmorgen nahm Nino die Lore und gab mit seinem Freund Totò seine kleinen Konzerte. Wenn er wieder nach Hause kam, war es immer schon dunkel. Und er fand zum Essen alles vorbereitet. Seine Frau nutzte diesen Tag, da sie ihn nicht um sich herum hatte, um ein paar Kleidungsstücke für sich zu nähen, denn auch darauf verstand sie sich, oder um Ninos Sachen zu stopfen: Hemden, Unterhosen oder Socken.
Sie hatte eine schöne Stimme. Und jeden Sonntagabend im Frühling und im Sommer nahmen Nino und Minica, wenn keine Züge mehr vorbeifuhren, zwei Stühle und setzten sich ans Meeresufer. Minica sang, und Nino begleitete sie auf der Mandoline. Danach kehrten sie wieder zu ihrem Häuschen zurück und gaben sich mit großer Lust der Beschäftigung hin, Kinder zu zeugen.
Als sechs Monate vergangen waren und beide sahen, dass es keinen Weg gab, Minica schwanger werden zu lassen, beredeten sich Mann und Frau eines Abends miteinander. Und sie gelangten zu der Einsicht, dass es vielleicht besser wäre, Rat bei einer Wehmutter zu erfragen, die sich auf diese Dinge verstand. Es war ja möglich, dass sie die richtige Behandlung einleiten konnte.
Eines Nachmittags machte Nino sich nach Vigàta auf und kehrte ein paar Stunden später mit Donna Ciccina Pirrò zurück, die siebzig Jahre alt war, das halbe Dorf auf die Welt gebracht hatte und von Pachino in Castellovitrano in höchsten Tönen gelobt worden war.
Die Wehmutter untersuchte Minica von innen und außen und sagte dann:
«Bestens. Bei dir stimmt alles.»
Und während sie das sagte, blickte sie Nino an, als wollte sie ihn fragen:
«Und du? Stimmt bei dir auch alles?»
Auf der Rückfahrt mit der Lore sagte Donna Ciccina, Nino solle sich einmal von einem Arzt untersuchen lassen. Sie riet ihm, zu Dottor Gerbino in Sicudiana zu gehen.
Tags darauf fuhr Nino zu ihm. Er wartete eineinhalb Stunden im Wartezimmer, weil er keinen Termin ausgemacht hatte, dann führte die Arzthelferin ihn ins Behandlungszimmer. Der Anblick des Arztes versetzte Nino in Angst und Schrecken. Er war mindestens einen Meter neunzig groß, wirkte mächtig wie ein Kleiderschrank und hatte einen gewaltigen Bart, der so rot war wie seine Haare.
«Zieh Hose und Unterhose aus!»
Nino lief vor Scham rot an, aber gehorchte. Der Arzt betastete ihn lange und gab ihm dann ein verschlossenes Gefäß mit einem Deckel drauf. Er zeigte auf den Wandschirm und sagte:
«Mach’s dahinter!»
«Was soll ich da machen, Entschuldigung?»
«Wichsen sollst du! Aber Vorsicht, der Samen muss im Gefäß landen!»
Er versuchte es. Aber es wollte nicht klappen.
«Na, was ist?», fragte der Arzt nach fünf Minuten gespannt.
Endlich gelang es ihm, ganz wie Gott es wollte.
«Komm übermorgen wieder!», sagte der Arzt.
Er kam wieder.
«Mein Freund, da kann man nichts machen. Wenn ihr keine Kinder kriegen könnt, dann deshalb, weil du ein Problem hast. Deine Spermien sind schwach und auch viel zu wenig. Und ich bin nicht der Meinung, dass man diese Sache durch irgendeine Behandlung in den Griff bekommen kann.»
Wenn er ihn erschossen hätte, wäre es besser gewesen.
«Und, was hat der Arzt gesagt?», fragte ihn Minica.
Er beschloss, ihr nur die halbe Wahrheit zu sagen.
«Er hat gesagt, wir sollen weiter probieren. Und wenn nichts geschieht, soll ich in sechs Monaten wiederkommen.»
Er fühlte sich nicht in der Lage, ihr gleich die Wahrheit zu sagen. Dazu brauchte er ein bisschen Zeit.
Dass er sich verändert hatte, merkte nur Totò. Und der bohrte und fragte so lange, bis Nino ihn schließlich ins Vertrauen zog.
«Ach, lass dich doch von diesem Dottor Gerbino nicht verrückt machen!»
«Was soll das heißen?»
«Das soll heißen, dass ich einen Freund hatte, der in der gleichen Lage war wie du, und auch ihm hat Gerbino das Gleiche gesagt wie dir.»
«Und was weiter?»
«Dann hat ihm jemand geraten, sich an Signora Pillica zu wenden.»
«Und wer ist das?»
«Eine aus Montereale, die sich auf Kräuter versteht.»
«Wie ist es ausgegangen?»
«Mein Freund ist hingefahren, sie hat ihm ein Heilmittel gegeben, und seine Frau ist mit Zwillingen schwanger geworden.»
«Weißt du, wo sie wohnt?»
«Gleich neben der Kirche vom heiligen Hieronymus.»
Tags darauf fuhr er zu ihr. Im Eingangszimmer saß ein Mann von siebzig Jahren, und die Helferin sah aus wie eine alte Mumie.
«Gnà Pillica ist beschäftigt.»
«Und ich bin jetzt hier!»
«Aber vor Euch ist noch dieser Herr dran.»
«Und ich bin jetzt hier!»
Dieses Mal wartete er zwei Stunden. Endlich war die Reihe an ihm. Er hatte sich vorgestellt, dass er es mit einem alten Kräuterweiblein zu tun haben würde, doch dann erwies sich Signora Pillica als eine elegante, sorgsam zurechtgemachte Fünfzigerin mit einem gewaltigen Busen und einem gewaltigen Hinterteil. Mit einer gewissen Erleichterung betrat er das Zimmer, bis er bemerkte, dass dort kein Wandschirm stand.