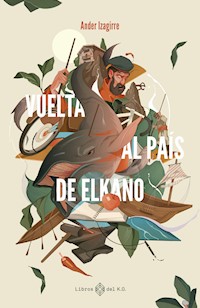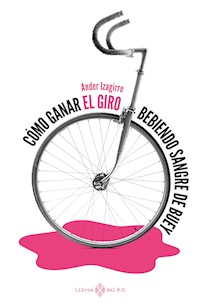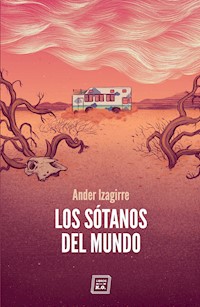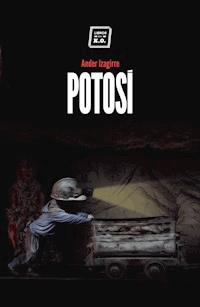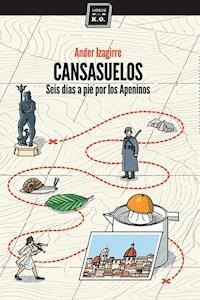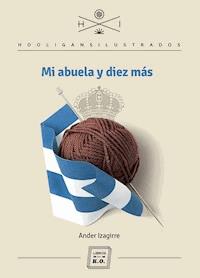Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der rohstoffreiche Berg Cerro Rico de Potosí in Bolivien ist Teil einer globalen Kette, die außergewöhnlichen Reichtum mit bitterster Armut verbindet. Am Anfang der Kette steht ein vierzehnjähriges Mädchen, das in einer Silbermine arbeitet. Für zwei Euro pro Nacht schiebt die Halbwaise Alicia einen Wagen voller Steine durch die unterirdischen Stollen, um die Familie mitzuernähren. Der giftige Staub der Mine schwebt in der Luft, die sie einatmet, und sickert ins Wasser, das sie trinkt. Anhand von Alicia, ihrer Familie und des Ortes, an dem sie lebt, erzählt der anerkannte, investigativ arbeitende Journalist Ander Izagirre die Geschichte des »Rohstoffsegens« in Bolivien: von den Conquistadores, die Mineralien in Sklavenarbeit abbauen ließen, über den Aufstieg einer lokalen Oligarchie im 19. Jahrhundert bis hin zu einer Reihe von Militärdiktaturen, oft installiert mithilfe der USA, um die Rohstoffversorgung des Nordens zu sichern. Izagirre zeigt, wie die Arbeitsbedingungen und fehlende Sicherheitsvorkehrungen in den Minen ein patriarchalisches Gesellschaftssystem hervorgebracht haben, in dem traumatisierte und durch Alkohol betäubte Bergleute erlittene Gewalt an Ehefrauen und Kinder weitergeben. Das Ergebnis ist eine einzigartig fesselnde Mischung aus Memoiren, Reportagen, Reiseberichten und historischen Texten, die an die Sozialreportagen von Ryszard Kapuscinski erinnert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ander Izagirre
Der Berg, der Menschen frisst
In den Minen des bolivianischen Hochlandes
Aus dem Spanischen von Grit Weirauch
Rotpunktverlag
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Dieses Buch wurde durch einen Zuschuss von Acción Cultural Española (AC/E), einer staatlichen Einrichtung, unterstützt.
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel Potosí bei Libros del K.O. in Madrid.
© 2017 Ander Izagirre
© 2022 Rotpunktverlag, Zürich (für die deutschsprachige Ausgabe)
www.rotpunktverlag.ch
Umschlagbild: Cerro Rico Silbermine, Potosí, Bolivien; bennu phoenix / Alamy Stock Foto
Lektorat: Andreas Simmen
Korrektorat: Sarah Schroepf
Umschlag: Patrizia Grab
eISBN 978-3-85869-972-5
1. Auflage
Inhalt
Im Wunderland der Schätze
Der Baron und die Prinzessin
Kurz vor der Explosion
Die Überzähligen
Der Teufel
Dank
Literatur
Für Sara
Im Wunderland der Schätze
»Frauen dürfen nicht in die Mine«, sagt Pedro Villca. »Stellen Sie sich vor, eine Frau geht da hinein. Und dann, wenn sie ihre Blutung bekommt, versiegt die Erzader. Pachamama versteckt das Erz. Aus Eifersucht.«
Villca ist ein sehr alter Bergarbeiter, etwas, was es in Bolivien eigentlich gar nicht gibt. Mit seinen 59 Jahren hat er keinen gleichaltrigen Kumpel mehr. Er lebe noch, sagt er, weil er nie gierig gewesen sei. Nie hat er lange im Bergwerk gearbeitet. Nie »vierundzwanzigerte« er: Das heißt, nie arbeitete er Schichten von vierundzwanzig Stunden am Stück unter Tage. Immer kam er wieder an die Oberfläche, von Zeit zu Zeit kehrte er für einige Monate in das Dorf seiner Eltern zurück, um Kartoffeln anzubauen und Lamas zu hüten, ließ seine Lungen klare Luft atmen, sodass sie sich vom Staub reinigen konnten, und dann ging er wieder in die Grube, aber wenn eine Gaswolke seine Kumpel erstickte oder einstürzendes Gestein sie zerquetschte, war er nie drinnen. Er hat das Gefühl, schon viele Partien mit Gevatter Tod gespielt zu haben, und er will ihn nicht noch mehr herausfordern. Ja, er geht in den Ruhestand. Er schwört, in wenigen Wochen gehe er in den Ruhestand.
Villca ist knapp anderthalb Meter groß. Und selbst er muss sich bücken und gebeugt gehen, um nicht mit dem Helm an die Eukalyptus-Balken des Stollens zu stoßen. Er geht in die Hocke, die Arme dicht am Körper, denn in diesem winzigen Tunnel …
»Was für ein übles Wurmloch!«
… denn in diesem Tunnel, kaum breitet man die Ellbogen aus, berührt man schon die rechte Wand und die linke gleichzeitig, kaum reckt man den Hals ein wenig, stößt man an die Decke. Wir sind im Inneren eines Berges. Um unsere Körper herum sind einige Zentimeter Luft und dann Millionen Tonnen massives Gestein. Am ehesten ist es vergleichbar mit dem Gefühl, lebendig begraben zu sein. Nur dieses eine Loch gibt es, um an die Oberfläche zu gelangen (wenn man es denn schafft, sich zu orientieren in dem Labyrinth aus Gängen, die sich schlängeln, kreuzen, verzweigen, abbiegen, ansteigen, hinabführen; nichts gibt es in den Tunneln, in den Grotten und Seen, kein Licht, keinen Windhauch, kein Geräusch, an denen man erkennen könnte, ob wir zum Leben zurückkehren oder immer tiefer in den Berg vordringen). Man hat den Eindruck, ein Niesen genügt, und der Berg verdichtet sich und dieser enge Stollen, durch den wir auf Händen und Füßen vorwärtskrabbeln, die Wände ertastend wie zwei Insekten, wird zusammengequetscht.
Atmen fällt schwer. In dieser Haltung, so gebeugt, mit den Armen eng am Oberkörper, dehnt sich die Lunge wenig aus. Jedes Einatmen ist ein bewusster Kraftakt: Ich dehne die Nasenflügel und sauge 40 Grad warme Luft ein, die von Feuchtigkeit gesättigt ist und klebrig wie in Terpentin getränkte Watte. Am Gaumen bleibt ein metallischer Geschmack, als würde ich Münzen lutschen. Es ist die copajira, der saure Schweiß der Mine, der an den Wänden entlangrinnt, orangefarbene Schlammpfützen bildet und im Dunst schwebt.
Villca ist in seinem Element. Er amüsiert sich. Setzen wir uns, sagt er, und ich solle das Licht am Helm ausmachen. Dann macht er seins aus. Mit dem Klick überschwemmt mich die Dunkelheit, wie eine dunkle Welle, die mich durch diesen Stollen in die Tiefen des Berges reißt. Ich habe mich nicht bewegt, aber eine Bewegung gespürt. Eine Welle von Schwindel und Übelkeit ergreift für zwei Sekunden mein Gehirn, ich verliere das Gleichgewicht, mir summen die Ohren. Stumm halte ich es aus, denn dieser Mistkerl Villca lacht. Ich atme tief ein und die Halsschlagader pocht in meiner Kehle.
»Verdammt.«
»Mach sie halt wieder an«, sagt er zu mir.
Ich schalte die Lampe ein, suche Villca, sein Schatten zeichnet sich an der Decke ab und breitet sich lang an den Balken aus. Er lächelt.
»Und diese Balken?«, frage ich. Sie sind verfault, verbogen unter dem Gewicht des Berges, einige von ihnen haben bereits Risse bekommen.
»Die callapos. Seit dreißig Jahren werden die nicht ausgewechselt, ein Scheiß ist das. Niemand hat Geld, um in Sicherheit zu investieren, in unserer Kolonne sind wir nur wenige Bergleute und verdienen selbst gerade mal genug, um zu überleben. Wir bauen an einer Stelle ab, beten, dass nichts einstürzt, und dann gehen wir weiter zu einer anderen Stelle.«
Er geht voran. Mit seinen 59 Jahren bewegt er sich leichtfüßig, bückt sich, kriecht auf allen vieren, richtet sich wieder auf, ich bleibe zurück, und als der Stollen eine Biegung macht, sehe ich ihn nicht mehr. Zwanzig Sekunden sind es nur, aber ich bin erleichtert, als ich ihn dann wiedersehe. Wir sind in einem breiteren Stollen angekommen, mit Schienen auf dem Boden, wo wir uns wieder aufrichten können.
»Sie sind gut in Form, Don Pedro.«
Er lacht. »Ich bin noch recht geschickt. Die Kumpel, die noch leben, haben alle die Grubenkrankheit. Viele im Bett. Mein Nachbar kann keine vier Schritte tun ohne seine Sauerstoffflasche. Er geht vom Bett zur Tür und von der Tür zum Bett. Mir geht es gut, Gott sei Dank.«
Er zeigt auf einen schmalen, mit Gestein gefüllten Kamin, den er Briefkasten nennt. »Der ist noch von den Spaniern, aus den Zeiten der Kolonie. Mit Hämmern aus Stein haben die gearbeitet, ab und zu haben wir so einen gefunden. In diesem Gebiet gibt es solche Briefkästen wie den hier, voll mit Gestein, das sie aussortiert haben, weil sie nur das reine Silber herausholen wollten. Von den oberen Ebenen haben sie die Steine runtergeworfen und die Briefkästen haben sie damit aufgefüllt. Aus dem Gestein machten sich die Spanier nichts, wir jetzt schon. Die Steine sind ziemlich wertvoll. Als das hier der Comibol (der staatlichen Bergbaufirma) gehörte, war es verboten, die Briefkästen zu leeren, damit der Berg nicht einstürzt. Jetzt macht jeder, was er will. Manche Trupps sprengen die Briefkästen einfach in die Luft. Und andere tragen die Gesteinssäulen ab, die die Spanier in den großen Kammern gelassen haben. Da muss man aufpassen, wegen der Sicherheit, damit die Decke nicht einstürzt. Aber in den Säulen ist wertvolles Mineral, die Bergleute schlagen es aus dem Gestein raus, schlagen es raus, schlagen es raus, solange es gutgeht. Bis es eines Tages nicht gutgeht.«
Villcas Wangen sind kupferfarben, die Haut ist glatt und straff, aber unter seinen Augen sind tiefe Furchen. Als ob vierzig Jahre Arbeit unter Tage einen Abdruck hinterlassen hätte. Wenn er eine dieser schrecklichen Geschichten erzählt, lächelt er ein wenig beschämt und seine Augen versinken zwischen den Falten, kleine Augen, rot wie Glut, sehr lebhaft.
Sein Sohn Federico begann mit dreizehn Jahren in der Mine zu arbeiten. Eines Tages, als er einem Arbeiter beim Bohren half, stürzte der Boden unter ihren Füßen ein. Sie fielen ein paar Meter tief, von einer Flut von Steinen mitgerissen. Sie konnten wieder zum Stollen hochklettern und rannten los. Sie rannten noch, als ein Lärm im Berg einsetzte und ein Staubsturm sie ergriff und auf den Boden warf. Hinter ihnen stürzte der ganze Stollen ein. Sie schafften es noch, Federico war voller Blut und Staub. Nie wieder wollte er einen Stollen betreten. Er bewarb sich um Arbeit auf der Baustelle, wo er Ziegel und Zementsäcke schleppte, an der frischen Luft.
Ich folge Villca den breiten Stollen entlang, im Glauben, dass es endlich nach draußen geht, hin zu einem anderen Schacht als dem, durch den wir vor zwei Stunden eingestiegen sind, aber wissen kann ich es nicht. Apropos breiter Stollen: Er misst gerade mal zweieinhalb Meter in der Höhe und etwa drei Meter in der Breite. Wir treten im Dunkeln in große und tiefe Pfützen, unsere Lampen werfen gelbe Lichtflecken an die Wände.
Villca sagt: »Der reinste Damenspaziergang ist das.« Und bleibt stehen.
Wir hören das Tropfen,
das Rumoren unter der Erde,
das Murmeln der Felsen.
Villca dreht sich langsam um, vertreibt die Dunkelheit des Stollens mit dem Licht seines Helms und leuchtet auf einmal eine menschliche Gestalt an, die eines Mannes, der an die Wand gelehnt sitzt, mit weit aufgerissenen Augen und einem irren Lächeln. Es ist der Teufel. Die Skulptur eines Teufels aus Ton, mit verdrehten Hörnern und einem breiten Mund, der von einem Ohr zum anderen reicht und in dem ein Dutzend Zigarettenstummel stecken. Mit einem Lächeln tritt Villca näher, zündet eine weitere Zigarette an und steckt sie ihm ins Maul.
»Hier sind wir, Tío.«
El Tío, der Onkel, ist der Geist, der die Tiefen regiert, der Verbündete der Bergarbeiter, der Schutzpatron, der die Pachamama, die Mutter Erde, begattet, damit sie Erzflöze produziert. Wenn er zufrieden ist, werden die Flöze sichtbar; wenn er wütend wird, schickt er Steinschläge. Der Schoß dieses Tío ist mit Zigarettenschachteln bedeckt, mit Fläschchen, in denen reiner Alkohol ist, und einem Durcheinander aus Luftschlangen, Konfetti und Kokablättern, die die Bergarbeiter ihm bei den challas –den Dankesritualen – zuwerfen. Er lächelt, die Beine sind gespreizt, um sein wichtigstes Attribut zur Schau zu stellen: einen großen erigierten Penis.
Villca öffnet eine Halbliter-Flasche Guabirá Buen Gusto, 96-prozentiger, den die Bergarbeiter in ihren Pausen trinken, pur oder mit ein wenig Wasser und Zucker gemischt. Er beugt sich zu dem Mund des Tío und schüttet ihm einen Schuss in den Schlund. Der Alkohol spritzt aus der Spitze seines Penis. Villca bricht in Gelächter aus.
»Einmal kam die Vizeministerin Álvarez zu Besuch, Bergbau-Vizeministerin. Sie haben wir hereingelassen, aber ich habe zu ihr gesagt: Sie müssen ihm das Glied an der Spitze küssen, Señora; damit eine Frau Zugang zur Mine bekommt, muss sie dem Tío zuerst das Glied an der Spitze küssen. Sie hat sich vorgebeugt und es ihm geküsst.«
Villca lacht und geht weiter. An der Kreuzung zu einem anderen Schacht, der unseren diagonal quert, hören wir Stimmen. Er reckt den Kopf hoch und ruft ihnen zu: »Hey, ihr Hurensöhne!« Als wir heraustreten, habe ich Lust, das Licht zu küssen, das Licht zu trinken, das Licht mir auf das Gesicht zu streichen.
Mein Schatten bewegt sich über den Berghang. Er klettert die Felsen hinauf, geht weiter, wächst und schwindet, er wandert den Berg entlang: Der Cerro Rico von Potosí war eine majestätische rote Pyramide, als ich ihn vorgestern von weitem sah; wenn ich ihn heute betrete, ist er eine Trümmerhalde. Der Berg knirscht unter meinen Füßen, es ist, als würden jeden Moment die losen Felsen abrutschen und Gestein mit sich reißen und die Felswand würde einstürzen und das ganze Gebirge achthundert Meter als Lawine abgehen und die Hütten der Wachmänner begraben, dann die höhergelegenen Viertel der Bergarbeiter, dann die Plätze, die Straßen, die Kolonialhäuser, die barocken Paläste der Stadt, und nur die zwei Türme der Kathedrale würden am Ende übrig bleiben und aus einem Meer von Steinen herausgucken.
Nach fünfhundert Jahren Bergbau ist der Cerro Rico ein durchlöcherter Berg. Immer noch werden täglich drei- bis viertausend Tonnen Gestein abgebaut, um Silber, Blei, Zink oder Zinn zu gewinnen. Nach Berechnungen des Geologen Osvaldo Arce befinden sich 47’824 Tonnen Feinsilber im Berg – mehr, als im Laufe der Geschichte abgebaut wurde. Das Problem ist, dass Silber nicht mehr konzentriert in Flözen lagert, sondern in winzigen Adern verteilt ist, in sehr geringen Anteilen, und man müsste den ganzen Berg niederreißen, zermalmen und verarbeiten, um diese Gesamtmenge gewinnen zu können.
Und dazu sind sie anscheinend bereit: Achttausend, zehntausend, zwölftausend Bergarbeiter gehen täglich unter Tage und schürfen weiter. Sie arbeiten für 39 Genossenschaften. Das große Unternehmen Manquiri, das im Besitz eines multinationalen US-Konzerns ist, verarbeitet das Bohrklein und die pallacos – die gigantischen Gesteins- und Kiesablagerungen, die die Bergleute jahrhundertelang wegen ihres sehr geringen Erzanteils nicht nutzten. Mit heutiger Technologie rentiert es sich für das Unternehmen, diese Masse an Nebengestein zu verarbeiten, um die kleinen Anteile an Silber und Zink herauszulösen.
Jede Dynamitsprengung öffnet ein weiteres Loch im Berg. Eine Studie des Bergbauministeriums wies 138 Zonen aus, in denen Stollen einstürzten, einige vor nicht allzu langer Zeit, andere vor Jahrhunderten, sowie viele Stellen in dem Stollenlabyrinth mit hohem Einsturzrisiko. Es gibt immense, verlassene Hohlräume, die aufgrund der Säurekorrosion brüchig werden. Im Jahr 2011 bekam der spitze Berggipfel nach heftigen Regenfällen Risse und innerhalb weniger Tage öffnete sich ein Krater von vierzig Metern Durchmesser und vierzig Metern Tiefe. Der Berg erreicht eine Höhe von 4800 Metern. Oberhalb von 4400 Metern, der am meisten beschädigten Zone, hat die Regierung den Bergbau verboten.
Der Cerro Rico ist unter anderem auch eine Gestalt. Er ist die Pyramide, die sich über der Stadt Potosí erhebt, jene Silhouette, die im bolivianischen Staatswappen auftaucht, auf den Briefmarken, den Postkarten und auf barocken Landschaftsgemälden, ein gigantisches dreieckiges Monument, die Ikone irdischer Reichtümer und göttlicher Mächte. Aber sie droht in sich zusammenzubrechen. In bolivianischen Tageszeitungen geben Kommentatoren ihrer Sorge Ausdruck, das nationale Symbol könnte beschädigt werden. Oder einstürzen – und schon blühen die Metaphern.
Die zehntausend Bergarbeiter kümmern sich derweil wenig um das Staatswappen und steigen jeden Tag in den Berg hinein.
Die Bewohner von Potosí fürchten den Tag des endgültigen Kollapses, die apokalyptische Lawine, die die Geschichte des Cerro Rico besiegelt: In seinem Inneren ruhen die Gebeine, oder der Staub der Gebeine, von Zigtausenden Bergmännern. Seit dem ersten versklavten Indigenen zu Zeiten der spanischen Kolonie bis zu Luis Characayo, dem Bergmann, über den die Tageszeitung gerade schreibt, weil man ihn gestern in einem eingestürzten Stollenabschnitt tot auffand; er starb durch ein schweres Hirntrauma und erstickte. Vom Cerro Rico von Potosí wird gesagt, er sei »der Berg, der Menschen frisst«.
Der Menschen frisst.
Alicia Quispe ist vierzehn Jahre alt. Sie trägt einen blauen Arbeitsoverall mit Rissen, die Ärmel hängen über die Hände hinaus, die Gummistiefel sind ihr zu groß und sie trägt einen Bergmannshelm, einen Bergfrauenhelm. Ihr schwarzes Haar ist in einem Pferdeschwanz zurückgebunden, sie hat mandelförmige Augen und einen stets fliehenden Blick, als ob sie hinter den Leuten etwas sucht.
Man sagte mir, dass sie gleich herauskommt. Es ist sieben Uhr morgens, es ist mein zweiter Besuch auf dem Cerro Rico und ich bin erleichtert, dass ich nicht erneut hineingehen muss, und ich habe ganz und gar nichts dagegen, auf der canchamina, dem Minenvorplatz, zu warten.
Der Minenvorplatz ist eine Esplanade aus grauem Staub in 4400 Metern Höhe neben einem der 569 Schachteingänge in den Cerro Rico, die jüngst für einen Bericht gezählt wurden. Zwei Toyota Corolla der Bergarbeiter befinden sich auf dem Platz, vier leere, umgestürzte Loren – drei von ihnen sind sehr verrostet und wurden anscheinend aufgegeben – und ein Stapel Ersatzschienen, um die durch die Salzsäuren korrodierten oder zu sehr abgenutzten Schienen im Innern des Berges auszutauschen. Auf dem Minenvorplatz stehen auch zwei aus Lehmziegeln gebaute Häuschen mit Wellblechdächern. Das eine ist das Lager für die Werkzeuge der Bergarbeiter, das andere das Haus, in dem Alicia wohnt.
Ich lese in der Tageszeitung El Potosí. Wieder ein Unfall gestern:
Zwei Grubenarbeiter sterben nach Stolleneinsturz
Zwei Grubenarbeiter im Alter von 37 und 41 Jahren starben, nachdem sie im Inneren der Encinas-Mine im Cerro Rico von Potosí unter einer Steinplatte begraben wurden, berichtete der Staatsanwalt des Departements, Fidel Castro. Der tragische Arbeitsunfall ereignete sich, als beide wie jeden Tag Erz schürften, so die vorläufige Untersuchung. »Bedauerlicherweise starben beide durch den Arbeitsunfall: Der eine erlitt ein stumpfes Thoraxtrauma und der andere ein stumpfes Kopftrauma. Soweit wir wissen, gab es einen Einsturz in der Mine, bei dem sie verschüttet wurden«, sagte der Staatsanwalt.
Die Leichen wurden von der forensischen Abteilung der Staatsanwaltschaft und Kräften der Sondereinheit zur Verbrechensbekämpfung (FELCC) geborgen.
Angehörige der Grubenarbeiter übernahmen die Leichen, um sie zu beerdigen.
Nachrichten wie diese finde ich fast täglich: Bergarbeiter, die von herabbrechenden Felsstücken erschlagen werden oder in Förderschächten zu Tode stürzen. Manch einer gerät auch in eine Dynamitexplosion oder sogar in die Stangen der Steinbrechanlage. Zu Dutzenden sterben sie jährlich: Zusammentragen muss man die vielen einzelnen Fälle selbst, aussagekräftige oder gar vollständige Statistiken existieren nicht. Es gibt noch eine andere Art von Fällen, die ich nicht in der Zeitung und auch nicht im Fernsehen oder in Dokumentarfilmen finde –Fälle, über die nicht berichtet wird. Von den Todesfällen durch Staublunge finde ich wenig, von der täglichen Gewalt an Frauen und Kindern, nichts …
Der Berg erzittert. Zuerst ganz leicht, die Erschütterung ist kaum wahrnehmbar, dann ein Rumpeln und Quietschen aus Metall und Gestein, das immer stärker wird. Ein mit Steinen beladener Wagen taucht aus dem Stollenmundloch auf und fährt mit beträchtlicher Geschwindigkeit an mir vorbei. Zwei Bergarbeiter im Arbeitsanzug, mit Helm und Stiefeln, schieben ihn mit kurzen, schnellen Schritten, der eine größer, der andere kleiner, ihre ausgestreckten, gespannten Arme am Wagen, ihre Köpfe zwischen den Schultern. Noch fünfzig Meter weiter, bis zum Ende der Schienen, am Rand einer Böschung. Ein dritter Bergmann wartet dort. Er tritt zum Wagen, drückt den Hebel, der den Trichter freigibt, und kippt die Steine aus dem Wagen auf den Hang. Zwei- oder dreimal pro Woche kommt ein Lastwagen, um die angesammelten Steine abzutransportieren.
Die beiden erwachsenen Bergarbeiter, der eine, der den Wagen schob, und der andere, der an der Böschung wartete, reiben sich die Hände am Arbeitsanzug ab, holen Zigaretten aus einer Innentasche hervor und zünden sie an. Es ist Viertel nach sieben am Morgen, ihre Schicht ist zu Ende.
Der dritte Bergmann, die kleinere Gestalt, die den Wagen schob, ist das Mädchen, auf das ich gewartet habe: Alicia Quispe, vierzehn Jahre alt, in zu großer Arbeitskleidung. Einer der Erwachsenen hält ihr eine Wasserflasche hin und sie trinkt einen großen Schluck.
Ich gehe nicht zu ihr hin, bleibe etwa fünfzig Meter entfernt und spaziere ein wenig auf dem Minenvorplatz herum. Ich möchte, dass sie mich für einen Touristen halten, obwohl es noch früh ist. Ich trage einen Rucksack und eine Kompaktkamera, mit der ich Fotos von den Bergen, von dem Minenvorplatz aufnehme, und als ich mich zu ihnen drehe, mache ich eine leichte Geste mit dem Kopf, um sie zu begrüßen. Alicia sieht mich, erkennt mich und tut nichts. Ich gehe langsam über den Vorplatz auf ihr Haus zu.
Alicia Quispe ist nicht ihr wahrer Name. Sie möchte lieber unerkannt bleiben, um ihre illegale Arbeit nicht zu verlieren. Diese Arbeit, von der mir irgendein Genossenschaftsleiter sagen wird, dass sie nicht existiert. Dass sie nicht existiert, aber nun gut, wenn sie existieren würde, wäre es auch nicht so schlimm, schließlich helfen die Kinder, die hier wohnen, ihren Familien, wie wir das auch taten, so sagt man in der Genossenschaft, wie man es immer getan hat, was sollen sie auch sonst tun, die Kinder des Cerro Rico.
Alicia macht eine Arbeit, die es nicht gibt, eine Arbeit, für die man ihr täglich – besser gesagt, nächtlich – zwanzig Pesos zahlt, etwas mehr als zwei Euro. Für die man jetzt gerade gar nicht bezahlt. Sie arbeitet jetzt umsonst, um Schulden abzuzahlen, die die Genossenschaft ihrer Mutter anlastet, eine Falle, um sie als Sklavinnen zu halten.
Gestern sprach ich mit Alicia in den Räumen der Cepromin, am Fuß des Berges, wo die Kinder der Minen – und andere arbeitende Kinder: Maurer, Schuhputzer, Hausangestellte – Schulunterricht erhalten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Wo sie auch Gemüse, Eier, Fleisch essen können, was sie zu Hause – in ihren Baracken – nie essen. Wo sie warm duschen, in aller Ruhe einige Stunden spielen, lesen können. Wo sie niemand schlägt. Die Lehrerinnen erzählten mir von ihr: Du musst sie kennenlernen. Als ich sie das erste Mal sah, saß sie mit vier oder fünf anderen Mädchen ihres Alters, die Hausaufgaben machten, an einem langen Tisch; sie blätterte in einem Bilderbuch über Aschenputtel. Ich ging zu ihnen hin, um sie zu begrüßen, plauderte ein wenig mit ihnen, stellte ungeschickte Fragen, und Alicia war die Einzige, die mir eine Frage stellte. Ich plauderte ein wenig länger mit ihr, während ihre Kameradinnen sich wieder ihren Aufgaben widmeten. Am Ende lud sie mich ein, zu ihr nach Hause zu kommen, wann immer ich wollte.
Cepromin steht für Centro de Promoción Minera, eine Vereinigung zur Förderung des Bergbaus, die 1979, in den letzten Jahren der Militärdiktatur und in den ersten Gehversuchen der bolivianischen Demokratie, gegründet wurde. Die Bergarbeitergewerkschaften waren eine der stärksten Kräfte im Kampf für die Demokratie. Und zu Beginn der achtziger Jahre waren die Bergarbeiter voller Enthusiasmus.
»Die Bergarbeiter hatten jahrelang gegen die Diktaturen gekämpft und jetzt waren sie es, die an der Demokratie teilhaben konnten. Genau dafür wurde Cepromin damals gegründet, um die Bergarbeiter politisch zu bilden, um Führungskräfte hervorzubringen; die Idee war, dass die Gewinne aus dem Bergbau nicht ins Ausland abwandern, sondern zum ersten Mal in der Geschichte dem Wohlstand des Landes dienen sollten«, erzählte mir Cecilia Molina, Vorsitzende der Organisation in ihrem Büro in La Paz. »Und sieh uns heute an. Die Idee ist untergegangen. Bei unserer Arbeit geht es um das blanke Überleben, sieh dir unsere Projekte an: Programme gegen den Hunger, gegen extreme Armut und gegen Kinderarbeit in den Minen. Vor dreißig Jahren gab es keine Minderjährigen in einem Bergwerk. Die Dinge geschehen nicht ohne Grund. Hinter der Armut stehen politische Entscheidungen. 1985 schloss der Staat alle Minen außer einer, 23’000 Arbeiter wurden entlassen, alles wurde privatisiert und ab sofort galt das Recht des Stärkeren. Heute ist die Ausbeutung erschreckend hoch. Tausende Bergleute arbeiten ohne Vertrag, ohne Krankenversicherung, ohne Zugang zur Rentenversicherung und sie verdienen miserabel, manchmal werden sie betrogen, weil sie weder lesen noch schreiben können. Und es gibt einige Unternehmer, die sich an diesem System bereichern. Die Unwissenheit ist das Schlimmste: Es gibt keine Bildung, keinerlei Bewusstsein, keine Art von Widerstand. Jeder Bergarbeiter tut, was er kann, um ein bisschen Geld zu verdienen, und das war’s. Dann haben sie einen Unfall oder bekommen Silikose und so enden sie und ihre Familie im reinen Elend. Die Bergwerke sind viel gefährlicher als früher, es gibt weder Technologie noch Sicherheitsmaßnahmen. So beten wir den Tío an und mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück. Wenn der Papa mit 30 oder 35 Jahren stirbt, müssen eben seine Söhne in die Mine.«
Im Jahr 2011 schätzte die bolivianische Regierung die Zahl der Minderjährigen, die in den Bergwerken arbeiten, auf 3800. Cepromin zählte etwa 13’000.
»Eine genaue Zahl zu nennen, ist unmöglich«, sagte Molina, »denn es handelt sich um Schwarzarbeiter, deren Zahl je nach Erzpreis steigt oder sinkt. Fest steht, dass sie, wenn sie mit zwölf oder vierzehn Jahren anfangen zu arbeiten, die 35 wahrscheinlich nicht erleben werden.«
Alicia verabschiedet sich von den zwei Kumpeln und geht einige Schritte bis zu der Hütte, in der sie mit ihrer Mutter, Doña Rosa, 42 Jahre alt, und ihrer Schwester Evelyn, vier, lebt. Es ist ein aus groben Lehmziegeln errichteter kleiner Raum mit vier Wänden ohne Fenster und einem Dach aus Wellblech. Die Bergleute bauten die Hütte mitten auf dem Minenvorplatz, auf felsigem Untergrund auf 4400 Metern Höhe, wo die Winde alles wegfegen, und sie legten einige große Steine auf das Dach, damit es nicht weggeweht wird. Hier oben – Wolken aus giftigem Staub, Geröllböen, die wie Hagel prasseln – kratzt der Wind, als hätte er Krallen.
Die Bergarbeiter gaben Alicia und ihrer Familie die Erlaubnis, hier wohnen zu dürfen. Nur hier können sie leben – wo es sich fast nicht leben lässt.
Sie wohnen in einem der höchstgelegenen Häuser des ganzen Planeten, in der letzten und dünnsten Schicht menschlichen Lebens, denn oberhalb von 4400 Metern lebt fast niemand mehr. Alicia, Doña Rosa und Evelyn haben 99,9 Prozent der Menschheit unter sich. Und knapp über ihnen erschöpft sich jede Möglichkeit dauerhaften Lebens: Über ihren Köpfen ist nur noch wenig Luft zum Atmen, eine Luftsäule, die halb so schwer ist wie auf dem Meeresspiegel; und bei so geringem Luftdruck sind die Lungenbläschen nicht in der Lage, das Blut mit genügend Sauerstoff zu versorgen. Über Tausende von Jahren haben sich die Bewohner solchen Höhen angepasst: Ihre Lungen sind größer, um mit jedem Atemzug mehr Luft aufzunehmen, sie haben mehr Blut und mehr rote Blutkörperchen, um Sauerstoff durch den Körper zu transportieren. Aber die Zahl der Blutkörperchen hat ein Limit, denn sonst wird das Blut zu dickflüssig und es kommt zu Gerinnseln, Schlaganfällen und Herzinfarkten. Kein Mensch kann deswegen dauerhaft oberhalb von 5500 Metern leben.
Hier auf 4400 Metern hält es auch kaum einer aus. Fast alle, die wir hier gerade angekommen sind, leiden an Kopfschmerzen, Übelkeit und wir erschrecken uns, wenn das Herz schneller schlägt. Wir müssen uns einige Tage akklimatisieren, schlafen, ausruhen, Tee aus Koka-Blättern trinken, die roten Blutkörperchen vervielfachen, um schließlich ein paar Schritte gehen zu können, ohne völlig erschöpft zu sein. Manchen ergeht es schlimmer: Sie erbrechen, werden ohnmächtig oder bekommen Migräne. Oder noch schlimmer: Sie leiden unter Ödemen, die Lungen oder das Gehirn schwellen und sie sterben.
Alicia lassen sie hier leben – wo sich fast nicht leben lässt.
Das Haus ist ein Aussichtspunkt über das andine Hochplateau: eine ocker- und salzfarbene Ebene, die unter der Sonne flimmert und sich zum blauen Himmel hin auflöst. Kein Baum wächst. Alles ist Stein und Licht. Hier und da wölben sich einige Hügel, aber man hat den Eindruck, die Welt würde schon müde hier oben ankommen, und aus diesem Grund ist die Erscheinung des Cerro Rico so beeindruckend: ein Gipfel, der sich tausend Meter über das marode Hochplateau erhebt. Am Fuß des Berges breitet sich die Stadt Potosí aus, zweihunderttausend Einwohner, mit ihren Vierteln aus würfelförmigen, kleinen Häusern mit Flachdächern, mit ihrem Raster aus dichtgedrängten Zellen, mit einer Geometrie, die wie das Werk von Insekten aussieht. Oder wie ein Lager: ein Lager von Pionieren, die gekommen sind, um einem unbewohnbaren Planeten Reichtum abzugewinnen.
Genau das ist es. Alicia wohnt in einem Gebirge aus reinem Silber, das die spanischen Eroberer blendete; das göttliche Geschenk, das ihr Streben belohnte, ihr Imperium festigte und ihre Überzeugungen bestätigte; es ist auch das Quechua-Wort, das im Spanischen übernommen wurde, um unvorstellbaren Reichtum schlechthin zu benennen: Vale un Potosí. Will heißen: Es ist ein Vermögen wert.
Alicia wohnt in Potosí, dem Wunderland der märchenhaften Schätze.
Sie grüßt mich, jetzt kann sie, und bittet mich ins Haus. Die Tür ist eine Metallplatte mit einem kleinen Vorhängeschloss, am Türsturz hängen blaue und grüne Bänder und zwei rote Plastikblumen. Im Inneren ist es dunkel, unter den Füßen die Erde, die Augen brauchen eine Weile, um Details zu erkennen. Nach und nach sehe ich, dass die Innenwände des Lehmziegelhäuschens, ein Raum von sechs mal drei Metern, verputzt sind, doch der Putz blättert ab. Und ich höre den Wind durch die Ritzen pfeifen. An einigen Stellen sind die Ritzen mit Pappe überdeckt; zum Beispiel mit einem großen Bild der kleinen Meerjungfrau von Disney, die auf einem Felsen auf dem Meeresgrund sitzt und lächelt, neben einem gelben Fisch, der ebenfalls lächelt, und einem roten Krebs mit hervorstechenden Augen, der seine Scheren begeistert öffnet. Von diesem Disney-Unterwassergrund auf Pappe tropft ein Flecken Feuchtigkeit die Wand entlang. Die undichten Stellen machen den Boden schlammig. Im Dunkeln sehe ich einen kleinen Gasherd auf einem Tisch, ein Bett mit dicken Decken, in dem die Mutter und die zwei Kinder schlafen, ein halbes Dutzend Leinensäcke, um die Kleidung aufzubewahren, drei alte Plastikstühle und noch einen kleinen Tisch, an dem sie essen und an dem Alicia oft ihre Schulaufgaben macht, wie sie mir sagt.
Alicia öffnet ihre Faust und zeigt mir drei bleigraue Steine, durch die sich glänzende Tupfen ziehen: Silberpartikel. Sie hat sie aus der Mine heimlich mitgenommen.
Die Steine wickelt sie in Zeitungspapier ein, bewahrt das Päckchen in ihrem Schulrucksack auf und entfernt sich in eine Ecke, hinter die Kleidungssäcke, um sich umzuziehen. Sie zieht den Arbeitsanzug aus und eine Jeans an, eine blaue Trainingsjacke und eine Wollmütze. Dann setzt sie sich den Rucksack auf und wir verlassen das Haus und gehen den Berg hinunter.
Vierzehn Jahre ist sie alt und ihre Hände sind verwittert, ausgetrocknet und ausgebleicht vom Staub des Berges.
Der Wind fegt über die Hänge, zerrt an den zermalmten Steinen, lässt die Halden knirschen. Der Staub des Cerro Rico gelangt in die Augen, zwischen die Backenzähne und in die Lunge und enthält krebserregendes Arsen sowie Kadmium, Zink, Chrom und Blei, die sich im Blut anreichern, es nach und nach vergiften, Krankheiten beschleunigen und den Körper erschöpfen. Auch Silber ist enthalten: 120 bis 150 Gramm Silber pro Tonne Staub. Jeder Besucher nimmt ein paar Silberpartikel aus Potosí in seiner Lunge mit. Wegen dieser Partikel, um diese Partikel von dem Rest herauszulösen, lebt Alicia in der kümmerlichen Lehmhütte auf dem Berg.
»Früher habe ich die Steine in Pailaviri verkauft. Touristen kaufen sie gerne da. Aber die Pailaviri-Kinder haben mich weggejagt, weil sie auch welche verkaufen. Jetzt gehe ich runter zum Platz.«
»Verkaufst du viele auf dem Platz?«
»Ja, ganz gut. Aber da sind Polizisten.«
Man hört entfernt unterirdische Explosionen. Vom Berg steigt wieder grauer Staub auf, sehr hoch, er fällt langsam, lässt sich auf die Menschen nieder, auf den Bergabhang, dann kommen Lastwagen und wirbeln ihn wieder auf.
Wir steigen zum Bergarbeiterviertel hinab, zuerst zu den unbefestigten Straßen, dann zu den asphaltierten mit Bürgersteig, und wir gehen weitere zwei Kilometer hinab bis zum Platz des 10. November, wo es Gärten, Brunnen und Bänke gibt. Es ist der antike Platz von Regocijo, dem Herzen des kolonialen Potosí. Wenn wir vom Platz aus Richtung Süden schauen, über die Tempel und Paläste hinweg, sehen wir die beeindruckende Pyramide des Cerro Rico. Zwei weibliche Silhouetten auf dem Platz heben sich vom Berg ab, eine Gerechtigkeitsstatue, die ihre Waage hält, und eine Freiheitsstatue, die die Fackel emporstreckt. Zu Füßen der Gerechtigkeit und der Freiheit, auf einer Bank auf dem Platz, holt Alicia aus ihrem Rucksack eine offene Holzkiste mit einem Gitter für neun Einheiten. Sie wickelt die drei versilberten Steine von heute aus und ein paar weitere, die sie in anderen Päckchen mitgebracht hat, und legt sie in die Zellen der Kiste.
Früher ging sie zum Abbaugebiet von Pailaviri, dem ältesten des Cerro Rico, seit dem 16. Jahrhundert in Betrieb; hier verkaufte sie Steine an die Touristen, die in geführten Touren in die Stollen hinabsteigen. Seitdem die Kinder von Pailaviri sie verjagten, geht sie zum Platz hinunter und stellt sich an die Ecke der Straßen Ayacucho und Quijarro. Hier kommen die Touristengruppen entlang, die das Königliche Münzhaus, die Casa de la Moneda, besichtigen. Sie stellt die offene Kiste mit den Steinen zur Schau.
»Señora, kaufen Sie Silbererz. Silber aus Potosí, Señora.«
Sie bittet um fünf Pesitos, zehn Pesitos.
Für einen der Steine gibt ihr eine junge Touristin zwanzig Pesos. Das gleiche Geld, das sie für eine ganze Nacht für das Lorenschieben bekam, bevor man sie zwang, umsonst zu arbeiten. Einmal, erzählt Alicia, hätten Touristen ihr fünfzig Pesos für einen Stein gegeben. Doch die Führer der Touristengruppen und Polizisten verjagen oft die Kinder, die etwas verkaufen. Sie schaut sich immer um.
Hundertfünfzig Meter vom Platz entfernt befindet sich die Casa de la Moneda, eine barocke Festung mit hohen, dicken Mauern, fünf Innenhöfen und zweihundert Zimmern, alle aus gemeißeltem Stein, mit Zedernholzdecken und schmiedeeisernen Gittern. Das Haus bewahrt die alten spanischen Prägemaschinen auf: die Öfen zum Schmelzen der Silberzapfen, die am Cerro Rico gewonnen wurden; die Barrenformen, in die man das flüssige Silber zum Modellieren goss; die Walzwerke, die in Cádiz hergestellt, in Einzelteilen nach Buenos Aires verschifft und auf Maultieren – viertausend Kilo Eisen und viertausend Kilo Holz –bis hoch nach Potosí getragen wurden. In einem der Untergeschosse kann man die Räder besichtigen, die von Maultieren gedreht wurden, um die Walzmaschinen im Obergeschoss anzutreiben.
Außer den Tieren arbeiteten auch von Wachen beaufsichtigte Indigenen an den Öfen und den Maschinen. Sie wurden mit Peitschen angetrieben und gelegentlich in den Kerkern des Gebäudes eingesperrt. Mit den noblen Aufgaben waren die besten numismatischen Handwerker des Reiches beauftragt, Prüfer, Gießer, Schleifer, Präger und Wäger. In der Frühzeit der Spanier wurden in Potosí Macuquinas hergestellt: unregelmäßige, mit dem Hammer geprägte Münzen. Aber die aus Cádiz mitgebrachten Walzmaschinen schnitten perfekte Silberscheiben, die dann als kastilische Pesos, Pesos ensayados, Pesos de cruz, Pesos de tres cuartillos, Pesos columnarios, Pesos de busto, Dukaten, Maravedís und Peseten geprägt wurden.
Für Münzen und Barren bauten die Spanier laut dem Bericht des Geografen Pentland in der Zeit von 1545 bis 1825 35’578 Tonnen Silber aus dem Cerro Rico von Potosí ab, die sie mit Maultierkarawanen und Galeonenflotten ins Mutterland transportierten. Bei den heutigen Silberpreisen entspricht dies etwa 17 Milliarden Dollar. Der bolivianische Bergbauingenieur und ehemalige Bergbauminister Jorge Espinoza kam gemäß seinen Berechnungen zum Schluss, dass dies für eine so lange Zeit gar nicht so viel gewesen sei, dass die reale Ausbeute jedenfalls nicht ausreiche, um die Saga des außergewöhnlichen Reichtums von Potosí zu begründen: Die Erträge waren niedrig, viel niedriger als die der heutigen Bergbauunternehmen. Aber das Geheimnis von Potosí war nicht das Silber. Oder es war nicht nur das Silber: Es war die Sklavenarbeit, die sehr niedrigen Abbaukosten, die riesige Gewinnspanne.
Der Reichtum von Potosí war nicht das Silber. Der Reichtum von Potosí war der Indio.