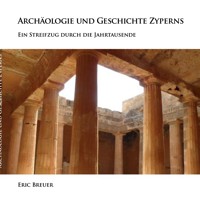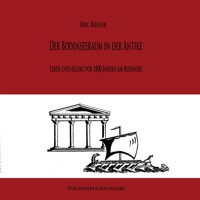
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Über die Kultur der Antike im Mittelmeerraum ist relativ viel bekannt. Viel weniger wissen wir hingegen über die Regionen am Rande der antiken Welt. Auch der Bodenseeraum war Teil der antiken Koine. Der Leser, sei er nun Tourist oder Einheimischer, wird mit dem Leben am Bodensee in römischer Zeit und römischen Orten des Bodenseeraumes vertraut gemacht. Hierdurch erhält er anhand ausgewählter Lebensbereiche schlaglichtartig Einblicke in Alltag, Lebensweise und Mentalität der Bewohner des Bodenseeraums vor fast 2000 Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1.
Forschungsgeschichte
1.1 Warum wir heute nicht von antiken Tempeln umgeben sind
1.2 Eine kurze Forschungsgeschichte
2.
Geschichte
2.1 Archäologische Funde der Vorgeschichte im Bodenseeraum
2.2 Kelten - Gallier – Galater – Eine mediterrane Randkultur
2.3 Wie mediterrane Kultur in den Bodenseeraum gelangte
2.4 Römische Verwahrfunde der Region
2.5 Ende der Antike und Nachleben
2.6 Alamannen im spätantiken Bodenseeraum
3.
Geographie
3.1 Antike Geographie der Region
3.2. Bregenz – Brigantium – Die „Haupt“-stadt des Bodenseeraumes
3.3. Arbon - Arbor felix – Von der Kaiserzeit bis zur Spätantike
3.4. Konstanz – Constantia – Vom namenlosen vicus zur „Kaiser“-Stadt
3.5. Eschenz – Tasgaetium – Von hölzernen Latrinen und Göttern auf Abwegen
3.6. Orsingen – Ein Tempel und seine Wurzeln
3.7. Eriskirch – Von Flusshäfen, Brücken und Strassen
3.8. Leben zwischen Vulkanen -Westlicher Bodenseeraum
3.9 Von der Sonne verwöhnt – Östlicher Bodenseeraum
4.
Architektur
4.1 Aussehen römischer Gebäude
4.2 Innenausstattung römischer villae rusticae
4.3 Mediterrane Thermentechnik am Bodensee
5.
Leben und Alltag
5.1 Alltag am römischen Bodensee
5.2 Mentalität und Wertesystem der Antike
5.3 Zeitvertreib kleiner Römer
5.4 Mode, Kleidung und Schmuck vor 1750 Jahren am römischen Bodensee
6.
Verkehr
6.1 Verkehr auf römischen Strassen
6.2 Schiffahrt am Bodensee in römischer Zeit
6.3 Transport und Lagerung in der Antike
7.
Ökonomie
7.1 Römisches Geldwesen
8.
Essen
8.1 Speisenzubereitung vor fast 2000 Jahren
8.2 Antike Tisch- und Speisesitten
8.3 Antikes Geschirr vom Bodensee
9.
Tod und Religion
9.1 Religion und Göttervorstellungen der Antike
9.2 Antike Nekropolen
10.
Anhang
10.1 Literatur
Forschungsgeschichte
Verschwundene Zeugnisse der Antike
Warum wir heute nicht von antiken Tempeln umgeben sind…
Wer als Tourist die Mittelmeerregion bereist, steht staunend vor den Zeugnissen der klassischen Antike. Ausgrabungs- und Ruinenstätten zeugen vom Glanz vergangener Zeiten. Der Besucher kann unter anderem klassisch griechische, hellenistische oder römische Podiumstempel besichtigen, sich antike Thermenanlagen ansehen oder ganze Stadtanlagen durchwandern. Auch wenn oftmals nur noch wenige Säulenschäfte in den zu grossen Teilen erdbebengefährdeten Mittelmeerländern aufrecht stehen oder grosse Teile der Baustruktur erst in jüngerer Zeit wiederhergestellt und restauriert wurden: Die Spuren des klassischen Altertums ziehen bis heute Besucher an und sind beliebte Ausflugsziele für kulturinteressierte Urlauber. Wenig beachtet ist jedoch der Umstand, dass auch unsere Regio Teil dieser klassischen Welt der Antike war. Denn mit der Eingliederung in das Imperium der Römer hielt auch mediterrane Lebenswelt Einzug am Bodensee. Auch in unserem Raum gab es antike Tempel, Thermen und stadtartige Siedlungen. Selbst auf abgeschiedenen landwirtschaftlichen Anwesen des antiken Bodenseeraumes existierten kleine Thermenanlagen und die Innenhöfe mögen in so manchem Fall eher einem hellenistischen Peristylhof des Südens geglichen haben, als dem heutiger traditioneller alemannischer Bauernhöfe. Alle diese Zeugen der Antike sind heutzutage in unserer Regio verschwunden. Selbst an Geschichte interessierte Fachleute können im Bodenseeraum kaum touristisch interessante Bauten aus der Zeit der Antike benennen. Doch warum sind wir heute nicht von imposanten antiken Ruinen und klassischen Podiumstempeln umgeben? Nach dem Ende römischer Verwaltungshoheit wurde der Bodenseeraum von Alamannen besiedelt. Im Laufe der Zeit verfielen die nicht genutzten antiken Gebäude immer mehr. Flurnamen wie „Mauern“ oder „Weiler“ bezeugen, dass bis weit ins Mittelalter von diesen antiken Gebäuden noch aufrecht stehende Mauern vorhanden waren. Die im tektonisch aktiven Bodenseeraum mit seinen Hegauvulkanen periodisch auftretenden Erdbeben dürften so manches baufällige Gemäuer zu Einsturz gebracht haben. Im Mittelalter und in der Neuzeit war gutes Baumaterial für Häuser rar. Deshalb verkaufte man in der Regio bis in 19. Jahrhundert sogar verfallene mittelalterliche Burgen zum Abbruch, um die Bausteine wiederzuverwerten. Auch die römischen Ruinen wurden zu diesem Zweck bis auf die Grundmauern abgetragen. Die Mauerstümpfe wurden, da schwierig zu beackern, von Pflanzen überwuchert, so dass sie bald unter einer Pflanzen- und Humusdecke nicht mehr im Gelände sichtbar waren. Da breiten Schichten der hiesigen Bevölkerung kaum etwas darüber bekannt ist, wird in diesem kleinen Büchlein ein kleiner Einblick in die Lebenswelt am Bodensee in der Zeit der klassischen Antike gegeben. Der Leser, sei er nun Tourist oder Einheimischer, wird mit den römischen Altertümern des Bodenseeraumes vertraut gemacht. Durch historisch-archäologische Erläuterungen zu den antiken Funden, erklärende Skizzen und kulturhistorischen Zwischenbemerkungen erhält er anhand ausgewählter Lebensbereiche schlaglichtartig Einblicke in Alltag, Lebensweise und Mentalität der Bewohner des Bodenseeraumes vor nahezu 2000 Jahren.
Pioniere und Enthusiasten von der Renaissance bis heute ...
Eine kurze Forschungsgeschichte
Die Beschäftigung mit römischen Altertümern geht im Bodenseeraum bis in die Zeit der Renaissance zurück. Angeregt durch die beginnende Erforschung des Altertums im Mittelmeerraum, hätten es die neuen bürgerlichen Eliten der aufstrebenden Städte des Bodenseeraumes nicht ungern gesehen, wenn die Wurzeln ihrer Orte bis in die Antike zurückreichen würden. So versuchte man gleichzuziehen, indem man mit viel Phantasie durch Interpretation der Ortsnamen eine Entstehung in der Antike postulierte. Für das Jahr 1490 ist eine erste Grabung im Bereich des spätantiken Kastells Vemania durch Bürger der nahen Stadt Isny überliefert. Eine der frühesten Ausgrabungen am Bodensee fand im Jahr 1686 in der Nähe von Bodman statt. Hierbei wurden die hypokaustierten Räume eines römischen Bades freigelegt. Die für die Ausgräber fremdartige Fussbodenheizung führte jedoch dazu, dass der ganze Komplex fälschlich als Schmelzofen für Metall interpretiert wurde. Im 19. Jahrhundert wurden viele Geschichtsvereine gegründet, welche begannen die römischen Hinterlassenschaften systematisch zu erforschen. Lokale Sammlungen und Museen entstanden selbst in kleinen Orten. Herausragende Einzelpersönlichkeiten, wie Samuel Jenny (1837-1901) in Bregenz oder Bernhard Schenk (1833-1893) in Eschenz trieben Ausgrabungen systematisch voran und deckten eine Vielzahl antiker Gebäude auf. Ein Höhepunkt der Bemühungen stellte die Gründung des Vereins zur Erforschung der Geschichte des Bodenseeraumes in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dar.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts versuchte man noch über die heutigen Ortsnamen römische Orte zu identifizieren. Klang der Name eines Ortes verdächtig romanisch oder hatte er gar Ähnlichkeit mit einem antiken Namen, so wurde eine Gleichsetzung postuliert.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts analysierten der Pfarrer Konrad Miller, der Kartograph Eduard Paulus und sein gleichnamiger Sohn Flurnamen der Regio, da sie annahmen, dass alte Gewannbezeichnungen, wie „Niederweiler“ in Langenargen oder “Mauren“ in Eriskirch, die auf Ruinen oder Siedlungen deuten, Hinweise auf eine vormalige römische Besiedlung sein könnten. Sie bereisten das Land und erkundigten sich überall bei der Landbevölkerung nach Flurnamen und Mauerresten in den Äckern und suchten dort nach Altertümern.
Durch den modernen Verwaltungsstaat mit seinen strengen Zuständigkeiten, wurden im 20. Jahrhundert derartige private Nachforschungen stark zurückgedrängt. Die Archäologie des Raumes war institutionalisiert. Während sich vormals zumeist Privatleute und Geschichtsvereine engagierten, wurde die Archäologie nunmehr zur staatlichen Aufgabe, die an das Budget eines bestimmten Departements gebunden war und auch nicht darüber hinaus ging, besonders wenn die zuständige Stelle in weiter Entfernung vom Bodensee lag..
Trotzdem gibt es auch weiterhin einzelne herausragende Persönlichkeiten, die sich besonders für die Archäologie bestimmter herausragender Orte engagieren, wie Alfons Diener in Eschenz, Harry Kleiner in Eriskirch, Ullrich Paret in Friedrichshafen und Dr. D. Wollheim in Orsingen.
Geschichte
Spuren früher Zeiten ...
Archäologische Funde der Vorgeschichte im Bodenseeraum
Obwohl schon zu allen Zeiten Spuren früherer Generationen zufällig oder bewusst freigelegt wurden, begann erst im 19. Jahrhundert die wissenschaftliche Erforschung der schriftlosen „Vor“zeiten durch systematische Analyse ihrer materiellen Hinterlassenschaften. Dem dänischen Forscher Christian Thomsen (1788-1865) wird die grundlegende, auch heute noch gültige chronologische Einteilung dieser Vor- Geschichte zugeschrieben. Während der Betreuung der Kopenhagener Museumssammlung war ihm aufgefallen, dass die ältesten menschlichen Artefakte aus Stein waren, während Gegenstände aus Bronze erst später aufkamen und solche aus Eisen noch jünger sein mussten. Hieraus leitete er eine zeitliche Dreiteilung in Stein-, Bronze- und Eisenzeit ab. In der Folge wurde das System weiter untergliedert und verfeinert, wobei sowohl Ortsnamen wichtiger Fundorte und typische Sachgruppen als auch für eine Zeit markante Bestattungssitten zur Benennung zeitlicher Stufen verwendet wurden. So wird zum Beispiel die Eisenzeit nach den Fundorten Hallstatt im Salzkammergut und La Tène am Neuenburger See weiter in Hallstattzeit und Latènezeit untergliedert, während die Stufe davor aufgrund der damals vorherrschenden Bestattungssitte Urnenfelderzeit genannt wird. Da der Bodenseeraum zu einer klassischen Altsiedellandschaft zählt, die zu allen Zeiten die Menschen anzog, sind aus allen archäologischen Epochen Funde auf uns gekommen. Besonders aus dem Neolithikum, der Bronze- und der Hallstattzeit sind zahlreiche menschliche Artefakte bekannt geworden. Wesentlich spärlicher vertreten ist die der römischen Kaiserzeit vorangehende Spätlatènezeit. Spätlatènezeitliche Münzen stammen beispielsweise aus Achberg und Tettnang, ein Hortfund gleichen Alters mit sechs eisernen Spitzbarren aus Bodnegg-Oberaich (RV). Im Lauteracher Ried nahe Bregenz wurde 1880 beim Torfstechen ein Schatz aus derselben Zeit mit zwei Fibeln, Ringen sowie keltischen und republikanischen römischen Münzen entdeckt. Welche Völker hinter den Funden der Stein- und Bronzezeit stehen, wie sie sich selber nannten sowie wesentliche Teile ihrer immateriellen Kultur wird man wohl nie mehr erschliessen können. Anders verhält es sich mit jenen Zeiten, aus denen wir bereits vereinzelte Nachrichten von griechischen und römischen Schriftstellern besitzen. Einige mediterrane Autoren berichten auch über die Völker des Nordens. Auf einer Inschrift des „Trophaium Alpium“, eines Siegesdenkmales der Römer, dessen Überreste in Südfrankreich entdeckt wurden, sind die Namen der Stämme vermerkt, die bei der Besetzung des Alpen- und Voralpenlandes unterworfen wurden. Nach den antiken Schriftquellen siedelten zur Zeit der römischen Okkupation Kelten am Bodensee. Im Bodenseeraum ist mit keltischen Vindelikern, Brigantiern oder Helvetiern zu rechnen. Nicht auszuschliessen ist, dass das Alpenvolk der Räter seinen Siedlungsraum über den Alpenrhein bis in die Nähe des südlichen Bodensees vorgeschoben hatte. Aus archäologischer Sicht ist die Besiedlung des Bodenseeraumes in der Zeit kurz vor der römischen Besetzung nur schwer zu fassen und jene Bevölkerung, auf welche die Römer bei der Besetzung des Bodenseeraumes stiessen ist kaum archäologisch nachweisbar.