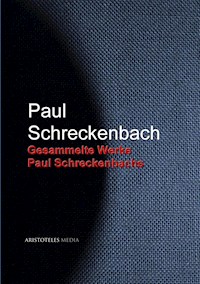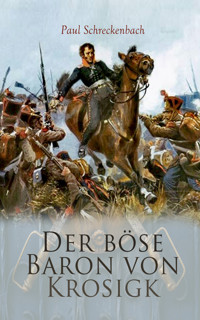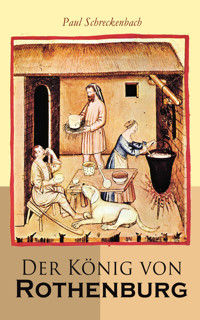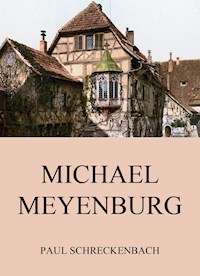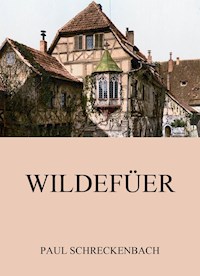Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman aus der Zeit deutscher Schmach und Erhebung. Erzählt wird aus der Geschichte derer von Krosigk, die viele Jahre über Alsleben an der Saale und Umgebung regierten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der böse Baron von Krosigk
Paul Schreckenbach
Inhalt:
Paul Schreckenbach – Biografie und Bibliografie
Der böse Baron von Krosigk
Erstes Buch.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Zweites Buch.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Drittes Buch.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Der böse Baron von Krosigk, P. Schreckenbach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849635701
www.jazzybee-verlag.de
Paul Schreckenbach – Biografie und Bibliografie
Deutscher Pfarrer und Schriftsteller, geboren am 6. November 1866 in Neumark (bei Weimar), verstorben am 27. Juni 1922 in Klitzschen bei Torgau. Sohn eines Pastors, studierte in Halle und Marburg Theologie und Geschichte und promovierte später zum Doktor phil. Ab 1896 arbeitete S. als Pfarrer in Klitzschen in der Nähe von Torgau. Der Autor ist bekannt für seine hervorragenden historischen Romane.
Wichtige Werke:
Bismarck, 1915
Der böse Baron von Krosigk, 1908
Die von Wintzingerode, 1905
Geistliche Lieder von Martin Luther, 1917
Der getreue Kleist, 1909
Der jüngste Tag, 1919
Der König von Rothenburg, 1910
Der Komtur, 1921
Kurfürst Augusts Abenteuer, 1921
Die letzten Rudelsburger, 1913
Markgraf Gero, 1916
Michael Meyenburg, 1920
Die Pfarrfrau von Schönbrunn, 1917
Sühne, 1923
Die Tat des Leonhard Koppe, 1916
Um die Wartburg, 1912
Der Weltbrand, 3 Bände, 1915-20
Die von Wintzingerode, 1905
Der Windmüller von Melpitz, 1914
Der Zusammenbruch Preußens 1806, 1906
Der böse Baron von Krosigk
Ein Roman aus der Zeit deutscher Schmach und Erhebung
Erstes Buch.
I.
Die Frühsonne eines hellen Oktobertages lag auf dem alten Herrenhause in Groß-Salze, das im Volksmunde der blaue Hof genannt wurde. Ihre Strahlen ließen die weißgetünchten Mauern des schmucklosen Baues weit hinaus ins flache Magdeburger Land erglänzen, sie glitten wie liebkosend hin über das altersgraue, etwas verwitterte Wappen derer von Schurff über der breiten Tür, sie fluteten in mächtigen Wogen in das halbgeöffnete Fenster hinein, in dem eine schlanke Mädchengestalt lehnte und gespannt in die Ferne hinausblickte. Das freche Volk der Spatzen lärmte laut in dem dichten Epheu, der die Giebelseite des Hauses überzogen hatte, und einige der gefiederten Helden hüpften keck auf das Fensterbrett und schauten das Mädchen neugierig lauernd von der Seite an, ob ihnen nicht ihre Hand das gewohnte Frühmahl spende. Aber sie hatte heute keine Augen für ihre kleinen Kostgänger, sondern unablässig verfolgte ihr Blick einen hochbepackten Reisewagen, der von vier kräftigen Braunen gezogen sich schnell immer weiter und weiter entfernte und endlich nur noch wie ein dunkler Punkt am fernen Horizonte zu sehen war.
Mit einem tiefen Atemzuge trat das Mädchen vom Fenster zurück, und dabei fiel ihr Auge auf ein kleines Buch, das auf einem zierlichen Nachttischchen neben ihrem Bette lag. »Losungen der Brüdergemeine für das Jahr 1806« stand in feinen Goldbuchstaben auf dem schwarzen Ledereinbande. Jeder seiner drei Töchter schenkte der alte Major von Schurff dieses Büchlein in gleichem Einbande an einem jeden Neujahrsmorgen, denn er war ein frommer Mann und hielt auf Gottesfurcht in seinem Hause. Außerdem war ein kleiner Aberglaube dabei. Er sah in den Losungen der Stillen im Lande eine Art von Orakel, nach dem er die Geschäfte des Tages einrichtete, und etwas davon war auch auf seine Frau und seine Töchter übergegangen.
Heute nun hatte die Älteste es vergessen, beim Aufstehen die heutige Losung nachzulesen, was ihr seit langer Zeit nicht passiert war. Hastig griff daher jetzt ihre Hand nach dem kleinen Buche, um das Versäumte nachzuholen. Sie fand mit leichter Mühe den Spruch des Tages, des siebzehnten Oktobers. Es war das Wort des weisen Salomo: Des Menschen Herz schlägt seinen Weg an, aber der Herr allein giebt, daß er fortgehe.
Ein tiefer Ernst prägte sich, als sie das Buch wieder hinlegte, in ihren feinen Zügen aus. Es mochte wohl etwas in dem Schriftworte liegen, was sie besonders bewegte, denn ihre großen graublauen Augen wurden feucht und zwei Tränen rollten über ihre Wangen.
Aber feste Schritte, die draußen auf dem Korridore erklangen und ihrer Tür sich näherten, schreckten sie auf. Sie ergriff schnell ein Tuch und suchte die verräterischen Spuren ihrer Gemütsbewegung hastig zu tilgen, was ihr indessen in der Eile nur sehr unvollkommen gelang. Die eintretende Mutter erkannte mit ihrem scharfen Blicke sogleich, daß sie geweint hatte. Sie blieb sehr erstaunt in der Tür stehen und sah ihre Tochter fast verwirrt an. Dann drückte sie rasch die Tür hinter sich ins Schloß, trat lebhaft auf das Mädchen zu und rief mit gedämpfter Stimme: »Wie, Friederike? Du in Tränen? Das ist doch sonst deine Art ganz und gar nicht! Was ist dir denn? Was ist geschehen?«
Friederike antwortete nicht. Sie hatte sich abgewendet und war sehr rot geworden.
Frau von Schurff betrachtete ihre Tochter eine Weile mit mütterlich besorgtem Blick, dann schüttelte sie halb traurig, halb mißbilligend den Kopf, auf dem die Haare trotz der frühen Morgenstunde zu einem tadellosen Toupet frisiert und schneeweiß gepudert waren.
»Kind, Kind!« sagte sie, »Du bist mir ein Rätsel. Dich in Tränen zu finden – vraiment – darauf war ich am wenigsten gefaßt. Wem galten sie denn?«
»Keinem Menschen,« erwiderte das Fräulein kurz und trotzig, aber ihre Stimme klang, als ob sie ein Schluchzen unterdrücken wolle.
Die Mutter runzelte unwillig die Stirn und setzte sich resolut auf einen der zierlichen Rohrstühle, obwohl er unter ihrer Last bedenklich knackte. »So, mein Döchting,« sagte sie, »nun komm mal her. Hier, setz dich, so, mir gegenüber. Was wir zu bereden haben, läßt sich nicht im Stehen abmachen. Ich will nämlich, daß du endlich einmal Farbe bekennst. Ich verlange, daß du deiner alten Mutter das Vertrauen schenkst, auf das ich, weiß Gott, ein Recht habe. Und deshalb – ohne alle Fisematenten und Winkelzüge: warum hast du meine gute alte Krosigken so meschant behandelt?«
Friederike schlug die Augen auf und blickte der Mutter erstaunt in das erregte Gesicht. »Meschant hätte ich die liebe alte Dame behandelt? Aber bestes Mutterchen, das ist wohl ein Mißverständnis. Ich werde eine so viel ältere Dame und nun gar einen Gast unseres Hauses nie anders als mit der größten Höflichkeit, dem höchsten Respekt behandeln.«
Die Majorin richtete sich ärgerlich auf. »Du willst mich nicht verstehen und weichst mir aus. Respekt? Höflichkeit? Daran hast du es nicht fehlen lassen. Aber kühl, unnahbar, steif bist du gewesen, wie ein Eiszapfen bist du gewesen. Die gute Krosigken kam dir so freundlich, so liebevoll entgegen, aber nachher war sie ganz erkältet. Als sie ankam, sagte sie mir gleich in der ersten Stunde, wie hübsch und nett sie dich fände; als sie abfuhr, sagte sie gar nichts mehr und sah ganz traurig und bekümmert aus. Und sie fährt direkt nach Poplitz. Was wird sie ihrem Sohne von dir erzählen!«
»Das mag sie halten, wie's ihr beliebt!« sagte das junge Mädchen und erhob sich ungestüm. Aber die Mutter ergriff ihre Hand und zog sie mit festem Drucke wieder auf den Sessel nieder. »Nein, nein, Kind, jetzt weichen wir uns einmal nicht aus. Jetzt will ich klar sehen, und du sollst es auch.« Sie machte eine Pause und fuhr dann fort: »Auf dem Balle, den Prinz Louis im Juni in Magdeburg gab, hat Krosigk dich auffallend ausgezeichnet. Er soll sonst kein Mädchen ansehen, mit dir hat er dreimal getanzt. Meine alte Freundin, die Wedell von Piesdorf, war ganz aufgeregt, sie sagte, so hätte sie den Weiberfeind noch nie gesehen. Nachher ist er auch noch hierher gekommen und hat dem Vater seine Aufwartung gemacht« –
»Und ist dann nicht wiedergekommen,« warf Friederike bitter ein.
»Das ist sehr einfach zu erklären. In der Ernte konnte er von seinen großen Gütern nicht weg, da bleibt ein Landwirt zu Hause. Nachher kam der Krieg.«
»Er steht nicht mit im Felde,« sagte Friederike kurz.
»Aber er macht sich dem Vaterlande auf andere Weise nützlich und hat damit viel Mühe und Arbeit. Las nicht erst vor wenigen Tagen der Vater aus der Zeitung vor, wie sie drunten im Saalkreise auf sein Betreiben eine Landmiliz ausrüsten? Und sagte der Vater nicht: Dieser Heinrich von Krosigk ist ein Mensch, auf den der ganze preußische Adel stolz sein kann? Meinst du, ich hätte nicht gesehen, wie glücklich du dabei aussahst? Denkst du, Kind, einer Mutter bleibt es verborgen, wenn ein Mann ihrer Tochter gefällt? Ich weiß es längst, wie es um dich steht. Darum möchte ich verhüten, daß du dich aus lauter Trotz und Sprödigkeit selbst unglücklich machst! Du bist leider, leider auf dem besten Wege dazu!«
Friederike sah eine Weile starr vor sich hin, dann schlug sie plötzlich beide Hände vor ihr Antlitz und brach in ein bitterliches Weinen aus. »Ach, Mutterchen, warum rühren Sie daran?« stieß sie schluchzend hervor. »Warum quälen Sie mich damit? Es ist ja nichts. Er mag mich ja gar nicht!«
Frau von Schurff war zunächst etwas erschrocken über diesen plötzlichen Gefühlsausbruch ihrer sonst so ruhigen und etwas verschlossenen Tochter. Dann aber brach ein Strahl warmer Liebe und Zärtlichkeit aus ihren Augen. Sie stand schnell auf, legte die Arme um den Hals Friederikes und rief: »Ach Kind, endlich, endlich! Wie bin ich glücklich, daß du mich einmal in dein Herz hineinsehen läßt! Du hast mich lange warten lassen.«
»Liebste, beste Mutter, ich konnte über solche Dinge nicht sprechen, ich bin nun einmal so. Aber ich wollte auch nicht sprechen. Ich habe gewartet, Tag für Tag, ob er wohl wiederkäme. Er kam nicht. So sollte es aus sein, ich wollte vergessen. Und ich muß es ja auch! Warum nachträglich noch darüber reden?«
»Dummes Mädchen,« sagte die Mutter und drückte sie kräftig an sich. »Was soll denn aus sein? Es geht ja erst an. Meinst du etwa, die Geheimrätin, seine Mutter, führe für nichts und wieder nichts über Groß-Salze? Es liegt nicht an ihrem Wege. Die sollte das Terrain sondieren, dazu war sie da. Du hast dir freilich die Sache bös verfahren, aber das läßt sich wieder zurechtziehen.«
Friederike löste sich sanft aus der Umarmung ihrer Mutter und erwiderte mit einem ungläubigen Lächeln: »Ach, Mutter, Sie täuschen sich. Meinen Sie, Krosigk würde seine Mutter schicken, wenn er um ein Mädchen werben will? Das sähe ihm ganz unähnlich. Wenn der das wollte, der käme selbst und schickte keinen andern.«
Die alte Dame lachte laut und kräftig auf und klopfte ihre Tochter auf die Wange. »Ach, du unerfahrenes Kücken!« rief sie. »Lehre du mich die Männer kennen! In Liebessachen sind die Tapfersten feig wie die Hasen. Der liebe Schurff, dein Vater, was war das für ein wilder Draufgänger! Der fürchtete sich vor dem Teufel nicht. Aber als er um mich werben wollte, stecke er sich doch hinter die alte Tante in Erxleben, und erst als er sicher wußte, daß ich nicht abgeneigt war, erst da kam er aus seinem Verstecke hervor. So sind sie alle, und dein Krosigk wird keine Ausnahme machen. Nur müssen wir ihn ermuntern, denn seine Mutter wird ihm mit ihrem Berichte nicht gerade viel Mut machen. Ich werde mich mal hinter meine gute Trotha in Hecklingen stecken. Die ist die Schwiegermutter seiner Schwester und kommt viel mit ihm zusammen. Er soll ja häusig dort sein. Die kann ihm das Nötige beibringen.«
»Mutter, um Gotteswillen, keine Avancen!« rief Friederike mit brennenden Wangen.
»Avancen? Gott bewahre!« erwiderte Frau von Schurff behaglich lächelnd. »So etwas traust du mir doch wohl im Ernst nicht zu. Aber was sich liebt, das soll sich finden, und wenn die Männer zu blöde sind, muß man sie auf ihr Glück darauf stupsen. Paß mal auf, mein Kind, du wirst einmal später deiner alten Mutter dafür danken. Und nun mach dir mal dein Haar ordentlich, du hast dich wohl vorhin nur sehr obenhin frisiert; ich schämte mich ein bischen vor meiner guten Krosigken, wie du so strubblich am Wagen standest. Nachher komm in die Küche, es gibt heute mit den Rebhühnern viel zu tun!«
Sie gab ihrer Tochter noch einen herzhaften Kuß und verließ das Zimmer. Auch während sie den Korridor und die Treppe hinabschritt, wich das behagliche Lächeln nicht von ihrem Antlitz. Sie hatte ja nun endlich Klarheit über eine Angelegenheit, die sie sehr bewegte, und noch dazu eine erfreuliche Klarheit. Daß der junge Krosigk ein Auge oder auch zwei auf ihre Tochter geworfen hatte, das war ihr keinen Augenblick zweifelhaft. Sie hatte genug gesehen, als er hier weilte, wenn es auch seltsam war und blieb, daß er sich seitdem nicht wieder hatte sehen lassen. Aber der Besuch seiner Mutter, die da so plötzlich wie aus heiterem Himmel ins Haus geschneit war, ließ doch für eine welterfahrene Frau nur eine Deutung zu. Schade, schade, daß Friederike sich so dumm benommen hatte; es würde immerhin Mühe kosten, den fatalen Eindruck zu verwischen. Woher nur das Mädchen das herbe und kühle Wesen hatte, das manchmal geradezu abstieß? Von ihr doch sicherlich nicht und vom lieben Schurff ebensowenig, denn der war ein lebendiger, vergnügter, im festen Glauben an Gottes weise Führung allezeit fröhlicher Mensch, trotz seiner grauen Haare. Wie würde der gute Mann sich freuen, wenn aus der Sache etwas werden sollte, denn der Krosigk gehörte unter die jüngeren Leute, die er am besten leiden konnte. Auch die äußeren Verhältnisse sprachen sehr dafür. Die Schurffs waren ja nicht arm, durchaus nicht. Aber die Zeiten waren schlecht und wurden immer schlechter, der Sohn bei der Armee kostete ein Heidengeld, und es waren drei Töchter zu versorgen, von denen freilich zwei, Minette und Luise, noch halbe Kinder waren. Heinrich von Krosigk aber, der Schloßherr auf Poplitz im Saalkreise, war eine der besten Partien des Herzogtums Magdeburg. Frau von Schurff wußte gar wohl, in wie vielen Familien des Landes er als Eidam höchlichst willkommen gewesen wäre. Ein bischen wild sollte er allerdings sein, ein bischen sehr wild sogar, aber, du lieber Gott, das gab sich schon in der Ehe und mit den Jahren. Und in allen den Geschichten, die man von ihm erzählte, war zwar von Duellen, tollen Ritten und heftigen Zechgelagen die Rede, aber zweierlei schien er total zu meiden, die Weiber und die Würfel. Das war sehr viel wert, denn an diesen beiden W hatte sie schon manchen Edelmann zu Grunde gehen sehen. Das dritte W, der Wein, erschien ihr nicht so gefährlich.
Sie begab sich sofort mit aller Eile, die ihre Würde als Edelfrau und Mutter ihr gestattete, in das Untergeschoß des Hauses, um den lieben Schurff mit der frohen Botschaft zu überraschen. Der saß um diese Tageszeit behaglich bei einem Schälchen Kaffee und studierte die Magdeburgische Zeitung. Zuweilen ließ er sie sich auch von seiner Lieblingstochter, dem braunlockigen Minettchen, vorlesen. Er konnte sie ganz ruhig in des Kindes Hand legen, denn in einem wohlregierten Staate merzte eine weise und fürsorgliche Zensur aus den Zeitungen alles aus, was dem Seelenheile eines sechzehnjährigen Mädchens allenfalls hätte Gefahr bringen können. Dazu pflegte er gewöhnlich seine kurze Pfeife zu schmauchen, in deren Tabak er des Wohlgeruches wegen stets einige getrocknete Wacholderbeeren mischte.
Heute aber fiel das Auge der eintretenden Gattin nicht auf das gewohnte Bild häuslicher Behaglichkeit. Von den Töchtern war keine im Zimmer, die Pfeife lag auf dem Erdboden, und ihr Mann saß in seinem Lehnstuhle, das Haupt zurückgelehnt und mit einem Ausdruck des Schreckens und des Schmerzes, den seine Frau noch niemals an ihm wahrgenommen hatte.
Aufs höchste bestürzt eilte sie auf ihn zu. Sie dachte an einen Schlagfluß. »Mein Gott, Mann, was ist dir!« rief sie und faßte seine Hand.
Der Major richtete sich auf, und eine große Träne rann über sein braunrotes Gesicht in den eisgrauen kurzen Schnurrbart. »Da lies selbst,« sagte er mit dumpfer Stimme und schob ihr mit zitternder Hand das Blatt hin. »Es hat dem Publikum nun nach sechs Tagen doch nicht mehr verheimlicht werden können,« setzte er bitter hinzu.
Die Zeitung brachte unter Trauerrand in kurzen Worten die Nachricht, daß am 11. Oktober Prinz Louis Ferdinand von Preußen bei einem unglücklichen Gefechte in der Gegend von Saalfeld gefallen sei.
Frau von Schurff war zunächst so erschrocken, daß sie gar nichts sagte. Dann fiel sie ihrem Manne um den Hals. Zu weinen vermochte sie nicht, die Tränen kamen ihr zu schwer, aber sie war aufs tiefste erschüttert. »Unser Prinz!« sagte sie leise. »Noch vor sechs Wochen habe ich in Magdeburg auf dem breiten Wege mit ihm gesprochen. Nun ist er tot! Der schöne, ritterliche Mann!«
Der Major fuhr sich über die Augen. »Er war mehr als das. Er war der Liebling des gemeinen Mannes, das glänzende Vorbild des Offizierkorps, alle Welt erwartete große Taten von ihm, und man durfte sie auch erwarten. Sein Tod wird lähmend, niederschmetternd wirken auf das Heer. Ach Frau, Frau, wie fängt dieser Feldzug an! Gott schütze Preußen!« Er erhob sich schwerfällig, stülpte die Mütze auf und ergriff den Krückstock. »Laß mich jetzt. Ich muß erst ruhiger werden, kann jetzt nicht darüber sprechen. Ich gehe in den Ellernschlag.« Und indem er ihr über das Haar strich und sich, zur Tür wandte, seufzte er noch einmal aus tiefster Brust: »Gott der Herr schütze Preußen!«
Frau von Schurff sah ihm vom Fenster aus nach, wie er, von seinen Hunden gefolgt, über die Stoppelfelder hinschritt. Es war nicht ihre Art, zu sinnen und zu grübeln, aber jetzt kam sie in ihrem Innern nicht los von der Frage, warum dieser bittere Wermutstropfen in den Freudenkelch gefallen sei, den sie ihrem lieben Manne hatte kredenzen wollen. War das eine Vorbedeutung? Jagte sie einem Traumbilde nach? Sollte aus der Verbindung, die sie wünschte, nichts werden, oder sollte ihre Tochter darin kein Glück finden?
Lange stand sie in tiefem Nachsinnen. Dann sprach sie leise vor sich hin: »Wie Gott will,« und ging, wenn auch noch mit bekümmerter Miene, doch mit erhobenem Haupte an ihre Arbeit.
II.
Herr August Christian Werkmeister, wohlbestallter Pfarrer zu Laublingen an der Saale, saß in seinem Studierzimmer und sann über seine Sonntagspredigt nach. Es war ein heller, freundlicher Oktobernachmittag, und die Sonne blickte strahlend durch die kleinen Fensterscheiben herein. Trotzdem brannte im Ofen ein mächtiges Feuer, und der geistliche Herr hatte den hageren Leib in einen dichten Schlafrock gehüllt und die Füße in große Pantoffeln vergraben. Denn er liebte die Wärme sehr und behauptete, daß ihm nur bei voller Behaglichkeit des äußeren Menschen erbauliche und fruchtbare Gedanken kämen.
Heute indessen schienen sie sich durchaus nicht herbeizaubern zu lassen. Was sollte man auch immer Neues sagen über die alten Evangelien, besonders wenn man ein strammer Nationalist war und von Wundern und Zeichen absolut nichts wissen wollte! Gerade die Erzählung von der Heilung des Gichtbrüchigen, die am nächsten Sonntage, dem neunzehnten nach Trinitatis, auszulegen war, bot für den vernünftigen und aufgeklärten Leser enorme Schwierigkeiten dar, Schwierigkeiten, die freilich der große Haufe der Beschränkten nicht ahnte, über die der feinere Geist sich jedoch nicht hinwegsetzen konnte.
Seufzend schloß er ein Fach seines Sekretärs auf, um nachzuforschen, was er früher über diesen Text gesagt hatte. Er sah die Predigten des vorvorigen Jahres durch, aber er legte sie sogleich zurück, denn der Herr Kantor hatte ein verwünscht gutes Gedächtnis, und es war ihm zuzutrauen, daß er die Wiederholung erkennen und deshalb in der Schänke mit anzüglichen Worten nach seinem Seelsorger zielen werde. Doch halt – vier Jahre vorher, als dieser Kantor noch nicht am Orte war, hatte er ja auch über das Evangelium predigen müssen. So griff er denn nach dem Jahrgange 1802 und fand bald, was er suchte. Aber während des Lesens verdüsterte sich sein Antlitz mehr und mehr. Die Predigt war zu schön gewesen, er entsann sich, sie hatte Eindruck gemacht, besonders die Verse aus Tiedges Urania, die er eingeflochten hatte. Er war sogar deshalb von der Patronatsherrschaft ausdrücklich angeredet und belobt worden. Durfte er es wagen, sie noch einmal aufzutischen? Zwar Herr Baron von Krosigk, so kalkulierte er, würde wohl schwerlich in der Kirche sein, denn mit dem war er seit einiger Zeit ziemlich zerfallen. Aber die beiden Schwestern des Patrons, Fräulein Antoinette und Charlotte, saßen regelmäßig noch im Gutsstuhle, und er entsann sich, daß die schwärmerische Charlotte damals eine Träne getrocknet hatte, als er auf Grund dieses Textes »Über den Wert der treuen Freunde, die uns zu Christus führen« gesprochen hatte. Fatal, sehr fatal, daß er nicht wußte, ob Charlotte gerade im Poplitzer Schlosse zugegen war, oder ob sie, wie in letzter Zeit häufig, ihrem jüngeren Bruder in Gröna haushielt.
Nein, er konnte es nicht wagen, das alles zum zweiten Male vorzubringen. Mißmutig schloß er den Schrank wieder zu, ließ sich noch einmal tief aufseufzend in seinen Sorgenstuhl nieder und blies so starken Dampf aus seiner langen Pfeife, daß er endlich in eine undurchdringliche blaue Wolke gehüllt dasaß.
Schon beschloß er, zum dritten Male seufzend, diesmal mit einem fremden Kalbe zu pflügen, und streckte die Hand nach seinem Bücherregale aus, um bei Spalding, Sack oder Reinhard eine Anleihe zu machen, als leise und schüchtern an der Tür geklopft wurde.
Auf sein »Herein« trat eine ärmlich, aber sauber gekleidete Bauernfrau in die Stube und blieb bescheiden am Eingange stehen.
»Sie ist es, Nageln,« sagte Werkmeister ziemlich ungnädig. »Ist es denn etwas Wichtiges? Weiß sie nicht, daß ich mich am Freitag nachmittags ungern stören lasse?«
»Ach, Herr Pastor,« erwiderte die Frau, »es ist nur wegen dem Briefe. Ich kann ja nicht mehr lesen, seit mir der Gasten ihre Kinder die Brille zerbrochen haben. Der Herr Pastor sollte doch einmal ein Einsehen haben und die wilde Brut« –
»Schon gut, schon gut,« wehrte Werkmeister ab. »Beschwere sie sich beim Schulmeister. Der mag die Bande durch den Backel im Zaume halten. Warum ist sie denn überhaupt nicht zum Kantor gegangen und belästigt mich mit ihrer Sache?«
»Der Herr Kantor ist nicht zu Hause.«
»Na, dann konnte sie ihn ja aus dem Wirtshause holen, wo er gewiß wieder herumflaniert,« versetzte der Pastor.
»In der Schänke ist er nicht, er ist auf dem Radeberg,« erwiderte die Frau eifrig. »Das ganze Dorf ist dort, der Schulze ist auch eben hingegangen. Man hört dort schießen von Halle her, es klingt wie Kanonen.«
Der Pastor lachte spöttisch. »In Kriegszeiten hört das Volk immer Kanonendonner. Wie sollte wohl der Napoleon nach Halle kommen! Das hat noch gute Wege. Es wird Hasenjagd sein beim Herrn von Rauchhaupt in der Trebitzer Flur, und alle die Abderiten halten das für Kanonenschüsse. Nun aber gebe sie ihren Brief her, ich will ihn ihr vorlesen. Gewiß wieder von der Großmutter in Dessau?«
»Diesmal nicht, Herr Pastor! Er ist von meinem Sohne Christian,« antwortete die Bäuerin. »Von Christian?« rief der Pastor interessiert und streckte geschwind die Hand aus. »Also ein Schreiben aus dem Felde? Da kann man ja etwas Neues erfahren. Gebe sie her. Setze sie sich.«
Die Frau nahm gehorsam auf einem Rohrstuhle in der Nähe des Pastors Platz und blickte ihn gespannt und etwas ängstlich von der Seite an. Werkmeister entfaltete den Brief, der mit einem Gothaischen Sechser zugesiegelt war, und las:
Blankenhayn, den 11. Oktober 1806.
»Sieh, sieh!« brummte er, »also schon sechs Tage alt, denn heute haben wir den siebzehnten.«
Geliebte Mutter!
Ich schreibe Euch diesen Brief aus dem Städtchen Blankenhayn im Weimarschen, woselbst wir heute mit Sr. Durchlaucht dem Herzog von Braunschweig hermarschiert sind. Der Weg war sehr schlecht, denn es hatte geregnet. Es heißt, die sackermenschten Franzosen währen nur noch ein paar Meilen von hier. Wenn wir nur erst an Sie heran währen, da wollten wir Ihnen schon zeichen, wo Barthel den Most hollt. Der König ist auch hier, ich habe ihn Selbst gesehen. Die Nächte sindt sehr kallt, wir frieren im Biwack an die Beine. Sonst bin ich gesund, was ich auch von Euch hoffe. Gelibte Mutter, womit das ich verbleibe
Ihr stäts dankbarer und liebender Sohn Christian Nagel, Gefreiter bei Alt-Larisch.
Nachschrift. Es sol gestern ein Gefecht gewesen sein und Prinz Louis soll erschossen sein. Aber ich glaubs nicht, Gott straf mich, ich glaub's nicht. Nachschrift: Sage Julichen, was auf dem Guhte in Poplitz ist, das ich sie schön grüßen lasse und das ich sie trei bleibe.
Dein
Der Obigte.
Der Pfarrer ließ den Brief sinken und blickte nachdenklich vor sich hin. »Es ist nicht viel Neues, was wir da erfahren,« sagte er. »Daß Prinz Louis gefallen ist, wissen wir ja nun sicher.«
»Ach Gott, ich bin ja nur froh, daß der Christian gesund ist,« rief die Frau und trocknete sich mit der Schürze die Augen.
»Ich will ihr wünschen, daß er noch gesund ist, denn seit sechs Tagen kann sich viel ereignet haben,« entgegnete der Pfarrer mit Nachdruck. »Ja, das wünsche ich ihr wirklich aufrichtig. Doch nun gehe sie, denn ich habe zu arbeiten.«
Die Frau entfernte sich mit vielen Dankesworten, und Werkmeister zündete sich seine Pfeife an, die während des Vorlesens kalt geworden war. Aber es war ihm nicht beschieden, zur ruhigen Ausarbeitung seiner Predigt zu gelangen. Denn gleich darauf steckte die Haushälterin, die ihm seit dem Tode seiner seligen Frau die Wirtschaft führte, den Kopf durch die Türspalte und rief mit ihrer kräftigen, schrillen Stimme: »Herr Pastor Moldenhauer aus Peißen und dessen Herr Sohn kommen aufs Haus zu.« Worauf sie eiligst verschwand, denn sie konnte sich in ihrer derangierten Toilette vor den geistlichen Herren unmöglich sehen lassen.
Pastor Werkmeister seufzte zum vierten Male an diesem Nachmittage und diesmal aus tiefster Brust. Die Störung war ihm unangenehm, der Besuch noch mehr. Zwar der alte Moldenhauer, der ging noch, mit dem war noch auszukommen, obwohl seine derbe Geradheit manchmal recht unangenehm war. Aber sein Sohn, ein Candidatus Theologiä, der vor kurzem erst von einer weiten Reise zurückgekehrt war und nun im Vaterhause auf eine Stelle wartete, dieser junge Mensch mit den scharfen Augen und der ebenso scharfen Zunge – der war ihm unausstehlich. Kaum ein paar Minuten konnte er ihn in seiner Nähe haben, so befand er sich auch schon in einem gelinden Wortwechsel mit ihm, denn in der ganzen Art des Kandidaten lag etwas, was ihm die Galle aufregte. Leider, ach leider hatte er sich neulich, als er erkrankt gewesen war, von ihm vertreten lassen, und da hatte der Kandidat so schön gepredigt, daß ihm der Patron, Herr von Krosigk, vor allen Leuten die Hand gedrückt und ihn höchlich gelobt hatte. Seitdem nannte Herr Pastor Werkmeister den Kandidaten einen Fuchsschwänzer, der nach seiner Stelle schiele, aber er tat es nur heimlich, denn es schien ihm gar nicht rätlich, mit dem jungen Manne anzubinden.
So wünschte er denn bei sich selbst den Besuch zu allen Teufeln, während er schnell seinen Schlafrock von sich warf, um in den schwarzen Rock zu schlüpfen. Leider aber hatte die Haushälterin, dieses liederliche, unzuverlässige Wesen, den Rock nicht wieder an seinen Ort im Schranke gehängt, und so stand er noch in Hemdsärmeln da, als kräftig an die Tür gepocht wurde und die beiden Moldenhauers, ohne sein Herein abzuwarten, in die Stube traten.
Der Alte schritt voran, ein stämmiger, rundlicher, munterer Greis, dessen volles schneeweißes Haar förmlich leuchtete, und von dessen behaglichem rosigem Gesichte mit den lebhaften blauen Augen ein heller Schein von Leben und Frische jedem entgegenstrahlte, der mit ihm in Berührung trat. Der viel jüngere Werkmeister sah mit seinem hagern, stubenfarbenen Antlitze ihm gegenüber geradezu alt aus. Hinter ihm trat der Sohn ins Zimmer. Er war nur wenig größer als sein Vater, aber der mächtige Kopf mit den scharf geschnittenen, von dunkelm, lang herabhängendem Haar umrahmten Zügen machte ihn zu einer auf den ersten Blick auffallenden und interessierenden Erscheinung.
Der alte Moldenhauer streckte dem verlegen umherfahrenden und nach seinem Rocke suchenden Hausherrn die Hand entgegen und rief in fröhlichem Tone: »Gott zum Gruße, Herr Bruder! Der Tausend, müssen Sie denn immer in Ihrem Baue stecken? Ich glaube. Sie wissen noch gar nicht, was draußen vorgeht.«
»Guten Tag, verehrter Herr Amtsbruder,« erwiderte der Angeredete, indem er in den glücklich gefundenen Rock hineinfuhr. »Sie haben mich überrascht. Bitte, nehmen Sie Platz, Sie auch, Herr Kandidat. Meine Haushälterin soll sogleich Kaffee und die Pfeifen –«
»Nichts da, nichts da!« sagte der Alte. »Wir wollen uns nicht aufhalten, wollen Sie mitnehmen. Kommen Sie mit uns auf den Radeberg. Es gehen große Dinge vor. Man hört dort ganz deutlich Kanonendonner aus Südosten.«
Werkmeister erblaßte. »Kanonendonner?« stotterte er. »Sie auch? Schon vorhin sagte mir eine Frau davon, ich glaubte es nicht. Sollte es wirklich an dem sein?«
»Es ist wahrhaftig und wirklich Kanonendonner,« versetzte der jüngere Moldenhauer kurz.
»Ach, sollten Sie sich nicht täuschen? Wie könnte denn so etwas in unsere Nähe kommen! Die Heere stehen, wie man weiß, in der Gegend von Weimar und Erfurt.«
»Nun, nahe braucht das nicht zu sein,« nahm der Alte das Wort. »Meine Mutter hat den Donner von Roßbach zwei bis drei Stunden hinter Halle gehört.«
»Jedenfalls riskieren Sie nichts, wenn Sie uns begleiten,« warf Moldenhauer der Sohn sarkastisch hin.
Werkmeister schleuderte ihm einen Zornesblick zu und errötete. Er war von Natur nicht beherzt und wußte das wohl, aber gerade deshalb verletzte ihn nichts so sehr, wie eine auch nur leise Anspielung auf seine Feigheit.
»Ich gehe mit Ihnen,« sagte er, zum Alten gewendet. »Denn Sie, Herr Bruder, sind ein Mann von Erfahrung, und wenn Sie mir sagen, daß es Kanonendonner ist, so will ich das glauben, während ich dem Urteile unerfahrener jüngerer Leute kein Gewicht beimesse. Sie entschuldigen, wenn ich mich drüben ankleide.«
Kaum war er zur Tür hinaus, so wandte sich der jüngere Moldenhauer mit der Miene höchster Verdrossenheit zu seinem Vater: »Was liegt dir daran, den faulen Patron aus seinem Hause aufzustören? Konnten wir nicht allein unseres Weges gehen?«
»Ich habe nachher noch amtlich mit ihm zu reden,« erwiderte der Alte in begütigendem Tone. »Das will ich auf dem Rückwege mit ihm abmachen. Er ist nun einmal mein Nachbar, wir sind vielfach auf einander angewiesen. Bedenke, daß er auch dein Nachbar wird, wenn du mein Substitut und später mein Nachfolger werden solltest, was Gott gebe.«
»Mir ist der Mensch wie Gift und Operment!« rief der Sohn und schlug heftig mit seinem Ziegenhainer, den er nicht beiseite gestellt hatte, gegen seine langen Stiefelschäfte.
»Du bist in allem zu hitzig und schießest über das Ziel hinaus,« verwies der Alte. »Was hat dir der Mann eigentlich getan?«
»Getan hat er mir nichts. Aber die Spinnen und Kröten haben mir auch nichts getan, und doch habe ich gegen sie von klein auf eine Aversion.«
»Das ist so ungerecht, daß ich dich tadeln muß,« sagte der Vater, und sein Gesicht rötete sich. »Ich gebe zu, der Bruder ist bequem und weich, wie ich es an einem Manne nicht liebe. Er ist auch eitel, eitler noch, als sein Vorgänger, der selige Inspektor Lange, den Lessing so greulich heruntergeputzt hat. Aber wer hätte nicht seine Fehler? Wir haben sie auch, mein lieber Sohn, und es ist nicht unseres Amtes, einen fremden Knecht zu richten. Wir sollen vielmehr die Fehler unserer Nächsten tragen und sie mit Sanftmut bessern. Siehst du,« schloß er mit einem halben Lächeln, »deshalb bin ich auch hier eingekehrt, um den unverbesserlichen Stubenhocker ein Weilchen an die frische Luft zu führen.«
Der Sohn war während dessen aufgestanden und ans Fenster getreten. Erst nach einer kleinen Pause erwiderte er ruhig und ohne Schärfe: »Es liegt mir fern, mit dir zu streiten, lieber Vater. Seine Bequemlichkeit und Eitelkeit sind es überdies nicht, die ihn mir widerwärtig machen. Darüber kann ich mich sogar hin und wieder ergötzen. Viel schlimmer ist in meinen Augen seine Feigheit, am schlimmsten die – ja, wie soll ich sagen – die Ungeradheit seines Charakters, wovon ich schon früher und jetzt, trotz meiner kurzen Anwesenheit, Proben erhalten habe.«
Der Alte öffnete eben den Mund zu einer Erwiderung, als der Gegenstand des Gespräches ins Zimmer trat. Bei seinem Anblicke brach Moldenhauer senior in ein lautes, herzliches Lachen aus, und auch Moldenhauer junior konnte ein Lächeln nicht verbergen. Denn Pastor Werkmeister hatte sich ausgerüstet wie zu einer Fahrt nach Sibirien. Die dicken Beinkleider steckten in hohen Stulpenstiefeln, ein schwerer Tuchrock fiel bis über die Knie herab, eine pelzverbrämte Mütze trug er auf dem Kopfe und war eben bemüht, ein unendlich langes, wollenes Halstuch in immer neuen Windungen um den dünnen Hals zu legen.
Die Schwäche Werkmeisters war seinem Amtsbruder bekannt; sagte doch der Volkswitz der Gegend, daß der Laublinger Pastor seine Röcke und Hosen nicht nach dem Maße, sondern nach dem Gewicht kaufe. Trotzdem konnte er sich nicht enthalten, zu sagen: »Aber lieber Bruder, Sie sehen ja aus, als wollten Sie in den grimmigen Januar hinaus.«
»Sie haben gut reden«, entgegnete Werkmeister, indem er große wollene Handschuhe über seine Finger streifte. »Sie sind ein kerngesunder Mann, dem nichts fehlt, als zuweilen ein Schnupfen. Ich aber habe alle Augenblicke das Reißen und böse Flüsse in den Gliedern.«
Dem jungen Moldenhauer schwebte die Bemerkung auf der Zunge: »Wenn Sie sich vernünftiger kleideten, würde wohl das Reißen ausbleiben.« Aber er unterdrückte sie aus Achtung vor seinem Vater und folgte den beiden schweigend die Treppe hinab, redete auch nicht in die amtlichen Gespräche hinein, mit denen die Geistlichen sich den Weg durchs Dorf und den Feldweg entlang würzten.
Als man die Anhöhe erreicht hatte, begann die Volksmenge sich bereits zu zerstreuen; nur hie und da standen noch Gruppen beisammen, in denen das aufregende Ereignis mit wichtigen Mienen und kräftigen Worten besprochen wurde. Fast alle waren der Meinung, daß die Affäre sehr weit entfernt sein müsse und in der Tat hörte man nur ganz schwach ein dumpfes Grollen, das immer mehr zu ersterben schien. Desgleichen waren alle überzeugt, daß der Napoleon wahrscheinlich irgendwo von der glorreichen preußischen Armee geschlagen worden sei und sich nun auf dem kläglichen Rückzuge befinde. Als der Schneider von Beesen sich erfrechte, das nicht für ganz sicher zu halten, gab es heftiges Geschrei, und beinahe wäre er zur größeren Ehre des Vaterlandes verprügelt worden. Nur das Erscheinen der geistlichen Herren wandte dieses traurige Schicksal von ihm ab, doch steht zu befürchten, daß es später in der Schänke ihn doch noch ereilte.
Die beiden Pastoren traten zu den Leuten heran und knüpften ein Gespräch mit ihnen an, während der jüngere Moldenhauer, mit beiden Händen auf seinen Stock gestützt, vornübergebeugt in die Ferne schaute. »Wer naht sich denn dort?« rief er plötzlich und deutete mit der Hand nach Osten. Drei Reiter kamen in sausender Karriere den welligen Hügel herabgesprengt, der die Grenze des Horizontes bildete.
»Weiß Gott,« sagte der Schulze von Beesen nach einer kleinen Pause, »es ist der Herr Baron. Er reitet wieder einmal wie der Teufel.«
Pastor Werkmeister zupfte seinen Amtsbruder am Ärmel. »Natürlich der Krosigk,« raunte er ihm ärgerlich zu, »und natürlich nicht wie ein vernünftiger Mensch auf Weg und Steg, sondern gerade durch über Stock und Stein. Ich empfehle mich, Herr Amtsbruder, ich habe in letzter Zeit mancherlei Irrungen mit ihm gehabt und habe keine Lust, mit ihm hier zusammenzustoßen.«
»Ach was, dageblieben!« sagte der alte Pastor lachend. »Was sollen denn die Leute denken, wenn Sie so davonlaufen! Glauben Sie etwa, der Baron wird Ihnen hier eine Szene machen? Da kennen Sie ihn schlecht. Er hält auf Autorität.«
In der Tat hätte Werkmeister auch kaum noch Zeit gefunden, seinen Rückzug mit Anstand anzutreten, denn die Reiter waren im Nu heran. Alle Häupter entblößten sich, als der stolze, hochgewachsene Mann seinen schweißbedeckten Fuchs auf dem Hügel zum Stehen brachte.
»Gott mag wissen, wo das Gefecht stattgefunden hat, Leute,« sagte er mit sonorer, weithin hallender Stimme. »Man kann nichts erkunden, es scheint nördlich von Halle zu sein. Keine Hauptschlacht – da hätte es ganz anders gewettert – aber doch immer ein ernsthaftes Gefecht.« »Gott gebe, daß es für unsere Waffen siegreich gewesen ist!« sprach Pastor Moldenhauer mit lauter Stimme.
»Amen!« rief Krosigk und ritt an die Pfarrer heran. Wertmeisters Verbeugung erwiderte er nur mit einem kurzen Lüften seines runden Hutes, dagegen streckte er dem alten Moldenhauer die Hand weit entgegen. »Mein lieber Pastor, ich freue mich, Sie zu sehen. Sie waren vorgestern bei mir und haben mich verfehlt. Hatten Sie ein spezielles Anliegen oder wollten Sie mir nur eine Visite machen?«
»Ich wollte um den patronatlichen Konsens gehorsamst bitten, meinen Sohn Philipp zu meinem Substituten machen zu dürfen.«
Der junge Moldenhauer trat nun auch mit ein paar raschen Schritten näher und nahm den Hut ab. »Ah,« rief Krosigk, »da ist ja auch der Herr Sohn! Seine Predigt hat mir gut gefallen, ich hab's ihm ja schon gesagt.« Er sprang vom Pferde und reichte dem Kandidaten die Hand, während er wieder mit der ihm eigenen kurzen Bewegung den Hut lüftete. »Breitmann, komm her, führe das Pferd,« wandte er sich an seinen Reitknecht, der hinter ihm hielt. »Sie, meine Herren, begleiten mich ein Stück. Also, mein Herr Kandidat, Sie wollen Ihres Vaters Substitut und Nachfolger werden?« Er faßte ihn an einem Knopfe seines Rockes und sah ihm mit seinen blitzenden braunen Augen scharf ins Gesicht. »Reden können Sie, das habe ich gehört. Sie predigen gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Kopf und Lunge – alles gut. Bei wem haben Sie in Halle besonders Kollegien gehört?« »Am meisten und am liebsten bei Professor Schleiermacher.«
»So, so, Schleiermacher. Habe auch von ihm gehört, er soll ein ausgezeichnetes Genie sein. Reil hat mir von ihm erzählt. Kennen Sie Reil?«
»Von Ansehen,« erwiderte der Kandidat, »sonst war ich nicht an ihn rekommandiert.«
»Schade, hätte Sie rekommandieren können. Er ist der klügste von der ganzen Gesellschaft in Halle. Wann haben Sie das Examen gemacht?«
»Vor drei Jahren, Herr Baron.«
»Und seitdem waren Sie Hofmeister bei Prenzlau? Wie ich hörte, auch lange auf Reisen gewesen? Wo waren Sie denn?«
»Wir sind zwei Jahre im Auslande gereist. Erst in der Schweiz, dann in Italien, längere Zeit in Paris, von da nach Holland, einige Monate in England und über Hamburg zurück.«
Der Edelmann blieb erstaunt stehen und schlug ihn mit der Hand auf die Schulter. »Dann sind Sie ja ein Wundertier! So weit ist kein Mensch herumgekommen in der ganzen Gegend. Wie lange sind Sie in Paris gewesen?«
»Länger als ein halbes Jahr.«
»Und wie ich Sie taxiere, haben Sie sich Menschen und Dinge mit scharfen Augen angesehen?«
»Ich habe mir wenigstens alle mögliche Mühe gegeben, die fremden Zustände und Institutionen kennen zu lernen und zu verstehen,« antwortete der Kandidat bescheiden.
Krosigk nickte und sah ihn wieder scharf prüfend an.
»Sie gefallen mir!« rief er und faßte ihn abermals an dem Rockknopfe an. »Sie haben mir gleich beim ersten Anblicke gefallen. Ich glaube, Sie sind mein Mann. Wollen Sie mir einen Dienst erweisen?«
»Gewiß, wenn es in meiner Macht steht.«
»Es steht in Ihrer Macht.« Er wandte sich rasch um. »Breitmann, steige von deinem Pferde ab!« befahl er. »So, du kannst die halbe Stunde zu Fuße gehen. And nun, Kandidate, man rin in den Sattel!«
Moldenhauer sah ihn überrascht an. »Ich soll auf dieses Pferd?«
»Warum nicht? Sie sind ja ein Staatsreiter. Ich sah Sie gestern dahinpreschen auf Ihres Vaters alter Rosinante, daß ich mich des Todes verwunderte.«
»Ich holte den Doktor zu einem kranken Kinde,« warf der Kandidat ein.
»Alle Achtung, alle Achtung!« fuhr Krosigk fort, ohne den Einwurf zu beachten. »Wer den alten, faul gewordenen Klepper zu solchen Sprüngen herankriegt, der muß ein Reiter comme il faut sein. Also steigen Sie getrost auf. Breitmann, halte den Bügel!«
»Wohin wollen Sie mich führen, Herr Baron?« fragte der Kandidat lachend, indem er den Fuß in den Steigbügel setzte.
»Direkt in das Schloß meiner Väter,« versetzte Krosigk. »Sie kommen sobald nicht wieder fort. Sie sollen mir erzählen von dem Korsen und seinem Reiche, denn was man von dort her hört, ist meist halber Schwindel. Die einen färben aus blindem Haß alles schwarz, die andern sehen alles rosig, weil sie den Kerl vergöttern.« Er schwang sich leicht in den Sattel und bot dem Pastor Moldenhauer die Hand, die der Alte kräftig schüttelte, während Werkmeister ganz verblüfft und mit etwas einfältigem Gesichte zur Seite stand.
»Herr Pastor!« rief Krosigk, »ich entführe Ihnen Ihren Sohn. Doch verpflichte ich mich bei den Gebeinen Karls des Großen, ihn in drei Tagen in eigener Person in Ihrem Pfarrhause wieder abzuliefern. Haben Sie dagegen etwas einzuwenden?«
»Immer rasch von Entschluß! So kennt man Sie, Herr Baron!« erwiderte der muntere Greis mit Lachen. »Warum denn nicht? Mir kann's recht sein, wenn der Junge will.«
»Mit Vergnügen,« sagte Moldenhauer junior.
»Das ist schön! Da wären wir ja d'accord,« rief Krosigk. »Also Adieu, mein Herr Pastor. En avant!«
Er trieb seinen Gaul an und jagte, ohne des Weges zu achten, über den Stoppelacker; dicht hinter ihm ritt der Kandidat; ein geraumes Stück von beiden, entfernt folgte der Jäger Schröder. Über einen ziemlich breiten Graben setzten die Reiter glatt hinweg.
Werkmeister sah es von ferne und entsetzte sich. »Um Gotteswillen, Herr Bruder, was sind das für Geschichten! Was soll ein Kandidat der Theologie auf dem Pferde! Sehen Sie nicht? Er kann den Hals brechen!«
»Mein Sohn ist beim Oberamtmann Flügge viel geritten und sitzt gut im Sattel. Er wird nicht gleich herunterfallen,« entgegnete der alte Pastor kaltblütig.
»Und haben Sie keine Sorge um das, was ihm auf dem Schlosse passieren kann?« fuhr Werkmeister fort. »Man erzählt ja Wunderdinge von dem, was dort getrunken wird. Dem Krosigk soll es keiner darin zuvortun im ganzen Saalkreise, und es soll ihm ein ganz absonderliches Amüsement sein, seine Gäste unter den Tisch zu trinken.«
»Man spricht ja viel, was nicht ganz wahr ist,« sagte Moldenhauer. »Ich pflege von dem, was mir die Leute erzählen, stets die gute Hälfte abzuziehen. Übrigens ist mein Sohn ein alter Konstantist von Halle, der schon etwas verträgt. Auch ist er kein Kind mehr und weiß, was er sich und seinem Stande schuldig ist. Und was den Baron betrifft, so hat man ihm viele Tollheiten, aber nie etwas Schlechtes nachgesagt. Im Gegenteil, es weiß jeder, daß er das Herz auf dem rechten Flecke hat, wenn auch sein wilder Mut und seine unbändige Lebenskraft sich hie und da in einem tollen Streiche austoben. Er ist ja noch ein junger Mann, kaum neunundzwanzig. Noch Most, aber es kann sehr guter Wein daraus werden. Also lassen wir sie in Gottes Namen zusammen reiten.«
III.
Dem Kandidaten der Theologie Moldenhauer war es zu Mute wie einem fahrenden Ritter, der in ein wundersames, reizvolles Abenteuer hineinreitet. Schon im Sommer war er von seiner Reise zurückgekehrt und war kurz darauf aus seiner Informatorstelle ehrenvoll entlassen worden, da der junge Mann, den er begleitet hatte, eines Lehrers und Mentors nicht mehr bedurfte.
Seitdem saß er auf der Pfarrei seines Vaters und hatte wenig zu tun, denn der rüstige Greis vermochte sein Amt trotz seiner siebzig Jahre noch ganz wohl selbst auszufüllen. Als der Krieg ausgebrochen war, hatte er versucht, eine Stelle als Feldprediger zu erhalten, aber sein Gesuch war ohne Antwort geblieben. Nun vertrat er oft seinen Vater oder einen benachbarten Pfarrer in ihren Amtsgeschäften, hielt sich auch häufig in Halle auf, um seinen verehrten Lehrer Schleiermacher zu hören, an den er sich mit der ganzen Glut seines Herzens angeschlossen hatte. Dazwischen las er viel und studierte eifrig, aber das alles befriedigte ihn nicht. Er sehnte sich nach einer Tätigkeit, die seine Kräfte anspannte, sein Leben ausfüllte. Aber wie sollte er sie finden? Noch einmal Informator werden, noch einmal als schlecht bezahlter Diener sich unter fremde Menschen ducken und schmiegen? Er hatte gerade genug davon. Oder sich um eine Pfarre bewerben? Das war fast aussichtslos, wenn nicht ein Zufall zu Hülfe kam; denn damals geschah es wohl, daß die alten Kandidaten einem hohen Konsistorio ihre grauen Haare einsandten, zum Beleg dafür, wie lange sie schon auf eine Stelle warteten. Wurde er Substitut seines Vaters, so hatte er wenigstens sichere Anwartschaft auf eine Pfarre, und da der Alte mit dem Gedanken umging, sich pensionieren zu lassen, so hatte er dem Drängen der Eltern nachgegeben und sich beworben. Aber jede Unterbrechung seines allzu stillen und einförmigen Lebens war ihm willkommen, und die plötzliche Einladung des Barons war ihm mehr als das, sie erfüllte ihn mit freudigem Stolze.
Denn Heinrich von Krosigk war zwar ein leutseliger und höflicher Herr, aber er machte es selten einem leicht, an ihn näher heranzukommen. So wenig er von junkerlichem Hochmut an sich hatte, so freundlich er mit jedermann, selbst mit den Ärmsten und Geringsten sprach, so wenig war sein Wesen dazu angetan, jemanden zur vertraulichen Annäherung zu ermutigen. In der ganzen Haltung seiner hohen Gestalt, in dem Ausdrucke des schönen, strengen Antlitzes mit den scharfen, klaren Augen lag etwas Gebietendes, unwillkürlich Respekt Einflößendes, dem sich selbst seine Standesgenossen beugten. Im geheimen freilich schüttelte mancher über ihn den Kopf, und besonders die alten und älteren Damen des Landadels hielten zuweilen ein scharfes Gericht über ihn, wenn sie unter sich waren. Denn was für ein unerklärlicher, seltsamer Mensch war er doch! Obwohl er schon weit über ein Jahr den Abschied genommen hatte und die großen Güter nach dem Tode seines Vaters bewirtschaftete, hatte er sich noch immer nicht umgesehen unter den Töchtern des Landes und behandelte alle jungen Damen seines Kreises mit der gleichen höflichen Kälte. Merkwürdiger Weise hörte man auch von keiner unstandesgemäßen Liaison – der Mann schien ein vollkommener Weiberfeind zu sein. Zwei seiner Schwestern hielten ihm abwechselnd Haus, und seine Mutter kam zuweilen von Halberstadt oder Gröna, um nach dem Rechten zu sehen – der Platz an seiner Seite blieb leer. Das war gewiß merveillös; wer konnte wissen, ob nicht ein Geheimnis dahinter steckte! Aber bedenklicher noch, geradezu skandalös und ridikül war der Geschmack, den er bei der Wahl seiner Freunde bewies. Zwar daß er mit denen von Wedell auf Piesdorf und mit dem von Trotha auf Gänsefurth, seinem Schwager, freundschaftlichen Verkehr pflog, das war ganz in der Ordnung. Aber was sollte man dazu sagen, daß der Sproß des ältesten und reichsten Geschlechtes im Saalkreise mit bürgerlichen Gelehrten in vertrautem Umgang stand! Da war zum Beispiel ein Arzt aus Halle, ein Professor Reil, häufiger Gast auf dem Poplitzer Schlosse, und man sagte, daß der Baron mit ihm oft bis Mitternacht beim Steinweine zusammensitze. Der Mann sollte ja nun freilich eine Berühmtheit sein, aber du lieber Gott, was wollte das besagen! Für einen Krosigk schickte sich der Verkehr trotz alledem ganz und gar nicht, und wie konnte ein Offizier des Königs und großer Grundherr überhaupt Gefallen finden an der Unterhaltung mit solch langweiligem Federfuchser und Büchermenschen!
Hätte Heinrich von Krosigk diese Urteile erfahren, so würden sie ihm sicher das größte Vergnügen bereitet haben. Denn der Standeshochmut war ihm greulich zuwider, so stolz er auf seinen alten Adel war, und wenn er den engen und beschränkten Geistern ein Ärgernis geben konnte, so gewährte ihm das eine besondere Herzensfreude. Aber jeder hütete sich, ihm derartiges zu sagen, weil er eine gar zu unangenehme Art hatte, unberufene Mahner und Berater abfallen zu lassen.
Übrigens schadete das Gezischel der alten Tanten und Basen seiner Stellung unter den Adeligen des Kreises gar nichts. Er hatte wenige nähere Freunde, aber überall, wo er erschien, übte er durch die Wucht seines geschlossenen Wesens einen bedeutenden Einfluß aus und spielte auf den Ständetagen eine große Rolle. Erst neulich hatte er durch seine feurige Beredsamkeit den Adel des Saalkreises dazu vermocht, dem Könige die Ausrüstung einer Landmiliz anzubieten, und der Monarch hatte den Antrag seiner getreuen Ritterschaft mit gnädigem Danke angenommen. Dadurch war der Name Heinrichs von Krosigk in der ganzen Provinz bekannt geworden; auch die selbst lau und lässig waren, rühmten seine Tatkraft und seine königstreue Gesinnung. Der Kandidat war freilich der Meinung, der König werde solcher Hilfe gar nicht bedürfen, sondern allein mit den Franzosen fertig werden. Aber der Opfermut, der lebendige patriotische Eifer, der aus Krosigks Vorgehen sprach, hatten eine helltönende Saite in seiner Brust berührt. Er fühlte sich mächtig hingezogen zu dem Manne, der ihn so plötzlich in seine Nähe gestellt hatte und neben dem er jetzt dahinritt.
Nach kurzer Zeit bog der Baron von den Feldern ab und ließ sein Pferd mit einem Sprunge über den Graben auf die breite Straße setzen, die nach dem Schlosse führte. Dann zügelte er den raschen Lauf des Tieres und schlug ein gemächliches Tempo an.
»Wir wollen,« sagte er zu dem jungen Manne, der ihm gefolgt war, »nachher gleich einen Diener nach Peissen schicken, der Wäsche, Bücher und was Sie sonst brauchen und haben wollen, für Sie herüberbringt. Sie sollen einige Tage bei mir leben und werden sich, wie ich hoffe, wohlfühlen.«
»Sie sind sehr gütig, Herr Baron, und ich weiß nicht, welchem Umstande ich eigentlich so viele Freundlichkeit verdanke,« erwiderte Moldenhauer bescheiden.
»Ich sagte Ihnen ja, Sie gefallen mir!« rief Krosigk. »Wissen Sie, mir geht es mit den Menschen eigentümlich. Es begegnet mir hin und wieder einer, der mir auf den ersten Anblick sympathisch ist, und dann wieder einer, den ich nicht ausstehen kann. Zu dem einen zieht mich etwas Unerklärliches hin, zu dem anderen kann ich mir beim besten Willen kein Herz fassen. Und was das Sonderbarste ist: diese innere Stimme hat mich noch nie betrogen. Mit Ihnen habe ich übrigens noch etwas Besonderes vor, was Sie nachher gleich erfahren werden. – Was ich noch sagen wollte, ehe ich's vergesse: Lassen Sie sich Ihren schwarzen Rock mit herüberkommen. Mir sind Sie so lieber, aber ich habe heute eine kleine Gesellschaft am Abend. Der Landrat ist da und einige andere Herren. Wissen Sie, welchen Gedenktag ich heut feiere?«
»Nein.«
»Nun, dann kann es Ihnen nachher der Schröder erzählen. Er wird auf Ihr Zimmer kommen, um Ihre Befehle entgegenzunehmen. Er ist sehr redselig und lügt nur wenig. Ich mag Ihnen die Geschichte nicht selbst berichten, denn man soll von seinen Taten so wenig wie möglich reden. Aber erfahren sollen Sie es doch, damit Sie im Bilde sind.«
Sie waren während dieser Unterhaltung die große Nußbaumallee entlang geritten, die direkt auf das Schloß zuführte. Der einfache, aber geräumige und vornehme Bau, in dessen Fenstern sich die Abendsonne spiegelte, lag dicht vor ihnen. In der Reitbahn vor dem Hause stand eine große Menge jüngerer Leute, Knechte, Tagelöhner, Förster, Bediente, in Gruppen beieinander. Als die beiden Reiter sichtbar wurden, erschollen kurze Kommandorufe, und die Männer begannen sich in Reihen aufzustellen.
»Das sind meine Leute, die ich zur Landmiliz ausgemustert habe,« sagte Krosigk. »Ich will sie nachher dem Landrate vorstellen; er kommt deshalb etwas eher, als die übrigen Gäste. Es sind weit über hundert Mann aus meinen Dörfern. Sehen Sie mal, was für prächtige Kerls darunter sind, die geborenen Grenadiere!« Er nahm die Meldung eines graubärtigen Försters entgegen und ritt dann freundlich grüßend an den Reihen hinab. »Laß er die Leute abtreten, aber paß er auf, wenn der Wagen des Herrn Landrats kommt. Dann wird sofort angetreten!« befahl er und schwang sich vor dem Hause aus dem Sattel. Der Kandidat folgte seinem Beispiele, und der Jäger Schröder führte mit einem rasch herbeispringenden Stallburschen die Tiere hinweg.
Als die beiden die Stufen der hohen Freitreppe erstiegen hatten, öffnete sich die Tür des Hauses, und sie standen einer jungen Dame gegenüber. Sie war eine hohe, schlanke Erscheinung, und man hätte sie eine vollendete Schönheit nennen müssen, wenn nicht der Kopf etwas zu groß, der Ausdruck des Gesichtes etwas zu herrisch gewesen wäre. Der Schnitt des Profils, die großen, braunen Augen, der feine Mund – alles das war den Gesichtszügen des Barons so ähnlich, daß jeder in den beiden auf den ersten Blick Geschwister erkennen mußte.
»Ich bringe dir hier den Kandidaten, Antoinette, dessen Predigt dich neulich so enchantiert hat,« sagte der Baron.
Das Mädchen zog unwillkürlich die dunkeln Brauen ein wenig zusammen und errötete leicht. Wie konnte nur ihr Bruder dem jungen Manne da gleich sagen, wie sie sich über ihn geäußert hatte; der mochte sich ja daraufhin irgend eine Schwachheit einbilden! Sie erwiderte daher die respektvolle Verbeugung Moldenhauers nur mit einem etwas hochmütigen Neigen des Hauptes und versetzte in kühlem Tone: »Die Predigt war wirklich exzellent, und wenn sie ganz auf eigenem Acker gewachsen war, so sage ich, daß Sie Ihr Metier verstehen.«
»Aber gnädiges Fräulein!« rief der Kandidat, ganz verblüfft von so viel Offenheit, und errötete nun seinerseits sehr stark.
Der Baron lachte. »Eine Schmeichelei war das nicht gerade, liebe Demoiselle Soeur! Der Herr Kandidat könnte sich billig beleidigt fühlen, wenn du ihm ein Plagiat zutraust.«
Sie zuckte die Achseln. »Natürlich liegt es mir fern, den Herrn irgendwie zu beleidigen. Ich meine, ein Prediger muß seiner Gemeinde das Beste bieten, was er kennt. Findet er das einmal bei einem anderen, mein Gott, warum sollte er es nicht benutzen? Meinen Sie nicht auch, Herr Kandidat?«
Moldenhauer bekam einen ganz roten Kopf. »Nein, mein gnädiges Fräulein,« erwiderte er mit großer Entschiedenheit. »Sie verzeihen, daß ich ganz entgegengesetzter Meinung bin. Ein Prediger muß aus seinem Innersten heraus reden, sonst ist seine Sache nichts. Wer sich Flicken und Lappen von anderen borgt, der ist ein armseliger Wicht.«
Das Fräulein wollte sich zu einer Entgegnung anschicken, aber ihr Bruder unterbrach sie, indem er noch stärker lachte. »Wenn ihr disputieren wollt, so geht wenigstens ins warme Zimmer,« rief er. »Die Treppe ist dazu doch zu kühl und zugig. Auch muß es wohl nicht gleich in der ersten Minute sein! Wie?«
Das Fräulein und der Kandidat lächelten nun auch; sie fühlten beide, daß ihr Eifer eine etwas komische Situation geschaffen hatte. Antoinette streckte dem jungen Manne die Hand entgegen und sagte: »Mein Bruder hat recht. Wir haben uns ja eigentlich noch gar nicht »Guten Tag« gesagt. So heiße ich Sie denn in unserem Hause willkommen. Ich hoffe, Sie nachher noch zu sehen, wenn ich zurückkehre.«
»Der Kandidat bleibt einige Tage hier,« bemerkte der Baron.
»So?« sagte das Fräulein nicht eben überrascht, denn solche plötzliche Einladungen kannte sie schon an ihrem Bruder. »Dann können wir uns ja noch tüchtig die Meinung sagen. Jetzt aber muß ich praktisches Christentum üben. Ich gehe zu meinen Kranken.« Sie reichte ihrem Bruder die Hand und neigte wieder das Haupt gegen den Kandidaten, diesmal aber mit einem freundlichen Blicke. »Einstweilen Adieu. Au revoir!«
Mit leichten, graziösen Schritten stieg sie die Treppe hinab; der Kandidat sah ihr in Gedanken versunken nach.
»Kommen Sie,« sagte Krosigk und faßte ihn am Arme. »Ich will Sie selbst auf Ihr Zimmer führen; nachher mag Schröder bei Ihnen antreten. Bitte, hier herein. Gesegnet sei Ihr Eingang!« Er schüttelte ihm die Hand mit kräftigem Drucke.
Ein weiter, geräumiger Vorsaal nahm die beiden auf. Rings an den Wänden hingen von oben bis unten Bilder der Ahnen des Krosigkschen Hauses, die Männer im Prunkharnisch und Allongeperücken, die Damen in der reichen und bunten Tracht, wie sie vor hundert und mehr Jahren bei den Vornehmen Mode gewesen war.
Den Kandidaten überkam eine Kindheitserinnerung. »Hier bin ich schon einmal gewesen,« sagte er. »Es mögen nun wohl zwanzig Jahre her sein, da hatte mich mein Vater mit herübergenommen. Ich durfte mit dem kleinen Junker Ernst, Ihrem Bruder, spielen, und bekam dann Schokolade, was mir etwas ganz Neues war. Ist der Herr Leutnant jetzt bei der Armee?«
»Mein Bruder Ernst ist zur Zeit noch in Spandau, hofft aber sehnlichst, bald mit ins Feld zu rücken.«
»Wenn er nur nicht zu spät kommt!« bemerkte der Kandidat. »Die Würfel dürften wohl in den nächsten Tagen fallen. Vielleicht sind sie schon gefallen.«
Krosigk nickte. »Das ist auch seine Sorge. Ich meine aber, es wird auch nach einer Schlacht auf deutschem Boden der Krieg noch lange nicht zu Ende sein. Den Bonaparte und seine Nation schlägt man nicht mit einem Schlage nieder. Bitte, hier links. Sie sollen oben wohnen.«
Der Kandidat setzte eben den Fuß auf die unterste Stufe, als aus einer Tür rechts seitwärts wieder ein junges Mädchen heraustrat. Sie machte den Herren eine tiefe Verbeugung und eilte dann leichtfüßig dem Ausgange zu. Sie trug ein weißes Tuch über dem Kopfe, so daß man wenig von ihrem Gesichte erblicken konnte, aber an dem rötlich blonden Lockenhaare, das unter dem Spitzenüberwurf hervorquoll, hatte der Kandidat sie trotzdem erkannt. Mit der Miene höchster Überraschung starrte er dem Schloßherrn ins Antlitz.
»Wundert Sie so, daß Mamsell Lisette Schicht in meinem Hause ist?« fragte Krosigk mit einem halben Lächeln.
»Wenn ich offen sein soll, ja, Herr Baron,« entgegnete der Kandidat mit einem tiefen Atemzuge.
»Was tut sie denn hier?« »Sie ist seit einigen Tagen eine Art von Stütze oder Gesellschafterin meiner Schwester.«
»Herr Baron«, sagte Moldenhauer mit gedämpfter Stimme, »kennen Sie nicht die Gerüchte, die in der Gegend über sie verbreitet sind? Für eine Pastorstochter sind sie nicht eben rühmlich, und ihr Vater, der selige Schicht, würde sich wohl in seinem Grabe in Laublingen umdrehen, wenn er sie hören könnte.«
»Der gute Mann braucht sich nicht zu derangieren und kann ruhig liegen bleiben,« erwiderte der Baron. »Die Tochter ist nämlich ein ganz braves Frauenzimmer.«
»Aber es wird doch allgemein gesagt, sie hätte in sehr intimem Verhältnisse mit dem verstorbenen Amtmann in Brumby gelebt, bei dem sie früher Wirtschafterin war?« warf Moldenhauer ein. »Und die Schwester des Amtmanns, die verwitwete Amtsrätin in Beesen, hat diesen Gerüchten auch nie widersprochen.«