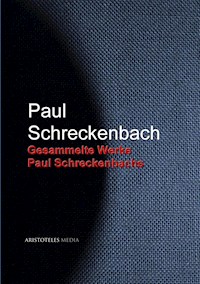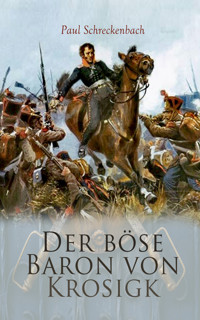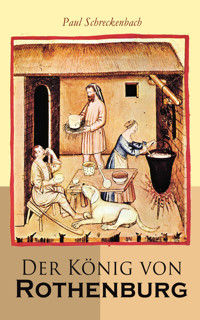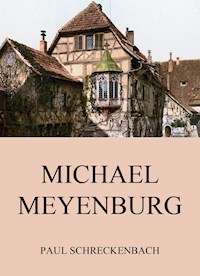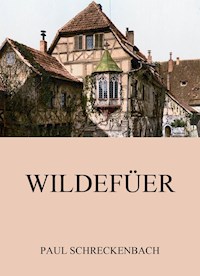Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zum wenigsten zwischen Saalfeld und Halle ist keine schönere Maid zu finden als Ihr. Dabei habt Ihr mit zweiundzwanzig Jahren noch keinen Mann. Warum weist Ihr alle Freier ab?« »Weil der Rechte noch nicht darunter war.« »Und wie müßte der wohl beschaffen sein?« rief der Graf. Gertrudis blickte ihn schelmisch von der Seite an. »Nehmt einen Spiegel, Graf Günther,« sagte sie, »und schaut hinein. Da könnt Ihr's sehen.« »Donner und Hagel!« brummte der Graf, »Ihr seid ein Kobold. Ich dachte, Ihr wäret eine ernsthafte Jungfrau, die eine rechte Antwort hätte auf eine rechte Frage, die ich in freundlicher Meinung tat. Warum foppt Ihr mich?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Schreckenbach
Die letzten Rudelsburger
Roman aus dem Mittelalter
idb
ISBN 9783962249731
Erstes Buch
I.
Auf der Bastei des Schlosses Dornburg, die am weitesten an den steilen Felsenabhang vorgeschoben war, stand eine hochgewachsene Jungfrau im Reitkleid und wehendem Federhut und blickte gedankenvoll ins Land hinaus. Der Burgherr, Graf Günther von Schwarzburg, hatte ihr soeben die Befestigungen gezeigt, die rund um das Schloß auf seinen Befehl neu ausgeführt waren, und sie hatte die starken Mauern mit denen ihres heimatlichen Bergschlosses verglichen. Der Vergleich hatte sie befriedigt. Was auch die Schwarzburger taten, ihre Dornburg unbezwinglich zu machen, so fest wie die Rudelsburg wurde sie doch niemals, und ihr Vater, der Edle Werner Kurtefrund, gebot noch immer über die gewaltigste Feste weit und breit. Darum hatte während des ganzen Rundganges ein Leuchten des Triumphes in ihren großen stahlblauen Augen gestanden.
Jetzt war sie allein, denn ein Diener hatte den Grafen abgerufen. Ihre Blicke hafteten nun nicht mehr an dem Mauerwerk, auf dem sie stand, sie waren vielmehr einem merkwürdigen Schauspiele zugewendet. Der mächtige, burggekrönte Berg, der Dornburg schräg gegenüber lag, begann mit einem Male in den Strahlen der Abendsonne zu glühen. Erst fuhr ein schwaches Rosenrot darüber hin, aber bald wurde die Farbe tiefer, leuchtender, gesättigter, und in Kürze sah es aus, als stünde der ganze Berg von oben bis unten in feuriger Glut.
Die Jungfrau war schon einige Male auf der Dornburg eingekehrt, aber diese Erscheinung hatte sie noch nie gesehen. Kein Wunder, daß ihr darob ein Ausruf des Staunens entfuhr.
»Ja,« sagte der Graf, der wieder zu ihr getreten war, »da verwundert Ihr Euch wohl, Gertrudis? Wer das noch nicht gesehen hat, verwundert sich immer, wenn er's zum ersten Male schaut.«
Das Mädchen nickte. »Es sieht prächtig aus. Ist das öfters so?«
»Nur an ganz hellen Tagen. Dann sagt das Volk: 'Der Berg gleißt', und mich will bedünken, er habe seinen Namen 'Gleißberg' wohl davon erhalten. Am schönsten funkelt er im Winter, wenn er im Schnee steckt. – Übrigens,« setzte er hinzu und blickte sie mit einem listigen Lächeln von der Seite an, »es läge wohl in Eurer Hand, auf diesem Feuerberg als Herrin zu thronen.
Die Lippen des Mädchens schürzten sich unmutsvoll, und zwischen ihren Brauen erschien eine kleine Falte. »Aber Graf Günther,« sagte sie, »was habe ich Euch getan, daß Ihr mit in das Horn meines Oheims, des Schenken, blaset? Wißt Ihr nicht, daß mir der plumpe Gleißberger zuwider ist?«
»Nein, das wußt' ich in Wahrheit nicht, sonst hätt' ich nichts gesagt,« erwiderte der Graf. »Aber da wir einmal davon reden und ich mir den Mund verbrannt habe, so will ich mir ihn gründlich verbrennen. Seht, ich kannte Euch schon, Gertrudis, als Euch die Zöpfe noch nicht über die Hüften herabhingen, sondern so lang waren wie mein Daumen. Ich bin vierundvierzig Jahre alt, also doppelt so alt wie Ihr, könnte fast Euer Vater sein und bin Eures Vaters günstiger Freund. Darum vergönnt mir die fürwitzige Frage: Warum heiratet Ihr nicht?«
Gertrudis blickte ihn verwundert an. »Wie kommt Ihr darauf?«
»Potz Wetter!« polterte der Graf. »Wie kommt Ihr darauf? Ist das eine so verwunderliche Frage? Hab' ich Euch zugemutet, nach Jerusalem zu fahren? Ist es nicht der Lauf der Welt, daß eine Jungfrau heiratet, wenn sie in die rechten Jahre kommt? Die meisten heiraten ja schon, ehe sie zwanzig sind, ja schon mit sechzehn und siebzehn! Ihr seid lange schon flügge. Warum seid Ihr nicht ausgeflogen?«
Die Jungfrau schwieg und sagte dann schalkhaft trocken: »Nehmt an, es hat mich noch keiner gemocht bis hierher.«
Der Graf lachte. »Haltet Ihr mich für einen Narren, daß Ihr mir das aufbindet? Die Leute nennen Euch landauf landab die Perle des Saaltales, und, weiß Gott, sie tun recht daran. Zum wenigsten zwischen Saalfeld und Halle ist keine schönere Maid zu finden als Ihr. Dabei habt Ihr mit zweiundzwanzig Jahren noch keinen Mann. Warum weist Ihr alle Freier ab?«
»Weil der Rechte noch nicht darunter war.«
»Und wie müßte der wohl beschaffen sein?« rief der Graf.
Gertrudis blickte ihn schelmisch von der Seite an. »Nehmt einen Spiegel, Graf Günther,« sagte sie, »und schaut hinein. Da könnt Ihr's sehen.«
»Donner und Hagel!« brummte der Graf, »Ihr seid ein Kobold. Ich dachte, Ihr wäret eine ernsthafte Jungfrau, die eine rechte Antwort hätte auf eine rechte Frage, die ich in freundlicher Meinung tat. Warum foppt Ihr mich?«
Das Mädchen wandte ihm das Gesicht zu und sah ihn mit klaren, ruhigen Augen an. Dabei sagte sie ohne jede Verlegenheit und ohne daß sich ihre Wangen auch nur im geringsten tiefer färbten: »Das ist nicht gefoppt, das ist die volle Wahrheit. Ihr sagt selber, daß Ihr noch einmal so alt seid wie ich, außerdem seid Ihr Gatte und Vater und lebt glücklich mit Eurer schönen Frau. Darum sage ich's Euch ohne Scheu: Ihr seid der beste Mann, den ich je gesehen, und wer mich heimführen will, der muß Euch ähnlich sein, sonst bleibe ich bis zu meinem Tode auf der Rudelsburg oder gehe nach Weißenfels ins Kloster.«
»Himmel!« rief der Graf und fuhr sich durch sein schon stark gelichtetes Haupthaar. »Ihr redet Dinge, werte Gertrudis, die einem alten Esel warm machen können.«
»Ihr aber bleibt kühl, weil Ihr keiner seid,« versetzte die Jungfrau. »Ich bin für Euch zehn oder zwölf Jahre zu spät geboren.«
»Oder ich zwölf Jahre zu früh,« knurrte der Graf.
»Würfelt es aus, ob ich zu früh oder Ihr zu spät geboren seid,« erwiderte Gertrudis mit leichtem Spottlächeln. »Aber ehe Ihr hingeht und das tut, sagt mir, was sich dort auf der Landstraße heranwälzt. Ist das ein Heerhaufe?« Sie beschattete die Augen mit der Hand und wies nach Süden, von wo offenbar ein großer Menschentroß herangezogen kam. Vorläufig war noch wenig zu erkennen, denn eine gewaltige Staubwolke wandelte vor der Masse her.
Vom Turme herab ertönte in diesem Augenblicke ein schmetternder Hornruf, zum Zeichen, daß auch der Wächter da droben etwas Verdächtiges wahrgenommen hatte.
Der Graf hatte sich weit über die Brüstung vorgebeugt und blickte gespannt die Straße entlang. »Kriegsvolk?« murmelte er. »Nein, eher ein Städtlein, das auswandert. Es sind Weiber dabei, auch Kinder. Ah, jetzt erkenne ich, was das bedeutet.«
«Nun, was meinet Ihr?« fragte Gertrudis und wandte sich dem Grafen zu, in dessen männlich offenes Angesicht plötzlich ein Zug des Widerwillens, ja des Ekels getreten war.
»Seht die blutroten Fahnen und die Heiligenbilder,« sagte er. »Es sind Geißler. Sie ziehen von Ort zu Ort und kasteien sich und reißen sich mit ihren Drahtpeitschen die Rücken blutig. Dadurch wollen sie erwirken, daß der liebe Herrgott das große Sterben aufhören lasse, das in deutschen und welschen Landen umgeht und so viele Menschen dahinrafft.«
Das Gesicht der Jungfrau wurde düster. »Im Städtlein Camburg sind mehr als dreißig Menschen daran gestorben, im Dorf unter der Saaleck zehn. Aber meint Ihr nicht, daß die Seuche bald erlöschen wird?«
Der Graf seufzte. »Ich fürchte eher, sie hat noch nicht recht angefangen bei uns und wird noch manch ein Opfer kosten. Es ist eine böse, betrübliche Zeit, in der wir leben. Heuschrecken und Erdbeben plagen die Menschen und nun die Pest, die sie den schwarzen Tod nennen. – Aber dieses Unwesen,« er wies auf die unten Vorüberziehenden, »wird Gottes Zorn nicht versöhnen. Täten die Menschen ihre Sünden und Bosheiten ab, vielleicht würde er dann zur Gnade gestimmt.«
»Ihr möget nicht unrecht haben,« erwiderte Gertrudis nachdenklich. »Aber seht!« rief sie laut. »Wen führen die Leute dort gefangen mit sich? Seht, auf dem Karren dort – ein junger Mann in Pilgerkleidung, aber mit Stricken gefesselt an Händen und Füßen!«
»Das wird wohl der Hauptnarr sein unter den Brüdern, der sich so gebunden durchs Land schleppen läßt, um Gott durch seine Martern zu preisen.«
»Das glaub' ich nicht. Seht, wie traurig er das Haupt gesenkt hält!«
»Verlangt Ihr, vieledle Jungfrau, daß einer fröhlich blickt, der solche Narretei im Kopfe hat?« spottete der Graf.
Gertrudis antwortete nicht sogleich. Dann atmete sie mit einem Male tief auf und sagte mit großer Entschiedenheit: »Wenn ich Ihr wäre, Graf Günther, so ritte ich jetzt da hinunter und machte den unglücklichen Menschen frei.«
»Damit mich der Unglückliche auslache oder gar grob auffahre? Nein, überlasset die Narren sich selber. Doch seht, sie biegen von der Straße ab, wollen nach Dorndorf hinüber. Ihr könntet wahrlich, wenn Ihr nach der Tautenburg reitet, mit ihnen zusammentreffen. Da will ich Euch lieber noch ein halb Dutzend Gewappnete mitgeben zu Euren Knechten.«
»Und es wird die höchste Zeit, daß ich aufbreche,« rief die Jungfrau. »Schon ist die Sonne gesunken, und bald kommt die Dunkelheit.«
»Ihr seid, wenn Ihr wollt, in einer halben Stunde drüben. Doch ist's wohl besser, daß ich Euch nicht aufhalte. So kommt denn in den Hof, wo Eure Gäule schon gesattelt stehen.« –
Kurze Zeit danach ritt Gertrudis mit zehn gewappneten Knechten über die Zugbrücke der Dornburg. Im Tore hatte sie sich vom Pferde herniedergebeugt und einem etwa sechzehnjährigen Jungen einen Kuß auf die Wange gedrückt. Denn der blonde Knabe war ihr Bruder, der am Schwarzburger Hof ritterliche Zucht und Sitte lernte und vor einigen Tagen mit dem Grafen von der Burg Greifenstein hierher gekommen war. Wesentlich seinetwegen war sie herübergeritten von der Tautenburg, wo sie mit ihrem Vater bei dem mächtigen Schenken und seiner edlen Gemahlin als Gast weilte.
Obwohl nur noch das Haupt des hohen Gleißberges im Abendlichte funkelte und aus den Wiesengründen zu beiden Seiten der Saale schon die Nebelschwaden emporstiegen, ließ Gertrudis ihr Roß in gemächlicher Gangart dahintraben. Sie wollte mit den Landfahrern nicht gern zusammentreffen. Der Anblick hatte sie unfroh gemacht, sie mochte ihn nicht noch einmal haben. Die Leute hatten einen weiten Vorsprung und würden, so dachte sie, jedenfalls bei dem Dorfe Steudnitz von ihrem Wege abbiegen und die Stadt Camburg zur Nacht zu erreichen suchen. Dann konnte sie ihnen nicht mehr begegnen.
Aber als sie in Dorndorf einritt, sah sie zu ihrer peinlichen Überraschung, daß sie sich in ihrer Annahme geirrt hatte. Die Wallfahrer schienen an ein Weiterziehen nicht zu denken, sondern sich das Dorf zur Nachtruhe ausersehen zu haben. Ihre Karren waren auf den Dorfwegen aufgefahren, und ein Teil von der Schar schien eben im Begriff zu stehen, eines ihrer düsteren Bußexerzitien zu beginnen. Denn ein großer, hagerer Mann, seinem Gewand nach ein entlaufener Mönch, hatte sich auf einen Stein geschwungen und hielt ein halb zerrissenes, stark beschmutztes Pergamentblatt hoch empor. Vor ihm standen im Halbkreise etwa vierzig Männer mit entblößten Oberkörpern, Ledergeißeln mit kleinen scharfen Eisenspitzen in den Händen tragend.
Gertrudis und die Knechte hatten ihre Rosse unwillkürlich zum Stehen gebracht. So widerwärtig sie die Szene berührte, so kam doch die Neugier über sie, was nun wohl geschehen werde. Auch lagen auf der Landstraße betende Frauen und Kinder in Menge auf den Knien und hemmten die Reise. Sie brauchte nicht lange zu warten. Der Mann auf dem Stein stieß einen Laut aus, der an den Ton einer zersprungenen Posaune erinnerte, schwenkte das Schriftstück wild in der Luft umher und schrie endlich mit vor Erregung und Anstrengung heiserer Stimme: »Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth und dreimal gebenedeiet die Mutter Gottes, die süße Jungfrau Maria! Amen! Brüder und Schwestern! Dies ist ein Brief, geschrieben vom hochheiligen Erzengel Michael und vom Himmel zur Erde gefallen bei der Stadt Rom im Lande Italien am Anfang dieses Jahres, da man schreibet das dreizehnhundertsiebenundvierzigste Jahr seit der Geburt unseres Herrn und Seligmachers Jesu Christi. Darin steht, daß Gottes Zorn die ganze Menschheit habe ertöten wollen um ihrer großen, unmenschlichen Sünde willen. Aber die allerheiligste Jungfrau habe vorgebeten, und so wolle uns Gott noch einmal gnädig sein, ob wir schon alle den Tod reichlich verdient hätten. Wir sollen aber unser Fleisch abtöten und uns martern und geißeln bis aufs Blut, und wir sollen die Juden allüberall zu Tode bringen, die schuldig sind an unseres Heilands bitterem Tod. So laßt uns büßen, büßen für unsere und aller Welt Sünde und dann den Sohn Belials, der in unsere Hand gefallen ist, mit Feuer verbrennen!«
Er riß einem, der neben ihm stand, ein Holzkruzifix aus der Hand und hielt es hoch empor. Auf dieses Zeichen stürzten die vierzig Büßer auf die Knie und begannen aufeinander loszuschlagen, indem die ganze Versammlung in dumpfem, heulendem Ton ein Bußlied anstimmte, das also begann:
Nun hebet auf eure Hände, Daß Gott das große Sterben wende! Nun hebet auf eure Arme, Daß sich Gott über uns erbarme! Kyrie eleison.
Dazu erklang vom Turm des nahen Kirchleins her, den einer der Wallfahrer erstiegen hatte, das scharfe, schrille Wimmern eines Glöckchens. Von Ekel und Grauen übermannt, trieb Gertrudis ihr Roß zum Vorwärtsschreiten an und wandte die Augen beiseite. Aber da ward ihr ein Anblick, der ihr Entsetzen einflößte. Der junge Mann, dessen Geschick schon auf der Dornburg ihr Mitleid erweckt hatte, stand da, gefesselt an den Stamm einer alten Weide. Um ihn herum hatte man Reisig aufgehäuft bis zur Mitte seines Leibes, und ein ungeschlachter Geselle, der aussah wie ein Schindersknecht, schwenkte eine brennende Fackel in bedenklicher Nähe des dürren Holzes.
Ohne sich zu besinnen, trieb die Jungfrau ihr Pferd an den Holzstoß heran und herrschte den Fakelträger an: »Was soll das? Was willst du dem Manne hier antun?«
Der Mensch grinste und erwiderte dann in unterwürfigem Tone: »Ein Jude, Herrin, den wir am Wege fanden, wo er den Brunnen bei Borsindorf an der alten Schenke vergiften wollte. Solche Teufelsbraten auszurotten, hat uns die heilige Jungfrau geboten.«
»Ist es so, wie dieser sagt?« wandte sie sich an den Gefesselten. Der hatte seine Augen auf ihr Antlitz gerichtet und sah sie an wie wohl ein in schwerer Sünde Sterbender auf ein Gnadenbild der heiligen Jungfrau blicken mag, von dem er Rettung erhofft vom ewigen Tode.
Dieser verzückte Blick, in dem sie las, daß er sie wie ein himmlisches Wunder betrachtete, jagte ihr mit einem Male das Blut ins Gesicht, und in plötzlicher Verwirrung fragte sie noch einmal mit fliegendem Atem: »Sprecht! Redet der da die Wahrheit?«
Der Gefesselte schüttelte das Haupt. »Lüge!« stöhnte er. »Ich bin ein Deutscher aus Mailand, reise zum Erzbischof von Magdeburg – bin überfallen am Wege–« Er schloß die Augen und konnte vor Erschöpfung nicht weiter sprechen.
»Herrin,« sagte der Fackelträger, »glaubt ihm nicht. Er ist ein Jude. Seht das schwarze Haar und die schwarzen Augen.«
»Die haben auch andere Leute,« sprach Gertrudis. »Ist das alles, was gegen ihn zeugt?«
Da drückte sich ein anderer heran. »Er hatte ein schwarzes Pulver bei sich in einer Flasche,« rief er. »Damit wollte er wohl gerade das Wasser vergiften, wie es die bösen, meineidigen Juden tun.«
»Das war kein Gift,« murmelte der Gefangene. »Es war ein Heilmittel. Hilfe! Rettet mich!« Wieder schlug er die Augen auf und sah sie starr an.
Die Jungfrau richtete sich hoch auf im Sattel. Sie war mit einem Male entschlossen, dem Gesindel seine Beute zu entreißen. Darum rief sie laut und hart: »Das Gericht auf diesem Grund und Boden gehört meinem Ohm, dem edlen Schenken von Tautenberg, nicht landfahrendem Volke. Wolfram und Enke, löst die Stricke, nehmt den Mann aufs Pferd, und dann vorwärts zur Tautenburg!«
Die Rudelsburger Knechte waren gewohnt, den Befehlen ihrer Herrin blindlings und aufs Wort zu gehorchen. Darum wurde trotz des drohenden Murrens und Schreiens der Umstehenden der Gefesselte sofort befreit und auf ein Pferd gehoben, und als der Fackelträger zu dem Manne auf dem Stein sprang und der den Bußgesang jählings unterbrach, war der reisige Zug durch kreischend auseinanderstiebende Weiber und halbwüchsiges Volk schon weiter geritten. Geheul und Gebrüll, Verwünschungen und Flüche folgten ihm, auch einige Steine wurden den Abreitenden nachgeschleudert. Aber sie erreichten ihr Ziel nicht. In scharfem Trabe ritt die Schar durch das Dörfchen Steudnitz die Bergstraße hinan, die nach Tautenburg führte, und bald leuchteten ihr aus der Halbdämmerung heraus die gastlichen Lichter des altersgrauen Schenkenschlosses entgegen.
II.
»Blitz und Strahl! Wen bringst du mir da, Mädchen?« rief eine Stimme aus dem Dunkel des kleinen Burghofes, als Gertrudis mit ihren Knechten durch den Torweg geritten war und nun vom Rosse stieg. Der Mann, dem diese Stimme gehörte, kam eilends herbei. Es war der Schenk Rudolf selbst, ein starker, untersetzter Mann mit energischen Zügen und einem großen Kopfe, den er meist ein wenig in den Nacken zurückgelegt trug. Etwas Selbstbewußtes, Gebietendes lag in seiner ganzen Erscheinung, und das war kein Wunder, denn der Tautenburger war einer der reichsten und mächtigsten Ritter in Thüringen. Um seine Freundschaft warben Grafen und hohe Herren.
»Wer ist das?« fragte er und deutete mit weitausgestreckter Hand auf den Mann in zerrissenem Pilgerkleid, der trotz seiner Erschöpfung aus dem Sattel geglitten war und versucht hatte, dem Fräulein beim Absteigen behilflich zu sein.
»Ein Unglücklicher, Ohm, der auf Eurem Gebiete beinahe den Tod erlitten hätte,« erwiderte sie und berichtete dann kurz, was vorgefallen war.
Der Schenk schüttelte den Kopf und runzelte die Stirn. »Wer sagt dir, Kind, daß diese Leute nicht recht hatten?«
Gertrudis nahm ruhig einem der Knechte das Licht aus der Hand und hob es hoch empor, so daß es auf die Züge des Fremden fiel.
»Seht selbst,« erwiderte sie. »So sieht kein Jude aus, der als feiger Mörder durchs Land streift.«
»Wahrlich nein!« versetzte der Schenk erstaunt.
Er war fast zurückgefahren vor dem scharfen, glänzenden Blicke des Mannes, der ihn plötzlich traf. »Wer seid Ihr, guter Freund?« fragte er nun höflicher, als es sonst seine Art war.
»Ich heiße Nikolaus Kyburg, bin ein freier Bürger aus Mailand.«
Der Schenk hob verwundert das Haupt.
»Mit diesem Namen ein Mailänder?«
»Mein Vater zog mit König Heinrich dem Lützelburger nach Welschland und blieb dort hängen.«
«Und was seid Ihr, und wo wollt Ihr hin?«
»Ich bin ein Arzt und wollte zum hochwürdigen Herrn von Magdeburg.«
Der Schenk musterte die schlanke, sehnige Gestalt von oben bis unten. »Ihr seht eher aus wie einer, der Wunden schlägt, als der sie heilt,« brummte er.
»Auch das kann ich, Herr. Ich war durch Jahre ein Kriegsmann. Gebt mir Schwert und Harnisch, so will ich für Euch kämpfen. Denn was Eure Tochter getan hat, macht mich zu Eurem Mann.«
»Sie ist nicht meine Tochter – leider, und was aus Euch wird, das muß der morgende Tag ausweisen. Ihr seht nicht aus wie ein Schelm, aber wenn die Wallfahrer kommen und Euch schwerer Tat bezichten, so werdet Ihr Eure Unschuld verteidigen müssen vor einem Gericht geschworener Männer. Für jetzt weise ich Euch ein Gemach an und gebe Euch Herberge und Zehrung. Wilke, führ' ihn ins Turmstübchen. Und nun komm, Gertrudis, das Essen wartet auf uns!«
Die Jungfrau wandte sich zum Gehen, warf aber vorher noch einen Blick auf den Fremdling und neigte gegen ihn fast unmerklich das Haupt. Der aber ließ sich auf seine Knie nieder, erfaßte ihre Hand und küßte sie. Das alles geschah mit dem Anstand eines höfischen Ritters.
»Ich danke Euch, edle –« begann er, aber Gertrudis entzog ihm hastig ihre Hand und eilte mit brennendroten Wangen ins Haus. Verwundert folgte ihr der Schenk mit langen Schritten.
Kyburg stand auf und schaute ihr nach wie einer Erscheinung. Da löste sich aus dem Dunkel eine Gestalt und trat auf ihn zu. Es war ein riesiger Mann von hagerem Gliederbau. Sein Gesicht glich merkwürdig dem eines großen Raubvogels, und wen er mit seinen hellen Habichtsaugen so recht ansah, den überlief leicht ein Frösteln.
»Ihr seid Arzt? Wo lerntet Ihr die Kunst? In Welschland?« fragte er mit einer Stimme, die noch tiefer und dumpfer klang als die des Schenken.
»Nein, edler Herr, bei denen, die mehr davon verstehen als alle Menschen, bei den Arabern.«
In den Augen des langen Ritters blitzte ein grelles Licht auf. »Wie kamt Ihr dahin?«
»Ich ward gefangen auf einem griechischen Schiff und war vier Jahre lang der Handlanger des weisen Muley Hassan in Cordova. Dann gelang mir's, zu entkommen.«
»Habt Ihr auch sonst etwas erlernt von der Wissenschaft jenes Volkes?«
«Nicht wenig, Herr.«
»Auch von der, die Alchymie heißt?«
»Auch davon etwas.«
Der Lange blickte ihn durchbohrend an. «Gut, gut!« sagte er dann, wandte sich und verschwand ohne ein weiteres Wort im Hause.
»Kommt!« mahnte Wille der Knecht. »Ich will Euch führen, wie es der Herr befohlen hat.«
»Um Christi Tod – wer war das?« fragte Kyburg und faßte des Knechtes Arm mit festem Griff.
Der alte Wilke blickte sich scheu um und flüsterte dann: »Das war Herr Werner Kurtefrund von der Rudelsburg, der Vater der edlen Jungfrau, mit der Ihr gekommen seid.«
Kyburg fuhr überrascht empor. Das zu hören, hatte er am wenigsten erwartet. «Wächst auch eine Rose auf dem Stamme der knorrigen Kiefer?« murmelte er.
»Redet nichts,« sagte der Knecht ängstlich, »Herr Kurtefrund hört und sieht durch sieben Mauern. Kommt, folgt mir hier die Stufen in die Höhe.« -
Einige Minuten später saß Kyburg in dem mittleren Gemach des hohen Burgfriedes. Vor ihm stand ein Teller mit kaltem Fleisch und ein dicker, bauchiger Krug, gefüllt bis fast an den Rand mit nicht sehr edlem Wein. Wenigstens verzog er, als er einen tiefen Schluck genommen, fast schmerzhaft den Mund und sprach seufzend vor sich hin: »O Italien, was ist alles Barbarengetränk gegen die Weine, die in deiner Sonne reifen!« Das hinderte aber nicht, daß er in Bälde einen zweiten, nicht minder gewaltigen Schluck zu sich nahm, denn immerhin däuchte ihm der säuerliche Wein besser als gar keiner, und er war durstig wie noch nie in seinem Leben. Denn hinter ihm lag seines Lebens heißester und bösester Tag. Er hatte wahrlich viel durchgemacht an Fährnissen, Kämpfen und Nöten in den dreizehn Jahren, seit er als Achtzehnjähriger aus der Klosterschule ausgebrochen war, um in die Welt zu fahren. Mit breiter Wunde auf der Brust hatte er auf einem Schlachtfeld Ungarns gelegen, hatte in einem Tiroler Burgverließ gesessen, in Tunis gefesselt auf dem Sklavenmarkte gestanden. Aber so nahe einem grauenvollen Tode war er noch nie gewesen wie heute. Die frommen Landstreicher, in deren Hände er gefallen war, hatten ihn ausgeplündert bis auf das elende Pilgergewand, das er auf dem Leibe trug und dessen Heiligkeit die Kerle nicht respektiert hatten. Sein Leibgurt mit den Goldmünzen und Silberstücken war fort, die Tasche mit dem Briefe des Bischofs von Brixen, der ihn dem Magdeburgischen Kirchenfürsten empfahl, war gleichfalls verschwunden, und vor allem fehlte das Fläschchen mit dem schwarzen Staube, dessen geheimnisvolle Eigenschaften ihn dem Erzbischof mehr empfehlen sollten als alle bischöflichen Schreiben der Welt. Er konnte ihn ja wieder herstellen durch seine Kunst, aber würde er nun dazu überhaupt wieder Gelegenheit finden, würde der Magdeburger ihn, den landfahrenden Bettler, der ihm nicht bekannt war, über seine Schwelle lassen? Vorläufig war er noch nicht einmal außer Gefahr. Die Bande konnte ihm nachziehen, ihn hart verklagen, ihn vor ein Gericht bringen, dessen Spruch immerhin zweifelhaft war. Was galt ein Menschenleben in dieser Zeit, wo täglich Hunderte an der Seuche starben und Fehde und Krieg in allen Landen war? Nun vollends das Leben eines Fremden, der zwar der Sprache des Landes von Kind auf kundig war, aber weit und breit keinen Menschen kannte, der für ihn bürgen, auf den er sich berufen könnte! Das Volk war halb wahnsinnig aus Angst vor der Pest und glaubte fest daran, daß die Ungläubigen im Lande, die Juden, sie durch Vergiftung der Brunnen herbeigeführt hätten. Darum fiel man überall her über das ungläubige Volk und brachte es unter Martern zu Tode, und wer in Verdacht kam, zu ihnen zu gehören oder auch nur mit ihnen in Verbindung zu stehen, der mußte sich vor dem wütenden Volkshaufen vorsehen. Würden die Richter, vor denen er vielleicht schon morgen stehen mußte, Vernunft und Kaltblütigkeit bewahren?
Er ließ sich auf den harten Estrich nieder und faltete die Hände. »Sankt Jakobus von Compostela,« betete er, »du hast mich so oft trefflich beschützt, hilf mir aus dieser schweren Gefahr! Komme ich wieder zu Gelde, so soll's dein Schaden nicht sein. Ja, führst du mich an mein Ziel, so will ich dir ein Kirchlein bauen mit einer ewigen Lampe, die immerdar brennen soll zu deinem Ruhm!«
Dann erhob er sich stöhnend, denn seine geschundenen Glieder schmerzten ihn sehr, besonders die Gelenke, wo die Fesseln gesessen hatten. Er aß von dem Brote und dem Fleische und trank von dem Weine, starrte ins Licht und dachte über sein Schicksal nach, und dabei tauchte immer wieder das stolze Gesicht des Mädchens vor ihm auf, das ihm heute wie ein Engel des Himmels erschienen war. Auch als er eine Stunde später auf dem harten Lager in der Ecke in Schlummer gesunken war, sah er sie vor sich, wie sie zürnend und hoheitsvoll vom Pferde herab den Befehl gab, ihn zu befreien.
Währenddessen wurde drüben im Pallas über sein Geschick verhandelt. Die beiden Ritter saßen nach dem Mahle noch allein bei einem Kruge rheinischen Weines in ernstem Gespräch beisammen. Denn nicht zur Kurzweil war Werner Kurtefrund zu seinem Vetter und Freunde, dem Schenken, herübergeritten. Schon seit längerer Zeit gab er sich Mühe, einen Bund der benachbarten Ritter und Herren gegen seine alte Feindin, die Stadt Naumburg, zusammenzubringen. Bei den meisten war ihm das leicht gefallen, denn den Herren war nichts lieber, als wenn irgendwo eine tüchtige Fehde aufbrannte, bei der man auf reiche Beute hoffen durfte. Nur der Schenk hatte bisher zögernd beiseite gestanden, und doch war an ihm dem Rudelsburger am meisten gelegen, da er so viele Reiter ins Feld stellen konnte wie vier oder fünf andere der kleinen schloßgesessenen Herren. Wieder und wieder war er deshalb zu ihm geritten, und heute war es seiner schlauen Beredsamkeit endlich gelungen, die Zweifel und Bedenklichkeiten des Tautenburgers zu zerstreuen. Der Schenk sah ein, daß man die reich und immer reicher werdenden Krämer beizeiten ducken müsse, ehe sie allzu mächtig wurden. »Sollen wir uns,« hatte Kurtefrund gerufen, »ein Erfurt oder gar ein Nürnberg vor der Nase aus der Erde emporwachsen lassen? Sollen wir zusehen, wie die Gewandschneider und Waidfärber, die Bierbrauer und Bäcker und Fischer mählich der Gegend Herren werden? Das mag der Teufel wollen!«
Solche Worte waren bei dem Schenken auf guten Boden gefallen, denn er war ein stolzer Landherr und den handelnden und handwerktreibenden Leuten hinter den Stadtmauern im tiefsten Herzen abgeneigt. So hatte er denn seinen Willen kundgegeben, dem Ritterbunde beizutreten, und Kurtefrund war darob hocherfreut in seinem Gemüte, denn das Wort des Schenken war sein Siegel und galt mehr im Lande als dreier hochwürdiger Bischöfe geschworener Eid.
Natürlich wurde das Ereignis durch einen gewaltigen Trunk gefeiert. Zwei mächtige Steinkrüge hatten die beiden in nicht allzu langer Zeit schon bis auf den Grund geleert, und jetzt ließ der Schenk noch ein kleineres Gefäß, gefüllt mit schwerem Ungarwein, auftragen, zu einem Schlaftrunke, wie er sagte. »Denn wenn du wirklich morgen früh mit der Sonne aufstehen und abreiten willst, Kurtefrund, so wird's wahrlich Zeit, daß wir uns in die Federn machen!«
»Du hast recht,« erwiderte der Rudelsburger. »Wir wollen's nicht viel später werden lassen. Auf dein Wohl und Tod den Krämern! Und nun noch eine Bitte: Schenke mir den Kerl, den meine Tochter heute eingefangen hat!«
Der Tautenburger sah ihn verwundert an. »Wie kann ich verschenken, was mir nicht gehört?«
»Aber er ist auf deinem Grunde gefangen und schwerer Tat bezichtigt.«
»Wird er verklagt, so mag er sich verantworten vor Gericht. Er ist ein freier Mann.«
»Wer weiß, ob er nicht lügt! Vielleicht ist er ein entlaufener Knecht.«
Der Schenk lachte. »Sieh ihn an, und du wirst ihm glauben. Hätt' er mir gesagt, er sei von Adel, ich hätt's ihm auch geglaubt.«
»Meinethalben,« versetzte Kurteftund etwas verdrießlich. »Jetzt aber ist er in deiner Hand.«
»Was in aller Welt willst du mit ihm?« fragte der Schenk ablehnend.
»Er ist ein Gelehrter, ich habe ihn gefragt, und, ich kann gerade einen Schreiber gebrauchen auf der Rudelsburg.«
»So, so! Nun höre: Den nähm' ich nicht, lieber einen alten Mönch. Er fiel vorhin vor deiner Tochter auf die Erde und küßte ihr die Hand, und dabei sah er sie an, als wäre sie eben vom Himmel gestiegen. Und die Weiber, ja die Weiber! Die sehen es nur zu gern, wenn einer sie anbetet, wenn er lang und rank ist wie der und Augen im Kopfe hat wie glühende Kohlen. – Donnerwetter, da geschieht manchmal das dümmste Zeug!«
Der Rudelsburger sah ihn an, als ob er ihn für betrunken hielte. Dann wieherte er und prustete vor Lachen. »Was redest du da? Du bist ein Spaßvogel, Schenk! Gertrudis, der der Beste im Lande nicht gut genug ist? Kröche so ein Landstrolch an sie heran, sie schlüge ihn in seine alberne Fratze. Aber Scherz beiseite: Willst du mir den Menschen geben oder nicht?«
Der Schenk zuckte die Achseln. »Will er mit dir reiten, so halt' ich ihn nicht. Zwingen kann ich ihn nicht. Er genießt den Frieden meiner Burg wie jeder andere, der darinnen ist.«
Der Rudelsburger war sichtlich geärgert. Seine Augen funkelten, und seine Stirn ward blutrot. Aber er war doch klug genug, die heftige Antwort zu unterdrücken, die ihm auf der Zunge lag, und versetzte nur mit verbissenem Hohne: »So werde ich den Herrn aus Italien fragen müssen, ob er so gnädig sein will, mit auf meine Burg zu kommen.« Der Schenk überhörte geflissentlich den gereizten und unhöflichen Ton der Antwort und entgegnete gleichmütig: »Warum sollte er nicht? Er entgeht ja damit seinen Verfolgern, denn auf der Rudelsburg sucht ihn kein Mensch, wenn überhaupt ihn einer suchen sollte. Und auch sonst wird er schwerlich etwas dagegen haben, dem Vater derer zu folgen, die ihn gerettet hat. Noch einen Becher, dann gute Nacht!«
III.
Als die ersten Strahlen der Morgensonne durch die kleinen Fenster des Tautenburger Turmgemaches blitzten, hatte der Schläfer darinnen einen wunderlichen Traum. Er sah die Jungfrau, die ihn gerettet hatte, auf der Spitze eines hohen Berggipfels stehen, umflossen von hellem, rosigem Lichte, und ihm, der tief im Tale stand, winkte sie mit einem glückverheißenden Lächeln zu. Da sprang er den Berg empor, von Klippe zu Klippe sich schwingend, bis sie ihm ganz nahe zu sein schien. Er streckte die Arme aus, um sie zu umfassen, aber in demselben Augenblick sah er, daß zwischen ihm und ihr ein tiefer Abgrund klaffte, den kein Mensch überspringen konnte. Verzweifelt starrte er hinab in die dunkle Tiefe. Da mit einem Male faßten ihn zwei eiserne Hände an den Schultern, hoben ihn empor und warfen ihn mit ungeheurer Kraft über die Kluft hinüber, so daß er gerade vor den Füßen des Mädchens auf die Knie zu liegen kam. In demselbm Augenblicke war sein Traum zu Ende, denn er spürte wirklich einen gewaltigen Druck an den Schultern und fuhr erschrocken in die Höhe. Vor ihm stand der Ritter Kurtefrund von der Rudelsburg, der ihn unsanft aus dem Schlafe geweckt hatte. Er war vom Kopf bis zu den Füßen in blankes Eisen gekleidet.
»Was begehrt Ihr, Herr?« rief Kyburg und saß im Nu aufrecht auf seinem Lager. Ihm schwante, daß dieser frühe Besuch etwas Absonderliches zu bedeuten habe, und seine Schlaftrunkenheit war im Augenblicke verflogen.
Der Ritter suchte seinen Zügen den Ausdruck des größtmöglichen Wohlwollens zu geben. »Hört mich an!« sagte er und stützte sich breitbeinig auf sein Schwert. Er pflegte gern zu reden, denn es war ihm von der Natur eine Fähigkeit gegeben, die Worte zu setzen, wie sie unter Seinesgleichen ganz ungewöhnlich war. »In zwei Stunden etwa, guter Freund, werden die vor den Toren der Burg stehen, die Euch gestern so übel mitgespielt haben. Bezichtigen sie Euch der Zauberei und üblen Teufelswerkes, so muß Euch der Schenk ausliefern vor das Gericht des Bischofs von Naumburg, und was dann die Pfaffen über Euch beschließen, das weiß der Henker. Nun halt' ich Euch für unschuldig, ebenso der Schenk, denn von den frommen Narren, die jetzt das Land durchziehen und sich geißeln und törichte Lieder plärren, ist jeder einzelne so dumm wie ein ganzer Stall voll Schafe. Darum haben sie Euch für einen hausierenden Hebräer gehalten, wo doch jeder sehen kann, daß Ihr ein ritterlicher Mann seid.« Hier mühte er sich, den Schein eines Lächelns über sein Antlitz gleiten zu lassen, und neigte sich ein wenig gegen ihn. »Kurz und gut also,« fuhr er fort, »ich schlage Euch vor, reitet mit mir nach der Rudelsburg! Dort seid Ihr sicher, und ich meine, ich könnte Euch dort wohl gebrauchen.« Kyburg stand mit einem Ruck auf beiden Füßen und blickte dem Ritter erstaunt, ja erschrocken ins Gesicht. Nicht nur Sicherheit und Unterkunft ward ihm, dem vom Schicksal arg Heimgesuchten, mit einem Male geboten, nein, das war viel mehr, es war geradezu die Erfüllung des Traumes, den er eben geträumt hatte. Wäre heute der Rudelsburger mit seiner Tochter von dannen geritten, so hätte er sie vielleicht niemals wiedergesehen. Denn wie hätte er Zutritt erhalten sollen auf einer Burg, deren Namen er bis gestern noch niemals gehört hatte, und von der er noch zur Stunde nicht wußte, wo sie gelegen war? Das hohe Frauenbild, das ihm unablässig leuchtend vor der Seele stand vom ersten Augenblick an, da er es gesehen, wäre ihm wahrscheinlich für immer entschwunden gewesen.
»Nun? Wie dünket Euch?« sagte der Rudelsburger ungeduldig.
»Herr, ich komme mit Euch mit Freuden!« rief Kyburg. »Aber,« setzte er nach einigem Besinnen hinzu, »als was wollt Ihr mich auf Eurem Schlosse halten und gebrauchen?«
Kurtefrund überflog seine Gestalt mit raschem Blicke und sagte dann bedächtig: »Fürs erste: Ich denke, Ihr seid des Schildamtes kundig und wisset ein Schwert wohl zu führen «
»Das kann ich, Herr.«
»Zum zweiten: Ich acht', Ihr seid auch wohl imstande, den Federkiel zu handhaben, und versteht die vermaledeite Sprache, in der die Pfaffen und Schreiber die Verträge und Urkunden abfassen.«
»In beidem, Herr, irrt Ihr nicht.«
»Und endlich zum dritten: Ihr wisset etwas von der geheimen Kunst, die aus Kupfer oder Blei Gold werden läßt oder zum wenigsten es vermag, das Gold, das man in den Tiegel wirft, zu vervielfältigen?«
Kyburg sah dem Rudelsburger starr ins Gesicht und hielt eine ganze Weile den Blick seiner Augen aus. Dann sagte er: »Habt Ihr Feinde, Herr?«
»Die schwere Menge.«
»Sind solche unter ihnen, die feste Häuser haben oder sich hinter Mauern bergen?«
»Ja freilich. Da sind vor allen anderen die Heringskrämer von Naumburg. Bin zwar zurzeit mit ihnen vertragen, aber bei Sankt Elisabeth, es soll nicht lange mehr mit dem Frieden währen!«
»Nun, Herr,« sagte Kyburg mit starker Stimme. »Eure Tochter hat mir das Leben gerettet. Ohne sie wäre mein Fleisch und Bein auf einem Holzstoße verkohlt. Das bindet mich an Euch und macht mich zu Eurem Freunde. Und ich verspreche Euch dies: Gebt Ihr mir, was ich bedarf, so schaff' ich Euch noch vor Weihnachten ein Mittel, das alle Eure Feinde in den Staub vor Euch wirft.«
»Ihr versprecht viel,« erwiderte der Ritter, »fast zu viel. Und ich frage Euch: Wie kommt es, daß Ihr bei solcher großen Kunst als ein Landstreicher umherfahret?«
»Das mag ich Euch leicht erklären, Herr. Von den Heiden floh ich auf ein Schiff von Sankt Marco und hatte nichts, als was ich auf dem Leibe trug. Von Venedig bettelte ich mich durch bis zum Bischof von Brixen, der mein Gönner ist von früher her und der mich aufnahm. Er stattete mich mit Kleidung aus und auch mit Geld und riet mir, zum Erzbischof nach Magdeburg zu fahren, bei dem die ärztliche Kunst hoch im Preise stehe. Er schrieb mir auch einen Brief, der mich empfehlen sollte. Den haben die Räuber gestohlen und zerrissen. Dem Hochwürdigen von Brixen darf man nicht nahe kommen mit der geheimen Kunst der Heiden. Er ist der Welt abgestorben und lebt nur noch den Werken der Liebe und Barmherzigkeit.«
»Das leuchtet mir ein,« versetzte der Rudelsburger nach einigem Nachdenken. »Ihr seid also bereit, mein Mann zu werden und Euch in meinen Dienst zu schwören, bis dieses Jahr zu Ende ist? Denn bis dahin muß sich's ja zeigen, was Ihr vermöget.«
»Hier meine Hand, Herr, ich gelobe mich Euch bei den Wunden des Heilandes und meinem Schutzpatron Sankt Jacob! Und so Ihr mich redlich haltet, so sollt ihr einen Dienstmann an mir haben, wie Ihr noch keinen hattet.«
»Mich redlich zu halten gegen Euch, will ich Euch gern geloben. Wer mir gute Dienste leistet, kann sich auf meine Erkenntlichkeit verlassen. Von allem anderen reden wir, wenn wir daheim sind. Jetzt aber müssen wir Euch ausrüsten, wie einen, der in meinem Gefolge reitet.« Er öffnete die Tür und rief die Stiegen hinunter: »Wilke, bringe dem Manne ein Gewand und einen Harnisch und alles, was ein Reiter haben muß. Dein Herr hat mir's zugesagt.«
Eine Viertelstunde später ritt Kyburg im Gefolge des Rudelsburgers aus dem Tore der Tautenburg. Es war kein ritterliches Ziergewand, das man ihm gegeben hatte, er trug vielmehr die Kleidung eines gewöhnlichen reisigen Knechtes. Aber sein hoher, schlanker Wuchs kam doch dadurch aufs vorteilhafteste zur Geltung, und seine schwarzen Augen blickten so kühn und herrisch unter der Eisenhaube hervor, als wäre er der reichste Landherr in der Runde.
Gertrudis, die neben ihrem Vater an der Spitze des Zuges ritt, schien davon nichts zu bemerken und hatte offenbar nicht mehr acht auf ihn als auf jeden anderen. Sie hatte ihn mit einigen kühlfreundlichen Worten willkommen geheißen unter den Mannen ihres Vaters, wobei sie nicht hatte verhindern können, daß ihr ein feines Rot in die Wangen getreten war. Dann aber hatte sie sich fast schroff von ihm abgewandt und nicht wieder das Wort an ihn gerichtet.
Ritter Kurtefrund, der seine Augen überall hatte, bemerkte wohl die feurigen und bewundernden Blicke, die der Fremdling auf seine Tochter warf, und sie bereiteten ihm ein großes Vergnügen. War der Mann wirklich geheimer Wissenschaft kundig, so konnte er ihm unermeßlich nützlich werden. Es war ein wunderliches Spiel des Zufalls, daß ihm der seltene Vogel ins Garn gegangen war. Verliebte er sich nun gar in seine Tochter, so war er stärker an die Rudelsburger gefesselt als durch jeden Eid und würde ihm gern und willig dienen mit allem, was er vermochte. Und für Gertrudis, die Stolze, Unnahbare, war ein fremder Landstreicher nimmer eine Gefahr, auch wenn er so adlig aussah wie der da. Sie ließ ihn ja ganz und gar links liegen. Er dagegen wandte von Zeit zu Zeit das Haupt nach ihm zurück und nannte ihm den Namen eines Dorfes oder festen Hauses, an dem man vorüberritt.