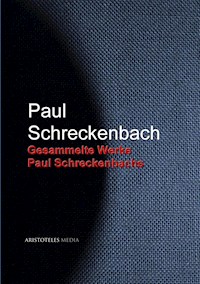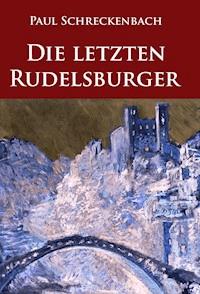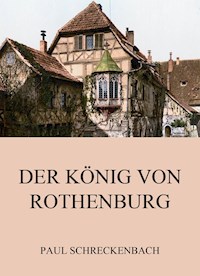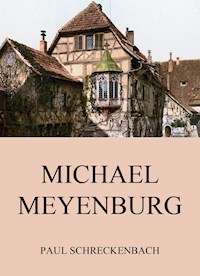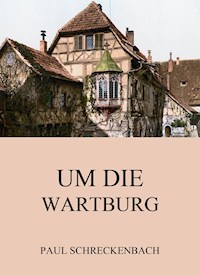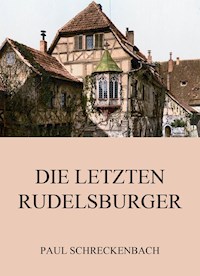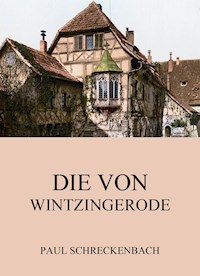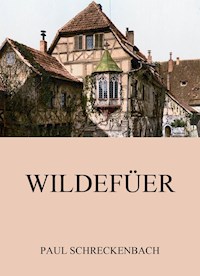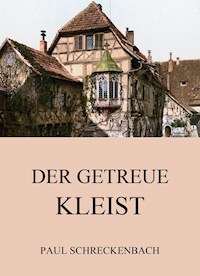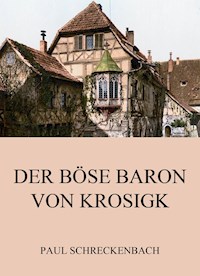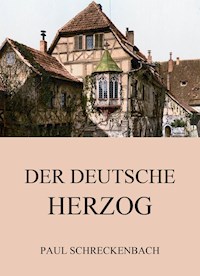
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Der Titelheld ist Bernhard von Weimar, einer der größten deutschen Feldherrn. In seinen Veröffentlichungen setzte sich Schreckenbach mit den ethischen und patriotischen Fragen seiner Zeit auseinander. Als Grundlage dafür nutzte er reale historische Ereignisse, die er jedoch künstlerisch frei umgestaltete.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der deutsche Herzog
Paul Schreckenbach
Inhalt:
Paul Schreckenbach – Biografie und Bibliografie
Der deutsche Herzog
Erstes Buch
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Zweites Buch
I.
II
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Der deutsche Herzog, P. Schreckenbach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849635688
www.jazzybee-verlag.de
Paul Schreckenbach – Biografie und Bibliografie
Deutscher Pfarrer und Schriftsteller, geboren am 6. November 1866 in Neumark (bei Weimar), verstorben am 27. Juni 1922 in Klitzschen bei Torgau. Sohn eines Pastors, studierte in Halle und Marburg Theologie und Geschichte und promovierte später zum Doktor phil. Ab 1896 arbeitete S. als Pfarrer in Klitzschen in der Nähe von Torgau. Der Autor ist bekannt für seine hervorragenden historischen Romane.
Wichtige Werke:
Bismarck, 1915
Der böse Baron von Krosigk, 1908
Die von Wintzingerode, 1905
Geistliche Lieder von Martin Luther, 1917
Der getreue Kleist, 1909
Der jüngste Tag, 1919
Der König von Rothenburg, 1910
Der Komtur, 1921
Kurfürst Augusts Abenteuer, 1921
Die letzten Rudelsburger, 1913
Markgraf Gero, 1916
Michael Meyenburg, 1920
Die Pfarrfrau von Schönbrunn, 1917
Sühne, 1923
Die Tat des Leonhard Koppe, 1916
Um die Wartburg, 1912
Der Weltbrand, 3 Bände, 1915-20
Die von Wintzingerode, 1905
Der Windmüller von Melpitz, 1914
Der Zusammenbruch Preußens 1806, 1906
Der deutsche Herzog
Roman aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges
Erstes Buch
I.
Auf einem Sturzacker nahe bei der kleinen Stadt Lützen hielt ein Reiter und blickte unverwandt hinüber nach der Richtung, wo sich, wie man ihm berichtet hatte, die Heerstraße hinzog, die nach Leipzig führte. Schwarz war sein Roß, und seine schlanke, geschmeidige Gestalt steckte vom Kopf bis zu den Knien in einem Harnisch von derselben Farbe. Alles an ihm war wohlgepanzert und verwahrt, wie es einem Krieger geziemt, der zum Kampfe auszieht. Nur das Antlitz war unverhüllt – ein feines, etwas bleiches Antlitz mit leicht gebogener Nase, dunkelblondem Schnurr- und Knebelbart und zwei so eigentümlich glänzenden, durchdringend blickenden Augen, wie sie nur selten einmal die Natur einem Menschen verleiht. Aber dem dichten, weißen Novembernebel gegenüber, der das weite Blachfeld bedeckte, waren auch diese falkenscharfen Augen machtlos, und der Reiter konnte, so sehr er sich anstrengte, auch nicht einen Stein von der Straße erspähen, die wohl nicht weiter als zweihundert Ellen vor ihm sich dehnte.
»Verwünscht!« murmelte er endlich. »Es ist wie verhext. Der Starrschedel kommt auch nicht wieder! Man hört nichts, man sieht nichts. Werde noch ein Stück vorwärts reiten!«
Der hagere Mann in halb bäuerlicher, halb geistlicher Tracht, der neben ihm stand, zuckte zusammen, »Um Gotteswillen, gnädiger Herr! Keinen Schritt mehr vorwärts! Hört Ihr die Turmuhr von Lützen? Es schlägt acht. Man sollt's nicht denken, weil es noch so dunkel ist. Aber horch! Der Schall ist deutlich. Wir sind ganz nahe an der Stadt, und die ist von oben bis unten voll von Friedländischem Volke. Brechen sie heraus, dann Gnade uns Gott! Wer weiß, ob Euch die dort heraushauen könnten!« Er wies auf einen Reitertrupp, der nur dreißig Schritte hinter den beiden hielt, aber im Nebel kaum zu erkennen war. Über das Gesicht des Kriegsmannes huschte ein Lächeln. »Nun, mich und die Meinen brächten wohl die Beine unserer Pferde rasch in Sicherheit,« erwiderte er heiter. »Aber du, Schulmeister, wärest trotz deiner langen Stelzen in einer üblen Lage.«
»Ach Herr,« versetzte der Lange ernst und bedächtig, »um mich ist mir's nicht. Ich spreche mit Jakob: Wenig und böse war die Zeit meines Lebens, und mit Salomo: Alles ist eitel. Was ich von der Welt gesehen habe« – er spuckte heftig nach der andern Seite aus – »alles Jammer und Schande und Kreuz und Elend, Herr! Jeden Tag will ich fort, wenn mich der Herr ruft, jeden Tag! Und könnte wohl der alte Schulmeister von Meuchen besser und anständiger von der Welt kommen, als wenn ihn eine Kugel träfe bei einem Kundschafterdienste, den er dem Herzog Bernhard von Weimar leistet?«
Der Reiter warf verwundert den Kopf herum. »Woher weißt du, daß ich's bin?«
»Es hat mir einer von der grünen Brigade, der bei mir lag, gestern abend alle die großen Herren gezeigt, die beim Könige waren. Ich hab' Euch nur von ferne gesehen, Herr, aber ich hab' Euch gleich wieder erkannt an Eurem schwarzen Panzer und dem roten Helmbusche.«
»Es schadet auch nichts, wenn du's weißt,« erwiderte der Herzog ruhig. »Aber sage mir, Alter, was ist das mit einem Male für ein Geruch? Das riecht wie ein Hausbrand.«
Der Schulmeister witterte und schnoberte in den Nebel hinein. »Ihr habt recht, gnädiger Herr,« sagte er, »das ist ein Brand und kein kleiner. Das mußte ja so kommen. Wo die Wallensteiner sind, die Hunde, da gibt's Mord und Brand!«
Der Herzog wollte eben den Mund zu einer Erwiderung öffnen, als unweit vor ihm mehrere Schüsse aufblitzten. Wie schwache rote Punkte zeichnete sich der Feuerstrahl aus den Musketen im Nebel ab, und der Schall klang, als wenn einer mit der flachen Hand auf hartes Leder aufschlägt. Zugleich jagten vier Rosse heran. Eines war ledig und brach zur Seite aus, auf den andern saßen schwedische Reiter.
»Retirieren, fürstliche Gnaden!« schrie der Rittmeister Starrschedel. »Da vorn steht alles voll von Musketieren, und meinen Reitknecht haben sie durch den Kopf geschossen!«
Der Herzog wandte sein Roß. »Der erste Tote an diesem Tage! Es werden ihm noch viele folgen!« murmelte er und setzte laut die Frage hinzu: »Nur Musketiere? Kein berittenes Volk?«
»Ich habe keines gesehen.«
»Dann können wir gemächlich reiten. Sie werden uns schwerlich verfolgen bei dem Nebel. Nicht schneller, als der da laufen kann! Geht Not an den Mann, so nehmen wir dich aufs Pferd, Schulmeister. Und nun, was habt Ihr erkundet, Starrschedel?«
»Fürstliche Gnaden, da vorn hinter der Straße setzen sie Batterien fest. Es mochten wohl so zehn bis zwölf schwere Kanonen sein, und links und rechts werfen die Musketiere Gräben aus zu ihrem Schutze.«
»Ah!« rief der Herzog, und ein Blitz fuhr über sein Antlitz hin. »So haben wir ihn also wirklich fest gemacht, den alten Wolf! Endlich will er sich zum Kampfe stellen.«
Der Rittmeister rapportierte weiter in seinem harten Deutsch: »Auch schien mir, als ob Lützen brenne. Zu sehen war wenig, aber man roch den Qualm, und mir war's, als hörte ich das Feuer knattern.«
In des Herzogs Antlitz erschien ein harter Zug. »Das dünkt mich glaublich.« sagte er. »Der Friedländer wird die Stadt in Brand gesteckt haben. Sie deckt ihm dann, kommt es zur Schlacht, die rechte Flanke.«
»Und was schiert den Erzschelm das Ketzernest!« knurrte der Schwede grimmig.
»Sagt lieber: Was schiert den Tschechen die deutsche Stadt! Denn Ketzer oder nicht – pah – was kümmert das den Wallenstein! Er selbst glaubt nicht einmal an Gott, geschweige an irgendeine Lehre seiner Kirche.«
»Herr Herzog von Weimar!« klang es da den Reitenden aus dem Nebel entgegen und noch einmal ein dünner, zerflatternder Schrei: »Herr Herzog von Weimar!«
»Hier!« rief der Fürst. »Wer ruft nach mir?«
Aus dem weißen Schleiergewölk tauchte eine jugendliche Gestalt zu Pferde auf. Es war der achtzehnjährige Nürnberger Patriziersohn August von Leubelfing, der dem Schwedenkönig aus seiner Vaterstadt ins Feld gefolgt war und seit etwa einem Jahre die blau und gelbe Tracht der königlichen Aufwärter trug. Der Jüngling keuchte von dem scharfen Ritte, und seine runden Wangen glänzten dunkelrot.
»Die Majestät sucht Eure fürstlichen Gnaden,« meldete er mit fliegendem Atem. »Es sind Boten ausgeschickt nach allen Seiten. Die Majestät hat eine sehr importante Zeitung erhalten, es kommt sicher zur Schlacht.«
»Gut. Wir wollen eilen,« gab der Herzog zur Antwort und spornte sein Roß, aber der Page erkühnte sich, seine Hand in die Zügel zu legen. »Fürstliche Gnaden,« bat er in flehendem Ton, »vergönnt mir eine kurze Bitte!«
»Was willst du?« fragte Bernhard verwundert. Er sah mit Befremden, daß der Junge am ganzen Leibe zitterte und daß in seinen sonst so lustigen Augen dicke Tränen standen.
»Fürstliche Gnaden, redet dem Könige zu, daß er den Panzer anlegt. Er weist ihn zurück, will nur den Elenkoller, hört auf niemandes Rat. Ach, wäre die Königin da, auf die hörte er gewiß! Vielleicht aber nimmt er auch von Euch einen Rat an. Wenn ihm ein Unglück zustieße« – – er brach ab und wischte sich mit zitternder Hand die Tränen vom Gesicht, die ihm jetzt in schweren Tropfen aus den Augen rollten, und mühsam sein Schluchzen hinabwürgend, stammelte er: »Die Majestät ist so seltsam, o so seltsam!«
Der Herzog sah ihn an und nickte. Ja, seltsam war auch ihm der König in den letzten Wochen erschienen, wunderlich verwandelt gegen früher. Seine heitere, gleichmäßige Ruhe, sein überlegener Humor schienen ihn ganz verlassen zu haben. Selbst er, sein ausgesprochener Liebling unter den deutschen Fürsten, war von ihm kurz und unfreundlich behandelt worden, als er, von seinem Siegeszuge in Süddeutschland zurückkehrend, zu Arnstadt seine Völker mit dem königlichen Heere wieder vereinigt hatte. Es war ihm fast so zumute gewesen, als neide ihm der König die frischen Lorbeeren, die er im Kampfe wider die kaiserlichen Generale gepflückt hatte. Allerdings war der Hochherzige seitdem bemüht gewesen, ihn die Kränkung vergessen zu machen, aber noch öfter hatte er bemerken müssen, daß Gustav Adolf aus geringen Anlässen die Herrschaft über sich selbst verlor, in heftigen Zorn geriet, harte Scheltworte brauchte, die er sonst nie über seine Lippen gehen ließ. Dann mit einem Male, seit seinem Einzug in Naumburg, war diese reizbare Heftigkeit von ihm gewichen und hatte einer tiefen Traurigkeit Platz gemacht. Als dort in der alten Bischofsstadt das protestantische Volk vor ihm auf den Knien lag, seine Hände, seinen Rocksaum, seine Stiefel küßte, da hatte er zu seinem Hofprediger Fabricius gesagt: »Diese Menschen ehren mich wie einen Gott. Ich fürchte, der Himmel wird ihnen bald offenbaren, daß ich ein armer, sterblicher Mensch bin.« Seitdem hatte ihn die Todesahnung nicht mehr verlassen. Fast immer ritt er ernst und in sich gekehrt dahin, und manchmal schien es, als wäre sein Geist dieser Welt schon fast entrückt. Redete er mit den Seinen, so sprach er meist über das Sterben und die gewisse Hoffnung auf ein ewiges Leben, oder über das, was geschehen sollte, wenn ihn etwa ein plötzlicher Tod ereilen würde.
Der Herzog hatte, das alles überdenkend, den Pagen neben sich vergessen und schrak nun aus seinen Gedanken auf, als der junge Mensch noch einmal mit halb erstickter Stimme bat: »Nicht wahr, gnädiger Herr, Ihr redet dem Könige gut zu?«
»Gewiß. Wo ist die Majestät?«
»Sie wollte in der Kirche zu Meuchen noch einmal das heilige Abendmahl feiern. Dazu sollten wir Euch holen.«
»Donnerwetter!« rief der Schulmeister, der mit langen Schritten die Reiter begleitete. »Wer soll da die Orgel spielen, wenn ich nicht dort bin?«
Der Herzog lachte. »Ja, sputen wir uns! Ohne den hier geht's nicht!« rief er. »Nimm ihn hinter dich aufs Pferd, Leubelfing! Dich und den Dürren trägt schon das starke Tier.«
Er trieb sein Roß zu schnellerer Gangart an, und bald war die Reiterschar an den Feldwachen und Vorposten vorbei an das schwedische Lager herangekommen. Seine Zelte und Wagenreihen umspannten im weiten, halbmondförmigen Bogen das stattliche Bauerndorf Meuchen, und auch in den Straßen und Gärten, den Häusern und Scheunen hatten die Soldaten genächtigt. Der Herzog selbst hatte hier mit dem Könige die Nacht in einer Kutsche sitzend unter freiem Himmel verbracht und war dann beim Morgengrauen, da er seinen ungeduldigen Tatendrang nicht zügeln konnte, auf Kundschaft ausgeritten. Jetzt wurden die Regimenter aus Dorf und Lager herausgeführt, um von ihren Obristen in der Schlachtordnung aufgestellt zu werden, die der König am Abend vorher entworfen hatte für den Fall, daß es zur Schlacht käme und der Friedländer nicht wieder einmal dem Treffen ausgewichen wäre. Eben zogen die livländischen Reiter an dem Herzog vorüber, die heute unter seinem Befehl kämpfen sollten. Die Krieger begrüßten ihn mit lautem Heilruf, und er dankte durch freundliches Neigen des Hauptes.
»Der Friedländer ordnet drüben seine Armada. Sie graben die Geschütze ein, warten also darauf, daß wir sie attackieren,« rief er dem vorüberreitenden Fürsten von Anhalt zu.
»Euer Liebden bestätigen, was der König seit einer Viertelstunde weiß,« erwiderte der Anhalter. »Er wartet nur darauf, daß der Nebel fällt oder steigt.« Hastig sprechend setzte er hinzu: »Jetzt ist er dort hinten in der Kirche. Er war sehr betrübt, daß Ihr so lange ausbliebt, wollte gern mit Euch zusammen kommunizieren. Seht zu, daß Ihr noch zurecht kommt. Ich muß weiter! Auf Wiedersehen, Herr Vetter von Weimar, wenn die Kartaunen krachen! – Aber halt – noch eins! Das muß ich Euch doch noch sagen!«
Er drängte sein Roß an Bernhards Seite heran und flüsterte so leise, wie es ihm mit seinem schallenden Organ möglich war: »Wißt Ihr, Liebden, daß heute noch die Königin in Weißenfels eintrifft?«
»Nein,« entgegnete der Herzog, befremdet, daß ihm der andere eine so unwichtige Neuigkeit in diesem Moment auftischte.
»Sie kommt nicht allein, auch nicht nur mit ihren Frauen und Fräuleins,« fuhr der Fürst verschmitzt lächelnd fort. »Mit ihr kommt eine – eine aus Weimar, die Ihr, wie ich meine, wohl kennt und schwerlich vergessen habt.«
Eine Blutwelle schoß dem Herzog ins Gesicht. »Gundel?« fragte er halblaut in ungläubigem Staunen.
»Kunigunde von Anhalt, mein Bäschen und Eurer Schwägerin Schwester! Ich sehe, Ihr denkt noch an sie.«
»Wie kommt sie zur Königin? Wie kommt sie nach Weißenfels?« wollte Bernhard fragen, aber der Anhalter war schon, nachdem er ihm noch kordial auf die Schulter geklopft hatte, mit einem breiten, behäbigen Lachen weitergeritten.
Ein paar Augenblicke lang war es dem Herzog, als versinke um ihn das Gewühl der reitenden Männer. Vor sich sah er ein Mädchenhaupt mit übermütig blitzenden dunkeln Augen, üppigem Goldhaar und einem feinen Munde, dessen Lippen in dem bräunlich-blassen Antlitze seltsam leuchteten, wie die rotglühende Blüte des wilden Mohns. Vier Jahre war es her, da hatten diese Lippen ihn geküßt und diese Augen um seinetwillen heiße Tränen geweint, denn zu jener Zeit war er nach den Niederlanden gegangen, um dort gegen die Feinde seines Glaubens zu kämpfen. Damals, als sie in tausend Schmerzen an seinem Halse hing, hatte er ihr feierlich gelobt: »Komme ich zurück, so wirst du mein Weib, und niemals werde ich eine andere freien!« Aber der Tag war wohl noch ferne, an dem er heimkehren durfte. Denn was frommte es, wenn er in die Heimat kam mit leeren Händen? Das kleine Land, das er mit seinen Brüdern vom frühverstorbenen Vater geerbt hatte, trug kaum die Last der Hofhaltung des Ältesten. Es war verheert und ausgesogen durch die Wallonen und Kroaten. Das arme, gepeinigte Volk konnte selber kaum leben, wie hätte es zinsen und steuern können zu einem zweiten Fürstenhofe? Nur wenn es ihm gelang, sich Land und Leute zu erkämpfen, nur dann konnte der nachgeborene Prinz die blutarme Prinzessin heimführen. Nun, der große Schwedenkönig, dem er jetzt diente, hatte ihm schon zweimal Hoffnung gemacht auf ein Fürstentum, das er ihm zu Lehn geben wollte aus der eroberten Ländermasse, so wie der Kaiser den Friedender zum Herzog von Mecklenburg gemacht hatte. Vielleicht fiel heute die Entscheidung darüber auf blutigem Felde, ob der König noch fürder die Macht haben sollte zu solchem Tun. So unbedingt sicher, wie das vor Jahresfrist geschienen, war es jetzt nicht mehr, denn es war in der letzten Zeit für die schwedischen Waffen nicht alles zum besten gegangen.
Während diese Gedanken in seinem Hirn sich kreuzten, hatte ihn sein Pferd ins Dorf getragen. Jenseits des Teiches vor der niedrigen Kirchhofsmauer sah er die Schlachtrosse der hohen Generalität stehen, auch das des Königs mit der Purpurschabracke. Da sprang er schnell aus dem Sattel, warf die Zügel dem Pagen Leubelfing hin und schritt den schmalen Pfad durch Kreuze und Grabsteine der Kirche zu.
Der kleine, dämmerige Raum, in den er eintrat, empfing sein Licht mehr von den Kerzen, die auf dem Altare flammten, als von außen durch die langen, schmalen Fenster. Droben an der Orgel saß ein Wachtmeister des blauen Regimentes, der früher in einem finnländischen Dorfe den Bakel geschwungen und als Küster gesungen hatte, und spielte, so gut er es noch vermochte. Dicht vor den niedrigen Stufen des Altars stand die markige Gestalt des Königs, hinter ihm erkannte Bernhard das große Haupt des schwedischen Grafen Nils Brahe, die biederen und ehrenfesten Gesichter der beiden deutschen Obristen von Eberstein und von Gersdorf und seitwärts von ihnen das bleiche, verwüstete Antlitz des Herzogs von Lauenburg mit den unstet flackernden Augen. Wer die andern waren, vermochte er nicht wahrzunehmen, denn bei seinem Eintreten kreischte die Tür in den rostigen Angeln, der König wandte sich um, und mit einer zugleich freundlichen und gebieterischen Gebärde winkte er ihn zu sich heran. Sofort öffnete sich für ihn eine schmale Gasse, die er eilig durchschritt, und gleich darauf kniete er neben der Majestät auf dem harten Steinboden der Kirche und empfing mit ihm das heilige Mahl.
Nachdem die Feier beendet, der letzte Ton des Chorals verklungen war, sagte der König mit lauter Stimme: »Ich bitte die Herren, hinaus auf den Kirchhof zu treten. Ich habe noch ein paar Worte mit Seiner Liebden, dem Herzog von Weimar, sekret.«
Die Versammelten gehorchten augenblicklich, einige der schwedischen Herren nicht ohne eine gewisse Verdrossenheit in den Mienen, denn sie neideten dem deutschen Herzog die große Gunst, die ihm der König zuwandte. Der rauhe Obrist Stahlhanske brummte im Hinausgehen: »Den Teufel auch! Der weimarische Milchbart ist und bleibt doch der Goldsohn des Königs! Hat die Majestät nicht – Gott straf mich! – andere Leute zur Hand?« Aber er fand bei dem neben ihm schreitenden Obristen Stenbock mit diesen Worten keine Gegenliebe, denn der erklärte kurz und bündig: »Halte dein Maul, Bruder, und verbrenne dir's nicht! Der Weimarer ist ein ganzer Kerl. Erhöht ihn der König über zwei alte Esel, wie wir beide sind, so tut er recht daran. Er hat mit seinen achtundzwanzig Jahren schon mehr geleistet als mancher mit fünfzig.« Damit schob er seinen Arm unter den des verdrießlichen Kriegsgefährten und zog ihn zur Tür hinaus.
Dem scharfen Ohre des Herzogs war das Zwiegespräch nicht entgangen, der König hingegen hatte augenscheinlich nichts davon bemerkt. Auch als das Gotteshaus längst geleert und er mit dem Herzog allein war, stand er noch in tiefen Gedanken da und sprach kein Wort, so daß es fast schien, als habe er die Gegenwart Bernhards vergessen. Mit einem Male aber fuhr er wie aus einem Traum empor und richtete den Blick seiner großen blauen Äugen voll und fest auf des Herzogs Gesicht. »Herzog Bernhard,« sagte er, »ich habe neulich in Arnstadt harte Worte zu Euch geredet, weil ich meinte. Ihr hättet eigenmächtig und wider meinen Nutzen gehandelt. Das war eine falsche Opinion, und ich sehe ein, daß Ihr in diesem Falle klüger wart als ich. Darum tat ich unrecht, als ich Euch schalt, und ich möchte Euch bitten, daß Ihr mir solches von Herzen vergebet. Denn wer kann es wissen, wie lange ich noch mit Euch auf dem Wege bin und wie bald mir der Herr unser Gott zuruft: Tue Rechnung von deinem Haushalten, denn du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein!«
Der Herzog stand einen Moment stumm da. Der Hochsinn des Königs, der in diesen Worten zutage trat, erschütterte ihn im Innersten. Dann aber ergriff er ungestüm mit beiden Händen des Königs Rechte, die dieser ihm entgegenstreckte, und rief: »Fahrt nicht fort, Herr! Es ziemt sich nicht, daß der Vater den Sohn bittet, ihm zu vergeben. Und wie ein Sohn zum Vater habe ich mich allezeit im Herzen zu Euch gehalten, wenngleich Ihr nur zehn Jahre älter seid als ich. Zürnt' ich Euch einmal, so tat ich's nimmer lange, das weiß Gott, und keinen Menschen weiß ich, vor dem ich solche Ehrfurcht habe wie vor Euch.«
Der König legte ihm die linke Hand auf die Schulter und blickte ihn noch gütiger an als vorher. »Ich danke Euch, Herzog Bernhard,« erwiderte er. »So wie Ihr Euch erweiset, so hab' ich Euch in meinem Sinne ästimiert. Und nun will ich Euch eine bessere Satisfaktion geben als durch bloße Worte. Die Stifter Würzburg und Bamberg sind in unserer Hand. Die geb' ich Euch zu Lehn, Euch und Euern Nachkommen, als ein Herzogtum Franken.«
Der Herzog beugte sich über des Königs Hand und küßte sie. Er war so überrascht und ergriffen, daß er zunächst keine Dankesworte fand.
»Die Voraussetzung ist freilich, daß ich am Leben bleibe,« fügte der König ernst hinzu. »Aber manchmal ist mir's, als käme bald mein Stündlein.«
»Herr!« rief Bernhard auffahrend, »das widerfahre Euch nicht! Das kann nicht im Plane Gottes liegen! Ihr führet seine Kriege!«
»Wer kennt Gottes Plan? Und welches Menschen bedarf der Allmächtige? Vor ihm sind wir alle nur Staub. Trifft mich eine Kugel, so setzt Gott einen andern an meine Stelle, der für ihn streitet, zum Exempel Euch!«
»Nein, Herr, das wolle Gott nicht! Ihr seid nicht zu ersetzen! Darum laßt Euch bitten: Schont Euch und haltet Euch ferne von der Gefahr!«
Gustav Adolf lächelte. »Ihr wißt, daß das zuweilen unmöglich ist.«
»So legt zum wenigsten einen festen Panzer an!«
»Das haben mir heute schon mehrere geraten. Aber ich kam's nicht, selbst wenn ich wollte. Die Narbe, die ich an der Schulter trage, macht mir jetzt wieder zu schaffen, und er riebe sie mir wohl wund. Nein, ich muß mich auf den Herrn allein verlassen, nicht auf irdische Waffen. Gott ist mein Harnisch, und meine Stunde ist im Himmel geschrieben, die Erde kann daran nichts ändern.«
Er hatte während seiner letzten Worte die Kirchtür geöffnet und trat nun ins Freie unter seine Offiziere. »Ihr Herren,« rief er, »kommt her und hört, was ich Euch zu sagen habe!« Und als sie nun alle im Halbkreis um ihn standen, sprach er mit helltönender Stimme: »Der Nebel fällt, und die Sonne dringt durchs Gewölk. Es wird also bald zum Schlagen kommen. Was er zu tun hat, weiß ein jeder, und jeder kennt seinen Platz. Das aber füge ich Euch noch zu wissen: Stößt mir nach Gottes Willen ein Unglück zu, so gehorcht jeder dem Herzog von Weimar! Fällt der, so kommandiert Graf Brahe. Gott nehme uns alle in seinen Schutz! Und nun, ihr Herren, auf die Rosse!«
II.
Ein feste Burg ist unser Gott, Ein gute Wehr und Waffen –
so klang es dem Könige brausend entgegen, als er aus der Dorfstraße herausgeritten kam. Denn die Aufstellung der Regimenter war soeben vollendet worden, und der angeordnete kurze Feldgottesdienst nahm seinen Anfang.
Gustav Adolf entblößte sein Haupt und zügelte sein Roß. Er fiel mit seiner hellen, kräftigen Stimme in den Gesang der Soldaten auf der Stelle ein und sang das gewaltige Lutherlied bis zu Ende mit. Als dann der Feldprediger des zunächststehenden Regimentes den sechsundvierzigsten Psalm sprach, bewegte der König die Lippen und sprach leise Wort für Wort nach, und nach dem Vaterunser und Segen stimmte er selbst das Lied an: »Verzage nicht, du Häuflein klein.« Gustav Adolf ließ dieses Lied jedesmal von seinem Heere singen, wenn eine Schlacht bevorstand, und heute mochte es wohl eine besondere Bedeutung für ihn haben. Denn er wußte, daß des Friedländers Armee stärker war als die seine. Kam nun etwa noch der wilde Pappenheim, den der kaiserliche Feldherr zu Hilfe gerufen hatte, mit seinen Reitern von Halle her rechtzeitig auf dem Schlachtfelde an, so stand das schwedische Heer einer bedeutenden Übermacht gegenüber.
Während des Singens war der Nebel fast völlig verschwunden, und die Sonne goß ihr Helles Licht über das weite Feld. Da sprengte der König vor die Front der deutschen Regimenter, die Bernhard führen sollte. Mit dem größten Erstaunen sah der Herzog, daß Gustav Adolf mit einem Male verwandelt erschien. Er trug nicht mehr, wie vorher, die Stirn gesenkt, als drücke ihn die Sorge nieder, sondern stolz und gebietend saß er im Sattel, und seine Augen leuchteten.
»Meine Freunde!« rief er, »Offiziere und Soldaten, ich beschwöre euch, heute eure Pflicht zu tun! Ihr streitet heute nicht nur unter, sondern neben und mit mir. Mein Blut und Leben werden euch den Weg zur Ehre zeigen. Folgt mir nur, so vertraue ich zu Gott, daß ihr einen Sieg gewinnt, der euch und euren Nachkommen zum Segen gereichen wird. Wo nicht, so ist es geschehen um eure Freiheit und euer Leben. Wollt ihr kämpfen, wie es redlichen deutschen Kriegsleuten ziemt?«
»Ja, ja!« schrien die Soldaten. »Drauf, drauf!«
Der König hob grüßend die Hand und ritt hinüber zu seinen Schweden, und wenige Minuten später erhielt Bernhard den Befehl zum Vorrücken. Das ganze schwedische Heer setzte sich in Bewegung und zog langsam über die ebenen Felder den Wallensteinern entgegen, die hinter der Heerstraße in schnell aufgeworfener Verschanzung den Angriff erwarteten. Bald erkannte der Herzog die Kanonen, die vor drei Windmühlen aufgefahren waren, im Hintergrunde ein gewaltiges Viereck der Infanterie und zur Seite vor den Geschützen die Kürassiere des Grafen Piccolomini. Wie aus Erz gegossen saßen die schwarzen Reiter drüben auf ihren starken Gäulen, keine Hand regte sich, kein Schuß blitzte auf, in starrer, unheimlicher Ruhe, wie eine riesige Gewitterwand vor dem losbrechenden Sturm, stand das ganze kaiserliche Heer und erwartete das Herannahen der Schweden. Noch etwa dreihundert Schritte weit waren die beiden Armeen voneinander entfernt, da klang vom rechten Flügel her, wo der König war, Helles Trompetengeschmetter. Hornsignale pflanzten sich fort von Regiment zu Regiment. Das war das verabredete Zeichen zum Angriff. Mit einem Male begannen die Kanonen zu donnern, die vor der Masse des Fußvolkes im Zentrum hergefahren waren, in ihr dumpfes Dröhnen mischte sich das helle, scharfe Knattern der Falkonetts auf den beiden Flügeln, und mit dem lauten Feldgeschrei: »Gott mit uns!« setzten sich die Reiterregimenter zur Attacke in Trab.
Wie dumpfes Heulen antwortete es von drüben: »Jesus Maria!« und noch einmal: »Jesus Maria!« Dann schollen laute welsche Kommandoworte, die Kanonen öffneten ihren ehernen Mund, und ein Hagel von Eisenstücken sauste den Heransprengenden entgegen.
Herzog Bernhards Reiterschar schrie laut auf, aber nicht vor Angst oder Entsetzen, sondern dem Feinde zum Spott, denn die Kugeln waren fast alle über ihre Köpfe hinweggegangen.
Aber nun kamen die kaiserlichen Kürassiere herangebraust, und die beiden Reiterharste trafen mit furchtbarem Anprall aufeinander. Hüben und drüben stürzten Männer und Pferde und wälzten sich im wüsten Knäuel auf der Erde, Klinge klirrte an Klinge, Schüsse knatterten, überall wildes Schnauben der Rosse, Geschrei und Gestöhn und dumpfes Aufschlagen von tausend Rossehufen. So wogte wohl eine halbe Stunde lang die Reiterschlacht ohne Entscheidung, und während die Männer keuchend miteinander rangen, verschwand auf einmal die Sonne wieder, und der vorher so strahlende Himmel ward bleigrau. Der Nebel sank von neuem über das Gefild herab und vermischte seine feuchten, weißen Schwaden mit dem Dampfe der Geschütze und dem Dunste des Blutes der erschlagenen Menschen und Pferde.
Der Herzog war nicht mit in dem Gewühl, denn noch war es für den Feldherrn nicht Zeit, sich persönlich einzusetzen. Seine wackeren deutschen und livländischen Reiter taten schon von selbst ihre Schuldigkeit und bedurften seiner Anfeuerung nicht. Immer mehr neigte sich in dem langen, zähen Ringen der Sieg auf ihre Seite, die kaiserlichen Schwadronen, so wütend sie sich auch wehrten, wichen langsam zurück und warfen endlich die Rosse zur Flucht herum.
Mit Hellem Siegesgeschrei folgten die Herzoglichen nach, aber sie hatten zu früh gejubelt. Die Fliehenden bogen zur Seite aus, und die Nachdrängenden sahen sich auf einmal einer wohlverschanzten mächtigen Batterie von Geschützen gegenüber. Und als sie diesmal aufbrüllten, da rissen ihre eisernen Kugeln wohl fünfzig Männer mit einem Male aus den Sätteln.
»Zurück!« schrie der tapfere Obrist von Rosen, der schon aus mehreren Wunden blutete, aber noch aufrecht und fest im Sattel saß. Er sah vor den Kanonen die ausgeworfenen Gräben und spitzen Palisaden und erkannte, daß Reiterei allein diese Batterie niemals erobern könne.
Die Reitermasse flutete zurück, und der Obrist sprengte zu dem Herzog hin und stattete ihm Rapport ab.
Sogleich gab Bernhard den Befehl, die Infanterie seines linken Flügels solle vorrücken und die Batterie im Sturm nehmen, und als jetzt herjagende Windstöße hier und da den Nebel wieder zerteilten, sah er auch drüben den Gewalthaufen des Fußvolkes vorgehen, um hinter dem Graben die Kanonen zu verteidigen. Ein Offizier auf hohem, hagerem Rappen wies ihnen mit dem gezogenen Degen die Richtung und trieb sie vorwärts. Der Obrist von Gersdorf, der gerade in Bernhards Nähe hielt, schwur Stein und Bein, das sei der Herzog von Friedland selber. »Ich kenne den Kerl und erkenne ihn, und wenn er zweitausend Schritte weit von mir stünde. Seht den roten Mantel, fürstliche Gnaden, und die roten Federn auf dem Hut! Die trägt kein anderer da drüben! Und den Gaul kenne ich auch, auf dem er sitzt. Sieht aus wie eine Schindmähre, hat aber den Leibhaftigen in sich.«
Er winkte zwei seiner Musketiere zu sich heran, die der Herzog als Scharfschützen kannte, und steckte jedem aus seiner Tasche etwas zu. »Kugeln, aus Erbsilber gegossen, fürstliche Gnaden!« sagte er. »Ich führe solche immer mit mir herum. Mit gewöhnlichen Kugeln ist denen nicht beizukommen, die gefroren sind durch die verfluchte Passauer Kunst. Und der Friedländer ist gefroren, das steht fest.«
Bernhard nickte, denn auch er traute dem unheimlichen Feldherrn zu, daß er sich teuflischer Künste bediene. Aber einer Antwort ward er enthoben. In dem Augenblick jagte eine königliche Ordonnanz heran, ein junger Offizier von den småländischen Reitern. »Der König hat die feindliche Reiterei auf dem rechten Flügel geworfen. Er befiehlt, daß überall die Infanterie vorrücken soll zum Sturm auf die Batterien!« meldete er.
»Sagt der Majestät: Ich bin schon dabei. Da kommen meine Kanonen. Wie geht's dem Könige?«
»Gut, gut!« rief der schwedische Rittmeister und stob von dannen.
Zwei Minuten später hatte Bernhards Fußvolk die Landstraße überschritten und stürzte sich voller Wut und Kampfbegierde auf die feindliche Infanterie. Aber trotz aller Tapferkeit gelang es ihnen nicht, die Kaiserlichen auch nur um einen Schritt zurückzudrängen. Die Colloredoschen Füsiliere waren eine erlesene Truppe und dazu gewaltig in der Überzahl, und so viele ihrer niedergehauen und geschossen wurden, es traten immer sofort andere in die Lücken, und auch als der Herzog selbst das zweite Treffen heranführte, war der eiserne Ring nicht zu durchbrechen. Es schlug die Mittagsstunde auf dem Turm des brennenden Lützen, da führte der Herzog selbst die Sturmkolonnen zurück. Die Feinde drängten nicht nach, denn sie waren selbst aufs furchtbarste erschöpft; auch war es wohl der Plan des Friedländers, das feindliche Heer sich bei einem zweiten Ansturm noch mehr verbluten zu lassen.
So entstand hier zwischen den beiden Armeen ein Zwischenraum, fast so breit wie er gewesen war beim Beginn der Schlacht, und abgesehen von einigen Schüssen, die noch gewechselt wurden, trat eine kurze Kampfespause ein.
Bernhard war bald hier, bald da, ordnend, ermunternd, anfeuernd, und auf seinen Ruf und Befehl hin schlossen sich die Glieder der Regimenter von neuem. Eben war er im Begriff, die Seinen zum zweiten Male zum Sturm zu führen, da bot sich ihm ein Anblick, der ihm ein paar Augenblicke das Blut in den Adern erstarren ließ.
Von rechts her, wo im Zentrum der Schlacht Reiterei und Fußvolk durcheinanderwogten, brach aus dem Pulverdampf ein lediges Roß hervor. Es war über und über mit Blut bedeckt und raste eine Strecke weit zwischen den beiden Heeren über den zerstampften und zerwühlten Boden hin. Dann stand es mit einem Male still, stieß mehrmals hintereinander seinen schrillen, gräßlichen Todesschrei aus und sank sterbend zusammen.
Bernhard bog sich auf seinem Gaule weit vor und stierte ungläubig und entsetzt das verröchelnde Tier an. Äffte ihn ein schrecklicher Spuk? Das war doch des Königs braunes Leibroß, das den Helden in die Schlacht getragen hatte?! Was war geschehen? War das Furchtbare Wahrheit? War er gefallen?
Noch hielt der Herzog starr auf seinem Rosse, da preschte der General Graf Knipphausen heran. »Der König ist tot. Es ist alles verloren!«
»Nein!« schrie Bernhard und reckte sich hoch in den Bügeln auf. Die lähmende Starrheit war im Nu von ihm abgefallen, und eine schreckliche Erbitterung hatte ihn erfaßt. »Nein! Nichts ist verloren«
»Aber der rechte Flügel weicht schon!« klagte Knipphausen.
»Anhalt!« rief Bernhard dem Führer des zweiten Treffens zu, der eben herankam, »der König ist gefallen. Ich habe das Kommando! Ihr bleibt hier stehen und greift nur an, wenn die Friedländischen über die Gräben kommen. Sonst erwartet Ihr weitere Order!« Damit wandte er sein Roß und jagte hinüber nach dem rechten Flügel.
Dort formierten gerade Stahlhanske und Eberstein, so gut es ging, die Reiterregimenter neu, die von dem kaiserlichen Fußvolk zurückgeschlagen waren. Die beiden Obristen weinten vor Wut und Schmerz, denn sie wußten schon, daß der König gefallen war, und verzweifelten am Sieg. Nur einen ehrenvollen Rückzug gedachten sie sich zu erkämpfen.
Da tauchte plötzlich in ihrer Nähe der Herzog von Weimar auf und seine Stimme schmetterte wie rollender Donner in die bestürzten, entmutigten Reihen: »Finnen! Deutsche! Schweden!« rief er, »euer König und unser Verfechter der Freiheit ist tot. Für mich ist das Leben kein Leben mehr, wenn ich seinen Tod nicht rächen soll. Wohlan! Greift unverzagt den Feind an! Wer beweisen will, daß er den König lieb gehabt hat, der tue es jetzt. Folgt mir und fechtet als ehrliche Soldaten!«
Damit riß er dem Fahnenträger des småländischen Regimentes die Standarte aus der Hand, wirbelte sie mit der linken Hand hoch in der Luft empor, warf sein Roh gegen den Feind herum und sprengte, den blanken Degen in der Rechten schwingend, gerade auf die Linien der Kaiserlichen los.
Einen Augenblick stutzten die Reiter. Dann brach ein lauter Schrei aus aller Munde, und vorwärts ging's hinter dem Führer her in wildem Rosseslauf. Wie eine verheerende Hagelwolke brausten die sechs Regimenter daher, unaufhaltsam, alles niederreitend. In Zeit von wenigen Minuten war die feindliche Kavallerie geworfen, zersprengt, auf die Vierecke des Zentrums zurückgeschleudert und diese selbst dadurch zum Weichen gebracht.
Wie ein gemeiner Reiter hatte Bernhard mit eingehauen. Nun aber, als er sah, daß die Feinde wichen, zügelte er sein Roß und ließ seine Leute unter ihren Obristen weiterkämpfen. Er ritt wieder hinüber zum linken Flügel, und nach einem furchtbaren Gemetzel gelang es auch hier, die feindlichen Regimenter zurückzudrängen und die Batterie zu nehmen.
Der Tag war für den Friedländer verloren, und auch Pappenheim, der am Nachmittag mit seinen Reitern eintraf, vermochte nicht mehr, dem Schicksal in die Zügel zu fallen. Wohl schien es einen Moment, als werde er dem vordringenden Herzog von Weimar mit seinen frischen Truppen doch noch den Lorbeer entreißen, aber eine tödliche Kugel traf ihn und warf ihn auf den Sand. Da ergriff seine Kürassiere, die ihn für fest gehalten hatten, eine abergläubische Furcht, und sie flohen eilig von dannen. Nur bei den drei Windmühlen in der Nähe des brennenden Lützen tobte noch in der Abenddämmerung der Kampf, aber als die früh hereinbrechende Novembernacht ihre dunklen Fittiche über das Land legte, da gingen auch dort die Kaiserlichen zurück, ihre Glieder lösten sich auf, und die geschlagenen Männer warfen Panzerstücke und Waffen weg, weil sie ihnen auf der Flucht hinderlich waren.
Die Sieger blieben auf der schwer erkämpften Wahlstatt und schickten sich an, wie Brauch war, hier die Nacht zu verbringen. Von einer Verfolgung der Feinde konnte gar nicht die Rede sein, denn die Mannschaften und Pferde waren bis auf den Tod erschöpft.
Die Troßknechte und Buben kamen aus dem Lager von Meuchen herbei, suchten Holz und Reisig und zündeten Feuer an. Um diese Feuer lagerten sich die müden Krieger; kein Scherzwort wurde laut, kein Liederklang, nur das Ächzen der Verwundeten unterbrach die schauervolle Stille der Nacht. Der Sieg war wohl erstritten, aber die Siegesfreude fehlte. Es war zu viel edles Blut geflossen; selbst den älteren schlachterprobten Kriegern graute es, als sie die Leichenhügel beim matten Schein der Feuer liegen sahen. Und hätte man auch alle diese Tausende verschmerzen wollen – einen konnte man nicht verschmerzen, einer war nicht zu ersetzen. Der König, der Herz und Haupt seines Heeres gewesen war, zu dem jeder einzelne aufgeblickt hatte wie zu einem Vater – der König war tot.
Herzog Bernhard ritt neben dem Fürsten von Anhalt nach Meuchen zurück. Er wollte dort in einem Bauernhause ein paar Stunden schlafen und dann wieder Knipphausen ablösen, der jetzt auf dem Schlachtfelde wachte. Das Suchen nach des Königs Leichnam hatte er aufgegeben, nachdem er fast eine Stunde lang bei Fackelschein mit einer Schar Getreuer auf der Walstatt umhergeirrt war. Der anhaltische Vetter sprach, um ihn aufzuheitern, von der herrlichen Viktoria, die sie errungen, und von dem Strahlenglanze des Ruhmes, den er sich um sein Haupt gewunden hätte. Aber Bernhard hörte kaum, was er sagte, und erwiderte ihm kein Wort. Er überdachte, was des Königs Tod bedeuten mochte für Deutschland, für die Sache des reinen Evangeliums und für sein eigenes Schicksal, und der heißeste Schmerz und die tiefste Trauer füllten seine Seele.
In starrem Schweigen ritt er ein in das Dorf, das wieder, wie am Morgen, voller Soldaten war. Auf dem Platze vor der Kirche brannten zwei helle Feuer, und zwischen ihnen erkannte er den alten Schulmeister von Meuchen, der, von schwedischen Reitern umringt, mit Hobel und Beil starke, breite Bretter bearbeitete. Denn der Alte war nicht nur Lehrer der Kinder und Küster des Kirchleins, er wußte sich auch als Tischler sein Brot zu verdienen, ja seine Hände erwarben ihm oft mehr, als ihm die Arbeit seines Kopfes einbrachte.
Der ungewöhnliche Anblick des schreinernden Kinderlehrers riß den Herzog aus seinen Gedanken. Er lenkte sein Roß zu ihm hin und fragte: »Was tust du da?«
Der Alte, in die Arbeit vertieft, hatte nicht acht gehabt auf sein Kommen. Jetzt wandte er sich rasch herum, und als er den Herzog erkannte, sank er auf die Knie und hob beide Arme zum Himmel empor. »Gelobt sei Gott!« rief er, »es ist noch einer Übrig, der den Streit des Herrn führen kann auf Erden wider die Söhne des Abgrundes, die Christi Reich zerstören wollen! Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist deines Vaters Wille, dir das Reich zu geben. Der Löwe aus Mitternacht, den der Herr gesandt hatte nach den Worten seines Propheten, ist tot, und wir zimmern hier seinen Sarg, aber – –«
»Wie?« unterbrach ihn Bernhard. »Des Königs Sarg? Habt ihr seinen Leichnam gefunden?«
Der alte Küster deutete nach der Kirche. »Dort, wo er heute früh noch den Leib und das Blut des Herrn empfangen hat, dort liegt nun sein Leib mit der blutigen Wunde, die ihm die Mordknechte des Friedländers beigebracht haben. Und wollt Ihr hören, gnädiger Herr, wie der gottselige Held gestorben ist, so kommt mit in mein Haus. Dort liegt der Page, der Euch heute früh zum Könige rief, und ein Arzt ist bei ihm und verbindet ihn, und wenn es Gott gefällt, so kann er wohl gerettet werden. Denn die Jugend kann oft überstehen, was keiner für möglich hält.«
Bernhard hörte schon längst nicht mehr auf das, was der Alte in seiner feierlichen, gesalbten Redeweise sagte. Sofort nach seinen ersten Worten hatte er sich zu der Kirchhofspforte hingewendet, durchschritt rasch das schmale Stück des Friedhofes und trat in das Gotteshaus ein, indem er die vor der Tür wachenden Offiziere mit einem kurzen Neigen des Hauptes grüßte.
An der Stelle, wo er heute früh mit Gustav Adolf gekniet hatte, stand ein rohgezimmerter Holztisch, und auf ihm lag die Königsleiche. Man hatte sie bereits gewaschen, in Leinen gehüllt und eine Decke von blauem Samt darüber hingebreitet. Das edle Antlitz schimmerte wachsbleich im Scheine der Altarkerzen, die es aus nächster Nähe voll beleuchteten. Man konnte den Zügen des Toten nicht ansehen, daß er auf gewaltsame Weise sein Leben verloren hatte, denn sie waren voll des tiefsten Friedens.
Bernhard trat schweigend an die Leiche heran und sank dann an ihrer Seite auf die Knie. Ein Tränenstrom stürzte aus seinen Augen, und ein Weinkrampf schüttelte seine Glieder. So lag er, die Hände gegen das Holz des Tisches gepreßt, eine geraume Zeit, und nur mühsam vermochte er sich endlich zu fassen. Er erhob sich, drückte einen Kuß auf die bleiche Stirn des Toten und wandte sich dann dem Ausgange zu. Es stand bei ihm fest, daß er die teure Leiche am nächsten Morgen früh selbst nach Weißenfels zur Königin bringen müsse, und er schickte sich an, die nötigen Befehle zu geben.
Da löste sich aus dem Dunkel des Hintergrundes der Kirche eine riesige Gestalt, die dort wohl schon lange gestanden haben mochte, und kam mit schweren Tritten auf ihn zu. Um die zerschundene Stirn trug der Hüne ein blutiges Tuch, und sein Panzer war vom Blut und Staub der Schlacht noch über und über bedeckt.
Bernhard erkannte den schwedischen Obristen Stahlhanske, und eine Röte des Zornes stieg ihm ins Gesicht, Schämte er sich auch seiner Tränen nicht, so war es ihm doch widerwärtig, daß gerade der sie gesehen hatte. Denn Stahlhanske war wohl der tapferste Mann des Heeres, aber rücksichtslos und hart und ihm von jeher abgeneigt. Er wollte mit einem finsteren Blicke und ohne Gruß an ihm vorüber, aber aufs höchste erstaunt blieb er stehen, denn er sah, daß der Riese plötzlich das Knie beugte.
»Herr Herzog von Weimar,« sprach er mit seiner tiefen, ungefügen Stimme, »ich war Euch feind. Ihr wißt es. Aber heute bitte ich Euch das ab. Von heute bin ich Euch Freund und ergebener Diener. Ihr habt meinen König gerächt und seine Schlacht gewonnen. Wart Ihr nicht, so war es aus mit unserem Ruhme. Darum müßt Ihr nun unser Heer führen alle Tage, bis der Krieg ein Ende hat.« Er stand schwerfällig auf und stieß sein Schwert auf den Boden. »Das sage ich, Herr Herzog, und verflucht sei, wer anders redet!«
»Herr Obrist Stahlhanske,« erwiderte Bernhard, »was Ihr da sagt, löscht allen Groll in meinem Herzen. Ich danke Euch. Gebt mir Eure Hand; es gibt keinen in der Armee, der heute mehr getan hätte wider den Feind! Ich nehme Eure Freundschaft und Euer Gelöbnis an. Überträgt mir die Krone Schwedens den Befehl, so rüste mich Gott der Herr mit der Kraft dazu aus, daß ich ihn allezeit wie heute führe.«
III.
In einem Bauernhause zu Meuchen hatten sich am Morgen des folgenden Tages die Führer des siegreichen Heeres zum Kriegsrat versammelt. Viele waren es nicht, die sich da auf Herzog Bernhards Befehl eingefunden hatten, denn die größere Hälfte der Generale und Obristen lag tot auf dem Schlachtfelde oder verwundet in den Häusern des Dorfes. Trotzdem vermochte der enge, niedrige Raum die Herren kaum zu fassen, so daß mehrere auf dem Ehebette des Bauern in der Ecke Platz nehmen mußten. Es herrschte eine so bedrückende Stille in der Stube, daß es fast den Anschein hatte, als habe man sich zu einem Leichenbegängnis versammelt, und als die letzten der Geladenen, die Obristen Lohusen und Eberstein, jetzt über die Schwelle traten, wurden sie von den Nächststehenden nur durch einen stummen Händedruck begrüßt.
»Ihr Herren!« begann Herzog Bernhard, der in einer der schmalen Fensternischen mit dem Rücken gegen die Scheibe stand. »Ich habe Euch hierher entboten, damit wir eilend festsetzen, was nun geschehen soll, unser großer König und Feldherr ist tot, Gott sei's geklagt. Er war uns allen, Schweden und Deutschen, ein Vater, und wie Waisen müssen wir uns fühlen, und über seinen Tod trauern wir, so lange wir leben. Aber das darf uns nicht hindern, schnell und entschieden zu handeln, und vor allem müssen wir da eines wissen: Wer soll von heute an das verwaiste Heer führen an Stelle dessen, der nicht mehr unter uns ist?«
»Ihr!« rief Stahlhanske, der auf der niedrigen Ofenbank saß und seine gewaltigen Beine mit den Rädersporen durch das halbe Zimmer strecken mußte. »Hat nicht der König Euch den Befehl übertragen? Und habt Ihr nicht gestern gezeigt, daß er damit recht getan hat?«
Beifallsgemurmel von allen Seiten. Aber aus dem Hintergründe des Gemaches kam eine ernste, ruhige Stimme: »Ich protestiere um des Gewissens willen.«
Alles fuhr herum und blickte den Sprecher voll ungläubigen