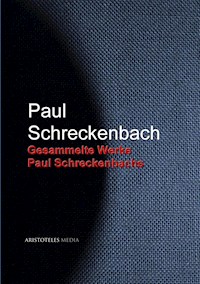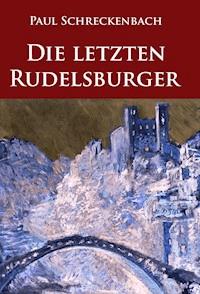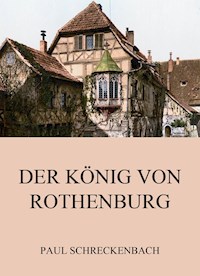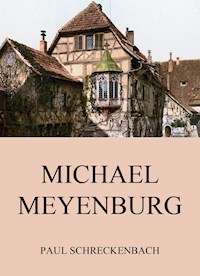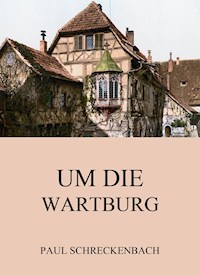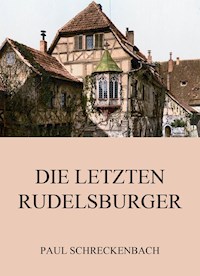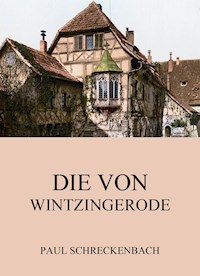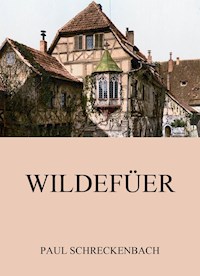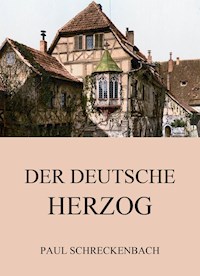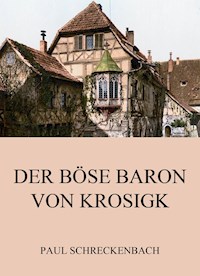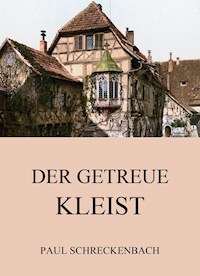
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem historische-biografischen Werk verarbeitet Schreckenbach die Lebensgeschichte Ewald Christian von Kleists, seines Zeichens deutscher Dichter und Offizier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der getreue Kleist
Paul Schreckenbach
Inhalt:
Paul Schreckenbach – Biografie und Bibliografie
Der getreue Kleist
Erstes Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Zweites Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Drittes Buch
I
II
III
IV
V
VI
Der getreue Kleist, P. Schreckenbach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849635695
www.jazzybee-verlag.de
Paul Schreckenbach – Biografie und Bibliografie
Deutscher Pfarrer und Schriftsteller, geboren am 6. November 1866 in Neumark (bei Weimar), verstorben am 27. Juni 1922 in Klitzschen bei Torgau. Sohn eines Pastors, studierte in Halle und Marburg Theologie und Geschichte und promovierte später zum Doktor phil. Ab 1896 arbeitete S. als Pfarrer in Klitzschen in der Nähe von Torgau. Der Autor ist bekannt für seine hervorragenden historischen Romane.
Wichtige Werke:
Bismarck, 1915
Der böse Baron von Krosigk, 1908
Die von Wintzingerode, 1905
Geistliche Lieder von Martin Luther, 1917
Der getreue Kleist, 1909
Der jüngste Tag, 1919
Der König von Rothenburg, 1910
Der Komtur, 1921
Kurfürst Augusts Abenteuer, 1921
Die letzten Rudelsburger, 1913
Markgraf Gero, 1916
Michael Meyenburg, 1920
Die Pfarrfrau von Schönbrunn, 1917
Sühne, 1923
Die Tat des Leonhard Koppe, 1916
Um die Wartburg, 1912
Der Weltbrand, 3 Bände, 1915-20
Die von Wintzingerode, 1905
Der Windmüller von Melpitz, 1914
Der Zusammenbruch Preußens 1806, 1906
Der getreue Kleist
Erstes Buch
I
Der Candidatus Theologiä Martin Garbrecht saß in seinem Informatorstüblein und schrieb in sein Tagebuch. Es war ein kleiner, aber unförmlich dicker Band, der vor ihm lag, verschließbar und für gewöhnlich auch streng verschlossen gehalten. Denn seinen verschwiegenen Blättern pflegte der junge Gottesmann alles anzuvertrauen, was er erlebte, dachte und empfand, das Buch durfte als ein getreues Spiegelbild seiner Seele gelten. Kein Wunder daher, daß er es vor profanen Blicken aufs sorgfältigste verbarg. Jetzt war er fertig und legte mit einem leichten Seufzer die Feder aus der Hand. Er bog sich in seinem roh gezimmerten Lehnstuhle so weit zurück, daß er mit dem Hinterkopfe fast das Fenster in seinem Rücken berührte, hob das Buch hoch empor und begann, die letzten Strahlen der Abendsonne auf diese Weise auffangend, halblaut vor sich hin zu lesen: »Schloß Zeblin, den 30. Junius 1724. Ein dies ater liegt hinter uns. Selten werden die gesegneten Fluren Zeblins und Curows solch ein Malheur erfahren haben. In der neunten Stunde des Vormittags schob sich eine effroyable schwarze Wolkenwand von Köslin heran, und ein Hagelwetter prasselte hernieder, erschröcklich zu sehen und ebenso erschröcklich zu hören, wohl fünf Minuten lang. Die Weibsen lagen auf den Knien und schrien, daß Gott sich erbarmen wolle, und mein Herr von Kleist stand weiß wie eine Wand mit zusammengebissenen Zähnen da. Es ist für ihn ein rechtes Kreuz, daß die schöne Ernte verhagelt ist, sintemalen seine Umstände, wie ich immer mehr sehe, ohnehin nicht die besten sind. Er ist zwar Erb-, Lehns- und Gerichtsherr auf sechs adeligen Gütern in unserem Pommernlande, aber –« Der Kandidat brach plötzlich ab, klappte das Buch zusammen und ließ es blitzschnell in einer Schublade verschwinden. Eilige Kinderfüße kamen die knarrende Stiege emporgestürmt, die Tür flog auf, und ehe der Kandidat den Schlüssel umdrehen konnte, stand ein etwa zehnjähriger Knabe im Zimmer. Man hätte ihn, der barfuß ging und ein vielfach geflicktes Wams anhatte, für einen Bauernjungen halten können, aber die feinen Züge und die großen blitzenden Augen deuteten darauf hin, daß nicht das Blut unterworfener wendischer Knechte in seinen Adern floß. Die wegen der Störung etwas unmutige Miene des Kandidaten entwölkte sich bei seinem Anblick sogleich, und ein Zug väterlichen Wohlwollens erschien in seinem jugendlichen, gewöhnlich etwas strengen Gesichte. Von den Kindern des Herrn Joachim Ewald von Kleist, die er zu erziehen hatte, war dieser Knabe ihm bei weitem der liebste. Denn er war nicht nur geweckt im Unterricht, er hatte sich auch seinem Präzeptor mit einer Zutraulichkeit angeschlossen, die eigentlich gar nicht in seinem ziemlich scheuen Wesen lag.
Darum trat der Kandidat mit freundlichem Lächeln auf ihn zu, faßte ihn scherzhaft beim Ohre und fragte in mild verweisendem Tone: »Junker Ewald, Junker Ewald, wann wirst du lernen manierlich anzuklopfen und ohne Gepolter in die Stube einzutreten? – Aber was ist denn los, mein Jung?« unterbrach er sich, denn er sah die Augen seines Zöglings mit einem so angstvollen Ausdrucke auf sich gerichtet, daß ihm der Gedanke durch den Kopf fuhr, es müsse ein Unglück geschehen sein. »Herrgott, was ist denn?« wiederholte er, als Ewald sich mit einem Male an seinen Arm klammerte und zu schluchzen anfing. »Ach, Herr Garbrecht,« stieß der Knabe hervor, »nicht wahr, es ist eine Lüge, daß die Daniela eine – eine Hexe ist?«
Der Kandidat trat betroffen einen Schritt zurück, und seine kleine zierliche Gestalt reckte sich. »Wer, sagst du? Die Schulmeistersche? Wer hat das gesagt?«
»Die Bauern sind unten beim Vater, ihrer drei aus Curow. Sie sagen, sie hätte das Wetter gemacht und dem Schulzen seine Ochsen hätte sie auch verhext.«
»Selbst Ochsen!« rief der junge Mann und schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Allmächtiger, wann endlich wird der scheußliche Wahn aufhören in diesem Lande! – Was wollen sie von deinem Vater?« fragte er weiter. »Der Vater soll sie nach Köslin schaffen lassen und nachher soll sie nach Berlin gebracht werden und – und –«
»Nun, und in Berlin?«
»Dort soll sie der König – der König soll sie – verbrennen lassen«, würgte der Knabe hervor und schluchzte wieder ganz verzweifelt auf.
Der Kandidat lachte spöttisch. »Das wird er wohl bleiben lassen. In unserem Lande ist der König neunmal klüger als sein dummes Volk.« Er legte seinem Zögling die Hand aufs Haupt und fuhr freundlich fort: »Sei ruhig, mein Jung. Deiner Daniela wird nichts geschehen. Sind die Leute noch unten? Ja? Nun, da werde ich gleich selbst einmal zu deinem Vater gehen.« – »Aber nicht doch!« wehrte er hastig und fast verlegen ab, als Ewald in stürmischer Aufwallung seine Hand ergriff, um sie zu küssen. »Geh noch eine halbe Stunde in den Park hinab, Ewald, ich komme dann zu dir.«
Als Garbrecht allein war, trat er mit raschen Schritten vor ein Bild, das an der Wand hing und blickte es wohl eine Minute lang unverwandt an. Es stellte einen Mann dar in der steifen Gelehrtentracht der Zeit, aber unter der von der ungeheuren Allongeperücke halb verdeckten Stirn funkelten ein paar ungewöhnlich scharfe Augen hervor, und um den feinen Mund spielte ein ironisches Lächeln. Das war Herr Christian Thomasius, Kanzler und einer der gefeiertsten Lehrer an der jungen Universität Halle, der große Bekämpfer und Überwinder des Hexenprozesses auf deutschem Boden. Durch ihn war der Kandidat einst in die Zahl der akademischen Bürger Halles aufgenommen worden, und auf eine Empfehlung hin hatte er sogar persönlich Zutritt zu dem Hause des berühmten Mannes gefunden. So kam es, daß selbst August Hermann Francke die Seele des jungen Theologen nicht in dem gleichen Maße hatte beeinflussen können wie der erleuchtete Jurist und Philosoph.
Erfüllt und begeistert von seinen Ideen kehrte er nach Hause zurück, aber er hatte damit kein Glück in seiner hinterpommerschen Heimat. Die Geistlichen dort waren fast alle in Greifswald gebildet und also in der starrsten lutherischen Rechtgläubigkeit befangen. Sie betrachteten von vornherein jeden mit Mißtrauen, der von Halle kam; denn der Pietismus Franckes war ihnen fast ebenso zuwider wie die humane Aufklärung des Thomasius. So hatte sich Garbrecht ihrer Gunst nicht zu erfreuen, und da die adeligen Patrone natürlich auf den Rat ihrer Pastoren hörten, so waren seine Aussichten auf eine Pfarrstelle sehr gering. Er wäre vielleicht sogar in Not und Bedrängnis geraten, wenn ihn nicht Herr Joachim Ewald von Kleist auf Zeblin in sein Haus aufgenommen hätte.
Dem war damals gerade die Frau gestorben, und so stellte er seine vier Mädchen unter die Zucht einer französischen Gouvernante, die beiden Knaben unter das Regiment eines Informators. Das war in seiner Lage sehr vernünftig gehandelt, denn er selbst hatte mit der Verwaltung seiner Güter genug zu tun und konnte sich um die Erziehung seiner Kinder wenig kümmern. Auch die Stiefmutter, die er ihnen einige Jahre später gab, nahm die Zügel der Erziehung nicht in ihre Hand. Sie war ein polnisches Fräulein, eine Tochter des königlichen Kammerherrn von Dorpowski auf Grabiana, noch ziemlich jung, hübsch, lebenslustig und sehr geneigt, sich auf Zeblin zum Sterben zu langweilen. Darum verreiste sie überaus häufig zu Verwandten oder Freunden, wo es etwas zu sehen und mitzumachen gab, und so befand sie sich gerade jetzt wieder bereits seit sechs Wochen bei einer Tante in Dresden und schien noch kaum an die Heimkehr zu denken. Daher war Herr von Kleist sehr häufig nur auf den Informator seiner Kinder angewiesen, wenn er mit jemand in seinem Hause ein vernünftiges Wort reden wollte, wozu er ein starkes Bedürfnis besaß. Denn er hatte in der Tat Interessen, die über seine Wirtschaft, die Reitbahn und Wildbahn hinauslagen. Er liebte es, tiefsinnige Gespräche über Gott und die Welt zu führen, wobei er freilich oft verwunderliche Meinungen zum besten gab, aber auch Widerspruch wohl vertragen konnte. Solche Disputationen dehnten sich nicht selten bis weit über Mitternacht aus, und seine Partner mußten sich nicht nur durch eine tüchtige Suada, sondern auch durch eine trunkfeste Kehle auszeichnen. Denn Herr Joachim Ewald war der Meinung, daß zu jedem ernsten Männergespräch Rotwein gehöre, vieler, guter und starker, oder auch ein steifer Grog, bei dem das Wasser gänzlich fehlen durfte. So hatte er schon manchen mundtot gemacht, nicht durch das Gewicht seiner Gründe, sondern durch kräftiges Zutrinken.
Bei Garbrecht hatte er damit allerdings selten Glück, denn der stand in einem festen Trunke, wie in allen anderen Dingen, seinen Mann. Das trug sicher dazu bei, ihm die Achtung und das Wohlwollen des Edelmannes zu erhalten. Erworben hatte er sich beides durch die gerade Ehrlichkeit seines Wesens und die ungeschminkte Deutlichkeit, mit der er seine Meinung äußerte. »Man weiß immer, wie man mit dem Kerl dran ist,« pflegte Herr von Kleist von dem Lehrer seiner Kinder zu sagen.
Auch jetzt war der Kandidat fest entschlossen, ohne alle Umschweife für die von ihm erkannte Wahrheit einzutreten, selbst wenn der Edelmann, was nicht unwahrscheinlich war, den Aberglauben seiner Bauern teilen sollte.
Er schritt die Treppe hinab und trat auf die Diele. Dort öffnete sich eben die Tür, die zu der Wohnstube des Gutsherrn führte. Drei Bauern in ihren Sonntagsgewändern schoben sich heraus, und bei ihrem Anblick vermochte der Kandidat ein schadenfrohes Lächeln nicht zu unterdrücken. Denn ihre Mienen waren so finster und verbissen, daß man ihnen auf den ersten Blick ansah, sie hatten ihren Zweck bei dem Herrn nicht erreicht.
»Nun, Enbschulze, hat Euch der gnädige Herr die Wahrheit recht ordentlich gesagt?« fragte Garbrecht den ältesten und dicksten unter ihnen.
Der Bauer sah ihn mit einem queren Blicke an und murmelte: »Recht möt man doch Recht bliven.« Dann schritt er ohne Gruß mit den anderen dem Ausgange zu.
Der Kandidat blickte ihnen nach. »Wenn die Dummheit weh täte,« dachte er bei sich, »so müßten diese Menschen vor Schmerzen rasen.« Dann klopfte er an, und auf ein mürrisches »Herein« trat er ins Zimmer.
Das Gemach war halb finster, die Lichter waren noch nicht gebracht. Mit Mühe unterschied der Kandidat die große Gestalt des Edelmannes, der sich mit der Stirn gegen das Fensterkreuz gelehnt hatte und sich bei seinem Eintritt nur halb umwandte.
»Was wollt Ihr?« fragte er verdrossen. Die Anrede »Sie« gebrauchte ein pommerscher Edelmann gegenüber einem Geistlichen erst dann, wenn der die Ordination empfangen hatte. Daran änderte alle persönliche Wertschätzung nichts. »Ich will Ihnen danken, Herr von Kleist, dafür, daß Sie die Menschlichkeit und die Vernunft gegen unsere Bauern vertreten haben.«
»Was wißt Ihr denn davon?« fragte der Edelmann verwundert.
»Ewald sagte mir, weshalb die drei gekommen waren.«
»Der Ewald? Der Jung ist überall und nirgends. Er hört alles, was er nicht hören soll,« brummte Kleist.
»Es wird sich keiner so freuen wie er, daß Sie die abscheulichen Anträge der Leute zurückgewiesen haben,« bemerkte Garbrecht.
»Zurückgewiesen? Ich habe ihnen nur gesagt, ich wolle mir die Sache überlegen,« erwiderte der Edelmann langsam und bedächtig.
»Herrgott, was gibt's da noch zu überlegen!« fuhr es dem Kandidaten heraus.; »Man müßte einem Menschen, der einen anderen der Hexerei bezichtigt, fünfundzwanzig Stockprügel zudiktieren. Dann würde die alberne Bosheit bald verschwinden.«
»Meint Ihr?« sagte Kleist und ließ sich schwerfällig in einem Stuhl am Fenster nieder. »Na, ich will Euch was sagen, Kandidat: In diesen Dingen spricht der eine so, der andere so, und der Henker weiß, wem man glauben soll. Eueren Thomasius in Ehren, aber es gibt kuriose Dinge in der Welt.«
»Mein Herr von Kleist will doch nicht sagen, daß er an Teufelsbündnisse glaubt?« gab Garbrecht mit einem überlegenen Lächeln zur Antwort.
Der Schloßherr schlug sich mit der Faust aufs Knie. »Glaubt Ihr, daß es einen Teufel gibt?« fragte er unwirsch.
»Das ist nicht zu leugnen!« rief der Kandidat, »wird auch vom großen Thomasius nicht geleugnet.«
»Ist mir lieb zu hören,« entgegnete der Edelmann, »denn wer nicht an den richtigen Teufel glaubt, der glaubt auch nicht an den richtigen Gott. Warum soll er also nicht mit den Menschen einen Pakt schließen können?«
»Ja, warum sollten die Leute mit ihm einen Pakt schließen wollen?« gab der Kandidat zurück.
»Damit sie reich oder mächtig oder sonst was werden.«
Garbrecht lachte. »Das paßt auf den Fall, der vorliegt, ausgezeichnet. Die Daniela Kluska ist eine arme Schulmeisterswitwe und lebt in dem alten halbverfallenen Schulmeisterhause, das Ihre Gnade ihr überlassen hat. Sie nährt sich und ihre Susanne redlich durch ihrer Hände Arbeit und durch die Heilmittel, die sie für Menschen und Tiere bereitet.«
»Eben dadurch hat sie sich im Dorfe verdächtig gemacht,« warf Kleist ein.
»Natürlich!« sagte Garbrecht hart, und sein Gesicht rötete sich, »wer der Welt wohltut, wird zum Dank von ihr gesteinigt.«
»Man kann auch sagen,« erwiderte Kleist, »die Menschen tragen Scheu vor einem, der an die geheimnisvollen Kräfte der Natur rührt. Das ist nicht wohlgetan.«
»So sprachen Sie nicht voriges Jahr, als die Kunst dieser Frau den Ewald und die Adelheid vom Fieber kurierte,« sagte der Kandidat gelassen.
»Den Ewald hat sie seit der Zeit auch ganz verhext,« knurrte der Edelmann, »der Bengel steckt oft halbe Tage lang in ihrer Spelunke und spielt mit der Schulmeistersgöhre.«
»Das hat wohl seinen triftigen Grund,« entgegnete Garbrecht, »die Frau war seine Amme, und die kleine Susanne ist seine Milchschwester. Und ich will meinem Herrn von Kleist den tieferen Grund sagen, der ihn zu der Frau zieht. Er findet dort die Liebe, die er sonst nirgends wo findet, seit seine Mutter in die Ewigkeit eingegangen ist.«
»Was?« rief der Edelmann und sprang auf, »wollt Ihr sagen, ich liebe meine Kinder nicht?«
»Das durchaus nicht,« fuhr Garbrecht ruhig fort, »aber Sie können ihnen die Mutterliebe nicht ersetzen. Sie sind ein guter Vater, aber ein strenger Vater, wie die allermeisten Väter sind und wohl sein müssen. Deshalb bildet die zärtliche Mutter nach Gottes Ordnung eine Art Gegengewicht gegen die rauhe Art des Vaters. Das fehlt hier. Manche Kinder entbehren es weniger, andere sehr, und Ewald gehört zu diesen anderen. Seine neue Mutter ist, hm, mit Respekt zu sagen, sehr viel verreist. Er hungert nach Liebe und findet sie nicht. Auch seine älteren Schwestern sind nicht zärtlichen Gemüts. Darum läuft er zu der Witwe des Schulmeisters, die ihm von seiner seligen Mutter erzählt und ihr Grab mit ihm schmückt. Das, mein Herr von Kleist, das ist es, was ihn dorthin treibt, nichts anderes.«
Herr von Kleist hatte sich, während er so redete, ganz von ihm abgewendet, als schaue er angelegentlich in den dämmernden Hof hinaus. Er schwieg lange, dann sagte er mit seltsam veränderter, gepreßter Stimme: »Ihr möget wohl nicht unrecht haben. Ja, es war ein Jammer, daß meine selige Frau starb. Sie ist nicht zu ersetzen. Geht jetzt, wir reden über alle diese Dinge ein andermal. Sagt dem Diener, er soll die Lichter bringen; ich habe noch allerlei zu schreiben vor dem Nachtessen, denn ich fahre morgen in Geschäften nach Köslin, dann auf zwei Tage zu meinem Schwiegervater nach Groß-Poplow.«
Der Kandidat verbeugte sich und ging. Er war ergriffen, denn bewegt hatte er den Herrn von Kleist noch nie gesehen. Zugleich war es ihm peinlich, daß er dem Manne, der sonst seine Gefühle so streng vor der Welt verbarg, diese Äußerung entlockt hatte. Es kam ihm vor, als habe er an eine Wunde gerührt, die zu berühren ihm nicht gezieme.
Mit einem Seufzer wandte er sich der hinteren Ausgangstür des Hauses zu, die in den Park führte. Dort lief ihm Franz Kasimir von Kleist, sein ältester Zögling, von außen entgegen.
»Wo ist dein Bruder Ewald?« fragte er ihn.
Der Knabe lächelte geringschätzig. »Er bringt die Schulmeistersuse heim.«
»Wen?«
»Na, das Kind von der –,« er machte eine verächtliche Handbewegung. »Sie hat wieder den ganzen Tag auf dem Hofe gesteckt, und nun traut sie sich nicht nach Hause und fürchtet sich.«
»Mit Fug und Recht. Warum bist du nicht mitgegangen?«
»Ich mag nicht. Das dumme Ding geht mich nichts an,« antwortete der Knabe trotzig.
»So! Welchen Weg sind sie?«
»Hinten durch den Park.«
Mit langen Schritten eilte der Kandidat den Kindern nach. Er mußte sich sagen, daß die Furcht der Kleinen keineswegs unbegründet war. Ihre Mutter war ja gewiß jetzt im Munde aller Leute, und rohe Burschen, die nach Feierabend umherschwärmten, mochten wohl auf den Gedanken kommen, an dem Kinde der verfemten Frau eine Gemeinheit zu verüben. Dem Herrensohne drohte allerdings kaum eine Gefahr, denn die Furcht vor der harten Hand des adeligen Gebieters bändigte auch die Frechsten. Aber vielleicht erlebte er etwas Abscheuliches, was ihm auf immer eine quälende Erinnerung blieb.
Seine Ahnung trog ihn nicht. Kaum war er aus dem Parke herausgetreten und den dämmernden Weg etwa hundert Schritte weit gegangen, da hörte er Stimmen, und hastig näher laufend und um eine Ecke biegend, gewahrte er eine eigenartige Gruppe.
Da stand der kleine Junker Ewald an einen Zaun gelehnt. Mit der Linken hatte er ein weinendes kleines Mädchen umfaßt, in der Rechten hielt er eine schwankende Gerte und schrie mit schriller Kinderstimme auf ein paar halbwüchsige Bengel ein, die grinsend vor den beiden standen.
»Geiht ut dem Weg, Lümmels, ich seggs min Vatter!«
»Lat sin, lütt Junker, dir dauhn wi nicks. Wir wölln det Hexenmäden en beten in de Radüe smeiten,« sagte der eine der Burschen mit rohem Lachen und streckte die Hand nach der Kleinen aus. Aber da pfiff die Gerte des Knaben durch die Luft, und er fuhr zurück mit einem breiten, roten Striemen auf dem Gesicht.
»Rackertüg!« knurrte er, indem er sich die getroffene Wange rieb. »Hei hadd mich geslagen. Jo, jo, jungen Spatzen und jungen Edellüt soll man bi Tiden de Köpp indrücken.«
»Was geht hier vor?« rief Garbrecht, der atemlos auf dem Platze erschien.
Kaum gewahrten ihn die beiden Burschen, so drehten sie sich um und gaben Fersengeld. Denn wenn sie dem geistlichen Herrn entgegentraten, dann, das wußten sie, nahm die Sache ein sehr böses Ende. Dann setzte es Prügel, das war so sicher wie das Amen in der Kirche, und die Strafbank in der Zebliner Gerichtsstube war beiden schon bekannt.
»Geh nach Hause, Ewald!« sagte der Kandidat ruhig und freundlich. »Du weißt, du sollst nicht in der Dämmerung herumstreichen. Ich selbst werde Susanne zu ihrer Mutter bringen.«
Der Knabe gehorchte ohne ein Wort der Widerrede und wandte sich zum Gehen. Aber da stürzte das Mädchen laut weinend auf ihn zu, warf ihre dünnen Ärmchen um seinen Hals und küßte ihn auf die Wange.
Ewald duldete die Zärtlichkeit still mit einem scheuen Blick nach seinem Erzieher hin. Er erwiderte sie nicht, sondern legte nur leise seine Hand auf den Kopf des Kindes.
Der Kandidat war über den plötzlichen Gefühlsausbruch des Mädchens geradezu erschrocken. Er berührte ihn peinlich. »Gott bewahre mich,« dachte er, »welch leidenschaftliches Wesen steckt in diesem Kinde! Welche Frühreife! Nun ja, es ist polnisches Blut in ihr. Aber für den Knaben ist das nicht gut, nein wahrhaftig, gar nicht gut. Sie darf nicht mehr so viel mit ihm spielen, denn da werden leicht Sentiments geweckt, die noch lange in seiner Seele schlummern sollten. –«
Noch auf dem Heimwege grübelte er darüber, wie er die Kinder voneinander trennen könne, ohne Ewalds Herzen zu weh zu tun. Aber wie er auch sann, er fand keinen Ausweg.
II
In der Morgenfrühe des folgenden Tages hielt die Kalesche des Schloßherrn vor der Freitreppe. Vier Pferde waren davor, zwei Reitknechte saßen rechts und links auf ihren Gäulen. So gehörte es sich bei der Ausfahrt eines adeligen Herrn im Pommernlande.
Herr von Kleist trat aus der Tür, redete noch eine Weile mit dem Kandidaten Garbrecht und seinen Töchtern, erteilte dem Vogt einige schnelle Instruktionen und stieg dann in den Wagen. Die beiden Junker, denen erlaubt war, den Vater ein Stück Weges zu geleiten, kamen auf ihren Ponys von den Ställen her eilig heran, und der Zug setzte sich in Bewegung.
Aber schon am Tore hielt er wieder. Eine Rotte von Bauern schob sich da herein, Weiber und Kinder hinter ihnen.
»Zum Henker, Schulze, was soll's? Sieht er nicht, daß ich verreisen will?« fragte Kleist unwirsch.
Der Bauer räusperte sich und fing dann zu reden an, langsam und breit, wie es seine Art war: »Ich wollt' dem gnä'n Herrn nur vermellen, dat min andrer Ochs ooch noch krepiert is.«
»Tut mir leid,« schnitt ihm der Edelmann kurz das Wort ab. »Kann aber nichts dafür. Jochem, fahr zu!«
»Jo, aber die Hexe!« rief der Bauer und ballte die mächtigen Fäuste, und seine kleinen, grauen Augen funkelten wie die eines gereizten Stieres. »Sell sie frei leddig blieven? Sie gehürt ins Loch und dann aufs Gericht!«
»Da ist man all noch Tid, bis wi wiederkamen,« erwiderte Herr von Kleist, »marsch, Jochem!«
Der Wagen zog an. Um ein Haar wäre sein Vorderrad dem Schulzen über die Füße gegangen. Der stand noch lange auf demselben Fleck und schüttelte die Fäuste und murmelte Flüche und Verwünschungen vor sich hin, während die anderen ihn murrend umringten.
Herr von Kleist war mit finsterem Angesicht in seinen Sitz zurückgesunken. Die Szene war ihm peinlich gewesen, denn er war keineswegs aufgeklärt genug, um das Ansinnen des Erbschulzen aus voller Überzeugung zurückzuweisen. Sein seliger Vater, das wußte er, hätte eine Person, die unter solchem Verdachte stand, ohne weiteres einsperren lassen und dann dem landesherrlichen Gericht überliefert. Dort mochte sie sehen, wie sie los kam. Auch ihm selbst war in früher Kindheit schon eingeprägt worden, daß viele von den Übeln, die das Menschengeschlecht betreffen, durch die Diener und Dienerinnen des bösen Feindes verursacht werden. Dieser Glaube war durch Garbrecht und die Bücher, die er von ihm empfangen hatte, stark erschüttert worden, aber gänzlich ausgerottet war er nicht aus seiner Seele. Er wußte nicht, ob er recht gehandelt hatte, wie seine Pflicht als Gerichtsherr gebot, und fühlte zugleich einen Abscheu vor dem Gedanken, die frühere Dienerin seiner Frau und die Retterin seiner Kinder aus schwerer Krankheitsgefahr in einen peinlichen Prozeß zu verstricken.
So fuhr er dahin im Zwiespalt mit sich selbst, und was er um sich her erblickte, konnte ihn nicht heiterer stimmen. Jetzt erst sah man, was das furchtbare Unwetter des gestrigen Vormittags auf den Feldern angerichtet hatte. Das Korn, das vorgestern noch im Winde gewogt hatte wie ein weites grünes Meer, lag zerschlagen am Boden. Verwüstung und Jammer, soweit das Auge reichte!
Herr von Kleist wußte, was das für ihn bedeutete. Wenn ihm seine Schwiegermutter in Groß-Poplow nicht half, nicht helfen konnte, so standen ihm schwere Tage bevor.
Den beiden Knaben war es kein Vergnügen, neben dem wortkargen, düster vor sich hinblickenden Vater durchs Land zu reiten. Sie waren daher froh, als er sie bei einer Wegbiegung verabschiedete. Sie schwenkten ihre Mützen, wünschten als artige, wohlerzogene Junker dem Herrn Vater glückliche Reise und baten, den Herrn Großvater und die Frau Großmutter sowie den Onkel Christian zu grüßen. Dann aber wandten sie schnell ihre Pferde und jagten davon, als hätte man sie bisher an Ketten gehalten.
»Der Vater ist gar zu verdrießlich,« bemerkte Franz, als die Tiere wieder eine ruhigere Gangart eingeschlagen hatten.
»Er sah aus wie der Bär, den Herr Garbrecht in seinem großen Buche hat.«
»Ich weiß, warum er so verdrießlich ist,« sagte der Kleine wichtig.
»Na, das ist nicht schwer zu erraten,« lachte Franz. »Die Ernte ist ihm verhagelt.«
Ewald schwieg eine Weile, dann sagte er geheimnisvoll: »Du, ich glaube, der Vater hat kein Geld mehr.«
Der Ältere, der einen Schritt vorausritt, warf mit einem Ruck den Kopf herum. »Kein Geld? Wie kommst du auf solchen Unsinn?«
»Als neulich Onkel Christian da war, sagte der Vater zu ihm im Parke: ›Wenn diesmal der Weizen so schlecht gerät wie im vorigen Jahre, so kann ich dem Jüd Abraham in Stettin die Zinsen wieder nicht bezahlen.‹ Und nun hat er gar keinen Weizen.«
Der größere Knabe pfiff durch die Zähne. »Das hast du gehört?«
»Ich saß auf der großen Ulme, sie gingen darunter weg.«
»Na, da wird ihm ja der Großvater schon aus der Patsche helfen,« sagte Franz nach einigem Besinnen. »Ich glaube, der hat viel Geld. Denke einmal, was sie auf Groß-Poplow alles haben, Kronleuchter und seidene Vorhänge und einen Papagei, und die Großmama hat sogar einen echten Mops. Der Vater sagte, der wäre fünfzig Dukaten wert und darüber.«
»Aber ich möchte doch nicht dort wohnen,« warf Ewald ein. »Dort muß man immer in guten Sachen gehen, und wenn man sich barfuß macht, schreit die Großmama: ›Affrös, affrös!‹ Und man muß immer die Hand geben und Komplimente machen und sich gerade halten.«
»Das müssen wir alles können, wenn wir Kavaliere werden und an den Hof kommen,« versetzte Franz Kasimir weise.
»Ach, ich will gar kein Kavalier werden und mag auch nicht an den Hof!« rief der Jüngere.
»So? Was willst du denn werden? Willst du immer auf unserem Gute hocken?«
»Am liebsten würde ich Förster,« sagte Ewald eifrig. »Oder Forstmeister, weißt du, wie der Onkel Hans. Im Walde, da bin ich doch am liebsten. Wenn so die Sonne durch die grünen Zweige scheint und die Vögel singen, da ist's doch zu schön, wie in einem Märchen.«
Das Gesicht des Knaben nahm bei diesen Worten einen fast schwärmerischen Ausdruck an, und die großen blauen Augen blickten traumverloren in die Ferne.
Der ältere Bruder sah es von der Seite und lächelte spöttisch. »Ach was, Forstmann!« rief er. »Ein Kleist muß Offizier werden!«
»Offizier? Ja, wenn Krieg wäre. Aber sonst ist das Exerzieren zu langweilig,« gab Ewald zurück.
»Na, du und Krieg!« erwiderte Franz Kasimir geringschätzig. »Das ist nichts für dich. Du solltest lieber Prediger werden.«
Das Gesicht des Jüngeren rötete sich. »Warum?« fragte er hastig.
»Weil du immer so klug snackst, und Mut hast du auch nicht!«
»Was, ich habe keinen Mut?« schrie der Knabe erbittert. »Sieh man zu, ob du das kannst!«
Er gab seinem kleinen Pferde die Sporen, setzte mit ihm über den Straßengraben, jagte über eine kleine Wiese und überflog einen breiten Abzugskanal, in dem sich trübes, schlammiges Wasser dem Flüßchen Radüe zuwälzte. Dann ritt er mit blitzenden Augen auf seinen Bruder wieder zu.
»Dortau is mien Pierd tau dick,« sagte der gleichgültig.
»Nee, dazu bist du selbst zu faul und ungeschickt, du Großhans!«
»Was bin ich?« rief der Ältere und erhob seine Reitgerte.
»Kurz und dick, Ungeschick!«
sang Ewald spottend und setzte von neuem sein Pferd in Trab. »Fang mich, wenn du kannst!«
Die Knaben waren dabei ins Dorf eingebogen, der Ältere immer dicht hinter dem Jüngeren, doch ohne ihn einholen zu können. Plötzlich aber, um eine Ecke biegend, hemmten beide mit einem Ruck den Lauf ihrer Tiere.
Sie hätten auch beim besten Willen nicht weitergekonnt, denn auf der engen Straße hatte sich die ganze Bewohnerschaft des Ortes zusammengedrängt, Männer, Weiber, Kinder, alles durcheinander. Der Kandidat Garbrecht war auch da. Er stand vor der niedrigen Lehmhütte der Schulmeisterswitwe Kluska und hatte beide Arme beschwörend zum Himmel emporgehoben. Laut gellte seine scharfe, durchdringende Stimme über die Menge hin, die ihm murrend und fluchend entgegendrängte.
»Leute!« rief er, »Leute, nehmt Vernunft an! Was ihr hier tut, ist Verbrechen, Landfriedensbruch! Ihr bringt euch in den Kerker!«
»Hei hat uns nicks tau seggen!« tönte es ihm entgegen. »Rut, rut mit die Hexe! Wi wölln se swimmen laten!«
»Herr Garbrecht, ich hole den Vater!« schrie da eine helle Kinderstimme in den Tumult hinein, und blitzschnell, ohne jedes Überlegen wandte der kleine Ewald sein Pferd um und jagte den Weg zurück, den er gekommen war. Wie ein Rasender trieb er sein Tier zum schnellsten Galopp an. Aber er kam nicht weit. Als er in die große Straße einbog, die von Köslin nach Polzin führt, kam ihm in gemächlicher Fahrt ein offener Wagen entgegen. Darin saß der Landrat von Kleist, ein entfernter Vetter seines Vaters, und neben ihm ein fremder Herr mit einem Sterne auf der Brust. Zwei Offiziere ritten links und rechts neben dem Wagenschlage, und mehrere Dragoner folgten in einiger Entfernung.
Der Knabe war im Nu von seinem Pferde herunter, das keuchend stehen blieb. »Herr Landrat, zu Hilfe, zu Hilfe! Der Vater ist nicht zu Hause, und da wollen die Bauern die Daniela tot machen!«
Die Kutsche hielt an, und der fremde Herr bog sich verwundert heraus. »Was ist das für eine tolle Geschichte?« fragte er. »Wer bist du, Jung?«
»Ich heiße Ewald von Kleist.«
»Kennt er den Bengel, Kleist?« wandte sich der Fremde an den Landrat.
»Jawohl, Majestät, es ist der zweite Sohn des Zebliners.«
»Des Zebliners? Kenne ich nicht. Hat er gedient?«
»Das nicht, Majestät, aber er ist ein tüchtiger Landwirt.«
»So. Freut mich zu hören. Nun komm mal her, mein Söhnchen, und erzähl' deine Sache. Ich bin der König.«
Ewald sperrte Mund und Augen auf. Wie? Der untersetzte Mann in der Kutsche war der König, den alle im Lande fürchteten? Er hatte ja einen ganz gewöhnlichen Offiziershut und keine Krone auf dem Kopfe, dachte der Knabe. Aber dabei schoß ihm der Gedanke durchs Hirn, daß er seine eigene Mütze noch auf dem Kopfe habe. Er riß sie eilfertig herunter und sagte höflich: »Guten Morgen, Herr König.«
Die Offiziere lachten. Auch der also begrüßte König schmunzelte. »Nun aber man fix, mein Jung!« rief er, »was ist in eurem Dorf passiert?«
Ewald erzählte hastig, stockend, seine Worte manchmal überstürzend. Je länger er sprach, um so mehr verfinsterten sich die Mienen des Königs, und als der Knabe seinen Bericht beendet hatte, schlug er mit der Faust auf das Kutschenleder, daß es knallte.
»Das ist ja unerhört!« rief er. »Das Volk nimmt sich selbst das Recht, als gäbe es keine gottgeordnete Obrigkeit. Was sagt er dazu, Kleist? He? Na, ich werde die Rackers lehren und ein Exempel statuieren. Vorwärts!«
Der Wagen rollte im schärfsten Trabe ins Dorf. Als er um die Ecke bog, wurden gerade die lauten Hilferufe eines Weibes hörbar. Die Bauern hatten die schwarze Daniela aus ihrem Häuschen ins Freie gezerrt. Sie lag auf den Knien und klammerte sich verzweifelt an den Kandidaten Garbrecht, der vergeblich auf das wütende Volk einredete.
»Wi wollen det Beest im Teiche swimmen laten. Sinkt sei unner, dann is sei schüllig un mag ersupen. Swimmt sei baben, so is sei unschüllig un kann geihn, woan sei will,« dekretierte eben der Dorfschulze mit schallender Stimme. Dann drehte er sich langsam um, betroffen über die Stille, die plötzlich hinter ihm entstand. Da fiel ihm der Stock aus der Hand, und das Wort blieb ihm in der Kehle stecken. Denn da saß im Wagen ein Mann mit zornrotem Angesicht, den er gar wohl kannte. Fast jeder Preuße wußte ja, wie der Monarch aussah, der unermüdlich kreuz und quer in seinem Lande umherfuhr, überall revidierte und streng darauf sah, daß das Rechte getan und das Unrechte gemieden werde.
»Der Düvel, der König!« stotterte der Schulze verwirrt und erschrocken.
»Seine Majestät! Den hat Gott selbst hergeführt,« rief der Kandidat Garbrecht.
Eine tiefe Stille entstand und wurde immer tiefer und beklemmender. Ein Heiduck war vom Bock gesprungen und riß den Wagenschlag auf.
Friedrich Wilhelm stieg langsam aus und schritt durch die Menge, die scheu und stumm zurückwich, der Tür der Hütte zu, wo sich der Kandidat noch immer nicht von der verzweifelten Frau und ihrem Kinde zu lösen vermochte.
»Wer ist er?« fuhr ihn der König an.
»Ich bin der Kandidat der Theologie Garbrecht, Präzeptor beim Herrn von Kleist, und wollte hier ein Verbrechen verhindern,« erwiderte der junge Mann, dem König fest in die durchbohrenden Augen blickend.
»Da hat er Recht getan. Und er? Was hat er hier zu suchen?« schnaubte der König den Erbschulzen an, der jetzt dicht vor ihm stand.
Der vermochte nicht zu antworten, so war ihm der Schreck in die Glieder gefahren.
»Eure Majestät halten zu Gnaden,« sagte Garbrecht, »die Leute hatten die Frau da, die Witwe des seligen Schulmeisters, eine ganz brave Person, der Hexerei beschuldigt. Da Herr von Kleist nicht auf ihr Geschwätz hörte, wollten sie in seiner Abwesenheit die Hexenprobe mit ihr vornehmen.«
Der König wandte sich wieder dem Schulzen zu, und sein Gesicht wurde braunrot vor Zorn. »Ist das wahr? Was hat er zu sagen?«
Der Bauer drehte seine Mütze unschlüssig in den Händen hin und her. In seinem eigenwilligen Gesicht malten sich zugleich Furcht und Trotz. »Dat Wiv«, sagte er, »hat uns Hagelwetter gemacht un uns Veih verhext. Uns gnä' Herr wull nich up uns hüren und fohr wegg. Da hewwen wi sülbst uns Recht schapen wölln.«
»Kanaille!« schrie der Monarch in hellem Zorn und hob den Stock. »Du bist dazu eingesetzt, in deinem Dorfe auf Ordnung zu halten und stiftest die Leute zu Rebellion an? Sind wir beim Großtürken? Weißt du nicht, wo du Recht findest, wo jeder Recht findet in Preußen? Kennst du meine Gerichte nicht? Erfrechst du dich, selbst richten zu wollen? Wart', ich will dich lehren, ich will dich lehren, Bursche!«
Dabei sauste der königliche Rohrstock unablässig auf die Rückseite des unglücklichen Dorfoberhauptes hernieder. Der wandte sich hin und her, sprang von einem Bein aufs andere und bat ächzend um Gnade, aber der König hörte nicht eher auf, als bis der Sünder eine tüchtige Tracht Prügel empfangen hatte.
Dann drehte ihm der Monarch den Rücken zu und wendete sich an Garbrecht. In seinem Antlitz lag mit einem Male nicht der geringste Zorn mehr, es war, als habe der sich bei der kräftigen Motion ganz und gar ausgetobt.
»Nun zu ihm, Theologe,« sagte er, »meint er, daß diese Person unschuldig ist?«
»Majestät!« rief Garbrecht, »sie hat nie etwas Böses getan, wohl aber vielen Leuten viel Gutes erwiesen. Es ist nur die Dummheit der Menschen, die sie verlästert. Die Menschen sehen in allen Dingen Hexerei und Wirkungen des bösen Feindes, während Gott der Herr das Unglück zu unserer Prüfung schickt.«
»Er meint das Hagelwetter? Bong!« versetzte der König; »ist der Gutsherr derselben Meinung?«
»Ich glaube wohl, Majestät.«
»Na, dann werdet ihrs ja wissen, und mein Amtmann braucht sich nicht mit dem Kasus zu befassen. Solche Prozesse sind mir ohnehin stark zuwider. Gar zu leicht werden Unschuldige dabei übel torquiert. Habe im Sinne, sie ganz abzuschaffen.«
»Gott segne Eure Majestät dafür!« rief der Kandidat und sah dem König mit so inniger Verehrung in die Augen, daß dieser unwillkürlich lächelte.
»Er hat gewiß in Halle studiert,« sagte er wohlwollend.
»Jawohl, Eure Majestät.«
»Bei Francke?«
»Bei demselben. Auch ward ich von dem berühmten Thomasius persönlichen Umgangs gewürdigt.«
»Der Francke und der Thomasius sind beides sehr reputierliche Subjekte,« versetzte die Majestät gnädig. »Und er scheint mir von ihnen profitiert zu haben, scheint mir ein resoluter Mensch zu sein. Kann er denn auch predigen?«
»Ich denke, es passiert,« erwiderte der Kandidat bescheiden.
»Na, dann kann er gleich einmal loslegen. Die Racker hier haben eine Strafpredigt verdient, weil sie sich gegen ihre Obrigkeit aufgelehnt haben. Den Text weiß er also. Wart' er, bis ich wieder in dem Wagen bin, dann fang er an.«
Dem Kandidaten wurde es einen Augenblick schwarz vor den Augen, und es durchfuhr ihn ein gewaltiger Schreck. Hier sollte er reden, auf der Straße, ohne Talar und Bäffchen, und noch dazu vor dem König! Aber er faßte sich rasch. Eine kunstvolle Predigt konnte der Herr nicht von ihm verlangen. So wollte er denn schlicht und von der Leber weg über den Text sprechen: Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.
Als er das Bibelwort sprach, nahm der König den Hut ab und faltete die Hände. Alle machten es ihm auf der Stelle nach.
Der Kandidat sprach zunächst befangen und stockend, allmählich aber redete er sich in Eifer und in Begeisterung hinein. Der König, der mit dem andächtigsten Gesichte im Wagen saß, nickte mehrmals bestätigend und beifällig mit dem Kopfe.
»Komm' er her,« rief er, als Garbrecht geendet hatte, »er ist ein tüchtiger Kerl, er hat mich erbaut. Leider ist seine Statur zu klein, sonst könnte er Feldprediger werden. Aber hör' er, Kleist, die erste Pfarre, die im Kreise aufgeht, kriegt dieser Musjöh. Ganz egal, wer Patron ist, er soll dem Konsistorium präsentiert werden. Keinen Dank – keine Flattusen – will nichts davon hören.«
Darauf winkte er den kleinen Ewald heran und legte ihm die Hand auf den blonden Kopf. »Du bist ein braver Bursch' und ein forscher Bengel. Sage deinem Vater, er soll dich Offizier werden lassen. Wenn ich noch lebe, werde ich dein nicht vergessen. Vor der Hand aber soll er dir eine große Schlackwurst schenken. Nun aber, Kutscher, fahr zu! Wir haben eine gute halbe Stunde verloren.«
III
Der Tag, der mit diesen Ereignissen begonnen hatte, war für die Junker von Kleist schulfrei. Das Gemüt des Kandidaten Garbrecht war viel zu bewegt, als daß er die Regeln der lateinischen Grammatik hätte dreschen mögen. Noch weniger traute er seinen Zöglingen irgendwelche Sammlung und Aufmerksamkeit zu. Die Knaben waren aufs höchste aufgeregt. Etwas so Interessantes hatten sie noch nicht erlebt, seit vor zwei Jahren ein Wolf in der Gegend aufgetaucht und zur Strecke gebracht worden war. Sie aßen bei Tische kaum ein paar Bissen, erzählten dagegen immer nur Beobachtungen, die sie gemacht haben wollten, und die Schwestern, die den Auftritt leider versäumt hatten, hörten voller Neid und Erstaunen zu. Unter gewöhnlichen Umständen würde der Kandidat solch lautes Sprechen bei Tisch ernstlich gerügt und verboten haben, denn den Kindern geziemte das nicht, sie hatten vom Anfang bis zum Ende den Mund zu halten. Heute aber vergaß der gestrenge Mentor seiner Pflicht ganz und gar. Er hörte offenbar überhaupt nicht, was gesprochen wurde, und als ihn Madame Colette, die Gouvernante der Mädchen, in zierlichem Französisch etwas fragte, gab er eine total verkehrte Antwort. Derselben Dame machte er beim Aufstehen ein so flüchtiges Kompliment, daß sie ihm erstaunt und fast gekränkt nachblickte.
Auf seiner Stube angekommen, riegelte Garbrecht sich ein. Er wollte allein sein, in Ruhe über das nachdenken, was ihm geschehen war. Er zündete sich seine lange Pfeife an und warf sich in seinen Sorgenstuhl. Am Vormittag hatte er vor demselben Stuhl auf den Knien gelegen und Gott für seine Gnade mit Tränen gedankt. Denn er wußte wohl, was des Königs Machtwort für sein Leben bedeutete. Kein Konsistorium, kein Patron hätte gewagt, das Wort des Monarchen unberücksichtigt zu lassen, und im Kreise waren viele bejahrte Prediger, deren Abgang durch Tod oder Emeritierung nahe bevorstehen mußte. So war ihm mit einem Male die schönste Aussicht geöffnet. Er konnte seine alte Mutter bald ganz anders unterstützen als bisher, vielleicht auch einen Traum verwirklichen, in dem ein hübsches blondes Jungfräulein aus Thorn eine nicht unwesentliche Rolle spielte.
Das alles durchdachte er nun noch einmal, starke Tabakswolken ausstoßend und hin und wieder die Hände faltend voller Dank gegen die göttliche Providenz, die so sichtbar in seinem Leben zutage getreten war.
Inzwischen beschäftigten sich die unbeaufsichtigten Herren Junker in weniger rühmlicher Weise. Sie spielten König mit den Kindern der Tagelöhner, die sie auf der hinteren Wiese des Parkes, in weiter Entfernung vom Hause um sich versammelt hatten. Franz Kasimir ward in einer Schiebekarre herbeigefahren und verhieb mit einem Haselstock den dicken Schäfersjungen Andreas ganz natürlich, wie er es am Vormittage von Seiner Majestät gesehen hatte. Der Inkulpat nahm die Tracht Prügel anfangs gleichmütig hin, wie er schon so manche in seinem Leben hingenommen hatte. Als es aber der König gar zu arg machte, heulte er laut auf und warf den übereifrigen Monarchen zu Boden. Dies gab das Zeichen zu einer allgemeinen Prügelei, denn Ewald stellte sich auf Seite des über Gebühr Gezüchtigten, den der ergrimmte König als einen Majestätsverbrecher in den Schweinestall sperren wollte.
In der Schlacht, die sich nun erhob, siegte der Anhang des Königs gänzlich über die Rebellen. Ewald und die Seinen wurden zerstreut, zersprengt und durch den ganzen Park verfolgt. Der schnelle und geschmeidige Führer schlüpfte in das dichte Gebüsch und erkletterte eine alte Esche, deren Zweige ihn von den nachsetzenden Feinden verbargen. Er stieg gemächlich höher und höher und klomm bis in die Krone hinauf. Dort blieb er still sitzen, auch als das Spiel längst zu Ende war und die schnell versöhnten Widersacher unter seinem luftigen Sitze einen Feldzug gegen etliche Rabennester in den Erlen an der Radüe berieten. Er beschloß, sich an diesem Streiche nicht zu beteiligen, sondern inzwischen seine Freundinnen Daniela und Susanne aufzusuchen.
Der Knabe hatte das Gefühl, daß dieser Besuch von seinem Präzeptor nicht gebilligt werden würde. Er wartete daher vorsichtig, bis sein Bruder und dessen Spielgenossen abgezogen waren. Erst als die Luft ganz rein war, glitt er behend an dem Stamme hernieder, wand sich durch das dichte Gebüsch, schwang sich über die niedrige Mauer und lief klopfenden Herzens übers Feld nach dem Dorfe, an dessen Eingang das kleine, verfallene Haus der Witwe lag. Er klopfte an die Holztür, aber nur der Widerhall antwortete. Er drückte auf die Klinke, aber die Tür war verschlossen. Nun spähte er durch die blanken Scheiben in das Innere, die Stube war leer. Er rief endlich, erst zaghaft, dann mit lauterer Stimme, aber nur die große graue Hauskatze kam um die Ecke gelaufen und schmiegte sich schnurrend an seine Knie.
Ewald beugte sich nieder und streichelte das Tier, aber es war ihm in der tiefen Stille bänglich und beklommen zumute. Er setzte sich auf eine schmale Bank, die an der Hauswand hinlief. Hier hatte die Daniela oft gesessen an schönen Sommerabenden und gestrickt und Märchen erzählt, und die beiden Kinder hatten ihr zur Seite gesessen und mit großen glänzenden Augen zugehört. Das Märchen vom Froschkönig fiel ihm plötzlich ein, und es war ihm, als hörte er deutlich die Stimme seiner kleinen Gespielin, die tief aufatmend sagte: »Wenn du einmal verzaubert wirst, rette ich dich auch.«
Und plötzlich stand sie vor ihm, atemlos vom raschen Laufen, die gewöhnlich etwas blassen Wangen hoch gerötet.
Der Knabe sprang auf. »Wo kommst du denn her?« rief er. »Wo ist deine Mutter? Warum hast du dein blaues Sonntagskleid an?«