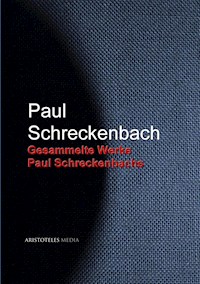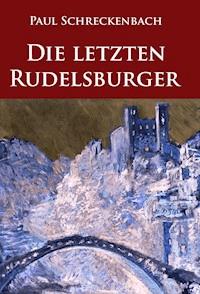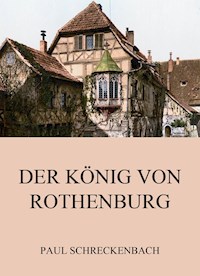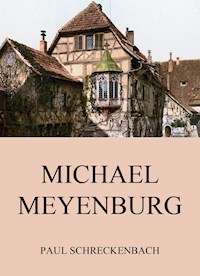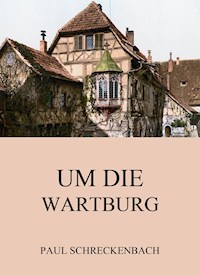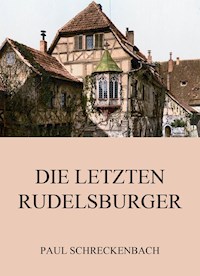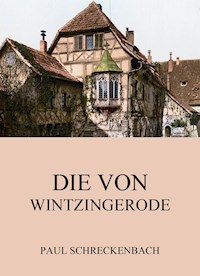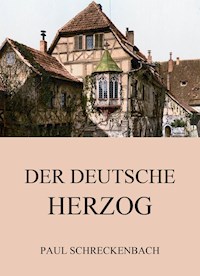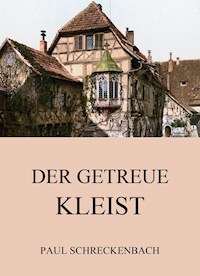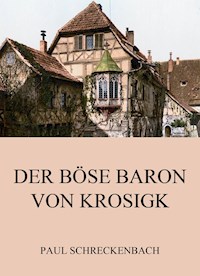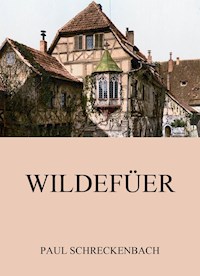
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman aus Alt-Hildesheim. Wie in vielen von Schreckenbachs Werken geht es auch hier um die Reformation, die mit der Rückkehr des verbannten Ritters von Hagen auch in Hildesheim Einzug halten soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wildefüer
Paul Schreckenbach
Inhalt:
Paul Schreckenbach – Biografie und Bibliografie
Wildefüer
Erstes Buch
Zweites Buch
Wildefüer, P. Schreckenbach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849635756
www.jazzybee-verlag.de
Paul Schreckenbach – Biografie und Bibliografie
Deutscher Pfarrer und Schriftsteller, geboren am 6. November 1866 in Neumark (bei Weimar), verstorben am 27. Juni 1922 in Klitzschen bei Torgau. Sohn eines Pastors, studierte in Halle und Marburg Theologie und Geschichte und promovierte später zum Doktor phil. Ab 1896 arbeitete S. als Pfarrer in Klitzschen in der Nähe von Torgau. Der Autor ist bekannt für seine hervorragenden historischen Romane.
Wichtige Werke:
Bismarck, 1915
Der böse Baron von Krosigk, 1908
Die von Wintzingerode, 1905
Geistliche Lieder von Martin Luther, 1917
Der getreue Kleist, 1909
Der jüngste Tag, 1919
Der König von Rothenburg, 1910
Der Komtur, 1921
Kurfürst Augusts Abenteuer, 1921
Die letzten Rudelsburger, 1913
Markgraf Gero, 1916
Michael Meyenburg, 1920
Die Pfarrfrau von Schönbrunn, 1917
Sühne, 1923
Die Tat des Leonhard Koppe, 1916
Um die Wartburg, 1912
Roman aus Alt-Hildesheim
Erstes Buch
Am Fenster eines weiten Gemaches im Grauen Kloster Wittenberg stand Doktor Martin Luther und blickte nachdenklich auf den Hof hinaus. Ein tiefer Ernst lag auf seinen Zügen, denn noch hielt er die Feder in der Hand, womit er einem seiner alten Kindheitsfreunde, dem die Gattin gestorben war, einen Trostbrief geschrieben hatte. Aber bald entwölkte sich seine Stirn, und ein warmer Glanz trat in seine Augen. Sein Lieblingskind, die zehnjährige Magdalene, spielte mit anderen Mädchen ihres Alters einen Ringelreihen. Hell klang der Gesang der seinen Kinderstimmchen zu ihm empor, dazwischen erscholl das lustige Bellen des Hündleins Tölpel, das die vorüberflatternden roten Röckchen der Kleinen zu fassen bestrebt war. Die Sprünge des täppischen Tieres belustigten ihn, und er lachte mehrmals kräftig auf. Dann aber schienen andere Gedanken durch sein Haupt dahinzuziehen. Sein Antlitz wurde wieder ernst, und er schüttelte einige Male den Kopf, als ob er sich über etwas verwundere. »Was ist Euch, lieber Herr? Worüber sinnt Ihr nach?« fragte Frau Käthe. Sie hatte eben das Wämslein des kleinen Hans ausgebessert und trat nun neben ihn. Luther schlang den linken Arm um ihre Schultern und erwiderte nach einer kleinen Weile, indem er mit der Rechten aus dem Fenster wies: »Der alte Birnbaum dort brachte mich auf den Gedanken, wie doch unser Gott alles in der Welt so rasch und von Grund aus zu verändern weiß. Was hat der Baum schon alles gesehen! Ich war ein junger Mönch von sechsundzwanzig Jahren, da saß ich unter ihm auf der Steinbank und grübelte nach über das schwere Wort von der Gerechtigkeit Gottes. Da trat Doktor Staupitz zu mir heran und tröstete mich. Wo ist der Staupitz jetzt? Seit langen Jahren gestorben. Dann saß ich mit Philippus dort. Er lehrte mich das Griechische, und ich öffnete ihm die Schrift. Aber auch damals war ich noch ein Mönch. Jetzt ist die Zeit der Mönche vorbei, und meine Kinder spielen unter dem Baume. Wie ist die Welt so ganz und gar verwandelt! Und wenn wieder eine Mandel Jahre dahin sind – ob da wohl der Baum noch steht? Ja, ob wohl die Welt noch steht?«
»Warum sollte sie nicht mehr stehen?« fragte Frau Käthe.
»Weil der Jüngste Tag gewißlich vor der Tür steht«, erwiderte Luther ernst. »Die Macht des Antichrists ist noch nicht gebrochen. Jetzt eben hat er einen Ablaß ausgeschrieben, um Gottes Langmut von neuem zu versuchen. Auch rüstet der Türke, wie man hört, mit großer Kraft, wird wohl im Sommer wider die Christenheit losbrechen. Falsche Propheten und Schwarmgeister verwirren allenthalben die Köpfe. Seuche und Pestilenz wüten da und dort. In Braunschweig, der werten Stadt, sollen schon etliche hundert Menschen gestorben sein, und die Krankheit greift immer weiter. Die Zeichen sind fast alle da, von denen der Herr Christus redet Matthäi am vierundzwanzigsten.«
»Noch fehlt das Erdbeben«, warf Käthe dazwischen.
Luther nickte. »Du kennst die Schrift wohl. Das fehlt in Wahrheit noch. Aber es kann jeden Tag oder jede Nacht kommen. Wir wissen ja nicht Zeit noch Stunde, aber wir müssen jederzeit darauf gefaßt sein, daß der Herr ein Ende macht mit der Welt.«
Frau Käthe schwieg ein paar Augenblicke. Dann zuckte es wie Schalkheit um ihren Mund, und in etwas leichtfertigem Tone rief sie: »Ei, lieber Herr, was plagt Ihr Euch mit solchen Gedanken! Ihr jagt mir ja beinahe einen Schrecken ein. Aber ich meine, es wird so schlimm nicht werden. Die Welt hat schon so lange gestanden, sie wird wohl auch noch eine gute Weile stehen. Warum sollte auch Gott der Herr die armen unschuldigen Kindlein verderben wollen, die doch nichts gesündigt haben? Wie reimte sich das zusammen mit seiner Güte?«
»Frau,« rief Luther lachend, »wie reimt sich diese Frage zusammen mit deiner großen Klugheit? Weißt du nicht, daß unser Gott denen die höchste Gnade erweisen wird, die den Jüngsten Tag erleben, dieweilen sie noch in ihrem Leibe sind? Sie werden den Tod nicht schmecken, denn der Herr wird sie verklären. So steht geschrieben im dritten Kapitel des Philipperbriefes.«
Er wandte sich nach seinem Pulte und ergriff eine Bibel, die in rotes Leder gebunden war, und schlug sie auf. »Höre! »Unser Wandel aber ist im Himmel, von bannen wir auch warten des Heilands Jesu Christi, des Herrn.««
Weiter kam er nicht, denn ein lauter Schrei aus dem Munde seiner Frau ließ ihn verstummen. Sie stand mit hocherhobenen Händen am Fenster, blaß, mit weitaufgerissenen Augen, und schien vor Schreck erstarrt zu sein.
»Mein Gott, was ist dir?« rief Luther und trat mit ein paar raschen Schritten auf sie zu. Aber als er einen Blick in den Hof hinabgeworfen hatte, fuhr er entsetzt zurück und ward so bleich wie sie, und die Knie zitterten ihm so, daß er sich am Fenstergesims festhalten mußte.
Da drunten stand mit einem Male, als wäre er aus der Erde emporgewachsen, ein riesiger Hund, etwa vier oder fünf Schritt entfernt von den spielenden Kindern, und stierte sie mit blutunterlaufenen Augen an, als wolle er sich im nächsten Augenblicke auf eines von ihnen stürzen. Es war die Dogge des Stadthauptmanns Hans von Metzsch, ein Tier, das in ganz Wittenberg um seiner Bösartigkeit willen gefürchtet war und von seinem Herrn an einer Kette gehalten und nur des Nachts abgebunden und in den Hof gelassen wurde. Das Untier hatte sich offenbar losgerissen, denn die Kette schleifte hinter ihm her, und der weiße Geifer, der ihm am Maule hing, ließ vermuten, daß es plötzlich toll geworden sei.
Die Kinder spielten ohne eine Ahnung der grausen Gefahr, aber nun nahm das kleine Töchterchen des Magisters Philipp Melanchthon den Hund wahr und stieß einen durchdringenden Schrei aus. Das Tier duckte sich, als setze es zum Sprunge an, und Frau Käthe schrie droben zum zweiten Male auf. Da erscholl vom Tore her ein scharfer Pfiff. Ein hochgewachsener junger Mann war in den Hof eingetreten und schien mit einem Blicke die Lage zu übersehen. »Hierher!« schrie er mit mächtiger Stimme und riß das Schwert aus der Scheide, das er an der Seite trug. Der Hund warf sich nach ihm herum und fuhr mit einem heulenden Laute auf ihn los. Aber gleich darauf lag er verendend am Boden, denn die Klinge des Fremden, der rasch zur Seite gesprungen war, hatte ihm den Nackenwirbel durchschlagen und war noch tief in den Hals eingedrungen.
Das alles war in wenigen Augenblicken geschehen. Den Kindern ging jetzt erst eine Ahnung auf, in welcher Gefahr sie geschwebt hatten, da sie das rinnende Blut des großen Hundes sahen. Sie begannen einstimmig ein lautes Wehgeschrei und stürmten dem Hause zu. Da löste sich Frau Käthes Erstarrung. In fliegender Hast eilte sie aus dem Gemach und die Treppe hinunter und riß drunten im Hausflur ihr Lenchen mit einem erstickten Jubelruf fest an ihre Brust. Die anderen kleinen Mädchen drängten sich schluchzend und weinend an sie heran wie ein Schwarm vom Habicht aufgescheuchter Küchlein, die piepsend und glucksend ihre Zuflucht unter den Flügeln der Mutter suchen.
Auch ihr Gatte kam nun die Treppe herunter. Er war noch blaß vor Schrecken, und die Hände, mit denen er sein weinendes Kind aus den Armen seiner Frau nahm, zitterten. »Gelobt sei unser Vater im Himmel, der uns vor großem Leid bewahrt hat!« rief er. »Ihm sei Preis und Ehre!« Dann trat er mit raschem Schritt auf den Retter zu, der mit einem etwas verlegenen Lächeln in der Hausflur stand. Er streckte ihm die Rechte weit entgegen und sagte mit großer Herzlichkeit: »Gott zum Gruße, lieber Herr! Nächst dem Allmächtigen haben wir Euch zu danken. Als sein Werkzeug betretet Ihr mein Haus. Wer seid Ihr, und was sucht Ihr bei mir?«
Er hatte, während er so sprach, den Blick erheben müssen, denn obwohl er von stattlicher Mittelgröße war, überragte ihn der Fremdling bei weitem. »Daß ich Euch einen Dienst leisten konnte, Herr Doktor, ist mir die größte Freude«, erwiderte der junge Mann mit einer wohlklingenden Stimme und neigte sich dabei so tief, als ob er vor einem Fürsten stände. »Ich bin nach Wittenberg gekommen, nur um Euch zu sehen und, wenn es möglich wäre, mit Euch zu reden.«
»Kommt Ihr in eigener Sache oder um des Evangeliums willen?« fragte Luther und sah ihn freundlich an. »Vor allem aber – wer seid Ihr? Und wo kommt Ihr her?«
»Ich heiße Christof von Hagen und stamme aus Hildesheim. Ich möchte in einer absonderlichen Sache mit Euch reden.«
»Ihr seid von Adel?«
»Meine Sippe gehört zu den alten Geschlechtern der Stadt, und meine Väter haben von jeher im Rate gesessen.«
»Kommt herein«, sagte Luther. »Ich lade Euch ein, bei mir zu nächtigen und für heute abend an unserem Tische fürliebzunehmen, nämlich wenn meine gestrenge Hausfrau und Eheherrin keinen Einspruch erhebt und ein Stüblein für Euch rüsten kann.«
»Von Herzen gern«, rief Frau Käthe und bot nun auch dem Gaste die Hand. »Und nehmt meinen Dank, Herr, und haltet mir's zugute, daß ich Euch nicht gleich gedankt habe. Ich bin noch halb erstarrt, meinte vorhin, das Herz solle mir stillstehen, und konnte kein Wörtlein reden.«
»Das kommt nicht häufig vor«, scherzte Luther. »Du bist sonst die beredteste Frau in ganz Wittenberg. Aber nun bringe uns eine Flasche Rheinwein, liebe Domina, und ein paar Gläser. Ich will den jungen Herrn aus Hildesheim nach alter deutscher Weise in unserem Hause willkommen heißen. Erlaubet, daß ich vorangehe.« Er wandte sich der Treppe zu, und Christof von Hagen schickte sich an, ihm zu folgen. Da fühlte er seine Hand von einem Kinderhändchen gefaßt, und eine seine Stimme sagte: »Ich danke Euch auch, Herr, daß Ihr das böse Tier tot gemacht habt. Ich war so erschrocken und habe mich gefürchtet!« Es war die kleine Magdalene Luther, die so sprach. Sie schmiegte sich zutraulich an ihn an und sah mit ihren großen dunkeln Augen ernsthaft zu ihm empor.
»Das ist recht, Lenchen, daß du ein dankbares Gemüt beweisest«, lobte Luther. Hagen aber strich dem Kinde mit seiner großen Hand leise über das Haar und sagte mit eigentümlich gepreßter Stimme: »Solch ein Schwesterchen hatte ich einstens auch. Sie sah Eurem Töchterchen verwunderlich ähnlich, Herr Doktor.«
»Sie ist gestorben?« fragte Luther teilnehmend.
»Sie starb als zehnjähriges Kind, als ich vierzehn Jahre alt war. Das ist nun schon länger als zwölf Jahre her, aber ich sehe sie zuweilen noch so deutlich vor mir, als ob sie lebte.«
»Sie lebt ja auch, obschon unsere Augen sie nicht sehen«, erwiderte Luther. »Selig sind die Kinder, die Gott in zarter Jugend zu sich ruft! Ihnen ist vieles erspart, und sie haben's gut. Aber für die Eltern und für alle, die sie liebhaben, ist freilich solch ein Abschiednehmen ein schweres Ding. Bitte, tretet hier herein, Freund! Es ist meine Arbeitsstube, und es sieht nicht sehr aufgeräumt aus, wie das so ist, wo ein Bücherwurm haust.«
Die beiden ließen sich an einem Tische nahe dem Fenster nieder, und gleich darauf brachte Frau Käthe selbst den Wein.
»Nun sagt, was führt Euch zu mir?« begann Luther, indem er bedächtig die goldklare Flüssigkeit in die Gläser goß. »Ihr hanget der reinen Lehre an?«
»Das tue ich, Herr, und von ganzem Herzen.«
»Und Ihr kommt von Hildesheim? Das nimmt mich wunder. Die Stadt soll, so höre ich, fest am päpstlichen Glauben hängen. So seid Ihr wohl ein weißer Rabe in Eurer Vaterstadt?«
»Da seid Ihr doch nicht recht berichtet, Herr Doktor. Die Bürgerschaft, die große Mehrzahl der Bürgerschaft zum wenigsten, verlangt schon seit geraumer Zeit nach der reinen Lehre. Aber sie wird ihr vorenthalten.«
»Ei, wer enthält sie ihr vor? Der Bischof?«
»Der hat dazu nicht die Macht. Er ist nur dem Namen nach Herr über die Stadt. Der Rat ist es, der das Evangelium hindert.«
Luther blickte ihn verwundert an. »Ja, kürt denn bei Euch nicht die Bürgerschaft den Rat? Wie kann er da auf die Dauer widerstreben?« fragte er.
»Ach, bei uns ist die Sache so: Die alten ratsfähigen Ämter und Gilden wählen die Ratsherren auf zwölf Jahre. Neben dem Rate haben wir ein Kollegium der Vierundzwanzig Männer, das aber auch wieder zum größten Teile aus den Ämtern und Gilden gewählt ist; die kleinere Zahl von ihnen ist aus der Gemeinde. Diese zusammen regieren die Stadt. Es kommt keiner in den Rat, der nicht einem Amte oder einer Gilde angehört, und so müßte denn der Hildesheimer Rat nur aus Handwerkern und Kaufleuten bestehen. Aber das wird umgangen. Die Herren aus den alten und reichen Geschlechtern der Stadt kaufen sich in die Gilden ein und werden so als Gildebrüder der Ratsstühle teilhaftig, und da sie untereinander sich fördern und zusammenhalten, so liegt das Regiment der Stadt doch in ihrer Hand, und die Bürgerschaft meint nur, daß sie sich selber regiere.«
»Soso! An und für sich kein übler Brauch,« sagte Luther, »denn die Gewalt gehört in die Hände der Leute, die des Regiments fähig und kundig sind. Wehe der Stadt, wo der Herr Omnes regiert und jeder mitreden will, sei er auch so dumm und ungelehrt wie ein Holzklotz!«
Hagen nickte. »Da habt Ihr gewißlich recht. Auch ich suche einen Sitz im Rate auf diese Weise, wenn ich heimkehre. Aber bei uns liegen zurzeit die Dinge noch anders. Bei uns meint auch der Rat nur, daß er regiere. In Wahrheit regiert er so wenig wie die Gemeinde der Bürger. Denn ein Mann gebietet in Hildesheim, und was er will, das geschieht, und wider ihn wagt niemand zu mucken, wenn auch viele die Fäuste heimlich ballen.«
»Ha!« rief Luther. »Ich entsinne mich – man hat mir von ihm erzählt. Heißt er nicht Wildefüer? Schlug ihn nicht zu Augsburg der Kaiser selbst zum Ritter?«
»Ja, Herr, Hans Wildefüer, der gerade dieses Jahr wieder Bürgermeister ist. Er ist es nicht immer, denn bei uns wechselt die oberste Gewalt Jahr um Jahr. Aber wenn er auch nur im Rate sitzt, so hat er alle Macht in der Stadt, denn sein Wort gilt bei den Ratsherren wie ein Evangelium, und er setzt alles durch, was er will.«
»Und was gibt ihm solches Ansehen?«
»Herr,« erwiderte Hagen nach kurzem Besinnen, »ich müßte lügen, wenn ich nicht sagen wollte: seine große Klugheit gibt es ihm. Auch hat er viel für die Stadt getan in Fehden, auf den Städtetagen und auf den Reichstagen und gilt viel bei der kaiserlichen Majestät.«
»Ist er ein alter Mann?«
»Nein, er ist wohl fünfzig Jahre und einige darüber. Nur an den Schläfen ist er weiß, sonst finden sich wenige graue Haare in seinem schwarzen Barte. Auch kann er noch reiten und trinken und fechten wie ein Junger. Er ist ein wunderbarer Mann, Herr, niemand ist ihm gewachsen, weder im Rat noch in der Tat, und deshalb wagt es keiner, gegen ihn aufzutreten. Das ist der Grund, weshalb Hildesheim noch nicht dem Evangelium zugefallen ist, denn er ist ein starrer Anhänger des alten Glaubens.«
»Ihr aber,« sagte Luther, nachdem er ihn eine Weile durchdringend angeblickt hatte, »Ihr wollt es wagen, gegen ihn aufzutreten. Denn Ihr wollt Eure Vaterstadt vom Papsttum losreißen und zur reinen Lehre führen. Darum seid Ihr zu mir gekommen, ist's nicht so?«
Hagen war von seinem Sitz in die Höhe gefahren. »Herr!« rief er, »wie könnt Ihr das wissen? Aber was verwundere ich mich? In Euch ist Gottes heiliger Geist. Aus dem redet Ihr!«
»Nein,« erwiderte Luther mit einem ernsten Lächeln, »das hat mit dem heiligen Geiste nichts zu tun. Es fuhr mir nur durch den Sinn, als ich Euch so sitzen sah. Ihr habt so etwas an Euch von einem Sankt Jörg, der mit dem Drachen kämpfte.« Er erhob sein Glas und neigte es gegen das seines Gastes. »So seid mir doppelt willkommen! Aber, mein junger Herr aus Hildesheim, mich dünkt, Ihr habt eine schwere Aufgabe vor Euch. Eben weil Ihr noch jung seid, wird es Euch nicht leicht werden, den Erfahrenen und Erprobten beim Rate und der Gemeinde aus dem Sattel zu heben.«
Über Hagens Gesicht flog ein Schatten. »Ihn zu bekämpfen wird jedem schwer sein, mir aber wohl am schwersten. Denn wisset, Herr, nach meiner Mutter frühem Tode und nachdem mein Vater in Trübsinn verfallen, war ich sein Mündel und habe jahrelang in seinem Hause gewohnt, und er hat mich gehalten wie seinen Sohn.«
Betroffen, beinahe erschrocken blickte ihn Luther an. »Wie seid Ihr denn zum Evangelium gekommen?« fragte er nach einer Pause.
»In der Fremde, Herr. Ich war zwei Jahre fern von Hildesheim, in Erfurt und Braunschweig zuerst, dann in Nürnberg und kehre jetzt nach der Heimat zurück.«
»Und was hielt Euch so lange in der Fremde fest?«
Über Hagens Antlitz flog ein schnelles Rot, und er senkte einen Augenblick die Stirne. Dann aber hob er die Augen frei empor und blickte dem Fragenden offen ins Gesicht. »Ich will Euch reinen Wein einschenken, Herr Doktor«, sagte er. »Nichts Rühmliches war es, was mich aus der Heimat trieb. Ich hatte einen Streit mit einem Geschlechtersohne aus Hildesheim, der um dieselbe Jungfrau warb wie ich. In einer Trinkstube trafen wir aufeinander, jeder geleitet von etlichen guten Gesellen. Wir höhnten und reizten uns zuerst mit Worten, dann griffen wir zum Schwerte. Ich schlug ihn nieder und wurde dafür auf zwei Jahre aus dem Frieden der Stadt gesetzt. Auch er mußte die Heimat auf zwei Jahre meiden, als er wieder zu Kräften gekommen war von seiner Wunde.«
»Die Tat reut Euch jetzt?« fragte Luther ernst.
»Es reut mich, daß ich ihn reizte, statt ihm aus dem Wege zu gehen. Daß ich ihn niederschlug, kann mich nicht reuen, denn er hob das Schwert zuerst. Darum war es auch ungerecht, daß ich dieselbe Strafe tragen mußte wie er. Sie traf mich um so bitterer, als ich eben freien wollte in der nächsten Zeit.«
»Wer sprach das Urteil über Euch aus?«
»Kein anderer als mein früherer Vormund, und er tat mir damit ein schweres Unrecht an.«
Luther schwieg eine Weile, dann erhob er sich und trat auf den jungen Mann zu. Er legte ihm die Hand auf die Schulter und sprach mit gütigem Ernst: »Prüfet Euch mit rechtem Fleiße, Freund, daß Ihr nicht falsch Feuer bringt auf den Altar des Herrn unseres Gottes! Denket nach: Weshalb wollt Ihr Euch erheben wider jenen Mann? Treibt Euch der Eifer für Gottes Wort? Oder sucht Ihr die Rache an einem, der Euer Feind geworden ist?«
»Nein!« rief Hagen laut. »Ich suche keine Rache an ihm, bin ihm auch nicht feindlich gesinnt. Ich grollte ihm heftig, als ich von bannen ziehen mußte, aber jetzt denke ich anders. Er hat wohl so an mir gehandelt als Gottes Werkzeug, ohne daß er es selber wußte. Denn was er über mich verhängt hat, das ist mir zum Segen geworden. In Hildesheim waren alle Eure Schriften verboten, und ich verlangte auch nicht danach. In Nürnberg gab mir einer Euer Büchlein von der Freiheit eines Christenmenschen. Da wurden mir die Augen dafür aufgetan, daß Eure Lehre wohl von Gott sein dürfte, und ich las alles, was Ihr geschrieben habt, und forschte fleißig in der Schrift und fand, daß Eure Lehre zusammenstimmt mit dem Worte Gottes. Da nahm ich mir fest vor, dieser Lehre zum Siege zu helfen in meiner Vaterstadt, sobald ich wieder daheim wäre, und Euch, Herr Doktor, der Ihr uns von Gott gesandt seid. Euch wollte ich aufsuchen auf meiner Heimfahrt, um mit Euch darüber zu reden und Euch zu bitten, daß Ihr mein Vorhaben segnet.«
In Luthers Augen war, während Hagen so sprach, ein immer helleres Licht aufgeleuchtet, und nun, als er geendet hatte, rief er freudig: »Denkt Ihr so, und steht es so mit Euch, so segne ich Euer Werk, das Ihr vorhabt, von ganzem Herzen. Möget Ihr für Hildesheim der Christofer werden, der den Heiland in die Stadt hineinträgt! Und was ich etwa tun kann. Euer Werk zu fördern, das werd' ich gewißlich tun!«
Er nahm Hagens Rechte und drückte sie kräftig. »Wir reden noch eingehend darüber. Ich hoffe, Ihr werdet ein paar Tage in meinem Hause verbleiben, da werden wir« –
Ein starkes Pochen an der Tür unterbrach ihn. Ohne das »Herein« abzuwarten, trat ein großer Mann in geistlicher Tracht auf die Schwelle und rief: »Es ist angerichtet! Eure Frau lädt Euch durch mich zu Tische! Es ist schon alles versammelt. Auch Philippus ist da. Doch verzeiht. Ihr habt ja Besuch.«
»Kommt immer herein, lieber Doktor Pommeranus«, sagte Luther. »Hier habe ich einen jungen Herrn aus Hildesheim, Christof von Hagen, der Großes vorhat in seiner Vaterstadt. Ihr werdet es hernach erfahren. Gebet ihm die Hand, er ist einer von den Unsern.«
»Aus Hildesheim seid Ihr, Herr?« fragte Bugenhagen, nähertretend und Luthers Geheiß folgend. »Habt Ihr dort Weib und Kind?«
»Nein, ich bin noch unbeweibt.«
»Oder Eltern und Geschwister?«
»Auch die nicht. Meine näheren Anverwandten, soweit sie nicht tot sind, leben zurzeit nicht in Hildesheim«, erwiderte Hagen, verwundert über die Fragen.
»Dann braucht Ihr nicht in großer Sorge zu stehen und könnt Gott danken, daß Ihr gerade jetzt nicht dort seid«, sagte Bugenhagen, und indem er sich zu Luther wandte, fuhr er fort: »Ich erzählte Euch gestern, die große Seuche sei in Braunschweig. Nun gehen mir heute Briefe zu mit der Zeitung, daß sie übergesprungen sei auch nach Goslar und Hildesheim und dort viele Opfer fordere.«
»Auch nach Goslar?« rief Hagen erschrocken und erblaßte.
»Ei nun, was ficht Euch an?« fragte Bugenhagen befremdet. »Ich denke, Ihr seid ein Hildesheimer? Wie kommt es, daß Euch die Pest in Goslar mehr entsetzt als in Eurer eigenen Stadt?«
»In Hildesheim«, erwiderte Hagen, »leben mir zwar einige gute Freunde, um die mir's ja leid wäre, wenn sie die Pest befiele. In Goslar aber ist eine – eine, die mir lieb ist, und die, so Gott will, mein Weib werden wird.«
»Die Jungfrau, die Ihr vorhin erwähntet?« fragte Luther.
»Dieselbe, Herr. Und Ihr werdet es verstehen und billigen, wenn ich unter solchen Umständen morgen in der Frühe Euer Haus verlasse und heimwärts reise. Unterwegs kehre ich in Goslar ein.«
»Ihr habt keine Angst?«
»Nein, Herr Doktor. Ich acht', ist's mir bestimmt, an der Pest zu sterben, so kann ich fliehen, wohin ich will, ich sterbe doch daran, und will mich Gott davor bewahren, so kann ich getrost in die Häuser der Seuche gehen.«
»Aber Ihr könnt dort nichts ändern und nichts bessern«, warf Bugenhagen ein.
»Aber ich kann der nahe sein, die ich liebhabe«, entgegnete Hagen. »Es ist ihr vielleicht schon ein Trost und eine Hilfe, wenn sie mich in der Nähe weiß. Sie lebt bei ihrem alten Vater mit einer Magd allein. Ihre Mutter ist schon vor Jahren gestorben. Gewiß, es wird ihr lieb sein, wenn ich mich in der Gefahr zu ihr finde.«
»Ihr habt ganz recht, und ich kann Euch nicht halten«, sagte Luther. »Wir können ja auch noch den ganzen Abend reden über das, was Euch bewegt, und was Ihr in Hildesheim tun wollt. Aber nun laßt uns hinuntergehen! Die Sonne ist schon verschwunden, und meine Domina wird unser schmerzlich harren. Die Suppen werden kalt und die Frauen ungeduldig, wenn man sie zu lange warten läßt.«
Über Goslar, die alte Kaiserstadt am Harz, war schweres Leid hereingebrochen. Seit fast einer Woche bimmelte Tag für Tag unaufhörlich das Totenglöcklein, um in die Weite zu rufen, daß wieder jemand des Todes verblichen sei. Ein zugereister Schuhmachergeselle aus Braunschweig hatte die Pest in die Mauern eingeschleppt. Er selbst war gestorben, und mit unheimlicher Schnelligkeit hatte die Krankheit um sich gegriffen. Am ersten Tage waren der Seuche zehn Menschen erlegen, am zweiten schon die doppelte Zahl, und seitdem waren der täglichen Opfer noch mehr geworden. Eine furchtbare Angst hatte die Gemüter erfaßt. Die sonst so belebten Straßen der reichen Stadt waren fast verödet, niemand wagte sich aus seinem Hause heraus, weil alle die Ansteckung fürchteten. Die meisten Läden waren geschlossen, viele Handwerker feierten mit ihren Gesellen, nur die Sargtischler hatten schwere Arbeit Tag und Nacht.
»Das ist ja, als ob man über einen Kirchhof ritte«, sagte ein großer, ganz in Eisen gekleideter Mann, der vom Vititore her sein schweres Roß dem Markte zulenkte. »Es scheint eine sonderliche Furcht über die Leute hier gekommen zu sein. Bei uns in Hildesheim ist ja auch, Gott sei's geklagt, die Seuche, aber auf den Gassen merkt man nichts davon.«
Der Mann im Priestergewande, der neben ihm ritt, nickte. »Bei uns sind noch nicht viele gestorben, und ich denke, es wird auch so schlimm nicht werden.« Nach einer Weile setzte er mit einem finsteren Blick hinzu: »Mir kann's nur recht sein, daß die Gassen hier so leer sind. Dieses Kleid« – er schlug sich mit der flachen Hand gegen die Brust – »stand vor kaum zehn Jahren hier noch in hohen Ehren. Aber seitdem die vermaledeite Lutherei ihren Einzug in Goslar gehalten, ist es beinahe gefährlich geworden, sich damit zu zeigen. In Braunschweig haben mich die Buben mit Kot und Dreck geworfen, und ich mußte in ein Haus flüchten, wo ich aber auch nur Hohn und Spott fand. Damals gelobte ich mir: Du gehst sobald nicht wieder in eine Stadt, wo die Martinsche Sekte regiert. Ich hätte wohl auch den Ritt für keinen anderen denn für Euch getan, Herr Bürgermeister Wildefüer, für Euch und Euren Schwäher, den ich hochachte.«
»Ich rechne es Euch hoch an, Herr Oldecop, und werde es Euch nimmer vergessen. Aber seid getrost, wenn ich dabei bin, krümmt Euch kein Mensch ein Haar.«
»Das meine ich auch. Zwanzig Meilen um Hildesheim herum kennt Euch ja wohl jedes Kind, und wer Euch kennt, der bindet lieber mit dem Teufel an als mit Euch. Unter Eurem Schutze fährt man sicher seine Straße dahin. Ich wäre aber auch hierhergeritten, wenn Ihr mich nicht in eigener Person hättet geleiten können, allein mit denen da.« Er wies über die Schulter zurück auf die beiden Knechte, die in einiger Entfernung hinter ihnen auf mageren Kleppern folgten. »Ich hätte Herrn Klaus von Hary nicht sterben lassen ohne den Trost unserer heiligen christkatholischen Religion, nach dem er verlangt. Ich denke, Ihr glaubt mir das.«
»Ja, das glaube ich Euch«, erwiderte der Bürgermeister. »Furcht ist nicht Eure Sache, und Ihr seid ein treuer Priester unserer Kirche, wie es deren jetzt nicht allzu viele gibt. Gott gebe nur, daß wir nicht zu spät kommen!«
Sie waren während dieser Reden auf dem Markt angelangt, der im grellen Sonnenschein, aber vollkommen tot und menschenleer vor ihnen lag. An dem stattlichen Gildehause ritten sie vorüber und machten halt vor einem alten, hohen Steinhause, schräg gegenüber. Wildefüer schwang sich rüstig aus dem Sattel und half auch dem Priester beim Absteigen, noch ehe die Knechte heran waren. Er ließ ihm auch den Vortritt, als sie nun das Haus betraten, das unverschlossen war, aber in tiefem Schweigen dalag, als sei es unbewohnt.
»Holla!« rief Wildefüer, aber es regte sich nichts. »Er wird oben liegen in seiner Kammer, kommt, Herr Oldecop«, sagte er und schickte sich an, die Diele zu durchschreiten. Da kam ein leichter Schritt die Stufen herab, die im Hintergrunde des großen Gemaches zu dem oberen Stockwerke hinaufführten, und ein Mädchenkopf bog sich über das Holzgeländer der Treppe. Von oben herab fiel ein verirrter Sonnenstrahl gerade auf ihr Haar, so daß es aufleuchtete wie gesponnenes Gold. Ihr Antlitz aber war totenbleich, die großen rehbraunen Augen vom Weinen gerötet.
»Lebt dein Vater noch, Lucke?« rief Wildefüer ihr hastig entgegen.
Das Mädchen flog die letzten Stufen herab und klammerte sich an ihn an wie eine Tochter an ihren Vater. Ihre Antwort war ein Strom von Tränen.
»Er ist tot?« fragte er nach einer Weile.
»Er liegt seit einer Stunde still und starr. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch lebt.«
»Ist niemand bei dir, Kind? Wo sind Hinnerk und Marthe?«
»Sie sind schon gestern fortgelaufen, wollten nicht in dem Pesthause bleiben. Ich bin allein beim Vater.«
»Die Bande!« sagte Wildefüer grimmig. Dann legte er ihr sanft die schwere Hand aufs Haupt.
»Hättest mich schon ehegestern rufen sollen, Kind! Dann wärest du nicht so lange allein gewesen« sagte er mit weicher Stimme. »Aber du dachtest wohl nicht, daß es so schlimm sollte werden. Es genesen ja auch viele von der Seuche. Doch nun führe uns zu ihm! Kommt, Herr Oldecop! Hoffentlich ist's noch nicht zu spät.«
Das Mädchen ließ seine Hand nicht los, während sie die Treppe emporschritten. Droben öffnete sie eine Tür und ließ die beiden Männer zuerst eintreten.
Herr Klaus von Hary lag in einem nicht hohen, aber weiten Gemach auf seinem breiten Ehebette, in dem er seit Jahren einsam schlummern mußte, da seine Gattin ihm schon längst hinweggestorben war. Sein hagerer Leib war unter der dünnen Federdecke lang ausgestreckt, die linke Hand hing schlaff neben der Bettstatt herunter, so daß sie fast den Boden berührte, seine Augen waren geschlossen. Er glich einem bereits Verstorbenen.
Oldecop trat rasch an ihn heran, ergriff die herabhängende Hand und suchte den Puls. »Es ist noch Leben in ihm,« sagte er nach einer Weile mit einem Seufzer, »aber es geht wohl bald zu Ende. Die heilige Kommunion kann er nicht mehr empfangen, aber die letzte Ölung will ich ihm geben, auf daß er doch nicht ganz ohne die heiligen Sterbesakramente hinübergehe.«
Er entnahm hastig die heiligen Gefäße dem Beutel, den er mitgebracht hatte, stellte sich dann neben dem Todkranken auf und begann die vorgeschriebenen Gebete. Wildefüer sank sogleich auf die Knie nieder und faltete die Hände, und die junge Lucke folgte seinem Beispiele.
Als die heilige Handlung vorüber war, erhob sich der Bürgermeister, setzte sich auf das Bett und legte seine Hand auf die Stirn des Kranken. Er zog sie aber sofort zurück, denn die Stirn fühlte sich eiskalt an. »Er ist wohl schon tot«, murmelte er, und eine tiefe Traurigkeit breitete sich über seine Züge.
»Erlaubet, daß ich Euch warne, Herr«, sagte der Priester. »Daß ich ihn berührte, war nötig; daß Ihr ihn berührt, ist unnötig und setzt Euch der Gefahr aus.«
»Ach was!« entgegnete Wildefüer gleichmütig. »Habt Ihr Angst, Oldecop? Ihr? Das nähme mich wunder!«
»Angst habe ich nicht, aber man soll Gott nicht versuchen. Auch sollte ein Mann wie Ihr allezeit bedenken, daß er nicht sich allein lebt, sondern anderen, und daß sein Tod ein großes Unglück wäre für alle, die auf ihn bauen!«
»Bin ich wirklich so nötig, wie Ihr meint, so wird Gott mich schon zu bewahren wissen«, erwiderte Wildefüer. »Zudem, Herr Oldecop, habe ich immer die Regel bestätigt gefunden: Die Seuche geht dem aus dem Wege, der ihr mannlich standhält und nicht vor ihr flieht. Habt Ihr nicht gehört, was der Wittenberger getan hat, als die Pest war in seiner Stadt? Er hat sie alle angerührt, einer soll in seinen Armen gestorben sein. Soll ich weniger Mut zeigen als der Erzfeind unserer Kirche?«
Der Priester schüttelte unwillig sein großes Haupt. »Mit dem, Herr, vergleicht Euch nicht, richtet Euch nicht nach ihm und ahmt ihm nichts nach. Dem kann nichts etwas schaden, denn er steht unter einem besonderen Schutze. Es gelingt ihm alles, bis dann das bestimmte Stündlein kommt, da sein Schutzpatron mit ihm abfährt.«
Wildefüer nickte. »Ihr möget recht haben. Wenn aber ein Mann so viel Mut beweist, weil er sich unter dem Schutze des Teufels weiß, so müssen wir dreimal so viel Mut beweisen, da wir uns unter dem Schutze Gottes wissen. Ihr und ich« – er hielt plötzlich inne und fuhr nach dem Lager des Sterbenden herum, denn ein schwacher Laut war von dort an sein Ohr gedrungen.
»Klaus! Mein alter Klaus!« rief er voller Freude. »Lebst du noch? Erkennst du mich?«
Der Kranke hatte die Augen aufgeschlagen und richtete auf ihn einen Blick, der erkennen ließ, daß er bei Bewußtsein war und ihn erkannte. Aber vergebens bemühte er sich, das Haupt aus den Kissen zu erheben und zu sprechen. Nur einzelne abgerissene Silben drangen an das Ohr Wildefüers, der sich tief auf ihn herniederbeugte und angestrengt lauschte.
»Ich weiß nicht, was er will«, sagte er nach einer Weile bekümmert. »Mich dünkt, er redet von einem Kasten.«
»Ach, Ohm Wildefüer, dann weiß ich, was er meint«, rief Lucke und trat von dem Türpfosten, an dem sie bisher gelehnt hatte, mit schnellem Schritt auf einen Wandschrank zu. Dem entnahm sie einen kleinen Kasten, dem der Schlüssel ansteckte, und bot ihn dem Bürgermeister dar. »Er hat etwas aufgeschrieben vor drei Tagen, das sollte ich Euch zu lesen geben. Es ist wohl sein letzter Wille.«
Als der Kranke das Kästchen in Wildefüers Hand erblickte, glänzte sein Auge hell auf. Nach vielen vergeblichen Anstrengungen, sich verständlich zu machen, gelang es ihm schließlich, das Wort »Lies!« deutlich über die Lippen zu bringen.
Wildefüer öffnete den Kasten, der mit Papieren gefüllt war. Obenauf lag ein zusammengefalteter Zettel. »Das ist es, was der Vater geschrieben hat«, sagte Lucke.
»Lies! lies!« tönte es noch einmal gurgelnd, aber wohlvernehmbar von dem Lager her.
Wildefüer entfaltete das Papier und folgte dem Wunsche seines sterbenden Freundes. Er las laut und langsam, was da geschrieben stand. Manchmal stockte er, denn die Hand, die diese Schriftzeichen aufs Papier gebracht hatte, war wohl schon sehr unsicher gewesen, und so war manches Wort kaum zu entziffern. Auch übermannte ihn hie und da die Bewegung, und seine Stimme zitterte merklich.
Der letzte Wille des Herrn Klaus von Hary war sehr kurz gefaßt. Er lautete: »Meinem lieben Schwager, dem ehrbaren, fürsichtigen, weisen und gestrengen Bürgermeister zu Hildesheim Hans Wildefüer, dem Gott gnade. Sonderlich lieber Schwager und Freund! Die böse Krankheit hat mich ergriffen, und ich fühl's, ich werde nicht wieder aufkommen, sondern sterben. Darum so befehle ich Deiner Huld, Güte und Treue meine liebe Tochter, die als Waise in dieser Welt wird bleiben, und bitte Dich und Deine Frau, meine liebe Schwägerin Mette, Ihr wollet sie in Euer Haus aufnehmen und sie halten als Euer eigen Kind. Ich bestalle Dich auch zu ihrem Pfleger und Vormund an meiner Statt, bitte Dich auch höchlichst um Gottes willen, Du wollest das Amt annehmen und Dir lassen meine Tochter befohlen sein. Dir lasse ich all mein Gewaffen und meine Rosse als Angedenken an mich, denn Du bist jederzeit mein liebster Freund gewesen. Mein Haus und Hof und Geld und Gut lasse ich meiner Tochter Lucke, die mir ein gutes und gehorsames Kind gewesen ist. Siehe zu, daß sie in allen Dingen zu ihrem Recht komme. Wenn Christofer von Hagen wieder heimkehrt nach Hildesheim, so will ich nichts mehr dawider haben, daß sie ihn zum Manne nimmt, denn ich erkenne wohl, daß sie ihm von Herzen zugetan ist. Aber er soll Dir zuvor einen leiblichen Eid in die Hand schwören, daß er sich der Lutherei und aller anderen Ketzerei für ewige Zeit will enthalten und fest bleiben will bei unserer alten, heil'gen christkatholischen Religion, der wir beide, ich und Du, zu aller Zeit sind treu gewesen. Dazu ermahne ich Dich mit allem Fleiße und bitte Dich, Du wollest nimmermehr dulden und zulassen, daß meine Tochter in Gefahr komme, ihrer Seelen Seligkeit zu verlieren. Du wollest auch tausend Gulden nehmen von ihrem Erbteil und sie geben an das Kloster Sankt Michaelis in Hildesheim, auf daß die heilige Messe gelesen werde für meine arme Seele in jedem Jahre am Tage meines Todes und am Tage Sankt Nikolaus, da ich geboren bin. Und nun befehle ich Euch alle der Gnade Gottes und seiner Heiligen. Ich kann nicht mehr schreiben. Es zieht mir die Finger zusammen. Gott sei mir gnädig. Amen.«
Als Wildefüer das Blatt sinken ließ und seinem Freunde ins Antlitz schaute, erkannte er an dem klaren Blick seiner Augen, daß der Kranke völlig bei Bewußtsein war. Aber mit Staunen und voller Ergriffenheit sah er, daß eine große Angst aus seinem Blicke sprach, als zweifle der Sterbende, daß ihm seine letzten Wünsche auch erfüllt werden würden.
»Klaus Hary«, sagte er und legte seine Hand wieder auf des Freundes eiskalte Stirn, »wenn es denn Gott oder der Teufel will, daß du schon sterben mußt, so stirb in Frieden. Sorge dich nicht um Christof Hagen. Er ist in meinem Hause erzogen, und ich kenne ihn. Sein Blut ist wild, aber sein christkatholischer Glaube ist wohlgegründet. Ich möchte mich für ihn verbürgen. Wie es aber auch komme, ich will deinen Willen heilighalten und danach tun in allen Stücken, so wahr mir Gott helfe und seine Heiligen in meiner letzten Stunde! Wir haben uns im Leben einander immer Wort gehalten, mein alter Klaus. Ich halte dir auch nach deinem Tode Wort. Des kannst du gewiß sein.«
In den Augen Harys leuchtete es auf, aber gleich darauf trat wieder der frühere Ausdruck der Angst in seine Züge. Seine Blicke irrten wie suchend umher, und seine Lippen bewegten sich, als wolle er noch etwas sagen. Aber er war nicht mehr imstande, auch nur einen Laut hervorzubringen. Mit ungeheurer Raschheit kam nun der Tod über ihn.
Wildefüer erriet, was ihn bewegte. Er beugte sich tief auf ihn herab und rief laut: »Du hast die heilige Ölung empfangen. Hier, Herr Oldecop hat sie dir erteilt, als du deiner Sinne nicht mächtig warst. Du ziehst mit dem Segen der Kirche hinüber.«
Da trat ein wunderbar heller Schein in die Augen des Sterbenden. Es war, als flackere ein Licht noch einmal glänzend empor, das eben verlöschen will. Einen Augenblick sah er mit diesem übernatürlichen seligen Ausdruck seinem Freunde ins Gesicht. Dann mit einem Male sanken seine Wimpern herab, Totenblässe breitete sich über sein Antlitz, und seine Züge verfielen zusehends. Er röchelte eine Weile leise, dann stieß er einen tiefen Seufzer aus und lag regungslos.
»Er ist tot«, sagte Oldecop und ergriff sein Buch, um das Gebet für die abgeschiedene Seele zu lesen.
Lucke schrie laut auf und wollte sich über ihren Vater hinwerfen. Aber Wildefüer umfaßte sie und führte sie mit sanfter Gewalt zur Seite. »Nicht, Kind! Das kann dir den Tod bringen«, warnte er.
Das Mädchen glitt auf eine Truhe nieder, die an der Wand aufgestellt war. Dort blieb sie sitzen und weinte heiß und unaufhaltsam in ihre Schürze hinein. Wildefüer stand zwischen ihr und dem Toten mit gefalteten Händen und gesenktem Haupte und ohne ein Glied zu regen, bis die Stimme des Priesters verklungen war. Dann trat er an das Lager heran und machte das Zeichen des Kreuzes über dem Entschlafenen. »Du bist eines schönen, schnellen Todes gestorben, Klaus«, sagte er. »Von uns fünfen, die wir einstmals die Burg zu Peine entsetzt haben in der großen Fehde und Freunde waren unser Leben lang, bin ich nun der letzte. Nun gebe dir Gott fröhliche Urständ und mir einen Tod so schnell wie den deinen, wenn ich einmal von hinnen muß! – Aber wer kennt sein Ende?« Er stand eine Weile in düsteres Sinnen verloren. Dann schlug er noch einmal das Kreuz über dem Toten und wandte sich nach Lucke um und sagte: »Ich gehe jetzt, deinem Vater ein Begräbnis zu verschaffen. Vor morgen früh wird das nicht möglich sein. Dann übergeben wir das Haus deiner Muhme Bröcker, und du ziehst mit mir nach Hildesheim. Da dort die Seuche schon ist, darf ich dich ohne Unrecht hinüberbringen. Dann bleibst du bei uns als unsere Tochter, bis Christof von Hagen heimkehrt und ich deine Hand in seine Hand lege.«
Unweit des Almtores in Hildesheim stand das stattliche, hochragende Haus, das der Bürgermeister Hans Wildefüer bewohnte. Vor etwa dreißig Jahren hatte es sein Vater käuflich erworben. Damals war es ein ziemlich unansehnlicher Bau gewesen, der sich von den Nachbarhäusern wenig unterschied. Je reicher aber Hans Wildefüer im Laufe seines tätigen und glückbegünstigten Lebens geworden war, um so mehr hatte sich auch das Aussehen seines Wohnhauses verändert, und der alte Jost Wildefüer würde es schwerlich wiedererkannt haben, wenn er seiner Gruft auf dem Andreaskirchhof hätte entsteigen können. Die Hildesheimer waren ja von jeher baulustige, kunst- und farbenfrohe Leute gewesen. In früheren Zeiten hatten sie diesen Zug ihres Wesens an ihren Gotteshäusern betätigt, weswegen Hildesheim so viele prächtige und kunstvolle Kirchen und Kapellen aufzuweisen hatte wie kaum eine andere Stadt von gleicher Größe im ganzen Heiligen Römischen Reiche. Dann waren sie darauf verfallen, ihr Rathaus, ihre Gilden- und Amtshäuser aufs herrlichste zu schmücken und herzurichten. Nun seit einigen Jahrzehnten war die gesamte Bürgerschaft von dem Verlangen ergriffen worden, in schönen, bunten und kunstvoll verzierten Häusern zu wohnen. Einige reiche Leute hatten damit angefangen, andere waren ihnen nachgefolgt, zuletzt wollte keiner nachstehen, auch die Ärmsten nicht. Wer wenig Geld in der Truhe hatte, ließ wenigstens über der Tür ein paar geschnitzte Figuren aus Holz oder Rosetten unter den Fenstern anbringen und Sprüche oder Verse auf die Hauswand pinseln, deren Anfangsbuchstaben in hellen Farben, in einem tiefen Rot oder in schimmerndem Blau leuchteten. Die Reichen aber ließen die ganze Vorderseite ihrer Häuser mit hölzernen Schnitzwerken überkleiden, und es gab Meister in Hildesheim, die darin eine hohe Kunst entfalteten. Da sah man ganze Volkssagen bildlich dargestellt und häufiger noch biblische Geschichten – Simson, wie er den Löwen zerreißt und die Philister erschlägt; Joseph, wie er von seinen Brüdern verkauft, dann von Potiphars Frau übel versucht wird und am Hofe des Pharao zu hohen Ehren gelangt, und zwischen diesen Männern und Frauen des Alten Testaments die Gestalten der hohen Heiligen Hildesheims, Bernward und Godehard, oder die starken Helden der Weltgeschichte, Hektor den Trojaner, Julius Cäsar, Kaiser Karl den Großen und andere. Sie alle standen da in bunten Gewändern, die Harnische blinkten silbern, die Kronen und sonstigen Zierrate waren vielfach vergoldet. Wer an einem hellen Sonnentage durch die Stadt wandelte, dem mochten wohl die Augen weh tun von all der Farbenpracht, die da zu schauen war, und er mochte gern einmal den Blick ausruhen lassen auf den grauen Mauern der riesigen Kirchen, die unter den bunten Häusern standen wie düstere Propheten der Vorzeit in härenem Gewand unter den lachenden, genußfrohen Kindern dieser Welt.
Hans Wildefüers Haus war unter den vielen prächtigen Gebäuden der Stadt eines der prächtigsten. Das entsprach seinen Neigungen und seiner Stellung. Er hatte das Nachbarhaus angekauft und niederreißen lassen. Dadurch war es ihm möglich gewesen, sein Haus fast um die Hälfte zu vergrößern. Dann hatte er vor etwa zehn Jahren auf die dicke Mauer des Unterstockes noch einen Stock aus Fachwerk aufsetzen und verschwenderisch ausschmücken lassen. In ellenhohen Figuren war da die ganze Geschichte des Täufers Johannes dargestellt, denn der Bürgermeister war am Tage dieses Gottesmannes geboren und getauft worden und hatte nach ihm den Namen empfangen. Da sah man ihn, wie er mit dem Jesusknaben spielte, wie er den Pharisäern und Schriftgelehrten Gottes Zorn weissagte, den Herrn im Jordan taufte und Herodes des Ehebruchs bezichtigte. Auch der Tanz der Salome fehlte nicht, und es konnte leider nicht behauptet werden, daß der Künstler die Reize der jüdischen Königstochter und ihrer Mutter Herodias allzu sittsam verschleiert hätte. Den Schluß bildeten die Enthauptung und die Vortragung des blutigen Hauptes auf einer Schüssel. Diese Schüssel war von ungeheurer Größe, stark vergoldet und mit vier Bildern aus der Belagerung von Peine durch Herzog Heinrich den Jüngeren von Braunschweig geziert. Sie war eine genaue Nachbildung der Schüssel, die Henni Konerding, der Bürgermeister, seinem Freunde Hans Wildefüer geschenkt hatte zum Gedächtnis an die ruhmvolle Verteidigung der hartbedrängten Burg. Wildefüer hatte das kostbare Geschenk zur Hochzeitsschüssel in seiner Familie bestimmt, in der dem Herkommen und Brauche nach beim Hochzeitsmahle die Gaben für Braut und Bräutigam von den Gästen eingesammelt werden sollten. Wenn auf diesem Bilde die Abendsonne lag, wie es jetzt geschah, so mußte man den Blick nach einer Weile geblendet abwenden, so funkelte es von Gold und Purpur.
An dem kleinen Fenster gerade über dem Bilde war der blonde Kopf einer Frau sichtbar, die in einem schmalen Buche las. Sie hielt es mit beiden Händen hoch empor, um das letzte Licht des scheidenden Frühlingstages sich dienstbar zu machen. Sie war von hohem Wuchse, ein Weib, auf dessen ganze Erscheinung das Wort »stattlich« wie kein anderes paßte. Schön war sie nicht zu nennen, dazu waren ihre Züge zu groß. Wer den Bürgermeister kannte, der sah auf der Stelle, daß sie seine Tochter war. Nur die Farbe ihres Haares hatte sie offenbar von ihrer Mutter geerbt, einer kaum mittelgroßen, feingliedrigen Frau, die ihr gegenübersaß und, die Hände im Schoße gefaltet, ihr zuhörte. Sie mochte wohl eine höhere Vierzigerin sein, aber der Ausdruck ihres schmalen, blassen Gesichtes hatte etwas Kindliches. Sie saß in einem großen Lehnstuhle, gehüllt in Kissen und Decken, denn sie hatte eben erst ein schweres Gliederreißen überwunden und war heute zum ersten Male von ihrem Krankenlager erstanden. Mit großen, glänzenden Augen blickte sie auf die Lesende. Sie sah aus, als wäre ihr Geist gänzlich der Welt entrückt.
Das kleine Buch, in das sich die beiden Frauen versenkt hatten, war Doktor Martin Luthers Auslegung des 14., 15. und 16. Kapitels des Johannesevangeliums. Der Ratsherr Tilo Brandis, der im geheimen der neuen Lehre anhing, hatte es vor einigen Tagen seiner Frau Gesche aus Braunschweig mitgebracht.
Die Vorlesende war von dem Buche offenbar nicht weniger gefesselt als die Zuhörende. Sie las mit blitzenden Augen und geröteten Wangen, und ihre Stimme schallte zuweilen so laut, als wolle sie eine geräumige Kirche ausfüllen. Sie konnte das ohne Gefahr wagen, denn das Gesinde arbeitete im Garten vor der Stadt, und das ganze Haus war leer. Ihres Vaters Heimkehr aus Goslar war noch kaum zu erwarten, auch konnte er sich nicht unbemerkt dem Hause nähern.
»Das ist meine Sprache«, klang es tönend von Frau Gesches Lippen. »Friede heißt Unfriede, Glück heißt Unglück, Freude heißt Angst, Leben heißt Tod in der Welt, und wiederum, was in der Welt heißt Unfriede, Angst, Tod, das heiße ich Friede, Trost und Leben. Leben ist es, Freude und Trost ist es; aber nicht in der Welt, sondern in mir werdet ihr solches finden, daß euer Herz durch mein Wort werde ein Demant wider alle Welt, Teufel und Hölle. Wenn ihrer noch vieltausendmal mehr wären und noch viel zorniger wären, so sollten sie es doch so böse nicht machen mit ihrem Zorn und Toben, daß sie mich euch können nehmen, denn ich bin ihnen so hochgesessen, daß ich von ihnen weg kann bleiben. – Darum ist solches ›in ihm Frieden haben‹ nichts anderes denn das: ›Wer sein Wort im Herzen hat, der wird so keck und unerschrocken, daß er kann der Welt und des Teufels Zorn und Toben verachten und dawider Trotz bieten; wie sich's auch bewiesen hat an den heiligen Märtyrern, ja auch ein junges Maidlein, als S. Agathe und Agnes, die so fröhlich zur Marter sind gegangen, als gingen sie zum Tanze und ihrer zornigen Tyrannen dazu spotteten‹.« –
Die Vorleserin hielt plötzlich inne, denn ein leiser Wehlaut zitterte durch das Gemach. Sie blickte erschrocken auf ihre Mutter, deren Augen sich mit Tränen gefüllt hatten, und um deren Mund es zuckte wie von verhaltenem Weinen.
»Liebste Mutter! Was ist Euch?« rief sie und sprang erschrocken auf. »Habt Ihr wieder Schmerzen?«
»Nicht in den Gliedern, aber in der Seele«, erwiderte Frau Mette Wildefüer, indem ihr eine große Träne über die Wange rollte. »Solche Worte gehen mir durchs Herz wie ein Schwert. Der Luther hat ja recht: Wer Gottes Wort im Herzen hat, der wird so keck und unerschrocken, daß er den Teufel selber kann verachten. So trage ich denn also Gottes Wort nicht im Herzen, denn ich bin nicht keck und unerschrocken, sondern ganz schwach und verzagt. Wie oft habe ich mir ein Herz wollen fassen und deinem Vater sagen, wie es mit mir steht, und daß ich heimlich eine Lutherin bin! Aber so er mich nur anschaut, sinkt allsogleich mein Mut dahin. So sündige ich zwiefach, bin untreu meinem Manne, der mir vertraut, und bin untreu meinem Heiland, der gesagt hat: ›Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater.‹ Das liegt wie eine Last auf meiner Seele, und viele Stunden der Nacht verbringe ich mit Weinen und Seufzen.«
»Ihr seid ja krank und schwach, liebes Mütterchen«, tröstete die Tochter. »Von kranken und schwachen Menschen verlangt wohl Jesus Christus nicht, daß sie sich als Helden erweisen.«
Frau Mette Wildefüer schüttelte leise den Kopf. »War nicht Sankt Paulus auch ein kranker Mann? Geplagt mit der Fallsucht und anderen Gebrechen? Und er konnte doch von sich schreiben: ›Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig.‹ Und ist der Doktor Luther nicht auch mit vielerlei Leibesschwachheit heimgesucht? Und bietet er nicht aller Welt die Stirn und trotzt der Hölle und dem Teufel? So sollten wir auch sein.«
»Das sind die Großen, die Gott auserwählt hat zu seinen Rüstzeugen«, erwiderte Gesche Brandis beruhigend. »Er verlangt wohl nicht von allen das gleiche.«
»Er verlangt, daß wir alle seinen heiligen Namen bekennen«, versetzte Frau Mette entschieden. »Das aber tue ich nicht, und ich bin in großer Angst und Sorgenpein, ob Gott der Herr mir's vergeben und mich gnädig ansehen wird.«
Über Gesches Antlitz flog ein Schatten, und sie entgegnete gedrückt: »Auch mir kommen zuweilen solche Gedanken. Tun wir's doch alle nicht. Keiner wagt es, das Evangelium frei zu bekennen; auch Tilo, mein Mann, hält sich damit zurück.« Sie blickte eine Weile nachdenklich vor sich nieder, dann setzte sie hinzu: »Wenn es nicht gerade der Vater wäre, der dem Evangelium widerstrebt, so träten wir wohl beide frei hervor, denn wir fürchten uns vor keinem. Aber es kommt uns über die Maßen schwer an, den zu kränken und zu betrüben, der uns viel Gutes getan hat, und der zudem ein besserer Mann ist als jeder andere, den wir von Angesicht kennen. Man kann wohl niemandem so schwer Widerpart halten wie dem, den man liebhat, und auf den man in herzlicher Ehrfurcht hinschaut.«
»Du sprichst aus, was ich denke!« rief die Mutter und schlug die Hände vor die Augen, aus denen jetzt die Tränen stromweise hervorbrachen. »Das ist es! Ich kann deinem Vater nicht wehe tun, und ich kann ihm nicht widerstreben, denn er hat mir so viel Glück gegeben in meinem Leben, wie selten eine Frau genießen darf. Und mit welcher Liebe und Treue umgibt er mich noch jetzt, obwohl ich seit mehreren Jahren schon dahinsieche und oft gelähmt bin, so daß er nur eine Last an mir hat! Es träfe ihn allzu tief ins Herz, müßte er erfahren, daß ich abgewichen bin von seinem Glauben. Ich kann es ihm nicht sagen, ich kann es nicht! Aber wie will ich damit vor Gott bestehen?«
Sie sank in die Kissen zurück, und ein Schluchzen erschütterte ihren schmächtigen Körper. Gesche nahm ihre Hände und streichelte sie liebevoll. Dann sank sie vor dem Stuhle in die Knie und legte ihre Stirn auf den Schoß der Mutter. »Ach liebes, liebes Mütterchen,« sagte sie, »entschlagt Euch doch jetzt der schweren Gedanken, sonst könnt Ihr ja nicht gesund werden! Wer weiß, ob nicht eines Tages Gott den starren Sinn des Vaters erweicht, so daß er sich doch noch der neuen Lehre zukehrt, wie das so viele getan haben. Dann wendet sich ja alles von selber zum besten.«
Frau Mette legte ihre durchsichtigen Hände der Tochter aufs Haupt und strich zärtlich drüber hin. »O Kind,« erwiderte sie, »wie habe ich gebetet, daß das geschehen möge! Aber ich hoffe nicht mehr darauf. Der Vater sperrt sich ja ab gegen alles, was von Luther kommt. Gäbe ihm jemand eine Schrift des Wittenbergers, so würfe er sie auf der Stelle ins Feuer. Ja, selbst das heilige Wort Gottes, das uns Luther verdeutscht hat, würde er nicht verschonen. Du weißt, daß ich es nicht wage, eine Bibel im Hause zu bewahren, so sehr auch meine Seele danach lechzt. Aber ich könnte das große, schwere Buch nicht verstecken. Wie bist du zu beneiden, daß du mit deinem Manne im Glauben eins bist! Du brauchst wenigstens in deinem Hause nichts zu verstecken und zu verbergen. Wenn ich das erlebte, ich stürbe wohl vor Freude, und ich stürbe ja gern. Aber ich werde sterben müssen mit meiner Heimlichkeit auf der Seele.«
Gesche hob den Kopf und blickte ihre Mutter liebevoll an. »Ihr werdet, so Gott will, noch lange nicht sterben, sondern bei uns bleiben noch viele Jahre, und Gott wird alles zum besten kehren.«
»Ach Kind, ich bin so schwach und werde immer schwächer. Jedesmal, wenn der Winter kommt, ergreift mich die böse Krankheit, und ich bin siech, bis es wieder warm wird in der Natur. Jedesmal aber werde ich weniger und komme schwerer wieder zu Kräften. Vielleicht ist das der letzte Frühling, den ich erlebe. – Aber sieh einmal nach, Gesche, was vor dem Hause ist. Hörst du es nicht? Der Vater kommt wohl von Goslar zurück?«
Gesche sprang auf und trat schnell ans Fenster. »Ja, der Vater!« rief sie. Dann eilte sie rasch auf eine große Truhe zu, die neben der Tür stand, schlug den Deckel zurück und verbarg das Buch Doktor Luthers unter den Linnenstücken, die da aufgespeichert waren. »Der Vater kommt nicht allein«, sprach sie dabei hastig. »Er bringt uns einen Besuch mit. Wenn ich recht gesehen habe, ist es Lucke Hary.«
»Ach, dann wird wohl Klaus gestorben sein!« rief Frau Mette, und ein ehrliches Bedauern klang aus ihrer Stimme. »Ich habe ihn immer gern gehabt, ob er gleich ein wunderlicher und einsiedlerischer Mann geworden war. Und den Vater wird sein Tod schwer getroffen haben, denn er war sein letzter Freund aus der Jugend.«
Während sie noch redete, erklangen schon Hans Wildefüers feste Tritte auf dem Estrich des Vorsaals, und gleich darauf trat der Bürgermeister ein. Er begrüßte seine Tochter, die noch in der Nähe der Tür stand, durch einen Händedruck und ein freundliches Zunicken, dann eilte er auf seine Frau zu, nahm ihr Haupt in seine linke Hand und küßte sie auf den Mund. »Du bist aus dem Bett heraus? Es geht dir besser? Sind die Schmerzen fort?« rief er freudig.
»Ja, Hans, es geht mir, Gott sei Dank, viel besser. Seit gestern abend bin ich die Schmerzen los«, erwiderte Frau Mette.
»Nun, das ist ja schön. Das freut mich von Herzen. Leider aber habe ich dir sehr Trauriges zu erzählen.« Er faßte das junge Mädchen, das an der Tür stehengeblieben war, bei der Hand und führte es zu seiner Frau. »Ich bringe dir hier Lucke Hary, die du nicht gesehen hast seit ihrer Firmelung. Sie ist eine Waise, denn mein alter Klaus ist gestern gestorben. Ich habe ihm gelobt, sie wie mein Kind zu halten in meinem Hause bis zu ihrer Heirat. Ich denke, Mette, du wirst sie wie eine Mutter aufnehmen.«
»Danach brauchst du nicht erst zu fragen. Das versteht sich von selber.« Sie streckte dem Mädchen beide Hände entgegen und zog es zu sich heran. »Komm, liebes Kind, laß dir einen Kuß geben. Willkommen in unserem Hause! Und Gott segne deinen Eingang!«
Die junge Lucke war mütterliche Zärtlichkeit nicht gewohnt, denn ihre Mutter war schon vor vielen Jahren gestorben. Aber als sie die Augen der Muhme so voller Freundlichkeit und Güte auf sich gerichtet sah und dann ihren Kuß auf ihrer Wange fühlte, kam ein Gefühl über sie, das sie bisher kaum gekannt hatte. Ihr Herz flog der Frau entgegen, die ihr doch halb fremd geworden war, weil sie schon seit Jahren nicht mehr nach Goslar gekommen war, wenn ihr Ohm Wildefüer seinen alten Freund, ihren Vater, besucht hatte. Mit heißem Weinen glitt sie vor ihr auf den Boden nieder und küßte ihre bleichen, durchsichtigen Hände und ließ ihre warmen Tränen auf sie herniederfallen.