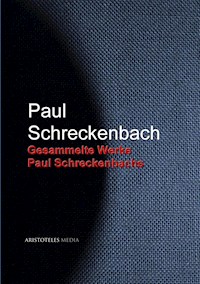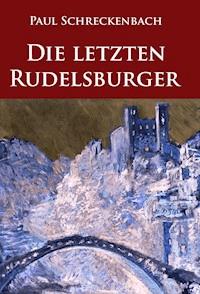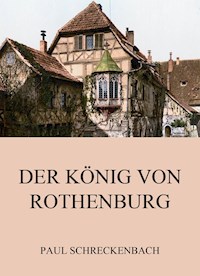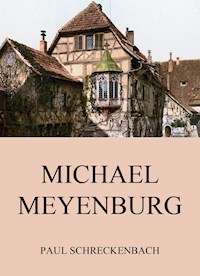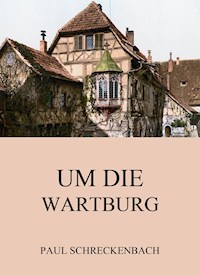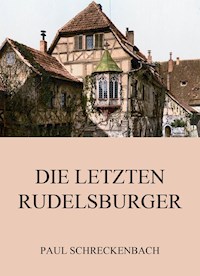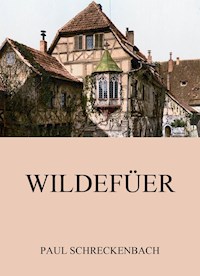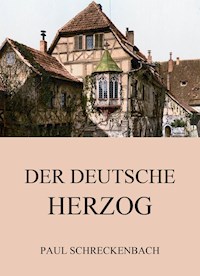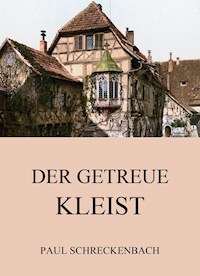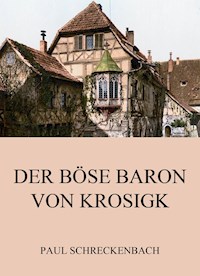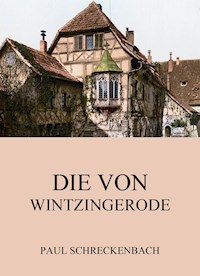
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman aus dem 16.Jahrhundert und über die Herrschaft des Geschlechtes der Herrschaft Bodenstein an der nördlichen Grenze des Eichfelds. In seinen Veröffentlichungen setzte sich Schreckenbach mit den ethischen und patriotischen Fragen seiner Zeit auseinander. Als Grundlage dafür nutzte er reale historische Ereignisse, die er jedoch künstlerisch frei umgestaltete.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die von Wintzingerode
Ein Roman aus dem sechzehnten Jahrhundert
Paul Schreckenbach
Inhalt:
Paul Schreckenbach – Biografie und Bibliografie
Die von Wintzingerode
I. Kapitel.
II. Kapitel.
III. Kapitel
IV. Kapitel.
V. Kapitel.
VI. Kapitel.
VII. Kapitel.
VIII. Kapitel.
IX. Kapitel.
X. Kapitel.
XI. Kapitel.
XII. Kapitel.
XIII. Kapitel.
XIV. Kapitel.
XV. Kapitel.
XVI. Kapitel.
XVII. Kapitel.
XVIII. Kapitel.
XIX. Kapitel.
XX. Kapitel.
XXI. Kapitel.
XXII. Kapitel.
XXIII. Kapitel.
XXIV. Kapitel.
XXV. Kapitel.
XXVI. Kapitel.
XXVII. Kapitel.
XXVIII. Kapitel.
XXIX. Kapitel.
XXX. Kapitel.
XXXI. Kapitel.
Die von Wintzingerode, P. Schreckenbach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849635763
www.jazzybee-verlag.de
Paul Schreckenbach – Biografie und Bibliografie
Deutscher Pfarrer und Schriftsteller, geboren am 6. November 1866 in Neumark (bei Weimar), verstorben am 27. Juni 1922 in Klitzschen bei Torgau. Sohn eines Pastors, studierte in Halle und Marburg Theologie und Geschichte und promovierte später zum Doktor phil. Ab 1896 arbeitete S. als Pfarrer in Klitzschen in der Nähe von Torgau. Der Autor ist bekannt für seine hervorragenden historischen Romane.
Wichtige Werke:
Bismarck, 1915
Der böse Baron von Krosigk, 1908
Die von Wintzingerode, 1905
Geistliche Lieder von Martin Luther, 1917
Der getreue Kleist, 1909
Der jüngste Tag, 1919
Der König von Rothenburg, 1910
Der Komtur, 1921
Kurfürst Augusts Abenteuer, 1921
Die letzten Rudelsburger, 1913
Markgraf Gero, 1916
Michael Meyenburg, 1920
Die Pfarrfrau von Schönbrunn, 1917
Sühne, 1923
Die Tat des Leonhard Koppe, 1916
Um die Wartburg, 1912
Der Weltbrand, 3 Bände, 1915-20
Die von Wintzingerode, 1905
Der Windmüller von Melpitz, 1914
Der Zusammenbruch Preußens 1806, 1906
Die von Wintzingerode
I. Kapitel.
Der Martinstag des Jahres 1573 ging über der alten Bischofsstadt Mainz zur Rüste. Die Kälte hatte dieses Jahr früh eingesetzt; ein scharfer Ostwind kräuselte die breite Flut des Rheins und pfiff schneidend durch die Straßen und zerzauste die Kränze und peitschte die Fähnlein, die zu Ehren des heiligen Schutzpatrones der Stadt heute zu seinem Festtage an fast allen Häusern herausgehängt waren. Dazu wirbelte der Schnee in harten, feinen Flocken vom Himmel hernieder und rieselte in dichten Schwaden von den hochgiebligen Dächern herab.
Trotzdem waren alle Straßen voll fröhlich geputzter Menschen. Was fochten das frische rheinische Blut die Kälte und der Schnee an! Die war man gewöhnt um diese Jahreszeit, die sollten den guten Mainzern ihren hohen Festtag nicht verderben! Sie hatten früh andächtig in ihren Kirchen gekniet und manchen Rosenkranz gebetet und sich erbaut an dem, was ihnen ihre Priester erzählten von den Taten des ritterlichen Heiligen, der ihre liebe Stadt im Himmel mit seiner Fürbitte vertrat. Nun aber, am Abend, war der Frömmigkeit Genüge getan, nun wollten sie leben! Die ganze Stadt duftete nach dem Braten des Martinsvogels, der Gans, die das ärmere Volk mit kleinen Äpfeln, die Vornehmen aber mit wälschen Kastanien stopften, und Arm und Reich aß in den Häusern und auf den Straßen ein süßes Kringelgebäck, das ebenfalls alter Sage zufolge dem Heiligen lieb war. Mit diesem Gebäck beschenkte man sich heute, suchte sich wohl auch im Straßengedränge die Brezeln zu entreißen, ja auf dem Liebfrauenplatze hinter dem Dome fütterte man zwei Affen damit, die ein brauner Fremdling dort für Geld sehen ließ. Eine große Menschenmasse hatte sich davor aufgestaut, Mädchen in schreiend bunten Röcken und lustige Gesellen aus der Stadt, Landsknechte und dazwischen einige ehrbare Ratsherren in pelzverbrämten Festmänteln. Alle lachten vergnügt über die tollen Grimassen der menschenähnlichen Tiere, die sich so gierig geberdeten.
Die Szene beobachtete ein älterer Mann, der an dem halb geöffneten Fenster eines stattlichen Hauses stand. Er trug die einfache Tracht der spanischen Weltgeistlichen, kein Abzeichen, keinen Schmuck, und doch sandte jeder, der ihn dort bemerkte, einen achtungsvollen Gruß hinauf. Denn jedes Kind in Mainz kannte diesen hageren Mann mit dem blassen, scharfgeschnittenen Gesicht und dem fast haarlosen Haupte, das er stets ein wenig nach vorn geneigt trug. Es war der Beichtvater des Kurfürsten, Pater Ludwig Bacharell, Mitglied der Gesellschaft Jesu.
Der Pater blickte gleichgültig, fast gelangweilt in das bunte Gewühl hinab. »Wo nur Stralendorf bleibt?« murmelte er vor sich hin. »Es geht stark auf vier Uhr.«
Plötzlich aber kam Leben in sein Antlitz. Gespannten Blickes schaute er über die Volksmenge hinweg nach der Richtung hin, wo vom Markte her eine Straße auf den Platz einmündete. Immer finsterer wurde der Ausdruck seiner Mienen, und mit einer jähen Bewegung wandte er sich plötzlich vom Fenster weg.
»Da tretet her, Gropper«, sagte er mit harter Stimme, »tretet her und überzeugt Euch von dem, was ich Euch gesagt habe. Da kommt der Nachfolger des heiligen Bonifatius geritten, der erste Prälat des Reiches, ein Erzbischof der heiligen Kirche, mit Jägern und Falken und Hunden! Sagt das dem heiligen Vater, wenn Ihr demnächst nach Rom kommt, damit er sich nicht wundert, daß wir nichts erreichen, und nicht uns der Lässigkeit beschuldigt.«
Der Angeredete trat langsam näher – eine große, grobe, starkknochige Gestalt in demselben Gewande wie jener, das Gesicht einer Bulldogge nicht unähnlich. Gespannt und ohne ein Wort zu sprechen, betrachtete er den glänzenden Jagdzug, der sich nahte, voran die Knechte mit der kläffenden Meute, dann der Kurfürst- Erzbischof auf feurigem Rappen in grünem Jagdkleide wie alle seine Begleiter, Ritter und Damen. Nur die wallenden weißen Federn auf seinem Hut und der breite Hermelinbesatz seines Mantels unterschieden ihn von den anderen. Er sprach eifrig mit einem jungen Manne, der ihm zur Seite ritt, grüßte auch hin und wieder einen von den Bürgern, die ehrerbietig das Haupt entblößten, aber kein Blick seiner klugen schwarzen Augen flog empor zu dem Fenster, wo die beiden Jesuiten ihn beobachteten. Der Zug eilte schnell vorüber, hinter ihm schloß sich die Menschenmasse wieder zusammen. Gropper wandte sich vom Fenster ab.
»Ein erbaulich Schauspiel!« sagte er spöttisch. »Als Kurfürst Daniel dreißig Jahre alt war, habe ich ihn freilich oft so gesehn. Seitdem, dachte ich, hätte er die Alfanzereien gelassen. Es scheint indessen nicht so. Ist denn dieser Falk ganz unzähmbar? Ich war immer so viel auswärts, daß ich ihn kaum noch kenne. Aber weiland erkannte ich Anlagen in ihm, die Großes versprachen.«
Bacharell ließ sich verdrossen in einen Stuhl fallen und entgegnete gereizt: »Soll das ein Hieb gegen mich sein, so trifft er nicht. Vielleicht bin ich zu töricht, vielleicht reicht mein Witz und Verstand nicht weit genug, aber an Eifer, wahrlich, habe ich es nie fehlen lassen.«
»Dessen zeihe ich Euch auch nicht«, sagte Gropper ruhig. »Auch seid Ihr, ich weiß es, luminanten Geistes. Und doch – ich staune, daß hier nichts vorwärts geht. Es ist wahr, der Kurfürst hat unseren heiligen Orden hier aufgenommen, er hat uns ein Kollegium errichtet, er hat seine Beichtiger aus unserer Zahl gewählt, er zeigt sich uns auf alle Weise gewogen. Aber das Wichtigste fehlt: Er selbst ist nicht unser. Ein Funke unseres Geistes – wohl, der ist in ihm erglommen. Aber wo bleibt die Glut, die starke Flamme, die das ganze Herz in Brand setzt, daß es sich verzehrt für die Sache Gottes und seiner heiligen Kirche? Ich sehe nichts davon. Wie kommt das?«
Der Pater schwieg eine kleine Weile, dann entgegnete er langsam und stockend: »Es war nicht immer so mit Daniel, wie es jetzt ist. Er war auf gutem Wege, ganz der unsere zu werden. Wie brannte sein Herz in Andacht zur gebenedeieten Mutter Gottes! Sogar die geistlichen Exerzitien hat er auf sich genommen und mir entzückt gesagt, er fühle dabei, wie die Ströme göttlicher Gnade sich in sein Herz ergössen und es ganz ausfüllten. Das war noch vor einem Jahre so. Aber in diesem Charakter ist nichts beständig, und was man Jahre hindurch mit Mühe aufgerichtet hat, das wird in einer Stunde niedergerissen durch die Wogen der ungezügelten, unbändigen Sinnlichkeit, die in seiner Natur liegt. In Kurfürst Daniels Seele herrscht das Weib!«
Gropper, der während der Rede des anderen langsam durchs Zimmer geschritten war, blieb überrascht stehen. »Wie? Ist Daniel über solche Versuchung nicht hinaus? Zählt er nicht fünfundvierzig Sommer?«
Bacharell nickte. »Das wohl. Aber die späte Leidenschaft ist die stärkste. Herbstgewitter sind oft die schwersten.«
Beide schwiegen ein paar Sekunden. »Und wer ist die neue Traute des Herrn?« fragte Gropper.
»Man sieht, daß Ihr neu angekommen seid«, erwiderte Bacharell. »Hier pfeifens schon längst die Spatzen von den Dächern! Es ist eine von Wintzingerode, ein adeliges Fräulein vom Eichsfeld« –
»Bartholds von Wintzingerode Tochter?« fragte Gropper schnell.
»Desselben!«
Gropper lächelte. Sein Gesicht mit den breiten, wulstigen Lippen nahm einen diabolischen Ausdruck an. »Unglaublich!« rief er. »Dieses Mannes Tochter eines Bischofs Dirne!«
Bacharell machte eine abwehrende Bewegung. »Leider nicht«, sagte er finster. »Wäre sie eine von denen, die ohne Ring am Finger hohen Herren gefällig sind, es wäre besser. Für dieses Weib aber geht mit ihrem Willen der Weg ins Brautgemach nur vom Altar aus.«
Groppers Gesicht zeigte bei diesen Worten die äußerste Bestürzung. »Was«, stammelte er. »Wie meint Ihr? Sollte Daniel – nicht möglich – ein Apostat werden? Von der heiligen Kirche abfallen« –
»Nein«, versetzte Bacharell fest und bestimmt. »Das ist nicht zu befürchten, der heiligen Jungfrau sei Dank. Daniel kann nie ein Ketzer werden, er ginge zu Grunde unter den salbadernden lutherischen Prädikanten mit ihren nüchternen Gottesdiensten in kahlen, schmucklosen Kirchen. Seine Seele verlangt nach dem, was wir haben, nach hohen Domen mit herrlichen Altären, mit Weihrauchduft und Kerzengeflimmer, mit Bildern und Zeichen. Sein Herz glüht in Andacht und Liebe zur allerseligsten Jungfrau. Zu ihr, die von den Ketzern geschmäht wird, richtet er seine Gebete. Und was wäre ein Mann, der so viel auf dem Gewissen trägt, ohne die Beichte, ohne die göttliche Absolution, die allein die Kirche des Apostelfürsten spendet! Nein, ein Ketzer wird Daniel niemals.«
»Gelobt sei Gott!« sagte Gropper aufatmend. »Es macht mich ruhig, daß Ihr das so sicher sagt, Ihr müßts ja wissen. Aber wenn nicht, was fürchtet Ihr?«
»Sehr vieles!« rief Bacharell. »Eine Gewalttat, die uns ungeheuer schaden wird. Ein Skandalen, wovon man reden wird von Polen bis Hispanien. Wißt Ihr noch, wie die Ketzer vor zwanzig Jahren triumphirten, als Heinz von Wolfenbüttel die schöne Eva von Trott heimlich auf sein Schloß bringen ließ und in Gandersheim an ihrer Statt eine Strohpuppe mit allen kirchlichen Ehren begrub? Ich war damals ein junger Mann, aber ich vergesse mein Lebtag das Gelächter nicht, das die ketzerischen Fürsten in Regensburg anstimmten, als Heinz den Saal betrat. Am lautesten lachte der Hesse, ders am wenigsten Ursache hatte. Gott wird ihn verdammt haben. Und Heinz Wolfenbüttel war ein weltlicher Herzog! Unser Herr ist ein Kirchenfürst, der erste in Germanien! Und er wird nicht abstehen, ich kenne den Herrn. Lange schwänzelt er nicht mehr mit glatten Worten und heißen Augen um die Magd herum. Fühlt er, daß er damit nicht zum Ziele kommt, dann nimmt er sich, was er will, mit Gewalt. Dann wird Anna von Wintzingerode eines Tages verschwunden sein.«
Gropper hatte sich schwerfällig in seinen Armstuhl gesetzt und schaute düster zur Decke empor. Es kam wie ein Stöhnen aus seiner Brust, aber er erwiderte kein Wort.
»Dann ist ein zwiefaches möglich«, fuhr Bacharell fort, »beides für uns verderblich. Entweder er macht sich das Weib gefügig, und sie bleibt bei ihm. Dann wird sie ihn beherrschen, ich fühle es, denn ich habe sie genau angesehen, obwohl ich sonst den Anblick der Weiber meide, weil nichts gutes dabei herauskommt. Dann ist es mit unserer Macht zu Ende. Oder sie wird wider ihren Willen gefangen gehalten, ihr Vater klagt, die Ritterschaft des Eichsfeldes kommt in Bewegung, Kaiser und Reich wird angerufen – wie wirds enden! Vielleicht überfällt der alte Wolf Barthold unsere Stadt, wie einst sein Kumpan Grumbach Würzburg überfallen hat«.
»Das wäre nicht unwahrscheinlich«, fiel Gropper ein.
»Schmach und Schande wirds auf jeden Fall. Und mich träfe es am härtesten, denn meines Lebens Ziel müßte dann versinken. Seit zwölf Jahren und länger kenne ich keinen heißeren Wunsch, als die gefährdetste Provinz dieses Mainzer Kirchensprengels wieder zurückzuführen zur allein seligmachenden Kirche. Das Eichsfeld soll wieder katholisch werden. Mit diesem Gedanken habe ich mich jeden Abend zur Ruhe gelegt und bin mit ihm jeden neuen Morgen aufgestanden. Ich habe unzählige Gebete darum zum Himmel gesendet, ich habe meinen Leib gepeinigt, um die Heiligen meinem Plane geneigt zu machen. Nun sollte das alles vergebens sein?« Er hielt inne und starrte finster vor sich nieder.
»Sagt einmal, Bacharell«, begann Gropper nach einer kleinen Pause, »woher kommt Eure besondere Liebe für dieses Land? Es gibt im Erzstift, Gott seis geklagt, doch viele Orte, wo die Ketzerei wuchert, Mainz selbst ist voll davon. Warum habt Ihr Euer Absehn gerade auf das Eichsfeld gerichtet?«
Bacharells Augen leuchteten auf. »Weil mirs die heilige Jungfrau selbst befohlen hat«, erwiderte er mit starker Stimme.
»Die heilige Jungfrau?« fragte Gropper erstaunt. »So hättet Ihr ein Gesicht gehabt?«
»Ich armer, sündiger Mensch bin dessen gewürdigt worden«, sagte der Pater geheimnisvoll und mit einem verzückten Ausdruck.
Gropper rückte gespannt näher. »Und darf ich wissen und erfahren, was Ihr geschaut?«
»Ihr dürft es, Gropper. Wem soll ichs erzählen, wenn nicht Euch? Auch Thyreus weiß es. So hört denn, ich will Euch den Hergang berichten.
Vor zwölf Jahren reiste ich in jenem Lande. Ich sollte erkunden, wie es dort stehe. Jammer über Jammer – ich fand den Weinberg Gottes zertreten und verwüstet. Überall Abfall vom wahren Glauben, die geweihten Priester weltlich geworden, die Klöster verödet, allenthalben breit und frech in Stadt und Land die lutherischen Diener am Wort. Schreckliches hörten meine Ohren, Entsetzliches sahen meine Augen. In Heiligenstadt erblickte ich ein herrliches Bild der gebenedeieten Gottesmutter, dem ruchlose Bubenhand einen Nagel in die Stirn getrieben hatte. Mit weinenden Augen zog ich das Eisen aus der Stirn der Holdseligen und setzte ihr ein Kränzlein aufs Haupt, daß es den Frevel bedecke. Mit blutendem Herzen zog ich weiter durchs Land, da kam ich auch in ein Dorf, das hieß Tastungen.
Als ich dies Dorf durchschritten hatte, ertönte eine Stimme hinter mir. Es war eines alten Weibes Stimme, die zitternd und kläglich nach mir rief. »Seid Ihr ein Priester der alten Kirche?« fragte sie scheu und ängstlich umherblickend, als ich mich näherte. Ich bejahte. »O, dann erbarmt Euch und nehmt mir meine Beichte ab«, wimmerte sie. »Ich bin vom alten Glauben, und hier gibt es keine Priester Gottes, nur lutherische Prädikanten. Der Herr leidet keine Priester, er hat sie alle vertrieben und sein ganzes Gericht lutherisch gemacht.« – Dieser ihr Herr war der Ritter Barthold von Wintzingerode. –
Was sollte ich tun? Sollte ich die Frau in ihren Sünden verderben lassen, eine Seele, die nach Vergebung dürstete? Ich trat ein und nahm dem Weib die Beichte ab. Es dauerte lange. Endlich war sie fertig, und ich verließ das Haus. Da tauchte vor mir hinter dem nächsten Hause ein Pferdekopf auf. »Um Gotteswillen tretet zurück ins Haus«, flüsterte erschreckt das Weib. Aber das Unheil war schon geschehen, der Ritter hielt vor mir, hinter ihm andere vom Adel und viele Knechte.
»Verdammt, Westernhagen!« rief er, »zwei böse Vorzeichen für unsere Jagd. Ein Pfaffe und ein altes Weib!« Dann trieb er sein Roß dicht an mich heran und fragte drohend: »Was tust du hier, Pfaff?«
Ich erklärte es ihm. Er lachte rauh und höhnisch auf. »Was geht dich die alte Eule an? Solltest sie ruhig in ihren Sünden abfahren lassen. Hierher Urschel! Hast du dem Pfaffen nicht gesagt, daß hier keiner von seinesgleichen geduldet wird? Was, Alte?«
Und das Weib, das mich vorher unter Tränen gebeten und mir die Hand geküßt und mich ihren Retter vom Himmel genannt hatte, das winselte jetzt am Boden um Gnade und schob alle Schuld auf mich und sagte, sie hätte mich wohl verwarnt und gesagt, daß der strenge Ritter es verboten habe zu beichten und Beichte zu hören.
»So, dann scheer' dich in deinen Bau!« rief er dazwischen, »dann soll der Pfaff allein büßen.«
»Herr«, sagte ich, »laßt mich ruhig meine Straße ziehn. Ich bin ein Diener des hochwürdigen Herrn von Mainz, er würde jede Unbill ahnden, die an mir geschieht.«
Ich hätte nichts Ungeschickteres sagen können. Denn sein Gesicht färbte sich blutrot, und auf der Stirn erschien eine dicke blaue Zornesader.
»Was?« schrie er mit sprühenden Augen. »Schrecken willst du mich mit dem Mainzer Rademachergesellen, dem Fuchse, der meine Vettern um ihr Erbe betrogen hat? Ja, Füchse seid Ihr alle, ihr verwünschten Pfaffen, und wie einen Fuchs will ich dich behandeln! Auf, Leute, ergreift ihn und prellt das Füchslein!«
Da holten die Knechte aus dem Hause das Bettlaken des alten Weibes, legten mich darauf und prellten mich, wie man einen Fuchs prellt. Jedesmal, wenn ich beim Anziehen des Tuches in die Höhe flog, wieherten die Ritter und Knechte wie über den köstlichsten Witz. Endlich aber ward man auch dieses Spaßes überdrüssig, man schnellte mich hoch in die Luft, daß ich betäubt zur Seite in einen Graben fiel, dann saßen sie auf, und der ganze Zug ritt unter großem Gelächter von dannen.
Elend, krank, zerschlagen an allen Gliedern wankte ich weiter nach Teistungenburg. Dort nahm mich die Äbtissin freundlich auf, die mit wenigen Nonnen in Armut hauste, und wies mir ein Lager an in der Sakristei der Klosterkirche. Ich lag in Halbschlaf lange, lange, den ganzen Nachmittag bis tief in die Nacht hinein. Nach Mitternacht erwachte ich plötzlich. Mir wars, als berühre eine kühle Hand meine Stirn, als flüsterte mir eine Stimme zu: »Steh auf und bete!« Ich schleppte mich mit Mühe beim Schein der ewigen Lampe durch die Kapelle bis zum Altar. Dort sank ich auf die Knie und betete. So habe ich nie sonst gebetet, nicht vorher, nicht nachher. Mein Gebet trug mich aufwärts, ich erlebte das, was Sankt Paulus beschreibt, ward dieser Welt entrückt im Geiste. Die Mutter Gottes sah ich, die neigte sich über mich mit einer Wunde auf der Stirn, wie jenes Bild in Heiligenstadt. Und ein Blutstropfen fiel auf meine Stirn hernieder, und die allerseligste unter den Weibern sprach zu mir: »Gesegnet seist du mein Sohn, und zu einem Segen will ich dich machen für dieses Land. Du sollst wieder bauen, was zerstört ist, und von dir sollen Ströme des Lebens ausgehen über das dürre Erdreich!« Dann war die himmlische Erscheinung verschwunden. Ich erwachte aus meiner Verzückung auf den kalten Steinfliesen vor dem Altar, das Morgenlicht brach durch die halberblindeten Fenster. Da hob ich meine Schwurhand empor und schwur einen Eid bei meiner Seele Seligkeit, daß ich alles tun würde, was in meinen Kräften stände, das Eichsfeld wieder zum alten Glauben zurückzuführen. Und drei Jahre später gab mir Gott ein zweites Zeichen, denn ich, der arme Pater, ward Beichtiger des Kurfürsten. Gott wollte es, ich sollte meinen Schwur erfüllen! Seitdem habe ich gearbeitet Tag für Tag und bin nicht lässig gewesen und habe in des Fürsten Seele leise und allmählich meinen Plan eingesenkt, und was ich gesäet hatte, ging auf und wuchs, und Daniel fing an, ein anderer zu werden, und eine heilige Begierde keimte in ihm auf, die Ketzerei zu zertreten und der Kirche dort zum Siege zu helfen. Nun reitet er wieder wie früher mit Weibern zur Falkenjagd und träumt von weißen Armen und roten Lippen. Aber ich wache, bei Gottes Tod, ich lasse den Schimpf nicht zu, den er auf sich, auf die Kirche laden will! Eher verderbe ich das Weib, das seine Seele verführt hat. Denn ich werde alt, ich will den Tag sehen, an dem die Altäre Gottes wieder stehen auf dem Eichsfelde! Das Land muß wieder katholisch werden!«
Er sank in seinen Stuhl zurück wie erschöpft von seiner langen Rede, aber seine sonst so kalten Augen glänzten wie Kohlen. Eine fanatische Glut leuchtete aus ihnen hervor.
Es entstand eine Pause. Dann begann Gropper kühl und ruhig: »Ich danke Euch, Bacharell. Was ich gehört, ist in meiner Brust begraben. Und Ihr habt Recht. Jetzt ist es Zeit, dort zu reformieren, vielleicht kommt die Zeit nie wieder. Die ketzerischen Fürsten sind uneins, sie schelten einander Heiden und Türken, Calvinisten hier, Lutheraner dort. So werden sie dem Kurfürsten nicht in den Arm fallen, wenn er in seinem Lande tut, was sein Recht ist. Und was das Hindernis betrifft« – er machte eine Bewegung, als ob er eine Schrift von dem Tische vor sich weglöschen wollte.
»Oder scheut Ihr Euch davor?« setzte er nach einer Weile hinzu, da der andere nichts erwiderte. »Sollen Tausende von Seelen um eines Weibes willen verloren gehen?«
»Das Äußerste im äußersten Falle!« versetzte Bacharell. »Ich habe da einen Plan, er ist noch nicht reif, aber vertraut mir, ich bin auf der Wacht. Das Mädchen ist einem sächsischen Ritter versprochen, zur Not könnte man den herbeizitieren. Die nächsten Tage müssen das entscheiden. Doch – wir werden unterbrochen.«
Auf der Treppe draußen wurden schnelle, sporenklirrende Schritte laut. Es pochte rasch und heftig an die Tür, und ohne einen Hereinruf abzuwarten, stürmte ein junger Mann ins Gemach, derselbe, der vorhin an der Seite des Kurfürsten geritten war.
»Ah, Herr Lippold von Stralendorf«, sagte Pater Bacharell. »Wir erwarteten Euch. – Doch, was ist geschehen?« setzte er rasch hinzu, als er das erregte Gesicht des jungen Edelmannes bemerkte.
»Etwas Unerhörtes!« schrie Stralendorf und schleuderte Handschuhe und Barett auf den Tisch. »Hätte ichs nicht mit eigenen Ohren gehört, ich glaubt' es nicht. Der Kurfürst will Barthel von Wintzingerode zum Hauptmann des Eichsfelds machen.«
Gropper fuhr mit einem unterdrückten Fluch in die Höhe, Bacharell dagegen ließ sich in seinen Sessel zurückfallen und brach in ein krähendes Gelächter aus.
»Hauptmann des Eichsfeldes! Das ist ein Witz seiner kurfürstlichen Gnaden, mein lieber Stralendorf. Der Kurfürst liebt zuweilen dergleichen Scherze.«
Stralendorf, der wütend im Zimmer umherrannte und Flüche vor sich hinmurmelte, blieb stehen und sagte in barschem Tone: »Ich bin kein Knabe, Herr Pater, und kann Ernst und Scherz gar wohl unterscheiden. Dem Kurfürsten war es heiliger Ernst mit seinem Plane, er hat eine Stunde lang mit mir von nichts anderem gesprochen.«
»Und es ist dennoch ein Scherz, sage ich Euch«, fuhr Bacharell mit Nachdruck fort. »Leider freilich ein Scherz wider Willen. Wäre Daniel nicht ganz und gar verblendet – solche Narrheit wäre nie in seinem Geiste aufgetaucht. Er sollte den Mann kennen, wir haben genug mit ihm zu tun gehabt. Es sind nicht drei Jahre vergangen, seit unser letzter Handel mit ihm geschlichtet worden ist. Der Ritter selbst muß den Kurfürsten für wahnsinnig halten, wenn er das hört. Der unglückliche Gesandte, der die Botschaft überbringt –«
»Ich selbst solls tun«, unterbrach ihn Stralendorf grimmig.
»Ihr? Ei, sieh da! Dann verseht Euch ja zuvor mit freiem Geleit, daß Ihr den Bodenstein ungekränkt wieder verlasset. Wenn Barthold erfährt, daß er die plötzliche Freundschaft unseres Herrn seiner schönen Tochter verdankt, so ist er imstande, Euch tot zu schlagen. Wie sollt Ihr es ihm denn erklären, daß der Kurfürst mit einem Male sein Freund sein will?«
»Ich soll ihm sagen, Kurfürst Daniel hätte sichs überlegt, daß es besser sei, mit einem so edeln und tapferen Ritter in Frieden zu leben«, erwiderte Stralendorf knirschend. »Er sei der Mächtigste der Ritterschaft, somit der Passendste, die Person des Landesherrn auf dem Eichsfelde zu vertreten. Der Kurfürst bietet ihm an, Hauptmann zu werden mit größerer Vollmacht als sie vor ihm jemals ein Hauptmann besessen. Seine Späne mit Graf Volkmar Wolf von Hohnstein sollen beigelegt werden. Dazu verspricht er eine jährliche Pension von dreitausend Goldgulden.«
»Meiner Treu, das ist viel! Und was soll Barthold dagegen leisten?« warf Bacharell ein.
»Von dem, was der Kurfürst in Wahrheit will, von seiner Tochter, ist gar nicht die Rede«, erwiderte Stralendorf. »Wahrscheinlich meinen Seine Gnaden, sein Diener werde dann selbst die Augen zudrücken. Der Preis, den der Ritter für die Gnade des Kurfürsten zahlen soll, ist die Rückkehr in den Schoß unserer allein seligmachenden Kirche.«
Bacharell lachte noch greller als zuvor. »Das wollt Ihr ihm sagen? Juckt Euch der Hals?«
»Sollte der Ritter darauf nicht eingehen«, fuhr Stralendorf fort, »so will sich der Kurfürst damit begnügen, daß er bei Landestagungen mit zur Messe geht. Vor allem aber soll er es dulden, daß der Kurfürst in den Städten die lutherischen Prädikanten vertreibt und geweihte Priester Gottes dafür einsetzt.«
»Von alledem, dessen bin ich ganz sicher, wird der Ritter nichts bewilligen«, sagte Bacharell bestimmt. »Denn er ist ein geborener Ketzer. Es gibt Menschen, die hat der allmächtige Gott nach seinem ewigen Rate, wie's scheint, zur Verdammnis geschaffen. Solch ein Geschöpf des Zornes ist jener Barthold. Er muß die Kirche des Herrn hassen und verfolgen, er kann nicht anders, seine böse Natur treibt ihn dazu. Und wenn ihm Kurfürst Daniel dreißigtausend Goldgulden jährlich böte und noch viel mehr, er würde alles mit Hohn und Spott zurückweisen und ein verstockter, verlorener und verdammter Ketzer bleiben. Wollte Gott, die heilige Kirche hätte viele Söhne, die ihr so treu wären, wie dieser Verworfene seiner Ketzerei!«
»Und doch, Freund Bacharell, würde ich mich darauf nicht verlassen, sondern alles tun, um den Kurfürsten auf den rechten Weg zurückzuleiten«, sagte Gropper und erhob sich. »Wer im Fieberwahn auf einen Abgrund zurast, muß zurückgerissen werden.«
»Seid dessen gewiß, ich säume keine Stunde«, entgegnete Bacharell. »Und darum, meine Freunde, laßt mich jetzt allein. Ich will zu Gott und der heiligen Jungfrau um Erleuchtung beten, daß mein Fuß den rechten Weg nicht verfehle. Dann will ich an unseren ehrwürdigen Thyreus schreiben, er ist in Speier und kann morgen hier sein. Mit ihm will ich beraten, er ist klüger als ich. Gehet mit Gott, meine Lieben, laßt uns nicht verzagen, die Heerscharen des Himmels sind mit uns! Euch, Gropper, sende ich sogleich Nachricht, wenn Thyreus bei mir eingetroffen ist. Und Euch, Herr von Stralendorf, sage ich noch dies: Ihr gehet jetzt einen schmählichen Gang, aber übers Jahr ziehet Ihr dennoch selbst in Heiligenstadt als Landeshauptmann ein!«
II. Kapitel.
Wo das Ohmgebirge, das im Osten des Eichsfeldes Grenze bildet, zum Tal des Flüßchens Hahle jäh hinabfällt, da erhob sich auf einer schroffen, kurz vorgestreckten Bergnase die uralte Burg Bodenstein. Wer über die Berge kam, der traf zunächst auf die Vorburg. Dort lagen die Wirtschaftsgebäude, die Gelasse für Knechte und Mägde, die Ställe für die Pferde, deren Ritter Barthold eine große Zahl hielt. Auch das Gebrumm der Rinder war zu vernehmen, und auf dem nur in der Mitte und längs der Gebäude gepflasterten Hofe wälzten sich grunzend unzählige Borstentiere, denen die ungeheuren Eichenwälder der Umgebung überreichliche Mast boten. Schon dieser Teil der Burg war stark befestigt durch einen breiten und tiefen Graben und eine mächtige Ringmauer, die hier und da ein stumpfer, kurzer Rundturm überragte. Nur ein starker und mit Geschütz wohl versehener Feind durfte hoffen, hier den Eingang zu erzwingen, und darum war es dem wilden Bauernheere, das vor achtundvierzig Jahren Thomas Münzer und Heinrich Pfeiffer vor die Burg geführt hatten, nicht gelungen, das Schloß zu stürmen. Mit blutigen Köpfen hatte sie Barthold von Wintzingerode, damals ein Jüngling, dem kaum der Bart sproßte, von seinen Mauern heimgeschickt. Das war die erste Waffentat des Ritters gewesen, und sie hatte den Ruf der Uneinnehmbarkeit, den der Bodenstein von altersher genoß, von neuem befestigt.
Drang aber auch wirklich ein Feind in diesen Teil des Schlosses ein, so waren die Herren der Burg noch keineswegs verloren. Sie brauchten sich dann nur über die Zugbrücke zurückzuziehen in die Hauptburg, die auf der vordersten steilen Felsgruppe gewaltig emporragte.
Hier, wo einst die wilden Sachsen dem Wodan ihre Opferfeuer entzündet hatten, stand seit mehr als fünfhundert Jahren eine Feste, die ihre Lage fast unüberwindlich machte. Nach drei Seiten fiel der Fels kirchturmtief glatt und steil ins Tal hinab, nach Norden zu in einer Terasse, die etwa dreißig Fuß unter dem Gipfel sich vorschob und durch eine ungeheure Ringmauer mit in den Kreis der Befestigungen eingeschlossen war. Von dieser Seite her mußte jeder feindliche Ansturm vergeblich sein. Nur von Süden her war es möglich, die Burg zu berennen, aber auch hier stellten sich dem Feinde die schwersten Hindernisse entgegen. Stand er dem Brückentor gegenüber, so gähnte zu seinen Füßen ein tiefer Felsengraben, und drüben starrten ihm zwei mächtige Türme entgegen, die links und rechts die Zugbrücke deckten. Wollte man die Burg stürmen, so blieb nichts anderes übrig, als zuvörderst in den Graben hinabzuklettern und dann mit Leitern die Mauern emporzuklimmen – ein schwierig Ding, denn Barthold von Wintzingerode verfügte über eine stattliche Schar von Feldschlangen und Wallbüchsen.
So war es denn kein Wunder, daß die von Wintzingerode mit stolzem Selbstgefühl auf ihre feste, unbezwingliche Burg hinblickten. Sie hatten im Laufe der mehr als zwei Jahrhunderte, seitdem sie das Schloß im Besitz hatten, schon manchem mächtigen Feinde hier Trotz geboten, und nie hatte ein feindlicher Fuß ihr Felsennest betreten. Längere Belagerungen hatten ebensowenig jemals zum Ziel geführt, wie plötzliche nächtliche Überfälle. Waren die Wintzingerode auch im Felde nicht immer glücklich, in ihrer festen Burg hatten sie stets eine sichere Zuflucht gefunden. Sie waren meist sehr fehdelustige Herren gewesen, denen das Schwert gar locker in der Scheide hing, und von jeher wenig gewillt sich zu beugen. Sie gingen bei vielen Herren zu Lehn, aber keinem bezeigten sie einen sonderlichen Respekt, und da sie behaupteten, ihr Stammgut Wintzingerode vom Reiche selbst zu Lehn zu tragen, und da ihnen niemand das Gegenteil beweisen konnte, so fühlten sie sich im Innersten den freien Reichsrittern und Dynasten gleich.
Der Stolzeste und Eigenwilligste aber von allen, die jemals vom Bodenstein als Herren ins Tal hinabgeblickt hatten, war der jetzige Besitzer der Burg, der Ritter Barthold von Wintzingerode. Er war jetzt fünfundsechzig Jahre alt, aber dem riesenstarken Manne, der das mächtige Haupt mit der Eulennase und den funkelnden Augen so aufrecht auf den breiten Schultern trug, merkte man nur an dem eisgrauen Barte an, daß er schon im Greisenalter stand. Der Schnitt des Bartes gab ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit dem alten sächsischen Bekennerkurfürsten Johann Friedrich, und das war des Ritters Stolz. Denn er war ein Rittmeister und treuer Diener dieses unglücklichen Fürsten gewesen. Eine breite, blutrote Narbe, die über die linke Stirnseite hinlief und sich unter dem dichten grauen Haupthaar verlor, zeugte für Zeit seines Lebens von seiner wilden Tapferkeit, die er im Dienste des Kurfürsten bei Mühlberg bewiesen hatte. Im übrigen hatte er in seinem Äußeren wenig von dem dicken, schwerfälligen Johann Friedrich, er war eher hager als beleibt, und alle seine Bewegungen waren rasch, jäh, eckig und herrisch.
Heute saß der Ritter im hohen, holzgetäfelten Gemach allein vor dem ungeheueren, wuchtigen Eichenholztisch, an dem die Familie mit ihren Gästen und den reisigen Knechten die Mahlzeiten einzunehmen pflegte. Es war ungefähr zehn Uhr vormittags, und das war eine frühe Tageszeit für einen, der bis nach Mitternacht beim Becher gesessen und im Trinken redlich seinen Mann gestanden hatte.
Denn zu Frau Käthes, des Ritters adeliger Hausfrau, heimlichem, aber großem Mißfallen war der gestrige Tag wieder einmal mit einem weidlichen Gelage zu Ende gegangen. Der Bodenstein beherbergte zur Zeit Gäste, soviele wie seit lange nicht. Seit fast zwei Wochen hielt sich in seinen Mauern der polnische Edelmann Casimir Kaminski auf, ein langer, bleicher, stets in tiefstes Schwarz gekleideter Mann mit einem unendlich hochmütigen Ausdruck in den verlebten Zügen. Wollte man seinen Worten trauen, so hatte er freilich alle Ursache, auf das gewöhnliche Menschenvolk voller Hochmut hinabzusehen. Denn er war ein Nekromant, er besaß die tiefste Einsicht in die geheimnisvollen Kräfte der Natur. Gold machen aus unedelm Metall, das konnte er nicht, wie er freimütig zugab. Dagegen war ihm das Geheimnis der Multiplikation aufgegangen, er konnte eine beliebige Masse Goldes verzehnfachen, ja, wenn die Sterne günstig waren, sogar um das hundertfache vermehren. Barthold hatte diesen Wundermann in Nordhausen kennen gelernt und ihn dringend gebeten, mit ihm auf den Bodenstein zu kommen und dort seine Kunst zu erproben. Nach einigem Sträuben war der Pole ihm willfährig geworden und hatte mit einem Diener Einzug in die Burg gehalten, während er den anderen Begleiter und seine Pferde in Nordhausen zurückgelassen hatte. Die Nacht des zwölften Tages im zwölften Monat, die zugleich den Vollmond bringen sollte, hatte er für überaus günstig erklärt und dem Ritter eingeschärft, bis dahin eine möglichst große Summe von Goldgulden zu beschaffen. Der Pole hauste mit seinem Diener in drei Zimmern des rechten Flügels, überdies war ihm noch ein Laboratorium eingerichtet worden in dem Obergeschosse des Kornhauses, das in die Ringmauer der Burg auf der Nordseite eingebaut war.
Der fremde Edelmann war jedermann im Schlosse, den Burgherrn allein ausgenommen, unheimlich, und Frau Käthe konnte nie ein Grauen unterdrücken, wenn sein bleiches Gesicht irgendwo auftauchte. Dagegen war gestern ein Gast in den Schloßhof eingeritten, den sie mit heller Freude begrüßt hatte. Das war der junge Ritter Heinrich von Bünau, ein entfernter Verwandter ihrer seligen Mutter. Schon seit mehreren Jahren war ihre älteste Tochter Anna ihm versprochen, und nächstes Frühjahr, an seinem sechsundzwanzigsten Geburtstage, sollte die Hochzeit sein. Der Junker war Frau Käthes erklärter Günstling und auch ihrem Gatten ein hochwillkommener Eidam, denn er war nicht nur begütert und von altem, edeln Geschlecht, sondern auch stattlich von Ansehen und von einem so hellen, freudigen, gehobenen Wesen, daß jeder fröhlich wurde in seiner Gegenwart, und daß ihn männiglich lieb hatte. Er wußte wohl, daß seine Erkorene zur Zeit in Mainz bei einer Patin und Erbtante weilte, die ihrem seligen Heimgang bei großer Leibesschwachheit entgegensah, und daß er sie also auf dem Bodenstein nicht vorfinden werde. Aber da er als Gesandter über das Eichsfeld zog, um dem Herzog von Grubenhagen eine Botschaft seines Kurfürsten zu überbringen, so hatte er den kleinen Umweg nicht gescheut und wollte auf der befreundeten Burg nächtigen. Sein Begleiter, der junge kurfürstliche Rat Doktor Neyher, hatte sich unschwer überreden lassen, von der geraden Heerstraße mit ihm abzuweichen. Er durfte annehmen, daß er als Bünaus Freund jedenfalls willkommen sei, und zudem war die Gastfreundschaft des Bodensteins im ganzen Lande fast sprüchwörtlich.
Sie wurden denn auch mit Freuden aufgenommen und mit allem bewirtet, was das Haus darbieten konnte. Frau Käthe erschöpfte sich dabei in Fragen nach dem Wohlergehen unzähliger Vettern und Basen im Sachsenlande, die sie seit Jahren nicht gesehen, und Bünau in seiner freundlichen und liebenswürdigen Weise stand ihr bereitwillig Rede und Antwort. Auch sein Reisegenosse wußte sich durch sein höfliches, vornehmes Wesen ihre Gunst zu erwerben, und mit mütterlichem Stolz bemerkte sie, daß ihre zweite Tochter Sophie, ein hübsches, frisches Kind von siebzehn Jahren, einen unverkennbaren Eindruck auf den hochgelehrten jungen Rat des Kurfürsten hervorbrachte. Was hatte sich aus solch zufälliger Bekanntschaft manchmal schon entsponnen! Wie oft hatten sie zu Verspruch, Brautstand und Hochzeit geführt! Und Reyher war gewiß nicht zu verachten, denn war er auch nicht von altem Adel, die Gunst des Kurfürsten erschloß ihm eine gute, vielleicht sogar glänzende Zukunft. Das Ehestiften galt damals in deutschen Landen für ein höchst löbliches und verdienstliches Werk, fürstliche Damen sahen darin eine ihrer wichtigsten Aufgaben – kein Wunder, daß der guten Edelfrau allsogleich der Gedanke kam, die beiden könnten wohl ein Paar werden. Sie hatte ja drei Töchter zu versorgen und unter die Haube zu bringen, deren jüngste freilich noch ein Kind war. Schade, daß die beiden Freunde nicht Herren ihrer Zeit waren und im Fürstendienste morgen schon weiterreisen mußten. Umsomehr erhoffte sie von dem traulichen Zusammensein am Abend im Familienkreise.
Ein tückisches Geschick aber durchkreuzte ihre Pläne. Denn beim Abendgrauen verkündete des Torwächters Horn das Herannahen neuer Gäste, und vier Ritter sprengten auf den Schloßhof. Es waren die Vettern Hans und Heinz von Westernhagen mit ihren erwachsenen Söhnen, sehr ehrenfeste und achtbare Herren, aber alle vier begabt mit ungewöhnlich trunkfesten Kehlen. Der dicke Heinz, der wie eine Tonne auf seinem unförmigen, breiten Schimmel saß, verkündete sogleich mit schallender Stimme, er sei gekommen, um den neuen Frankenwein zu probieren, von dem seines Wissens vorige Woche ein Fuder über Worbis eingetroffen sei, und der lange Hans, der ungern Worte machte, schielte sehnsüchtig nach dem Keller und strich bedeutungsvoll den spitzen, grauen Bart. Unter tiefem Seufzen gab Frau Käthe die schweren Trinkgefäße heraus, die für gewöhnlich in dem massiven, mit Schnitzwerk reich verzierten Prunkschrank aufbewahrt wurden. Sie hatte ja nichts gegen das Trinken der Männer einzuwenden, sie wußte, daß ein fester Ritter auch im Trunke seinen Mann stehen mußte, wollte er nicht als ein Schwächling den andern zum Gespött dienen. Sie hatte sich früher immer herzlich gefreut, wenn ihr erzählt wurde, wie wacker ihr Eheherr bei Landtagen und Festen sich beim Trunke gehalten, wie er anno sechzig zumal bei der Hochzeit des Grafen Günther von Schwarzburg sogar den bechergewaltigen Bürgermeister von Arttstadt unter den Tisch getrunken hatte. Sie wußte, daß er es auch jetzt noch mit dem Jüngsten aufnahm, aber bei seinen Jahren war ihr die Sache bedenklich. Hatte doch erst vor kurzem den trinkfrohen Grafen von Mansfeld, einen Altersgenossen ihres Ritters, mitten in einem großen Zechgelage ein Schlagfluß vom Leben zum Tode gebracht. Und nun mußten diese Westernhagen gerade heute in die Burg einfallen! Indessen als eine kluge Frau fügte sie sich mit Würde in das Unvermeidliche. Sie begrüßte, freilich mit etwas sauersüßer Miene, die ungeladenen Gäste, ließ den Herren wacker auftafeln und zog sich dann mit ihren Töchtern schleunigst in die Frauengemächer zurück. Denn wenn sie auch, wie alle ihresgleichen, einen derben Scherz gar wohl vertragen konnte, so hielt sie es doch für besser, daß Mädchenohren den Gesprächen der Männer beim Weine fern blieben. Der Zwang, den die Herren sich durch die Gegenwart der Frauen in ihren Reden auferlegten, war zumeist sehr gering.
Der Abend verlief dann, wie die Abende fast immer zu verlaufen pflegten, wenn rittermäßige Freunde zusammensaßen. Man trank einander unermeßliche Mengen zu, wurde lustig und lärmend, lachte und sang mit rauher Kehle. Der junge Westernhagen trug ein Spottlied vor auf Herzog Alba, den spanischen Hund, der eben durch seine Greueltaten in den Niederlanden den Haß aller Protestanten auf sich geladen hatte. Den Endreim sangen alle mit, indem sie dabei dröhnend und brüllend auf den Tisch hämmerten. Waren die Herren einmal verschiedener Meinung, so prasselten sie mit Worten heftig aufeinander los, und ihre gegenseitigen Bezeichnungen waren durchaus nicht schmeichelhaft. Aber die Eintracht ward bald wieder hergestellt und die Versöhnung durch einen gewaltigen Trunk besiegelt.
So hatte man um Mitternacht ein großes Faß des schweren, feurigen Frankenweins bis auf die Neige geleert. Die Folgen waren deutlich sichtbar, alle hatten einen guten Rausch. Aufrecht stehen konnten nur noch Barthold und der lange Hans von Westernhagen, der ernst und schweigsam bei weitem das meiste getrunken hatte. Heinz von Westernhagen lag mit einem glücklichen Lächeln neben seinem Stuhle auf dem Estrich und schnarchte. Er mußte von den Knechten in seine Kammer getragen werden. Auch die anderen bedurften gar sehr des Beistandes kundiger Diener, seine Lagerstätte hätte keiner allein gefunden!
Nun schliefen sie alle noch den Schlaf des Gerechten, obwohl der helle Schein der Morgensonne schon längst durch die kleinen grünlichen Butzenscheiben fiel. Nur Barthold hatte sich dem dicken Federpfühle entrungen und sich an den Frühstückstisch gesetzt. Da die andern nicht da waren und kein Mensch sagen konnte, wann sie erscheinen würden, so begann er, den guten Dingen zuzusprechen, die seine Hausfrau aufgetragen hatte. Sein Antlitz war etwas mehr gerötet als sonst, im übrigen war von dem scharfen Trunke der vergangenen Nacht nichts an ihm wahrzunehmen. Mit großem Eifer bearbeitete er den mächtigen Schinken, der vor ihm stand, und trank in starkem Zuge das wohlschmeckende Eierbier, das er früh besonders liebte.
Nach einer Weile erschien auch Hans von Westernhagen und begrüßte ihn mit einem Kopfnicken und einem kurzen, unwirschen Gebrumm, da er am Morgen nicht zu sprechen pflegte. Auch er widmete sich mit allem Eifer all dem Gesalzenen und Geräucherten, mit dem der Tisch besetzt war; beim ersten Bissen von einer großen Schlackwurst entfuhr ihm sogar ein kurzes Wort der Anerkennung.
»Ein tüchtig Weib ist Frau Käthe, das muß ihr der Neid lassen«, bemerkte er, indem er eine riesige Scheibe der Wurst in seinem großen Munde verschwinden ließ. Vielleicht hätte er kauend noch etwas zu ihrem Lobe hinzugefügt, aber er wurde unterbrochen, denn Bartholds alter Diener Jakob Holstein erschien in der Tür.
»Der Gestrenge hat befohlen, daß ich um zehn Uhr den gefangenen Geilhaus herführen soll«, meldete er.
»Richtig, das hatt' ich fast vergessen, so führe ihn mit dem Schreiber herein«, erwiderte sein Herr. »Ich will den Schuft heute seiner Haft entledigen«, wandte er sich erklärend an seinen Freund.
»Der Kerl hätte den Strang verdient«, bemerkte Westernhagen.
«Das hätte er. Aber noch einmal will ich ihm Gnade erweisen, das letzte Mal. Treffe ich ihn wieder auf meiner Wildbahn, dann gnade ihm Gott!«
»Gerade den ließe ich hängen, das ist ein gefährlicher Mensch. Ein Schwarmgeist, ein Winkelprophet. Habt schon von ihm gehört. Hast ja den Blutbann auf deinem Grunde«, entgegnete Westernhagen.
»Hätt' ich den Kerl auf frischer Tat ertappt, vielleicht hätt' ich ihn im Zorne niedergeschlagen. Du weißt ja, wie ich bin. Aber um einer Wildsau willen einen Menschen an den Galgen hängen und das Gewinsel seines Weibes mit anhören, das mag ich nicht. Er hat mit heute ein halb Jahr im Turm gesessen, das soll genug sein.«
»Ein absonderlich Blut, Ihr Wintzingerodes«, bemerkte Westernhagen. »Nach oben hart und starr, nach unten zu weich. Die meisten Menschen sind umgekehrt.«
»Milde gegen den armen Mann hat mich noch nie gereut«, erwiderte Barthold. »Warum konnte ich mit meiner Mutter selig allein gegen den Bundschuh mein Schloß halten? Weil keiner von meinen Leuten zu dem Münzer lief. Ich konnte mich auf sie verlassen. Ihr wart doch auch keine Memmen, aber Ihr mußtet Euch ducken, weil Ihr Eurer Leute nicht sicher waret.«
»Ja, ja«, sagte der andere verdrießlich, denn er hörte nicht gern von diesen Zeiten reden. »Das hast du schon hundertmal erzählt. Tu', was du willst. Mögs dich nicht gereuen.«
Indem wurde der Gefangene ins Zimmer geführt, ein hoch gewachsener Mann, dem das lange Haar und der verwilderte schwarze Bart unheimlich um das gelblich-bleiche, hagere Antlitz hingen. Hände und Füße waren mit starken eisernen Ketten beschwert. Seine Augen hielt er gesenkt, nur verstohlen flog ein stechender Blick hinüber zu dem Ritter, der hinter dem Tisch auf seinem Lehnstuhle saß.
»Arnold Geilhaus«, begann Barthold, »du sitzest mit dem heutigen Tage ein halbes Jahr in meinem Turme. Du weißt, daß ich dich richten könnte, denn wer zweimal auf fremder Wildbahn betroffen wird, hat den Strang verdient. Doch noch einmal, das letzte Mal will ich Gnade üben. Willst du beschwören, daß du dich nicht rächen willst weder an mir noch an den Meinen für die gerechte Strafe, die du für deine Missetat erlitten hast?«
Ein Blitz zuckte über das finstere Gesicht des Gefragten. »Ich will«, erwiderte er mit dumpfer, gepreßter Stimme.
»So nimm ihm die Ketten ab, Jakob!« befahl Barthold, »und du, Schreiber, sprich ihm den Eid vor.«
Es geschah. Beilhaus sprach den Eid der Urfehde nach. Das Schriftstück wurde gesiegelt, und da der Gefangene kein Siegel führte, so drückte Hans von Westernhagen sein Petschaft darauf zum Zeugnis dessen, was geschehen war.
»Nun erlöse mich von deiner Gegenwart. Jakob, führe ihn zur Burg hinaus. Doch halt!«, rief Barthold, als der Befreite nach der Tür zu schwankte. «Noch einen Rat gebe ich dir, Geilhaus, befolge ihn, wenn du klug bist. Lasse dich von meinen Vettern deines Eides entbinden, wenn auch die Försterstelle gut ist, die du in ihrem Dienste hast. Mache dich fort aus Wintzingerode, die Bodensteiner Luft ist dir nicht gut. Hüte dich, mir wieder zu begegnen, hüte dich!«
Geilhaus erwiederte nichts, und Jakob führte ihn zur Tür hinaus.
»Ein feiner Vogel, Herr Vater, den Ihr da habt fliegen lassen«, sagte Bünau im Hereintreten. »Der Kerl warf mir einen Blick zu – da lag die Hölle drin.«
»Blicke schaden nichts«, sagte Barthold gelassen. »Meinetwegen mag mich einer noch so giftig anstieren, darüber lach' ich nur. Geilhaus wird sich verteufelt hüten, mir noch einmal zu nahe zu kommen. Ich hoffe, daß wir die Bremse bald ganz aus der Gegend verlieren.«
Allmählig versammelte sich die ganze Familie mit ihren Gästen am Frühstückstisch. Nur der polnische Edelmann ließ sich entschuldigen, er hatte schweres Kopfweh, denn er trank zwar viel, vertrug aber nichts. Ebenso fehlte Heinz von Westernhagen, der aus seinem Bärenschlafe nicht zu erwecken war. Man beschloß, ihn ruhig liegen zu lassen; mochte er heimreiten, wenn er erwachte und es ihm gefällig war aufzustehen. Die andern rüsteten sich, den beiden Sachsen ein Stück Wegs das Geleite zu geben, denn für die war es die höchste Zeit geworden, abzureiten.
»Wenn im Mai der Bodenstein ein hochzeitlich Gewand trägt, so hoffe ich wieder Euer Gast zu sein. Freund Bünau will, daß ich einen seiner Brautführer abgebe«, sagte Reyher, als er auf dem Schloßhofe vom Pferd herab noch einmal der Schloßherrin die Hand zum Abschied reichte.
Frau Käthe nickte ihm lächelnd zu, »Ihr werdet stets auf dem Bodenstein willkommen sein, Herr Doktor«, sagte sie fröhlich.
»Und ich komme gern wieder hierher!« rief Reyher mit einem so sprechenden Blick auf die zur Seite stehende Sophie, daß ihr das Blut in die Wangen trat und sie sich verwirrt abwendete. »Einstweilen gehabt Euch wohl, hochedle Frau und Jungfrau. Gott halte Euch in seiner Hut!«
Donnernd sprengte der Zug über die Brücke, eine stattliche Reiterschar, denn es folgten ihnen noch zehn gewappnete Knechte mit blitzenden Stahlhauben und den Wintzingeroder weiß und roten Feldbinden. Barthold wollte seinen künftigen Schwiegersohn bis Heiligenstadt begleiten, wo er ohnehin mit einem Roßkamme zu handeln hatte, und kehrte vor Dunkelheit schwerlich heim. Deshalb erschien es ihm rätlich, nicht allein zu reiten, denn bei den unruhigen Zeiten war ein einzelner jederzeit einem Überfall ausgesetzt. Auch wußte er gar wohl, daß er da und dort in den Schlössern des Eichsfeldes manchen heimlichen Feind sitzen hatte. Begegnete er einem unversehens, so mochte es leicht zu einem Wortwechsel kommen und dann zu scharfem Schwertschlag.
III. Kapitel
Leise vor sich hinfluchend hatte der alte Knecht Jakob Holstein den finster blickenden Geilhaus bis ans äußerste Tor der Burg geleitet. Er mißbilligte die Milde gründlich, die sein Herr dem Gefangenen erwiesen hatte, und konnte es nicht verstehen, warum der gestrenge Ritter den Schuft nicht einfach hängen ließ. Anderswo stach man den Kerlen die Augen aus oder hetzte sie auf einen Hirsch geschmiedet zu Tode, die man bei einmaligem Wildfrevel ertappte – dieser Bursche, den man zum zweiten Male auf fremder Wildbahn ergriffen hatte, sollte mit lumpigen sechs Monaten davonkommen! War das erhört? Heiliges Kreuz! Ging da nicht alle Gerechtigkeit zum Teufel? War sein Herr ein altes Weib geworden, daß er solches Gelichter laufen ließ?
Jakob Holstein war ernstlich erzürnt und legte das auch dadurch an den Tag, daß er den Wilddieb nicht ruhig zum Tore hinausgehen ließ, sondern ihn mit Tritt und Faustschlag hinaus beförderte und dann das Tor krachend hinter ihm zuschlug. Solches war ihm zwar nicht befohlen, aber ein treuer Knecht tut auch einmal von selbst etwas Gutes.
Arnold Geilhaus raffte sich mühsam aus dem Schnee auf und wankte den Berg hinunter. Ihm war zumute wie einem Trunkenen. Er vermochte kaum noch zu gehen, denn er hatte ein halbes Jahr in der engen, halb dunkeln Gefängniszelle gesessen, wo er nur mühsam in seinen Ketten sich drehen und wenden konnte. Dazu hatten ihn Tag und Nacht die finstersten Gedanken gepeinigt. Zwar sein Weib und Kind wußte er versorgt. Sein Brotherr, Ritter Hans von Wintzingerode, war mit seinem Vetter, dem Bodensteiner, verfeindet, wenn auch zurzeit äußerlich Friede war. In seinem Dienste hatte er das Wild verfolgt, das in die Bodensteiner Waldungen hinüber gewechselt war, darum würde er sicher die unglückliche Familie seines Försters nicht im Stich lassen.
Um so trüber standen die Dinge für ihn selbst. Der Ritter, in dessen Hand er gefallen war, konnte ihn ohne weiteres hinrichten lassen, das wußte er wohl. Die von Wintzingerode hatten im Gericht Bodenstein das Recht über Leden und Tod, und die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. setzte die Todesstrafe auf sein Verbrechen. Jeden Tag, wenn sein Wärter ihm die karge Nahrung brachte, zitterte er für seinen Hals und meinte, man werde ihn zum Galgen hinausführen.
Allmählich war dann diese Furcht verschwunden. Hätte der Ritter seinen Tod gewollt, so hätte er nicht so lange mit seinem Urteil gezögert. Offenbar wollte man seines Lebens schonen, er sollte seine Tat im Kerker büßen. Aber wie lange würde das dauern? Wenn Barthold ihn jahrelang gefangen hielt, ja wenn er ihn im Kerker verfaulen ließ, so würde kein Hahn danach krähen. Eine Fürbitte seines Herrn würde nichts fruchten, und sonst würde sich niemand seiner annehmen; denn er war ein auf handhafter Tat ergriffener Verbrecher, und der Herr, der ihn strafte, war in seinem Recht.
Aber war das wirklich Recht, was da an ihm geübt wurde? Wenn die Bauern und die kleinen Leute dieser Gegend, in der er ein Fremdling war, des Abends beim brennenden Kienspan zusammensaßen, dann erzählte manchmal der oder jener von der Zeit, in der es geschienen hatte, als ob alle Rechte der Großen und Gewaltigen in den Staub sinken wollten. Scheu und verstohlen sprachen die ältesten Leute von dem, was damals geschehen war, wie die Herren von Adel alle so klein geworden wären, wie man die Schlösser und Klöster geplündert habe, und wie ein paar Wochen lang der arme Mann Herr gewesen wäre über all seine Bedrücker. Stolze, hochgebietende Grafen wären damals christliche Brüder geworden und hätten die zwölf Artikel beschworen. Diese zwölf Artikel hätten die Gerechtigkeit Gottes enthalten, daß Gott der Herr alle Menschen frei haben wolle, so daß nach seinem Willen keiner des andern Knecht sei, daß Wald und Weide, Jagd und Fischfang allen in gleicher Weise zu eigen sein sollten, und vieles andere mehr, was den Armen und Geringen wie der Gesang der himmlischen Heerscharen erklang. Obwohl Geilhaus das Kleid eines herrschaftlichen Jägers trug, hatte er solche Worte stets mit gierigen Ohren eingesogen, ja er hatte hin und wieder Leute aufgesucht, von denen er hoffen durfte, über diese Lehren mehr zu erfahren. In seinem Dorfe fand er sie nicht, denn die Untertanen derer von Wintzingerode hatten sich anno fünfundzwanzig an dem Aufruhr nicht beteiligt, und deshalb war ihre Ortschaft von der wütenden Pfeifferschen Rotte niedergebrannt werden. Sie klagten zwar auch über mancherlei Lasten, und wenn sie im Kruge zusammensaßen und sich am Dünnbier die Köpfe erhitzten, so schimpften sie wohl einmal über den gestrengen Junker, aber nur, wenn es ganz gewiß niemand hörte. Im allgemeinen herrschte bei einem gewissen Wohlstande unter mildem Regiment auch ziemliche Zufriedenheit bei den Hintersassen der Wintzingerode. Dagegen in Worbis und noch mehr in Duderstadt gab es manchen kümmerlichen kleinen Weber und manchen alten Handwerksgesellen, der einst als blutjunger Mensch mit im Kreise gestanden hatte, wenn Thomas Münzer predigte, und in dessen Seele die Erinnerung an den dämonischen Mann und seine Lehre noch nicht gestorben war. Manche erwarteten noch immer, daß seine Verkündigung wahr werden sollte, und hofften, das Kommen Gottes zum Gericht und den Anbruch des tausendjährigen Reiches nach der Ausrottung der Gottlosen zu erleben. Unter den Gottlosen verstanden diese Leute vornehmlich die Adligen, die Pfaffen und überhaupt alle, die reich und mächtig waren oder schienen.
Wie Feuerfunken in einem Haufen Zunder, so zündeten ihre Worte in Arnold Geilhaus´ Seele. Seiner wilden, trotzigen Natur war alles, was Dienstbarkeit und Untertänigkeit hieß, aufs höchste zuwider, er hatte schon manch bitteren Tag erlebt, weil er sich nicht beugen wollte, weil er manchmal vergaß, daß er ein geringer Knecht war. Nun bewies man ihm aus Gottes Wort, daß alle Menschen Brüder seien, und daß nach Jesu Christi ausdrücklichem Gebote keiner des anderen Meister und Herr sein sollte. Alle die harten Fronden, die auf dem armen Manne lasteten, alle die hohen Rechte, die sich die Mächtigen anmaßten, beruhten nur auf Schwert und Gewalt, nicht auf Gottes Willen, sondern Gott wollte sogar die Stolzen im ewigen Gerichte strafen, die sich über seine Kinder zu Herren aufwarfen. Bald war er nicht nur ein Anhänger, er wurde ein Prophet und heimlicher Verkünder dieser Lehren. Er gewann Anhang unter den kleinen Leuten in der Gegend, er war auf dem besten Wege, ein gefährlicher Aufwiegler und Hetzer zu werden. Die Kerkerhaft hatte seinen Trotz keineswegs gebrochen. Was hatte er denn getan, daß man ihn einsperren durfte und in Ketten warf wie ein wildes Tier? Ein Recht hatte er geübt, das jedem zustand, denn Gott hatte zu allen Menschen gesagt: Herrschet über alles Tier, das auf Erden kreucht. Und deshalb riß man ihn fort von Weib und Kind und ließ ihn hier unter der Erde liegen auf halbfaulem Stroh! Warum? Weil die Herren wider Gottes Wort allein haben wollten, was allen gehörte. Räuber und Diebe waren sie, wenn sie auch in stolzen Häusern wohnten und prunkvolle Wappen führten und Ehre genossen im ganzen Lande. Ein wütender Ingrimm gegen die Mächtigen, insbesondere gegen seinen Bedrücker, ein Haß, der sich nicht mit Worten aussprechen ließ, hatte sich immer tiefer in des Gefangenen Seele eingefressen.–
Nun war er frei. Die frische, schneidende Winterluft spielte in seinen Haaren und weitete seine Brust. Vor ihm lag die herrliche Landschaft im Glanze der Sonne. Von waldumgebenem Berge grüßte aus der Ferne seines Herrn Burg, der Scharfenstein, herüber, drunten im Tale sah er durch die kahlen Äste der Bäume die schmucken Häuser des Dorfes Wintzingerode schimmern. Einen Augenblick vergaß er all seinen Haß und seine wilden Rachegedanken. Ein jähes Glücksgefühl kam über ihn. Dort wohnten Weib und Kind, die würde er wiedersehen, sein schönes, junges Weib und sein liebes Kind! Der Bube, den er als Säugling zuletzt gesehen, mußte nun über ein Jahr alt sein, konnte wohl schon »Vater« sagen und schwankte ihm vielleicht auf ungeschickten Beinchen entgegen, wenn er heimkam.
Mit langen Schritten lief er den Berg hinab, ging durchs Dorf, ohne nach rechts und links zu blicken, immer nur das eine Ziel im Auge, sein Haus, das jenseits der Hahle lag.
Hochaufatmend von dem schnellen Laufe blieb er ein kurzes Weilchen stehen, als er vor der langen niederen Hütte stand, dann klinkte er leise die Tür auf.
Aber entsetzt taumelte er zurück, als hätte er einen schweren Schlag vor die Stirn erhalten. War das sein Weib, die da so krank mit bleichem, blutlosem Antlitz in den Linnen lag, seine Gertrud, die er so rosig und frisch zurückgelassen? Und da – in der Mitte des Zimmers – heiliger Gott – war es ein Blendwerk, was er sah? Da stand ein kleiner, plump gezimmerter Sarg, und ein abgezehrtes Kindergesicht lag still und friedlich mit wächsernen Zügen auf dem Kissen – sein Kind war tot.
Die Frau richtete sich mühsam in die Höhe und sah ihn an. Da stürzte er auf sie zu und sank vor dem ärmlichen Lager auf die Knie. Sie umfaßte mit den Armen sein Haupt und schluchzte laut auf.
»Gestern, ach Mann, wärst du gestern gekommen!« sagte sie leise mit müdem Tone. »Da hättest du den Kleinen noch einmal gesehen. Gestern mittag ging's zu Ende. Er hatte die Bräune, sie ist im ganzen Dorfe. Ich habe sie überstanden, aber das Kind war zu schwach.«
Geilhaus lag einige Augenblicke regungslos. Dann aber fuhr er mit einem heiseren Schrei in die Höhe. Sein Gesicht war von Wut verzerrt, seine Augen traten aus ihren Höhlen, und seine Hände spreizten sich krampfhaft aus, als wollte er sich auf jemand stürzen und ihn erwürgen.
»Hunde!« schrie er, »Mörder sind sie alle, alle! Und diesen Hund, der mich eingesperrt hat, daß ich mein Kind nicht sehen konnte in seiner Todesstunde, – ich erschieße den Hallunken, so wahr Gott lebt, ich schieße ihn nieder! Rache dieser Adelsbrut, Rache!«
»Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr«, sagte eine tiefe, klare Stimme hinter ihm. Geilhaus fuhr herum und sah einen Mann in geistlichem Gewand an der Tür stehen. Er blickte in ein paar freundliche und doch scharfe und durchdringende lichtbraune Augen und in ein Antlitz, das eine große Ähnlichkeit mit dem des seligen Doktor Martin Luther aufwies. Es war das Antlitz des Herrn Conrad Schneeganß, Pfarrers zu Kirchohmfeld und Wintzingerode.
»Hinaus!« schrie Geilhaus. »Pfaffengewäsch! Das fehlte mir noch! Hinaus!«
Seine Frau umklammerte ängstlich seine Hand, die er wie zum Schlage gegen den Pfarrer erhoben hatte. »Um Gottes willen, Mann, versündige dich nicht. Der Herr Pfarrer hat mich jeden Tag besucht und das Kind gepflegt, und seine Frau hat mir viel Gutes getan, ich wäre vielleicht ohne sie gestorben.«
Geilhaus ließ den Arm sinken und warf sich mürrisch auf einen Stuhl. »Stehts so, dann dank ich Euch, Herr Pfarrer. Aber nun laßt uns allein. Was wollt Ihr hier Worte machen, wo der Tod eingekehrt ist? Spart das Euch und uns!«
»Das Wort, das ich Euch bringe, ist nicht mein Wort, sondern das unseres Gottes. Ich spreche zu Euch im Namen dessen, der die Mühseligen und Beladenen erquicken will«, erwiderte der Pfarrer ernst und freundlich. »Ich kam vom Kirchhofe hinter Euch her und folgte Euch, weil ich glaubte, Ihr würdet nach dem Troste verlangen, den unser Heiland durch meinen Mund Euch bietet.«
Geilhaus lachte grell auf. »Da irrt Ihr, Herr. Altweibertrost will ich nicht. – Mich tröstet nur eins«, schrie er in neuausbrechender Wut, »und Gott soll mich verdammen, wenn ich mir diesen Trost nicht suche!«
Der Pfarrer blickte dem Rasenden traurig in das haßentstellte Gesicht und fragte dann ruhig: »Ihr wollt Euch an Herrn Barthold rächen?«
»Bei dem dreieinigen Gott, das will ich! Sein Blut über ihn!« knirschte Geilhaus.