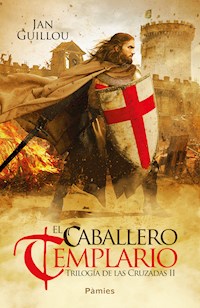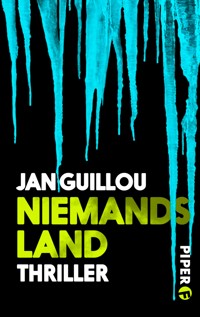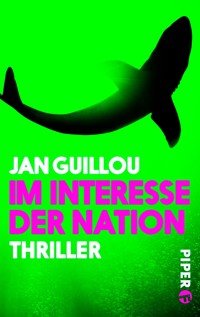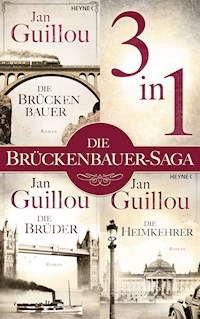4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf einem Parkplatz in Nordschweden wird ein Lkw-Fahrer ermordet. Die Obduktion ergibt, dass ihm das Muskelgift Curare injiziert worden sein muss, eine besonders beim KGB beliebte Tötungsmethode. Auch fehlen Teile der unbekannten Ladung. Graf Hamilton, Topagent des schwedischen Geheimdiensts, kommt bei seinen Nachforschungen einer groß angelegten Schmuggel-Aktion auf die Spur: Eine russische Atomrakete soll nach Libyen verschifft und dort für einen Anschlag auf die USA verwendet werden. Mit Unterstützung der Amerikaner plant Hamilton alias »Coq Rouge« einen Gegenschlag - ein weiterer brillant erzählter Thriller des schwedischen Bestsellerautors Jan Guillou.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hans-Joachim Maass
ISBN 978-3-492-98076-0 © für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © 1993 Jan Guillou Titel der schwedischen Originalausgabe: »Den enda segern«, Norstedts Förlag, Stockholm 1993 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1996 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © argus, federicofoto / shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 2. Auflage 2003 In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Prolog
Es dürfte nur selten nötig sein, einem Menschen die Haut abzuziehen. Dies jedoch war ein solcher Ausnahmefall.
Man würde nämlich erst dann an die Wahrheit herankommen, wenn man dem Verstorbenen, wie es im Jargon einiger Gerichtsmediziner hieß, das »Hautkostüm« abzog. Falls es überhaupt eine Wahrheit zu finden gab. Das konnte im voraus jedoch niemand wissen. Alles beruhte auf der, wie es schien, weit hergeholten Vermutung eines Kriminalinspektors in Norrbotten, den man sogar verdächtigen konnte, er verfolge nicht zuletzt seine eigenen Ziele. Diese Angelegenheit sei prestigegeladen, hieß es.
Rein technisch ist es nicht besonders schwierig, einen Menschen zu häuten. Die menschliche Haut ist fast völlig frei von Pelz und überdies relativ weich und geschmeidig. Die Schwierigkeit ist eher gefühlsmäßiger Art, und um das zu vermeiden, greift man gern zu passenden medizinischen Umschreibungen – so kann man die Prozedur beispielsweise »erweiterte gerichtsmedizinische Untersuchung« nennen. Für die Angehörigen, in diesem Fall eine junge Ehefrau und Eltern, ist es leichter zu erfahren, daß der geliebte Verblichene einer erweiterten gerichtsmedizinischen Untersuchung unterzogen worden ist, als zu hören, daß er wie ein Tier gehäutet wurde und danach nicht mehr wie ein Mensch aussieht, sondern wie eine Farbtafel aus einem Konversationslexikon.
Für einen Gerichtsmediziner gibt es bei diesem Vorgang keine besonderen Komplikationen. Es gehört zu seiner Arbeit, in bestimmten Fällen auch Menschen zu häuten, wenn dies zur Wahrheitsfindung beiträgt.
In diesem Fall war es tatsächlich so, wie sich nachträglich herausstellte. Und es war eine schauerliche Wahrheit. Zwei Nationen hätten in einen Krieg gegeneinander gestürzt werden können, was unweigerlich zum vollständigen Untergang der einen geführt hätte.
Dennoch ist dies nur eine der theoretischen Konsequenzen jener Wahrheit, die sich tatsächlich unter der Haut eines jungen Lastwagenfahrers aus Haparanda befand. Die Welt würde heute vermutlich anders aussehen, wenn man ihn nicht gehäutet hätte. Und die Tatsache, daß die Welt so aussieht wie heute, besonders in Washington, ist darauf zurückzuführen, daß man den Mann gehäutet hat.
Welche Schlußfolgerungen lassen sich daraus ziehen? Möglicherweise die, daß die Welt nicht unbedingt von Systemen gesteuert wird, die unsere Massenmedien als bis zur Trägheit stabil darstellen, die Mühlen der Demokratie und all das, sondern manchmal von reinen Zufällen. Ferner der Schluß, daß der ständige Strom von Informationen, das Nachrichtengeschnatter, mit dem wir alle leben, uns in falsche Sicherheit wiegt und die Vorstellung vermittelt, über alles Bescheid zu wissen, was geschieht, da es vor kurzem in der BBC oder bei CNN oder auch nur in Rapport zu sehen oder zu hören war.
Keiner dieser Nachrichtenkanäle erhielt je Kenntnis von den Folgen, die der Tod des jungen Lastwagenfahrers in der exotisch nördlichen Stadt Haparanda nach sich zog. Und es ist durchaus vorstellbar, daß es oft so ist, zumindest bedeutend häufiger, als man sich das bei CNN und Rapport vorstellt.
Und auch die beiden Männer, die mehr als jeder andere zu der folgenden Geschichte Anlaß gaben, ein Kriminalinspektor aus Haparanda und ein Gerichtsmediziner aus Umeå, erfuhren nie etwas von den Konsequenzen der unerwarteten Entdeckung, die sie schließlich unter der Haut des Toten machten.
1
Er lag eine Weile hellwach da und plante seine Flucht. Dann drehte er sich mit einer einzigen weichen, aber doch entschlossenen Bewegung aus dem Bett, blieb still stehen und vergewisserte sich, daß sie nichts gemerkt hatte. Ihr Atem ging gleichmäßig und ruhig.
Er schlich vorsichtig zu dem gustavianischen Stuhl, auf den er seine Kleidung geworfen hatte, nahm die Dinge an sich, die er brauchte, und war im nächsten Moment aus dem Zimmer verschwunden. Er zog die Tür ohne jedes Klicken des Schlosses zu, lehnte sich einen Augenblick gegen die Tür und atmete auf. Draußen in der Halle war es frisch, und der Schweiß kühlte seinen Körper. Er zog sich schnell an und ging die Treppe hinunter, wo er eine warme Jacke und gefütterte Stiefel aus dem Kleiderschrank holte, die Alarmanlage ausschaltete und dann in die Kälte hinaustrat.
Zu Weihnachten war tatsächlich ein wenig Schnee gekommen, nasser, matschiger Schnee, den ein spürbarer Südwind jetzt schmelzen ließ. Es wurde allmählich hell draußen. Er kam zu dem Schluß, daß es mit dem richtigen Zielfernrohr hell genug zum Schießen war, aber der Nebel verringerte die Sicht trotzdem auf weniger als hundert Meter. Er zog die daunengefütterte Polarjacke zu, zitterte leicht vor Kälte und ging langsam zum Hirschgehege hinunter. An der nächstgelegenen Futterstelle schreckte eine Gruppe von Hirschkühen und Kälbern auf, als er sich näherte. Die Leitkuh ließ einen Warnlaut hören, worauf alle wie Schatten im Nebel verschwanden. Ihre Schritte waren in dem matschigen Schnee zunächst deutlich zu hören, erstarben dann aber bald. Vielleicht waren sie auch stehengeblieben, um zu lauschen. Er prüfte mechanisch, aus welcher Richtung der Wind kam, und ging dann, gegen den Wind, auf die Mitte des Geheges zu. Dort befand sich ein mit Kiefern bewachsener Hügel, von dessen Kuppe man eine weite Aussicht auf ein paar halb mit Schnee bedeckte Felder mit Futterkohl und Futterpflanzen hatte. Er nahm sich vor, von dort eine Zeitlang nach den kapitalen Hirschen Ausschau zu halten; obwohl es seine Tiere waren, hatte er bisher kaum Zeit gehabt, sich mit ihnen vertraut zu machen.
Er wußte jedoch sehr wohl, daß es nicht darum ging. Das war nicht der Grund, weshalb er sich an diesem Weihnachtsmorgen davongestohlen hatte. Es kam ihm vor, als wollte er seine Rechtfertigung einüben oder wahr machen oder zumindest dafür sorgen, daß er absolut glaubwürdig lügen oder, noch besser, lügen konnte, ohne zu lügen.
Es ging jetzt um etwas ganz anderes: Einsamkeit, sein unwiderstehliches Bedürfnis nach Einsamkeit. Er wollte einige Zeit ohne Verstellung oder Theater zubringen. Åke und er hatten ein ganzes Weihnachtsfest lang Theater gespielt, an zwei sehr langen Tagen, an denen alles plötzlich und auf Kommando der Frauen mit militärischer Präzision hatte organisiert werden sollen. Was sie auch getan hatten. Sie hatten Lebensmittel und Getränke für ein ganzes Weihnachtsfest eingekauft und in weniger als fünf Stunden im Kofferraum ihrer Wagen verstaut. Danach war den Männern nur noch geblieben, in den Wald zu gehen und einen Weihnachtsbaum zu fällen. Tessie und Anna hatten es so entschieden, an Widerspruch war nicht zu denken. Wie hätten sie widersprechen sollen? Åke hatte vermutlich das gleiche Bedürfnis wie er selbst, sofort weit weg zu reisen, sehr weit weg zu einem warmen Meer mit weißen Stränden, Palmen und Piña coladas in Plastikgläsern, wohin auch immer, nur nicht an einen Ort, an dem Schnee lag.
Irgendwohin, wenn es nur ein Gegensatz zu der Polarnacht war, aus der sie vor kurzem gekommen waren.
Widerspruch war also unmöglich gewesen. Sie hatten ja nur einen langweiligen Routineauftrag in dem kalten nördlichen Finnland hinter sich, nichts Besonderes. Vor allem war es weder gewalttätig noch gefährlich gewesen, und jetzt hatten sie es hinter sich.
Er hatte Åke sehr sorgfältig beobachtet, als dieser seine Lügen erzählte, und war überzeugt, daß Alte es umgekehrt genauso gehalten hatte. Keiner von ihnen hatte mit einer Miene oder auch nur einer kleinen Andeutung etwas von dem ahnen lassen, was die Wahrheit hinter dem langweiligen Routineauftrag war.
Doch jetzt stand er hier, allein in der Morgendämmerung, und blickte auf leere weiße Felder voller Schneematsch und brauchte keine Maske mehr. Richtiger, er durfte keine Maske mehr haben. Jetzt würde er sie abreißen und zu verstehen versuchen, was er sah.
Die Weltgeschichte hatte auch andere Menschen erlebt, die genau das gleiche getan hatten wie sie selbst. Das war jedoch kein Trost, sondern gerade das unabweisbare Problem: Diese Menschen, Männer ihres Alters und mit vergleichbaren militärischen Dienstgraden, Männer von vielleicht dem gleichen Aussehen und auf jeden Fall aus dem gleichen Kulturkreis, hatten schwarze Uniformen getragen und das Totenkopf-Emblem an den Schirmmützen.
Sie hatten die gleichen Dinge getan. Wenn man es ganz konkret betrachtete, hatten er und Åke die gleichen Dinge getan wie manche SS-Verbände. Sie hatten wehrlose Menschen systematisch ermordet, ihnen die Kleider ausgezogen und sie in der polaren Kälte dann noch ein paar Stunden steif frieren lassen, um sie mit der Motorsäge leichter zerstückeln zu können. Anschließend hatten sie ein großes Feuer gemacht und …
Insoweit waren sie nicht besser als manche SS-Verbände, insoweit war mit Ausnahme der Uniformsymbole alles gleich.
Er sah die Bilder vor sich. Es war kein Traum. Er konnte alles sehr deutlich vor sich sehen, als hätte sich ihm jedes Detail ins Gedächtnis eingebrannt. Offene Augen, die geschrumpft und gebrochen waren, weil das Augensekret zu Eis gefroren war. Und anschließend der gesamte, mit Wasser gefüllte Glaskörper; dies bewirkte, daß die Augäpfel anschwollen und ein wenig aus den schützenden Höhlen drangen. Erstarrte Bärte und Haare, die verzerrten Körperhaltungen, der zischende Laut von Fett und Wasser in dem brüllenden Feuer, der schwarze, fette Rauch und dann natürlich der Geruch. Alles war da. Er war für immer an diese Erinnerungsbilder gekettet, und er würde nichts davon je verdrängen oder vergessen können.
Er hatte die Befehle dazu erteilt, jeden einzelnen Befehl. Und die Männer, die diese Befehle befolgt hatten, waren anständige schwedische Offiziere, junge Männer, die man in feierlichen Reden den Stolz der Streitkräfte zu nennen pflegte, die allerbesten. Sie hatten seinen Befehlen ohne zu zögern gehorcht, und wenn sie eine Rechtfertigung suchten, würde sie die altbekannte sein: Wir haben nur Befehle befolgt.
Doch dann würden sie sagen, daß es sich nicht um irgendwelche Befehle gehandelt habe. Wir sind keine Nazis, wir sind anständige schwedische Fallschirmjäger, und jeder Vergleich zwischen uns und diesen Leuten mit den schwarzen Uniformen und den Totenschädeln an den Mützen ist eine Beleidigung von uns und Schweden als Nation und der schwedischen Demokratie und blablabla.
Doch was konnte er selbst sagen? Was konnte er sich in der Einsamkeit selbst sagen, wenn niemand zuhörte, und was würde er einem Gericht sagen können?
Schon die Tatsache, daß er automatisch diese Unterscheidung machte, war entlarvend.
Nun, was konnte er also zu sich selbst sagen, um damit zu beginnen? »Da oben denkt man nicht. Wenn man denkt, stirbt man. Ich meine folgendes: Das war eine Operation, wir folgten sehr deutlichen und klaren Befehlen, die völlig unmißverständlich waren. Um ein solches Unternehmen durchzuführen, muß man sich vollkommen kalt verhalten. Alles andere wäre menschlich unmöglich. Denken kann man hinterher, aber im Augenblick des Handelns ist es unmöglich.«
Das stimmte. So war es gewesen. Doch was würde er vor Gericht sagen? Aber er würde nie vor ein Gericht gestellt werden, das war das eine. Die Sieger werden nie vor Gericht gestellt, weder in Nürnberg noch sonstwo.
Einmal hatte er wegen eines Verbrechens vor Gericht gestanden, das im Vergleich mit diesem eher als Bagatelle gelten konnte, das damals aber eine Katastrophe gewesen war und nach allen normalen menschlichen Maßstäben auch so gesehen werden mußte. Er hatte außerhalb des Dienstes einen Menschen getötet, zwar aus Versehen, aber immerhin.
Er hatte einen Verteidiger gehabt. Das Verfahren war geheim gewesen und hatte unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattgefunden. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, was der Anwalt gesagt hatte. Was es auch gewesen war, es hatte genügt, um einen Freispruch zu erreichen. Vielleicht war das Verfahren ein Bluff gewesen, ein von dem Alten oder einem anderen inszeniertes Theater, aber damals hatte er es tödlich ernst genommen.
Nun, aber jetzt? Was würde der Anwalt jetzt sagen?
»Mein Mandant hat auf Befehl gehandelt. Das befreit jedoch keinen Schweden davon, eine eigene Beurteilung vorzunehmen. Bei keiner Streitmacht des Westens kann die Tatsache, daß ein Befehl vorliegt, einen Soldaten von der eigenen Verantwortung befreien, da seit Nürnberg jeder verpflichtet ist, die Befehle, die er erhält, in eigener Verantwortung zu prüfen. Ein schwedischer Offizier kann ebenso wie ein amerikanischer, ein englischer oder ein französischer einen Befehl verweigern, wenn er überzeugt ist, daß dieser im Widerspruch zu den Gesetzen des Landes steht. Danach muß er vor einem Militärgericht nachweisen, daß er recht gehabt hat. Nun, ich möchte das Gericht jetzt darauf aufmerksam machen, daß der Befehl, den mein Mandant erhielt, kein x-beliebiger Befehl war. Und damit meine ich nicht nur den dramatischen, um nicht zu sagen drakonischen Inhalt des Befehls. Ich meine, daß es ein Befehl war, auf den sich die schwedische Regierung mit den Regierungen in Washington, Moskau und möglicherweise auch Helsinki geeinigt hatte. Die Präsidenten der beiden Supermächte, nun ja, der damaligen Supermächte, hatten sich mit dem Präsidenten der Republik Finnland und dem schwedischen Ministerpräsidenten geeinigt. Der Befehl wurde meinem Mandanten von seinem nächsthöheren Vorgesetzten erteilt, jedoch von dem schwedischen Verteidigungsminister bestätigt, und meinem Mandanten war vollkommen klar, daß alle beteiligten politischen Entscheidungsträger sich einig waren, blablabla.«
Ja, das Gericht würde ihn freisprechen. Kein Gericht der Welt würde ihn verurteilen können.
Er hörte Schritte, ein deutliches Knirschen in dem nassen Schnee. Drei große Hirsche schritten von einer fünfzig Meter entfernten Tannenschonung langsam auf die Äsung da draußen zu. Der größte ging als erster, dann kam der zweitgrößte. Sie sahen aus wie mythische Tiere, die magische Zahl drei in abnehmender Größe. Er zählte fasziniert die Geweihspitzen des größten Tiers und erkannte in diesem Moment, daß er den konkreten Anblick brauchte, um wahrheitsgemäß zu beschreiben, was er getan hatte. Er war sich nicht sicher. An der Spitze des Geweihs befanden sich vermutlich vier Enden auf jeder Seite, ein Vierzehnender also, ein großartiges Tier. Der letzte in der Reihe war ein Junghirsch. Die Rangordnung der Tiere war klar. Der Wind wehte ihm direkt ins Gesicht, und die Tiere würden ihn jetzt nicht entdecken können, wenn er sich nicht bewegte, jetzt, wo der CO, der commanding officer, zu dem Schluß gekommen war, daß die Luft rein war. Der kommandierende Offizier hatte einen Entschluß gefaßt, der unter bestimmten anderen Umständen zu ihrem Tod führen konnte. Die Verantwortung lag bei ihm.
Die Hirsche begannen ruhig zu äsen.
Aber was sollte er sich selbst sagen? Als Ausrede war es doch wohl reichlich schwach, amerikanische Schablonen anzuführen wie etwa »Da oben denkt man nicht. Wenn man denkt, stirbt man.« Immerhin war es sein Job zu denken. Aber was folgte daraus?
Er gab schnell auf, denn sehr viel mehr fiel ihm nicht ein. Es würde nie wieder geschehen, natürlich nicht. Das war das eine. Es ließ sich aber auch nicht ungeschehen machen. Es gab keinen Weg zurück. Das war das andere.
Aber irgendwo hatten Männer in Regierungsgebäuden gesessen und das Problem von allen Seiten beleuchtet, es gedreht und gewendet und sich systematisch zu einer Schlußfolgerung vorgearbeitet, die sie in die Worte »Zerstört alle menschlichen Gewebereste« gekleidet hatten. Das hatten sie dann Kollegen in ähnlichen Regierungsgebäuden mitgeteilt, und am Ende hatten sich alle geeinigt.
Sein eigener Chef, der jetzige Ministerpräsident, war einer dieser Männer gewesen. Er versuchte sich vorzustellen, wie der Ministerpräsident damals ausgesehen hatte – inzwischen kannte er ihn ja einigermaßen –, als er den Befehl bestätigte.
In einem Konferenzraum mit einem hellblauen Teppichboden und hellen Möbeln in gemaserter Birke hörte sich das sicher logisch an. Politisch korrekt. Realpolitik. Realismus und Vernunft. Die einzige Möglichkeit, den Willen des sowjetischen Präsidenten mit dem des amerikanischen in Übereinstimmung zu bringen.
Was hatten diese Männer gedacht? Was hatten sie vor sich gesehen, als sie sich auf die Formulierung geeinigt hatten »Zerstört alle menschlichen Gewebereste«?
An der Logik war nichts auszusetzen. Die Besorgnis des sowjetischen Präsidenten mußte man natürlich verstehen. Er sorgte sich um Publizität und Gerüchte. Natürlich hätte das Ganze zu einer Epidemie von Kernwaffenschmuggel führen können. Die Logik war kristallklar.
Aber was hatten diese Männer sich ganz konkret vorgestellt? Hatten sie geglaubt, es gäbe göttliche Maschinen, die man wie einen Zauberstab über Menschen hält, damit sie einfach schmerzlos in die Ewigkeit eingehen, ohne eine einzige körperliche Spur zurückzulassen, kein einziges intaktes DNA-Molekül?
Oder hatten sie geahnt, was geschehen würde, die unangenehmen Konsequenzen aber auf die Ebene eines einfachen Kapitäns zur See abgeladen?
In einem plötzlichen Anfall von Rachlust phantasierte er, den gesamten Vorgang auf Videofilm aufgenommen zu haben, Detail für Detail mit deutscher Gründlichkeit, um anschließend in Form einer Filmvorführung seinem Ministerpräsidenten und seinem Verteidigungsminister Bericht zu erstatten. Meine Herren, wie Sie sehen, haben wir exakt das getan, was Sie wollten. Wir haben Ihre Befehle bis aufs I-Tüpfelchen befolgt. Welche Medaillen bekommen wir für diesen heldenmütigen Einsatz?
Ein weiterer Hirsch trat aufs Feld hinaus. Er sah ungefähr wie der mittelgroße Hirsch der heiligen Prozession aus, die sich schon aufgelöst hatte. Die Tiere ästen jetzt friedlich. Der vierte Hirsch ging jedoch sehr merkwürdig und zog den rechten Hinterlauf hoch, als hätte er eine Beinverletzung oder schwere Bauchschmerzen. Er sah sehr menschlich aus.
Als das verletzte Tier den äußersten Rand der Äsung erreicht hatte, wurde es von den anderen entdeckt. Der größte Hirsch ging sofort zum Angriff über. Das verletzte Tier versuchte zu fliehen, lief aber zu unbeholfen, um entkommen zu können, und wurde von den anderen heftig gestoßen, zunächst von dem größten und dann sogar von dem kleinsten Hirsch, dessen noch unentwickeltes spitzes Geweih dem ausgegrenzten Tier den Bauch aufriß. Es zog sich dann mit größter Mühe in den Wald zurück.
Dieser Anblick riß Carl aus seinen Grübeleien. Er machte auf dem Absatz kehrt und ging mit entschlossenen Schritten zum Hof zurück. Die drei Hirsche draußen auf dem Feld hörten ihn sofort und flüchteten mit langen, eleganten Sprüngen in den Wald.
Als Carl gerade den Türgriff der Haustür berührte, wurde diese von innen geöffnet, und Åke Stålhandske kam heraus. Er war genauso gekleidet wie Carl.
»Vielen Dank für das Weihnachtsfest und alles Gute für die Zukunft«, sagte Åke, als er seine Verblüffung überwunden hatte.
»Oh, ich bedanke mich auch«, erwiderte Carl zögernd. »Schlafen Anna und Tessie noch?«
»Ja, ich glaube schon. Ich brauche etwas frische Luft.«
»Gut«, sagte Carl. »Warte hier, ich bin gleich wieder da.«
Er lief in den Keller und schloß einen seiner Waffenschränke auf Er entnahm ihm zwei passende Gewehre, riß eine Schachtel mit Munition an sich und ging mit langen Schritten die Treppe hinauf Åke Stålhandske wartete unruhig auf ihn; er hatte sich wohl vorgestellt, allein spazierengehen zu können.
»Hier«, sagte Carl, »nimm das hier. Wir haben etwas zu erledigen!«
Er warf Åke Stålhandske ein Gewehr mit Zielfernrohr zu. Dieser fing es mit einer Grimasse des Ekels auf, blieb wie versteinert stehen und betrachtete die Waffe, die er in den Händen hielt.
»Es geht um einen Hirsch, einen verletzten Hirsch«, erklärte Carl sachlich, als wäre es nichts Besonderes, obwohl er sehr wohl Zeit gehabt hatte, Alte Stålhandskes Gesichtsausdruck wahrzunehmen. Dieser erwiderte nichts, warf das Gewehr mechanisch über die Schulter und ging hinter Carl her, der sich schon in Bewegung gesetzt hatte.
Sie schwiegen, bis sie das Gehege erreicht hatten.
»Ein Mord aus Barmherzigkeit also«, sagte Åke Stålhandske tonlos.
»Nun ja, es ist schon ein Mord aus Barmherzigkeit«, erwiderte Carl mit einem Versuch, Åke Stålhandskes finnland-schwedischen Tonfall nachzuahmen. Ihm ging sofort auf, daß das kein gelungener Einfall war. Sie gingen schweigend Seite an Seite bis zu der Tannenschonung, an der Carl gestanden hatte. Dort blieb Carl unentschlossen stehen. Der schweigende Kamerad stand hinter ihm.
»Ich habe vorhin hier einen Hirsch gesehen, der schwer verletzt war. Wir müssen versuchen, ihm den Gnadenschuß zu geben«, sagte Carl weich.
»Den Gnadenschuß geben«, sagte Åke Stålhandske mit einem sarkastischen Tonfall, der nicht mißzuverstehen war. »Das ist doch eine euphemistische Umschreibung dafür, daß wir den armen Teufel ermorden sollen?«
»Nein«, entgegnete Carl behutsam, »das ist ein Jägerbegriff und bedeutet, daß wir ein verletztes Tier töten müssen, um seine Leiden abzukürzen. Wenn wir ihn jetzt nicht zu töten versuchen, wird er erst in einer Woche sterben und sich bis dahin entsetzlich quälen.«
Carl blickte kurz zur Seite. Er erkannte Åke Stålhandske nicht wieder. Der Mann hatte noch nie so ausgesehen, doch es fiel Carl nicht schwer, die Gründe zu verstehen. Åke war aus dem gleichen Grund wie er aus seinem Bett geflüchtet, um an die frische Luft zu kommen. Carl blieb noch eine Zeitlang schweigend stehen und wartete darauf; daß er noch etwas sagte.
»Und was sollen wir mit den tierischen Geweberesten anfangen?« fragte Alte Stålhandske schließlich.
»Das Tier häuten, zerlegen und aufessen«, erwiderte Carl mit zusammengebissenen Zähnen und abgewandtem Blick.
Dann drehte er sich um und sah seinem Freund, seinem neuerdings sehr engen Freund, in die Augen.
»Nun sag schon, Åke, was ist es? Alpträume?«
»Ja, das könnte man sagen.«
»Du siehst es noch vor dir, das Feuer und die Motorsäge und all das?«
»Ja.«
»Und du fragst dich, was zum Teufel eigentlich mit uns los ist?«
»Ja.«
»Und du fragst dich auch, ob auch wir schwarze Uniformen mit silbernen Totenschädeln an der Mütze hätten tragen können?«
»Ja. Genau das habe ich mir tatsächlich vorgestellt.«
»Und wie zum Teufel können wir dann zu unseren Frauen nach Hause gehen und Schweinebraten und Hering essen, Rollsülze und Schweinshaxen, und dann die Kerzen im Weihnachtsbaum anzünden und glücklich überrascht sein, wenn unsere Frauen sagen, sie erwarten ein Kind?«
»Ja, ungefähr so ist es.«
Carl seufzte und wandte sich ab, um nachzudenken. So etwas wie ein Instinkt sagte ihm, daß er selbst jetzt als kommandierender Offizier bestimmte Verpflichtungen hatte, die brutal und kurz ausgedrückt bedeuteten, daß er den untergebenen Major so schnell wie möglich in einen kampftauglichen Zustand versetzen mußte. Seine Vernunft sagte ihm, daß er dem anderen von seiner Angst erzählen mußte. Er folgte dem Instinkt.
»Was wir da oben getan haben, war nicht leicht«, begann er und wandte sich ihm plötzlich zu. Er sah seinem Freund und untergebenen Major, was immer es jetzt war, direkt in die Augen. »Das war wahrscheinlich einer der teuflischsten, vermutlich der teuflischste Befehl, den schwedische Offiziere seit der Großmachtszeit im siebzehnten Jahrhundert erhalten haben. Das wissen wir, und wir haben ihn befolgt!«
»Ja, das haben wir getan«, erwiderte Åke Stålhandske leise. Er erweckte den Eindruck, als wäre der größte Teil seiner ungeheuren Kraft aus ihm ausgelaufen. Carl überkam das absurde Gefühl, selbst gewachsen und größer geworden zu sein als der Zwei-Meter-Riese, der ihm gegenüberstand.
»Die Präsidenten der USA, der Sowjetunion und Finnlands sowie die schwedische Regierung hatten sich auf diesen Befehl geeinigt, und zwar im vollen Bewußtsein seines Inhalts«, fuhr Carl fort.
Åke Stålhandske antwortete nicht, sondern blickte Carl nur abwartend an, als wollte er die Fortsetzung hören.
»Das schließt alle diese Vorwürfe aus, wie sie in Nürnberg erhoben wurden«, fuhr Carl angestrengt fort. »Wir hatten also keine schwarzen Uniformen an. Wir hätten ebensogut die blauen Baskenmützen der UNO tragen können. Was die Frage der Legitimität angeht, gibt es keine Probleme.«
»Nein, zum Teufel, mit der Legitimität gibt es kein Problem«, erwiderte Åke Stålhandske mit einer sichtlich ironischen Grimasse.
»Mit der Legitimität sieht es natürlich glänzend aus. Man hätte aus diesem Grund sogar An die Freude spielen können.«
»Wie bitte?«
»Ja, das ist was von Beethoven, teuflisch schön.«
»Ach so, hm, aha. Bleibt noch das Menschliche, und das haben sie uns überlassen.«
»Und ob. Du verstehst dich teuflisch gut darauf, Theater zu spielen. Ich denke daran, du weißt schon, als erst Anna und dann Tessie … ja, als sie erzählten. Ich selbst hatte das Gefühl, als würde ich innerlich zerspringen. Du hast sie umarmt und bist dann in die Küche gegangen und hast Champagner geholt.«
»Und was ist, wenn ich genauso empfunden habe wie du?«
»Das hast du nicht getan. Du bist einfach losgegangen und hast Champagner geholt.«
Carl fühlte sich unentschlossen, als versuchte die Vernunft verzweifelt, seine Intuition einzuholen, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Er sah sich um und entdeckte in einiger Entfernung zwei Tannenstümpfe. Er machte eine Handbewegung, worauf sie hingingen, den Schnee abkratzten und sich setzten.
So blieben sie eine Weile sitzen, schwer nach vorn geneigt. Sie hatten die Gewehre automatisch so abgestellt, daß sie jederzeit schießen konnten.
»Theater gehört zu unserem Leben, ’Ike. Es fällt uns verdammt leicht, zu lügen und uns zu verstellen, aber das ist unser Job«, begann Carl in dem Glauben, eine logische Linie gefunden zu haben.
»Na ja«, erwiderte Åke Stålhandske schwer, »aber wer zum Teufel hat eigentlich gesagt, daß wir uns ausgerechnet vor den einzigen Menschen verstellen sollen, bei denen wir uns nicht verstellen dürften.«
»Würdest du Anna lieber die Wahrheit erzählen? Das kann doch nicht dein Ernst sein?«
»Doch, in gewisser Weise schon.«
»Mit Motorsägen und einem großen Feuer?«
»Nein, so natürlich nicht.«
»Und was bleibt? Das Ganze ist ja sehr einfach. Ich liebe Tessie. Ich würde nie wollen, daß sie das sieht, was wir getan haben, etwas, was nur wenige Menschen fertigbringen und sich vorstellen können. Du liebst Anna. Ihr wollt Kinder haben. Ihr seid glücklich. Ihr habt da draußen irgendwo neben den Heimlichkeiten unseres Jobs ein Leben, wie es alle Menschen haben können. Babynahrung, Säuglingsscheiße, die nicht wie richtige Scheiße riecht, alles.«
»Du bist so gottverdammt logisch.«
»Gibt es eine andere Rettung?«
»Nein, ich bin nur ganz allgemein ziemlich durcheinander im Kopf. Es gibt keine andere Lösung, aber leicht ist es nicht, weiß der Himmel.«
»Nein«, bestätigte Carl mit der ersten Andeutung eines feinen Lächelns, da er die Krise überwunden zu haben schien, »wer zum Teufel hat eigentlich gesagt, daß es leicht sein muß. Das haben sie nicht mal auf der Sunset Farm gesagt. Hast du denn Skip und seinen Ermahnungen nie geglaubt?«
Åke Stålhandske zeigte ein zögerndes Lächeln. Er sah fast verlegen aus. Die Krise schien tatsächlich vorbei zu sein.
Åke bat um Anweisungen. Carl zeigte ihm Windrichtung und Spuren, entschied, wo Åke sich in den Hinterhalt legen sollte, und wie er selbst den verletzten Hirsch aufscheuchen und treiben mußte.
Carl wartete eine Viertelstunde, bis er der Meinung war, daß Åke jetzt richtig stehen mußte. Dann ging er entschlossen und laut in der Spur des verletzten Hirschs. Er hielt das Gewehr schußbereit in der Armbeuge, falls das Tier plötzlich vor ihm auftauchte. Nach zehn Minuten hörte er einen Schuß, einen einzigen.
Als er den toten Hirsch erreichte, sah er reflexmäßig nach dem Treffer. Der Hirsch war hinter dem Ohr getroffen worden. Das Einschußloch war kleiner als ein halber Dollarschein. Und das aus einem Abstand von mehr als hundertfünfzig Metern.
Kriminalinspektor Eino Niemi graute vor dem Telefongespräch, das er unweigerlich würde führen müssen. Er hatte die ganze Zeit gezetert, daß es Mord sein müsse, und der Mann, der jetzt zu behaupten schien, daß er unrecht hatte, trug unglücklicherweise einen Professorentitel und hatte einen besorgniserregend reichsschwedischen Namen und kam sicher weit aus dem Süden. Solche Menschen hörten sich ungefähr wie Politiker bei Fernsehdebatten an und schienen ebensowenig gewillt zu sein, Argumente eines kleinen Polizisten vom Lande anzuerkennen.
Er starrte feindselig auf das eigenartig geformte R am oberen Rand des Briefpapiers des Gerichtsmedizinischen Zentralamts, und plötzlich ging ihm auf, daß es eine Schlange symbolisierte. Aus diesem Grund war der Buchstabe unvollständig.
Er entfloh dem Anblick der Dokumente und sah aus dem Fenster. Der Fluß war noch nicht ganz zugefroren. Dort hinten sah er einen breiten Streifen offenen Wassers, auf finnischem Territorium. Der Park vor dem Polizeigebäude war bis zum Strand hinunter leer. Kein Mensch war zu sehen. Es war immerhin einer der Tage, an denen Schweden stillsteht. Weihnachten.
Vor vier Tagen hatte das Ganze wie eine große Sache ausgesehen, wie ein schweres Verbrechen. Nach zwei Tagen hatte es sich jedoch in einen Multbeerendiebstahl verwandelt, was zumindest in Tornedalen als eher leichtes Vergehen angesehen werden kann. Folglich hatte der Polizeidirektor die meisten Leute von dem Fall abgezogen und sich damit begnügt, bis auf weiteres nur einen Mann auf die Angelegenheit anzusetzen, Eino Niemi.
Dieser hatte den Verdacht, daß die Sache möglicherweise mit den beiden verschwundenen Jungen von den Kukkola-Stromschnellen zu tun hatte. Die Zeitungen hatten viel darüber geschrieben und wie üblich die Frage gestellt: Was tut eigentlich die Polizei? Die Beamten der Abteilung, die nicht Weihnachten feierten, suchten in einem der größten Polizeibezirke Schwedens nach einem verschwundenen Wagen mit zwei Jungen.
Der Anlaß für den Abzug der Beamten waren also die Dokumente, die auf der im übrigen weihnachtlich leergefegten Schreibtischplatte vor ihm lagen, wenn man von Zeitungen und Weihnachten und derlei absah, was sich unter dem Begriff menschlicher Faktor zusammenfassen ließ. Ein gelber Zettel, vom Polizeidirektor mit eigener Hand beschrieben, hatte die Dokumente bis auf Eino Niemis Schreibtisch begleitet. Die Mitteilung war von lakonischer Kürze:
Da Holma an plötzlichem Kindstod gestorben zu sein scheint, bleibt noch der eigentliche Diebstahl.
Erledige das nach Weihnachten. Schöne Feiertage.
Im Gutachten des Pathologen stand jedoch nichts von plötzlichem Kindstod, jedenfalls nicht ausdrücklich und im Klartext. Falls der Polizeidirektor nicht irgendeine Zusatzinformation am Telefon erhalten hatte, sozusagen von Südschwede zu Südschwede, mußte es also möglich sein, den Sachverhalt dem Obduktionsbericht zu entnehmen.
Eino Niemi schnippte ein paarmal unentschlossen mit seinem Kugelschreiber, bevor er mit einer seltsamen Mischung aus Entschlossenheit und Resignation erneut zu lesen begann, diesmal, um alles aufzuschreiben, was er nicht verstand oder wonach er sich erkundigen mußte. Strenggenommen verstieß er jetzt gegen ausdrückliche Anweisungen, da er einen Diebstahl einiger Kartons mit Multbeeren aufklären sollte, einen Fall von geringer Bedeutung, und keinen eventuellen Mord, der sich als plötzlicher Kindstod erwiesen hatte. Falls ein Mann, der dreißig Jahre alt war, überhaupt an so etwas sterben konnte, was immer es war.
Eino Niemi begann von vorn, las langsam und versuchte alle Details zu ordnen.
Die Identität der Leiche sei durch einen Namenszettel geklärt, der am Körper befestigt sei, hieß es gleich zu Anfang. War es denkbar, daß sie die falsche Person obduziert hatten?
Er notierte sich die Frage, strich sie dann aber durch. Es war zu dumm.
Punkt 4. An der Unterseite der Schenkel und der Gesäßmuskulatur sind ziemlich dunkle, blaulila Leichenflecke zu sehen.
Warum stand dort »ziemlich dunkle«? Wie sahen Leichenflecken sonst aus, und was würde eine Farbabweichung eventuell bedeuten?
Er notierte sich die Fragen und nickte vor sich hin. Zumindest brauchte er kein Idiot zu sein, um danach zu fragen.
Punkt 7. Im Mund befinden sich eigene, sanierte Zähne. Im vorderen Teil des Mundes farbloser Schleim. Hinten im Mund sind kleinere Mengen halbverdauten Mageninhalts zu sehen.
Mageninhalt, kein Essen, etwas, was Essen gewesen war und dann halbverdaut wieder hochgekommen war. Kurz, hatte der Mann sich etwa übergeben?
Punkt 21. Die Lungen sind etwas schwerer und stärker mit Flüssigkeit gefüllt als normal, von etwas reduzierter Elastizität und dunkler, blaulila Farbe. Unter dem Lungenfell sind mehrere, bis 0,2cm im Durchmesser große, blaurote aderähnliche Verästelungen zu sehen. An den Schnittflächen lassen sich kleine bis mäßige Mengen einer schäumenden Flüssigkeit hervorpressen sowie reichliche Mengen dunkelblauen, leicht fließenden Bluts. Überdies tritt aus beschnittenen feineren Bronchien trübes, halbflüssiges Material aus. Herdförmige Veränderungen sind nicht zu erkennen.
Eino Niemi saß eine Zeitlang da und schnippte die Spitze des Kugelschreibers mal hinein, mal heraus. Diesen Lungen ging es offensichtlich nicht gut. Blaurote blutende Verästelungen, dunkelblaues, leicht fließendes Blut und außerdem – das Wort deutete ja darauf hin, daß hier etwas zusätzlich zu finden war – halbflüssiges Material.
Die Frage, die er hier zu Papier bringen mußte, war vielleicht einfacher, als es den Anschein hatte: Wie ging es den Lungen? Ist der Mann erstickt?
Punkt 24 beschrieb das Herz. Es schien über längere Textpassagen hinweg ein normales, ordentliches Herz eines jungen Mannes aus dem Tornedalen zu sein, bis ein aber auftauchte:
Die inneren Schleimhäute sind normal, aber unter ihnen finden sich über der Lappentrennwand im linken Lungenlappen fleckenweise vorkommende, frische, dünne Verästelungen von Blut in einem insgesamt etwa drei Zentimeter langen und zwei Zentimeter breiten Feld.
Im übrigen schien das Herz in gutem Zustand gewesen zu sein. In den Herzkranzgefäßen war nichts von Verkalkung zu sehen, und die Herzmuskulatur war fest, ohne jedes Anzeichen von was auch immer und von normaler Farbe.
Der Kugelschreiber schnippte wieder, und Eino Niemi nahm eine neue Prise Schnupftabak. Aber hier gab es irgendwelche Blutflecken an einer Stelle, die Lappentrennwand genannt wurde. Dieses Aber bedeutete etwas Anomales. Welche Frage sollte er dazu stellen? Hatten die anomalen Blutflecken im Herzen irgendeinen Zusammenhang mit blauem und anomalem Blut in den Lungen und den Blutflecken dort?
Er las weiter, erfuhr etwas über verschiedene Organe, die entweder ohne Befund oder glatt und glänzend waren, hielt beim Bauchteil der großen Körperschlagader inne, da, wie es hieß, sie »einzelne, weiche, gelbe Ablagerungen an den Wänden« aufwies. Das klang nicht sonderlich aufgeregt, und Eino Niemi versuchte sich vorzustellen, daß ein dreißigjähriger Mann nur ein paar vereinzelte gelbe und überdies weiche Ablagerungen an den Aderwänden hatte, und zwar an den Stellen, die zwanzig Jahre später verkalken und das letzte Kapitel im Leben einleiten würden.
Da die Schnittflächen der Nebennieren »normal« waren, setzte er die Lektüre fort und übersprang auch die Fettkapseln der Nieren, die »normal entwickelt« waren. Er konnte es recht deutlich vor sich sehen. Das Ganze sah vermutlich wie bei Elchen aus, wenngleich kleiner. Die Milz war »glänzend«, und bei einem Leberschnitt »zeigte das Messer keinen Fettbelag«, was er als etwas Positives deutete. Eine große Zahl der Menschen, mit denen er es als Polizeibeamter des Tornedalen im Dezernat für Gewaltverbrechen zu tun gehabt hatte, hatte vermutlich fettere Lebern gehabt.
Nach einer normalen Gallenblase und einer Bauchspeicheldrüse, »deren Schnittflächen keine der üblichen Veränderungen« aufwiesen, hielt er bei Punkt 32. inne, bei dem es um den Mageninhalt ging. Der Magen sollte »etwa 150ml einer recht gut durchgekauten und halbverdauten Nahrung« enthalten haben, »von der Fleischfasern und Erbsenschalen nachgewiesen worden sind«. Im übrigen schien auch der Magen in gutem Zustand gewesen zu sein, wie Eino Niemi vermutete, da kurz vermerkt war, daß von Wunden oder Narben nichts zu sehen sei.
Die letzte Mahlzeit hatte also aus Fleisch und Erbsen bestanden.
Gegen Endes des Protokolls wurde beschrieben, wie weitere Proben entnommen worden waren, um für nähere Laboranalysen weggeschickt zu werden. Es handelte sich um Blut und Mageninhalt, um Urin, Leberstücke und einige Muskelproben. Anschließend folgte ein Verzeichnis verschiedener Gewichte. Das gesamte Körpergewicht und das Gewicht von Gehirn, Lungen, Leber, Milz und so weiter.
Nach eingehender Untersuchung festgestellt, nach bestem Wissen und Gewissen diktiert und von dem Südschweden mit Professorentitel bezeugt. Ein weiblicher Name bestätigte, daß alles nach Diktaphon richtig abgeschrieben worden war.
Eino Niemi blieb eine Weile sitzen und versuchte, sich das Ganze vorzustellen. Er hatte schon lange keine Obduktion mehr gesehen, nicht mehr seit der Polizeischule unten in Stockholm. Wenn die Ärzte jedoch keine Zeugen hatten, waren vielleicht auch sie etwas leichtsinniger und weniger pädagogisch, außerdem war es vor Weihnachten gewesen. Möglicherweise hatten sie über verschiedene Dinge gesprochen, die sie noch rechtzeitig erledigen wollten.
Nein, Eino Niemi schob diese Überlegung beiseite. Ein Pathologe war wohl nicht besser oder schlechter als andere Menschen, und wenn man kurz vor dem Weihnachtsurlaub einen Job zu erledigen hat, möchte man ihn am liebsten korrekt erledigen, um nichts wiederholen zu müssen. So hätte er es zumindest selbst empfunden, und so hatte er auch reagiert, als das, was zunächst eine Ermittlung in einem Mordfall zu werden schien, anfing.
Er hatte den jungen Lasse Holma ein wenig gekannt. Dieser war weder besonders helle noch besonders dämlich gewesen, war irgendwann einmal betrunken in eine Schlägerei verwickelt und festgenommen worden. Aber falls das in dieser Gegend als verdächtig galt, würde man eine große Zahl von Mitbürgern unter die Lupe nehmen müssen. Lasse Holma war wohl weder besser noch schlechter gewesen als sonst jemand, doch jetzt war er tot.
Jemand hatte ihn ermordet, möglicherweise durch Vortäuschung eines »plötzlichen Kindstods«, davon war Eino Niemi überzeugt. Er war zwar nur Polizist, und seine Allgemeinbildung war in medizinischer Hinsicht allerhöchstens mäßig, aber selbst seine ganz normale polizeiliche Erfahrung protestierte entschieden. Ein plötzlicher Kindstod mußte bei Lastwagenfahrern der 90-Kilo-Klasse mit im übrigen glatten Organen und allem Drum und Dran extrem ungewöhnlich sein. Extrem ungewöhnlich dürfte auch der vermeintliche Raubüberfall auf eine Multbeerenlieferung gewesen sein, oder, wenn er seinen Auftrag jetzt dienstlich sah, der Diebstahl von Multbeeren in Verbindung mit einem rätselhaften plötzlichen Kindstod.
Das Problem war, daß die medizinische Wissenschaft es anders sah, denn für sie galten nur objektive Wahrheiten.
Dem Obduktionsbericht war ein Fax beigefügt, Absender Gerichtschemisches Labor in Linköping. Man brauchte kein Chemiker zu sein, um es zu lesen, da es ebenso kurz wie klar formuliert war.
Auf Verlangen des Gerichtsmedizinischen Instituts in Umeå, wohin man den Verstorbenen von Haparanda zur Obduktion verfrachtet hatte, hatte das staatliche Gerichtschemische Labor einige Proben von Schenkel- und Herzblut analysiert. Es enthielt weder Arzneimittelspuren noch Morphin, Kodein, Amphetamin, auch-kein Tetrahydrocannabinol oder Alkohol.
Die wissenschaftliche Wahrheit schien mit anderen Worten einfach zu sein.
Lasse Holma, ein kräftig gebauter und nach wissenschaftlicher Untersuchung normaler dreißigjähriger Lastwagenfahrer ohne erkennbare Gebrechen und ohne jedes Gift im Körper, denn er hatte nicht einmal ein Bier getrunken, hält seinen Lastwagen an. Parkt sorgfältig auf einem Parkplatz. Anschließend stirbt er an plötzlichem Kindstod, und es gibt keinen Grund, ein Verbrechen zu vermuten.
Das war die wissenschaftliche Wahrheit, und wie wahr sie auch sein mochte, so war sie unsinnig.
Eino Niemi starrte sein stummes Telefon mißbilligend an. Erstens war es kein Tag für Telefongespräche. Zweitens ging es darum, irgendeinen Professor anzurufen und ihm Fragen zu stellen, die sich mal klug, mal kindisch und dumm anhören würden, und dennoch würden die dummen und vielleicht weniger dummen Fragen in Wahrheit nur andeuten, daß der Professor sich irgendwo geirrt haben mußte.
Wenn der Professor erst einmal richtig wütend wurde, würde er den Polizeidirektor anrufen, einen Mann aus Östergötland, und dieser würde einen gewissen Kriminalinspektor Niemi zu sich zitieren und ihn fragen, was zum Teufel es damit auf sich habe, den Professor an einem Feiertag wegen etwas zu stören, was nichts mit jenem Multbeerendiebstahl zu tun haben könne, und weshalb ein solcher Diebstahl ausgerechnet über Weihnachten mit solcher Eile untersucht werden müsse. Vielleicht würde der Polizeidirektor noch einiges anderes fragen.
Eino Niemi wollte nicht anrufen. Er stand auf, machte die Schreibtischlampe aus und ging zum Parkplatz hinunter. Er hatte seinen Notizblock und den Kugelschreiber mitgenommen, warf sie neben sich auf den Beifahrersitz und fuhr dann das kurze Stück am Fluß entlang zum Zoll.
Hier war Lasse Holma mit seinem Fernlaster der Firma NORRFRYS vorbeigekommen. Sogar die exakte Uhrzeit war bekannt. Vom Zollgebäude aus waren es nur wenige hundert Meter bis zum Kreisverkehr an der E 4, und bis dort konnte man nirgends abbiegen, wenn man zu NORRFRYS unten an der Bahnstation am Südende der Stadt wollte.
Lasse Holma hatte jedoch nicht den selbstverständlichen Weg gewählt. Er war nicht vom Kreisverkehr aus nach Süden durch die Stadt und an der Västra Esplanaden zur Järnvägsgatan und dann nach rechts gefahren. Er war auf der E 4 in Richtung Luleå weitergefahren.
Daran war eigentlich nichts merkwürdig. Besonders, wenn man im Winter und bei Schneeverwehungen einen großen schweren Fernlaster mit Anhänger fuhr, den man in der Stadt nur schwer bewegen konnte, konnte man ebensogut eine Runde über die E 4 drehen und über das südliche Gewerbegebiet fahren. Dieser Tatsache war vielleicht noch niemand auf den Grund gegangen, aber Eino Niemi kam es plausibel vor, daß dies im Winter die häufigste Route der Fahrer war.
Am Kreisverkehr schaltete er seinen Tageskilometerzähler ein und fuhr auf der Straße weiter, auf der auch der Laster gefahren sein mußte. Schon nach einigen hundert Metern war er unschlüssig, was er überhaupt untersuchen sollte.
Sagen wir, du bist von Murmansk bis hierher gefahren, achthundertzwanzig Kilometer, sagte er zu sich selbst. Du hast achthundertzwanzig Kilometer hinter dir und fühlst dich ganz mies oder entdeckst gerade, daß dir schlecht wird.
Du sollst nämlich schon bald eines plötzlichen Kindstodes sterben, knurrte er zwischen zusammengebissenen Zähnen.
Nun, hier kommst du. Jetzt wollen wir mal sehen, wie lange du noch fahren mußt.
Er fuhr an dem Parkplatz vorbei, auf dem der Fernlaster gestanden hatte, und fuhr dann langsam weiter, während er sich die einzig denkbare Fahrtroute zu den Büros und Lagergebäuden von NORRFRYS unten am Bahnhof notierte. Er fuhr langsam, als säße er am Steuer eines Fernlasters im Schneematsch, falls das irgendeine Bedeutung hatte, und notierte zunächst vierhundert Meter vom Tatort zur Eisenbahnbrücke, dann wieder ein paar hundert Meter, bis links in Richtung Süden eine Kurve kam, um dann wieder in Richtung Stadt zu fahren. Die Hinweisschilder wiesen auf das Freizeitgelände Grankullen und das südliche Gewerbegebiet hin.
Als er erneut links abbiegen mußte, um zum Gewerbegebiet und wieder in die Stadtmitte zu kommen, notierte er eine Entfernung von 1,5Kilometern vom Tatort; er entschloß sich, den Schauplatz des Mordes vorläufig als Tatort zu bezeichnen. Falls es ein Mord war, wußte er nicht, wo er begangen worden war. Dagegen stand fest, wo die Multbeeren gestohlen worden waren.
Als er auf der Köpmangatan so weit gefahren war, daß er unweigerlich nach rechts um die moderne, eigenartige Holzkirche herumfahren mußte, um auf die Östra Kyrkogatan zu kommen, befand er sich 2,3Kilometer vom Tatort entfernt.
Danach gab es nur eine mögliche Route, nämlich ein paar hundert Meter auf der Tingshusgatan, und dann war er da. Der Tageskilometer zeigte 3,6Kilometer.
Was hatte er nun aus all dem gelernt und verstanden? Daß es von hier bis zum Tatort 3,6Kilometer waren?
Das niedrige Bürogebäude von NORRFRYS aus braunen Klinkern war natürlich geschlossen. Die braun-weiß gestreiften Markisen über den Fenstern sahen trotz des Schnees, der auf ihnen lag, auffallend sommerlich aus. In den Fenstern standen elektrische Weihnachtsleuchter in Pyramidenform. Die rund zwanzig Stellplätze auf dem Parkplatz waren leer. Die blauen, barackenähnlichen Lagergebäude von NORRFRYS waren geschlossen. Kein Mensch war zu sehen.
Er fragte sich, ob er nicht einfach zu Frau und Kindern nach Hause fahren sollte, um sich mit ein paar Bieren vor den Fernseher zu setzen und auf alles zu pfeifen, vor allem auf sich selbst. Jetzt hatte er gerade eine Fahrt hinter sich, die der Ermordete, dem Pathologen zufolge der auf rätselhafte Weise Umgekommene, nicht gefahren war. Ob es sehr intelligent war, solche Experimente durchzuführen, schien ihm äußerst zweifelhaft.
Eino Niemi hatte sorgfältig ermittelt, daß der Tatort sich 3,6Kilometer von dem vermuteten Bestimmungsort des Lastwagens entfernt befand. Na und?
Außerdem fing die Windschutzscheibe an zu beschlagen. Der Ventilator schien nicht in Ordnung zu sein. Eino Niemi legte den ersten Gang ein und fuhr durch die Stadt wieder nach Norden, auf dem Weg, den die Lastwagenfahrer vielleicht im Sommer nahmen, an der Västra Esplanaden entlang, an einer geschlossenen Schule vorbei und einem hellblauen, erleuchteten Bethaus. Kurz darauf war er wieder oben am Kreisverkehr.
Hier zweigten mehrere Straßen ab. Um nach Hause zu kommen, mußte er direkt nach Norden in Richtung Mattila fahren. Statt dessen drehte er jedoch eine langsame Runde, dann noch eine und noch eine dritte. Dann fuhr er nach Osten. Exakt 1,1Kilometer, lächelte er höhnisch vor sich hin und hielt an der Parkbucht auf der rechten Seite, die unleugbar ein möglicher Tatort war. Er stellte den Motor ab und stieg aus.
Es ging allmählich auf zwei Uhr nachmittags zu, und es war schon fast völlig dunkel.
Von einer schönen Aussicht konnte keine Rede sein. Wenn er an der Straße entlang schräg nach Westen blickte, waren nur vier graue Holzschuppen zu sehen, die draußen auf einem großen, verschneiten Feld standen, und dahinter begann der Wald. Wenn er den Blick nach Osten wandte, brannte in der Nähe nur in einem einzigen Haus Licht, einem kleinen grünen, zweistöckigen Haus, das links und rechts von einer großen und einer kleinen Scheune flankiert war. Man hatte den Eigentümer des Hauses schon vernommen, aber er hatte natürlich weder etwas gesehen noch gehört, da er einer dieser Tornedalen-Bewohner war, die nie etwas gesehen oder gehört hatten, wenn die Polizei fragte; das hatte etwas mit dem Wildern zu tun. Normalerweise wurde hier oben nie jemand wegen Wilderns geschnappt, höchstens wenn man mit der Polizei noch ein Hühnchen zu rupfen oder sich auf irgendeinem Tanzboden mit einem Polizeibeamten angelegt hatte.
Nun, der Eigentümer des Hauses hatte angegeben, nichts gesehen zu haben. Er konnte sich nicht einmal erinnern, daß der große NORRFRYS-Laster dort gestanden hatte.
Eino Niemi drehte sich langsam um und blickte quer über die E 4 direkt nach Süden. Auf der anderen Seite der Straße sah er ein schütteres Birkenwäldchen. Die Bäume waren schneebedeckt. Dahinter lag ein Viertel mit Einfamilienhäusern, Närsta. Er hatte vor nicht allzu langer Zeit dort bei einem Familienstreit eingreifen müssen, an Ostmans väg.
Wenn es draußen dunkel war, konnte man von dort aus ohnehin nichts erkennen. Und zur Tatzeit war es nachweislich dunkel gewesen.
Derjenige, der diesen Ort ausgesucht hatte, vorausgesetzt, daß es sich tatsächlich um Mord handelte, hatte eine sehr gute Wahl getroffen. Allenfalls aus einem vorbeifahrenden Auto hätte jemand etwas sehen können.
Er beobachtete eine Zeitlang den spärlichen Verkehr auf der E 4. Was sahen die Leute, die jetzt gerade vorbeifuhren? Hier stand ein Mann vor seinem geparkten Volvo. Er war vermutlich ausgestiegen, um zu pinkeln.
Hier also stand der große Scania-Laster, auf dessen Seite eine Art Mitternachtssonne aufgemalt war. Die meisten Bewohner der Gegend mußten das Fahrzeug oft gesehen haben. Was hätte ihnen auffallen sollen?
Da war etwas. Etwas, woran zu Anfang jeder gedacht hatte, das dann aber irgendwie durch die polizeilichen Routinefragen verdrängt worden war; durch Fragen wie die, wer die Angehörigen benachrichtigen sollte, wann die Männer des Erkennungsdienstes aus Luleå kommen konnten, ein wie großer Teil des Tatorts abgesperrt werden müsse, und alles andere. Zu Anfang hatte jeder daran gedacht. Später war es dann zu einem bloßen Detail unter vielen geworden.
Der Fernlaster war in der falschen Richtung geparkt gewesen, als wäre er von Luleå gekommen und nicht von der weniger als zwei Kilometer entfernten finnischen Grenze. Was nach den Aussagen der Zollbeamten jedoch nachweislich der Fall war. Exakt zwei Stunden und drei Minuten, nachdem Lasse Holma seinen Scania-Laster über den Grenzfluß gelenkt hatte und in Richtung Haparanda gefahren war, war der Laster hier gefunden worden. So geparkt, als wäre er aus der anderen Richtung gekommen.
Eino Niemi lächelte still vor sich hin, als wollte er sich selbst aufmuntern oder auf die Schulter klopfen, da sonst niemand da war, der es hätte tun können. Diese einfache Tatsache mußte doch etwas zu bedeuten haben, sie mußte wichtig sein.
Er blickte in Richtung des Kreisverkehrs, der genau 1,1Kilometer entfernt war: Hier kommt Lasse also in seinem Scania, dachte er. Er wird bald sterben, aber das weiß er natürlich nicht. Der plötzliche Kindstod tritt schnell ein und kommt wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Vielleicht ist Lasse auch übel, vielleicht fühlt er sich krank, weil er sich übergeben muß. Tatsächlich übergibt er sich genau an dieser Stelle zu Tode. Und genau hier hat er auf seiner achthundertzwanzig Kilometer langen Reise noch 3,6Kilometer zum Ziel. Er fühlt sich hundeelend. Was tut er? Er wendet den Fernlaster irgendwo, um ihn hier sozusagen in der falschen Fahrtrichtung zu parken, und anschließend stirbt er auf dem Fahrersitz. Den Teufel auch!
Jetzt aber ran an die Buletten, dachte er, als er zu seinem Wagen zurückging, um endlich ein Experiment durchzuführen, das vielleicht einige Bedeutung hatte, zumindest für ein gewisses Telefongespräch.
Wieder fuhr er so, als säße er in einem großen Scania und nicht in einem kleinen PKW, und mußte zunächst an der Stelle vorbei, an der er in der anderen Richtung parken sollte. Draußen auf der E 4 gab es keinerlei Möglichkeit, den Scania-Laster zu wenden.
Fünf Minuten später stand es fest. Die Fahrstrecke, die nötig war, um zu wenden und an den gleichen Ort zurückzukehren, wenn auch in entgegengesetzter Richtung, war bis auf ein paar hundert Meter genauso lang wie die Entfernung zum Reiseziel bei NORRFRYS.
Lasse Holma hätte an einem gewöhnlichen Arbeitstag zur üblichen Bürozeit ankommen sollen. Wenn ihm übel gewesen wäre, hätte er mit Sicherheit nicht angehalten, um mit schweren Krämpfen oder Schmerzen auf einem Parkplatz zu sterben. Er hätte vermutlich versucht, bis zum Ziel zu fahren, zur Telefonistin am Empfang zu taumeln und sie um Hilfe zu bitten. Als er jetzt erneut am Tatort vorbeifuhr, notierte Eino Niemi die Fahrtroute und setzte den Weg zum Polizeigebäude fort. Jetzt konnte er diesen Professor anrufen; dabei hatte er durchaus nicht mehr begriffen, als irgendwelche Kollegen begriffen hätten. Sie wußten genausowenig wie er über glatte Schleimhäute und Blutergüsse von 0,2Zentimeter Durchmesser. Ein Professor sollte allerdings in einer Hinsicht wie andere Menschen sein: normal und vernünftig.
Lasse Holma hatte von seinem bevorstehenden Tod keine Ahnung gehabt. Vermutlich hatte er, nein, nicht einmal vermutlich – er hatte sich mit Sicherheit nicht einmal schlecht gefühlt, als er das komplizierte Manöver durchführte. Er mußte wenden, zurücksetzen und seine schwere Last zurückfahren. Er war also ermordet worden. Kindstod hin, Kindstod her, er war ermordet worden.
Die Telefonistin des Krankenhauses in Umeå weigerte sich zunächst entschieden, die private Telefonnummer eines Chefarzts zu nennen, »denn an solchen Feiertagen rufen immer so viele komische Leute an«.
Sie sprach mit einem südschwedischen Tonfall und hörte sich wie eine Behördenvertreterin an, obwohl sie es nicht war. Eino Niemi fiel es ein paar Augenblicke lang ziemlich schwer, seine Wut zu beherrschen, er erkannte aber schnell, daß er sich hier ein paar Dinge verkneifen mußte. Wenn er auch nur ein Zehntel von dem gesagt hätte, was er zunächst sagen wollte, hätte das seine Aussichten, die Telefonnummer zu erhalten, nicht gerade vergrößert.
»Es geht um Ermittlungen in einem Mordfall. Hier spricht Kriminalinspektor Niemi von der Polizei in Haparanda. Du kannst mich zur Kontrolle gern zurückrufen, falls … aber es geht wie gesagt um eine Mordermittlung«, sagte Eino Niemi. Es kostete ihn große Anstrengung, ruhig zu bleiben.
Er bekam sofort die Telefonnummer und rief gleich an, bevor er den Elan verlor. Schon beim zweiten Läuten wurde am anderen Ende abgenommen.
Ein Kind war am Apparat. Im Hintergrund hörte er lauten Lärm, vermutlich das Festgetöse mit Weihnachtsliedern aus dem Fernseher. Er fragte, ob Papi zu Hause sei, und hörte dann, wie der Hörer eine Zeitlang neben dem Telefon lag, während im Hintergrund ein Kind nach einem Papi rief, der offenbar keine Lust hatte, ans Telefon zu gehen. Es hörte sich an, als würde kurz gestritten, doch dann legte jemand die Hand auf den Hörer, worauf eine Zeitlang nur ein Kratzen und gedämpfte Unterhaltung zu hören waren, bis sich eine entschlossene Männerstimme meldete.
»Anders Eriksson!«
»Guten Tag … hier Kriminalinspektor Eino Niemi in Haparanda. Verzeihung, falls ich zu so unpassender Zeit störe, aber …«
»Keine Ursache. Aber worum geht es?«
»Wie bitte?«
»Worum geht es!«
»Also … es geht um eine Ermittlung …«
»Ja, natürlich. Aber welche?«
Eino Niemi betrachtete den als Kerzenhalter dienenden kleinen Weihnachtsmann mit der halb abgebrannten weißen Kerze neben seinem Telefon auf der leeren Schreibtischplatte. Er hätte also lieber nicht anrufen sollen. Es war idiotisch, Leute so zu überfallen.
»Ist es vielleicht besser, wenn ich nach Weihnachten anrufe?« fühlte er vor.
»Durchaus nicht, solange es nur nicht meinen Jagdausflug stört. Bist du Jäger?« kam die Antwort schnell, aber nicht besonders unfreundlich, vor allem nicht bei der letzten Frage.
»Natürlich jage ich, das tun wir hier oben ja alle, aber … Ja, das ist doch so.«
»Na dann. Du darfst mich mit allem stören, was du auf dem Herzen hast, solange du meinem Jagdausflug nicht in die Quere kommst. Ich fahre nämlich zur Rehjagd nach Südschweden. Bin gerade dabei zu packen. Nun, worum ging es noch mal?«
Nach der letzten Mitteilung fühlte sich Eino Niemi erleichtert und erschüttert zugleich. Wer es eilig hatte, auf die Jagd zu gehen, mußte ja ein im Grunde anständiger Kerl sein, selbst wenn er Professor war. Andererseits würde ihm die Angelegenheit vielleicht die Jagd verderben.
»Ich fürchte, daß ich der Jagd vielleicht doch in die Quere komme«, sagte Eino Niemi und bereute die Worte im selben Augenblick, da er sich noch einmal hatte entschuldigen wollen.
»Teufel auch, das hört sich interessant an. Ich hoffe nur, daß du verdammt gute Gründe hast, denn hier oben haben wir ja nicht so viele Rehe, wie du weißt, und ich will zu einem Kollegen fahren, der uns Hoffnung macht, daß wir mit nur fünf Mann zehn oder fünfzehn Stück schießen können. Nun, zur Sache!«
»Ich glaube, wir haben es hier oben mit einem Mord zu tun, aber soviel ich weiß, hast du plötzlichen Kindstod festgestellt«, sagte Eino Niemi, während er nervös in seinen Notizen wühlte, um die Fragen zu finden, die er stellen wollte.
»Ich habe nie etwas über plötzlichen Kindstod gesagt, aber ich weiß, woher du das hast. Mir ist natürlich klar, von welchem Fall du sprichst. Es ist dieser Lastwagenfahrer, nicht wahr?«
»Ja. Genau der. Aber der Polizeidirektor hat gesagt …«
»Ja, ich weiß. Ich hatte keine Gelegenheit zu sagen … jetzt laß uns aber methodisch vorgehen, ja?«
»Aber gern. Ich habe mir ein paar Fragen notiert …«
»Gut. Aber wir sollten jetzt von vorn anfangen. Vor der toxikologischen Analyse war es nicht möglich, mit Sicherheit eine Todesursache festzustellen. Keine Spuren von äußerer Gewalteinwirkung, kein Herzinfarkt, keine Gehirnblutung, nichts in dieser Richtung. Hast du die toxikologische Analyse?«
»Ja, ich habe hier ein Gutachten des Gerichtschemischen Labors in Linköping und …«
»Gut! Was steht da?«
»So wie ich es deute, haben sich keine Gifte gefunden, weder Alkohol, Drogen noch sonst etwas.«
»Teufel auch. Gar nichts?«
»Nein, und jetzt frage ich mich, ob diese Sache mit dem plötzlichen Kindstod …«
»Das sollte eher ein Scherz sein.«
»Wie?«
»Na ja, was heißt Scherz. Aber als dein Chef anrief, fragte er, wonach es aussehe. Da habe ich im Grunde wahrheitsgemäß gesagt, daß es tatsächlich wie plötzlicher Kindstod aussieht. Das bedeutet aber nicht, daß ich im Ernst so etwas in meinem Bericht schreiben würde. Ich muß damit ja warten, bis ich die toxi … ja, also die Giftanalysen und das bekommen habe.«
»Was ist plötzlicher Kindstod?«
»Das ist … möchtest du eine lange oder eine kurze Geschichte?«
»Eine kurze. Am liebsten etwas, was auf dreißigjährige LKW-Fahrer bei guter Gesundheit zutrifft.«
»Dreißigjährige Lastwagenfahrer von guter Gesundheit sterben schon qua definitionem nicht an plötzlichem Kindstod. Es bedeutet, daß die Atmung aus Gründen aufhört, die … ja, bei Säuglingen läßt sich das erklären, aber nicht bei Dreißigjährigen. Was hast du eigentlich herausgefunden? Der Teufel soll dich holen, wenn du mir meinen Jagdausflug vermasselst. Ich will nämlich morgen früh fahren!«
Inzwischen hatte Eino Niemi sein Selbstvertrauen zurückgewonnen. Nicht nur, weil dieser Professor Jäger war und ein normaler Mensch zu sein schien, sondern weil er sich wie eine ehrliche Haut anhörte.
Er blätterte in seinen Notizen und erhielt schnell eine Bestätigung für das, was er schon vermutet hatte. Die verschiedenen Aber bei der Beschreibung von Lasse Holmas Herz und Lungen deuteten darauf hin, daß die Atmung plötzlich aufgehört hatte und daß er deshalb erstickt war. Die direkte Todesursache war vielleicht gewesen, daß er an halbverdauten Nahrungsresten erstickt war – nein, wenn sich in seiner letzten Mahlzeit Gift befunden hätte, hätte man Spuren gefunden. Er hatte also aus bislang ungeklärten Gründen plötzlich nicht mehr geatmet.
Nein, nicht ertrunken, natürlich nicht. Es gab keinerlei Spuren von Wasser in den Lungen. Mit einem Kissen oder etwas Ähnlichem hatte man ihn auch nicht erstickt, dann hätten sich in den Lungen charakteristische Spuren gefunden. Aber auf jeden Fall hatte die Atmung plötzlich aufgehört.
Anschließend erzählte Eino Niemi von den Manövern des Lastwagens, also von der letzten Fahrt des Mannes, der kurz darauf gestorben war.
Die Frage war am Ende sehr einfach. Wenn jemand den Lastwagenfahrer Lasse ermordet hatte, um etwas zu stehlen, was, wovon man wohl ausgehen konnte, sich irgendwo in der Multbeerenladung befunden hatte – vermutlich waren es nicht die Multbeeren selbst –, wie hatte er es angestellt?
Das war die letztlich wichtige Frage. Denn ihre Antwort würde einen Multbeerendiebstahl, eine in Haparanda eher unwichtige Angelegenheit, zumindest aus der Sicht der Kriminalpolizei, in einen Mordfall verwandeln.
Um diesen Diebstahl gewissermaßen zu adeln und zum Gegenstand einer Mordermittlung zu machen, waren wissenschaftliche Beweise nötig, und nur der angehende Rehjäger Anders Eriksson würde diese bürokratische Veränderung der polizeilichen Arbeit bewirken können.
Als das Gespräch beendet wurde, versprach der Pathologe, sich sofort der Frage anzunehmen, in der Hoffnung, die Rehjagd in Sörmland trotzdem noch zu retten.
Sie hatte ihn wegen der von ihm gewählten Art des Reisens ein wenig gehänselt. Auf dem Flug von Stockholm nach Paris war alles nach seinen Wünschen gegangen. Sie hatten sehr beengt inmitten schreiender Kinder hinter einem Vorhang gesessen und in Plastik verpacktes kaltes Essen bekommen. Sie konnte diese Geste nicht recht ernst nehmen und machte sich über ihn lustig, jagte ihn mit verbalem Geschick und mit Hilfe von Argumenten, wie sie für Juristen so typisch sind, von einer Ecke in die andere:
Und wie, wie genau sollen sich die sogenannten gewöhnlichen Leute davon beeindrucken lassen, daß der Berater des Ministerpräsidenten Touristenklasse fliegt? Ist es nicht vielmehr so, daß sie eher denken werden, daß er auf eigene Rechnung fliegt und nichts weiter als geizig ist?
Er hatte sich gut gelaunt gewehrt und eingewandt, wenn sie hier mit schreienden Kindern zu tun hätten, hätte ihnen das in der Business Class genausogut mit reichen schreienden Kindern passieren können. Einen akustischen Unterschied zwischen reichen und armen Kindern gebe es nicht, ihre Biologie funktioniere genau gleich. Doch, meinte Tessie, die Gefahr, durch Kinder gestört zu werden, sei in der Touristenklasse größer als in der Business Class.
Wahr, gab Carl zu. Jedoch hätten sie jetzt selbst ein Kind bei sich, wenn auch erst im dritten Monat, und aus diesem Grund verböten sich mißbilligende Bemerkungen über Kinder von selbst. »Objection sustained«, lachte Tessie und warf den Kopf in den Nacken, womit sie deutlich ihre Billigung zum Ausdruck gab. Er hatte sich plötzlich wie ein amerikanischer Anwalt angehört, was schon für sich genommen amüsanter war als das Argument selbst.
Aus dem Flug in der Touristenklasse von Paris nach Los Angeles wurde nichts. Kaum hatte das Bodenpersonal am Flughafen Charles de Gaulle ihren Namen in den Computer eingegeben, schien dieser Alarm zu schlagen. Nach kurzer geflüsterter Beratung hatten die verblüfften Bodenstewardessen, die ihnen ab und zu Seitenblicke zuwarfen, sie schnell in die Erste Klasse umgebucht. Zu ihrem großen Vergnügen, während er eher verlegen zu sein schien.
»Ach so, du Wiesel, du hast Air France gepflückt, um ohne Gewissensbisse Erster Klasse zu fliegen, nur weil sie dir eins schuldig sind«, neckte sie ihn, als die Maschine abhob und die Stewardessen mit dem Champagner herbeieilten.
»Es heißt nicht Wiesel«, korrigierte er mit verkniffenem Mund, »das ist amerikanisch. Auf schwedisch heißt es in diesem Fall Fuchs. Außerdem habe ich nicht Air France gepflückt, sondern gewählt. Außerdem sind sie mir nicht eins schuldig, sondern einen Gefallen. Sonst war alles richtig!«
Sie hatten beschlossen, schwedisch zu sprechen, um unbeschwert und ungestört unter sich zu sein; wenn einer der anderen sechs Erster-Klasse-Passagiere Schwede gewesen wäre, hätten sie es an seinem Starren gemerkt. Wenn es um die Alltagssprache ging, war Tessie fest entschlossen. Sie wollte zumindest eine Stunde an jedem Tag schwedisch sprechen.
Das war ihr eigener Vorschlag gewesen, doch jetzt bereute sie ihn. Englisch wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Versuch machen wollte, etwas aus ihm herauszubekommen. Er war irgendwie anders als sonst, wie sie fand, fast etwas abwesend und passiv, als dächte er die ganze Zeit an etwas anderes, wollte aber nicht zeigen, daß ihm andere Dinge im Kopf herumgingen.
Sie wechselte das Thema. Sie selbst war seit der Kindheit zweisprachig, und wie sollten sie es mit ihren Kindern halten?
Genauso, bemerkte er fast nebenbei, während er die in Französisch und Englisch abgefaßte Speisekarte studierte. Genauso. Sehr einfach. Er werde mit dem Kind Schwedisch sprechen und sie Englisch. Außerdem hätten sie das gesetzliche Recht, das Kind zusätzlich entweder in Spanisch oder Englisch unterrichten zu lassen. So wolle es das schwedische System, der sogenannte Muttersprachenunterricht. Er sah sich genötigt, das Wort ins Englische zu übersetzen, da sie zunächst bezweifelte, richtig gehört zu haben. Nun, unter Muttersprache verstehe man also nicht Schwedisch, selbst wenn das Kind in Schweden mit einem schwedischen Vater geboren werde. Muttersprache in diesem Sinn sei entweder Spanisch oder Englisch. Die Mutter habe die Wahl.
Tessie interessierte sich plötzlich sehr für das Thema. Die kalifornischen Kinder, die spanische Schulen besuchten, hatten im allgemeinen schlechtere Möglichkeiten, sich in der amerikanischen Gesellschaft zu behaupten. Sie selbst war eine heftige Gegnerin dieses Systems gewesen. Millionen Amerikaner waren auf Italienisch oder Spanisch angewiesen, und die entsprechende soziologische Statistik war nicht schwer zu deuten. Sie wollte sich zu Hause in dieser Frage engagieren, also zu Hause in Schweden. Überhaupt wollte sie sich bei Dingen engagieren, mit denen sie sich schon ihr halbes Erwachsenenleben lang beschäftigt hatte, den Rechten von Minderheiten und dem Kampf gegen Diskriminierung.