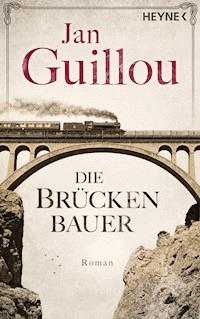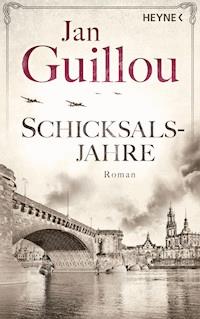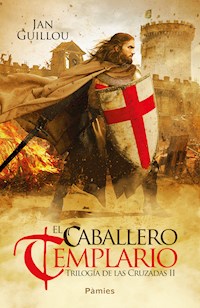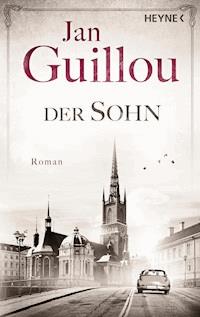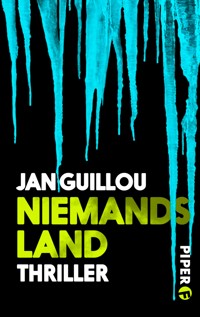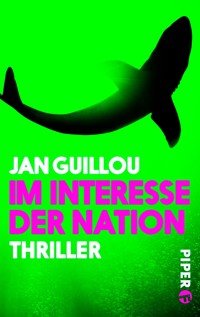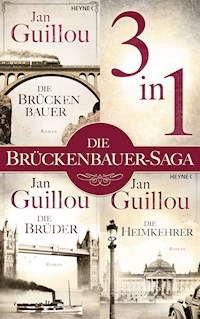2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die RAF jagt die Akademie der deutschen Bundeswehr in die Luft. Und auch in Schweden scheint sie mit einer gewaltsamen Aktion ein Zeichen setzen zu wollen. Das ist die Gelegenheit für den schwedischen Geheimdienst, einen Undercover-Agenten in die Terrorszene einzuschleusen. Agent Hamilton alias »Coq Rouge« gelingt es, bis in den innersten Kreis der RAF vorzudringen. Er ködert seine Genossen mit dem Plan, die CIA-Zentrale in Stockholm angreifen zu wollen. Doch die Mission gerät außer Kontrolle: Hamilton wir gefangen genommen, die geplante Waffenlieferung nach Deutschland ist nicht mehr zu stoppen... Jan Guillou gilt als Kultklassiker unter den schwedischen Thriller-Autoren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hans-Joachim Maass
ISBN 978-3-492-98024-1
© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2013 © 1987 Jan Guillou Titel der schwedischen Originalausgabe: »Coq Rouge. Den demokratiske terroristen«, Norstedts Förlag, Stockholm 1987 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1990 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Alexander.Yakovlev / Shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
3. Auflage 2004
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
1
Der Tod kam per Bierwagen. Hinterher war die Polizeiführung im Präsidium Beim Strohhause 31 natürlich schlauer. Zunächst aber hatte es so ausgesehen, als handelte es sich nur um einen der täglich rund 200Kraftfahrzeugdiebstähle in Hamburg. Dabei war es außerdem noch unklar gewesen, welche Abteilung der Anzeige nachgehen sollte. War es einfacher Diebstahl oder die schwerere Form des Transportdiebstahls, da der Bierwagen mit 4000 Flaschen Ratsherrn-Pils beladen gewesen war? Der Gedanke lag nahe, daß ein paar Jugendliche sich an diesem Montagmorgen, am 14.November, mit einem reellen Vorrat eingedeckt hatten, um ihren Nachdurst vom Wochenende zu löschen.
Überdies hatte der Sicherheitsoffizier der Führungsakademie der Bundeswehr vom Hamburger Verfassungsschutz eine Warnung erhalten.
Da die Ausbildung ausländischer Offiziere an der Führungsakademie wieder einmal in die öffentliche Kritik geraten war – diesmal waren es keine Kadetten aus Chile, denen eine Spezialausbildung zuteil wurde, sondern, noch schlimmer, Offiziere aus Honduras –, durfte man davon ausgehen, daß es zu Demonstrationen kommen würde. Vor allem, da ein Pressesprecher der Bundeswehr bekanntgegeben hatte, daß einige hohe Generale in zwei Tagen beim offiziellen Abschluß des Kurses anwesend sein würden.
Vorstellbar waren beispielsweise gewalttätige Demonstrationen und diverse Sachbeschädigungen, wie etwa Attacken von Graffiti-Künstlern. In einem in der Stadt anonym verteilten Flugblatt hieß es, die Bundesrepublik habe sich wieder einmal offen an die Seite des US-Imperialismus gestellt, indem sie sich der Ausbildung von dessen Lakaien und damit auch direkter kriegerischer Handlungen gegen die Revolution in Nicaragua schuldig gemacht habe.
Schon die in dem Flugblatt geäußerten Gedanken sowie der Umstand, daß es anonym war, hätten größtmögliche Sicherheitsvorkehrungen auslösen müssen.
Möglicherweise hatte sich der Sicherheitschef der Führungsakademie das auch vorgenommen, jedoch nicht vor dem Eintreffen der Generale, das als der kritische Zeitpunkt betrachtet werden mußte.
Die Führungsakademie der Bundeswehr liegt in der Manteuffelstraße 20 in einem idyllischen Villenviertel zwischen Blankenese und Nienstedten, einem einst ländlichen Vorort Hamburgs. Die roten Klinkerbauten dienten im Zweiten Weltkrieg schon der Wehrmacht als Kasernen.
Der Bierwagen, der auf dem Weg nach Blankenese die Villen an der Elbchaussee hinter sich gebracht hatte und in die Manteuffelstraße einbog, war ein alltäglicher Anblick. Zwar hatte der Posten beim Einfahrtstor wie das gesamte Wachpersonal militärischer Anlagen sowohl der Bundesrepublik wie der NATO in den letzten Jahren zahlreiche Verhaltensvorschriften erhalten, was die Kontrolle von Personen und Fahrzeugen betraf. Besucher und militärisches Personal wurden minuziös überprüft. Truppenausweise boten keine Sicherheit mehr, da es Terroristen schon mehrmals gelungen war, sich solche Papiere zu beschaffen. So war es etwa den Angehörigen der Streitkräfte in den meisten Anlagen verboten, mit Privatfahrzeugen Militärgelände zu befahren.
Der Bierwagen wurde jedoch ohne weiteres durchgewinkt. Der Wachtposten erklärte am nächsten Tag, daß das Kennzeichen des Fahrzeugs seit langem bekannt und daß es zur gewohnten Stunde erschienen sei.
Später stellte sich heraus, daß der Fahrer sich äußerst kaltblütig verhalten hatte. Er hatte auf dem Gelände kurz angehalten und einen vorbeigehenden Leutnant gefragt, in welcher Baracke die lateinamerikanische Delegation wohne, da er dort Bier anliefern solle. Der Leutnant hatte es ihm erklärt.
Zehn Minuten später, als 22 junge Offiziere aus Honduras zur Mittagspause in ihr Quartier zurückkehrten, stand der Bierwagen vor der Eingangstür.
Um diese Zeit hatte aber die Hauptwache schon Verdacht geschöpft und einen Feldwebel namens Heinrich Behnke losgeschickt, um der Sache nachzugehen. Behnke fand den Bierwagen leer vor. Merkwürdig, dachte er, als er sich auf das Trittbrett stellte und an den Türgriff faßte. Es war das letzte, was er dachte.
Soweit sich nachträglich feststellen ließ, mußte der Bierwagen mit mindestens 25Kilogramm TNT sowie rund 20Gasflaschen beladen gewesen sein.
Die Druckwelle der Explosion hatte in einem Umkreis von 500Metern sämtliche Fenster zertrümmert, und die Rauchwolken waren fast in ganz Hamburg zu sehen. Vier deutsche und neun ausländische Offiziere kamen bei dem Anschlag ums Leben.
Nach den Maßstäben der westdeutschen Terroristen mußte dies als der erfolgreichste Angriff gelten, den sie in der Bundesrepublik je verübt hatten. Die noch am selben Nachmittag den Zeitungen zugespielten Erklärungen enthielten ungefähr das, was zu erwarten gewesen war. Wieder einmal hätten die europäischen Guerilleros gegen das Herzstück des kapitalistischen Staates zugeschlagen. Man habe direkt den Krieg der NATO gegen die Völker der Dritten Welt attackiert und das Kommando nach einem nicaraguanischen Revolutionshelden benannt.
Im nachhinein erschien alles logisch und vorhersagbar, obwohl die deutschen Terroristen zum ersten Mal einen so massiven Angriff gegen eine Einrichtung der Bundeswehr gerichtet hatten.
Neu hingegen war, daß den Bekennerbriefen zufolge nicht nur die Rote Armee Fraktion an dem Anschlag beteiligt war, was sowohl Polizei wie Verfassungsschutz vermuteten, als sie von der Katastrophe erfuhren, sondern auch die belgische Terroristenorganisation CCC. Früher hatte die RAF mit ihren französischen Genossen von der Action Directe zusammengearbeitet, sowohl bei Mordanschlägen wie bei Sabotageakten. Jetzt war also auch die belgische Organisation bei Aktionen dieses Schlages mit von der Partie. Die Terroristen waren dabei, ihre Internationale zu schaffen.
Ein verwirrendes Detail war die Tatsache, daß man nicht wußte, wo der vermeintliche Bierfahrer geblieben war, nachdem er den Wagen verlassen hatte. Man vermutete, daß er ganz einfach davonspaziert war oder eine Toilette aufgesucht hatte, um dann in dem Chaos nach der Explosion zu verschwinden. Wie dem auch sei: Sein Auftritt war gespenstisch kaltblütig gewesen.
Als noch am selben Nachmittag der Hamburger Senat zusammentrat, wurden zwei Dinge hervorgehoben: Dies sei erstens der schlimmste Anschlag in der Geschichte des westdeutschen Terrorismus. Und zweitens: Im Kampf gegen diesen Terrorismus gelte es jetzt, mit aller Kraft zurückzuschlagen – um jeden Preis. Der demokratische Staat müsse sich verteidigen.
2
Das Bundeskriminalamt, abgekürzt BKA, hat sein Hauptquartier in einem kleinbürgerlichen Villenviertel am Rande Wiesbadens. Der unscheinbare, von Fernsehkameras überwachte Eingang an der Thaerstraße 11 macht eher den Eindruck, als führe er in ein unbedeutendes Bürogebäude oder eine Berufsschule. Die Thaerstraße ist eine Sackgasse, die beim BKA endet, und erst wenn man sich etwas genauer umsieht, entdeckt man, daß sich hier in Wahrheit ein großer Komplex von vier bis fünf Gebäuden verbirgt, die hinter Stacheldraht und Alarmanlagen durch verglaste Gänge verbunden sind. Dies ist das polizeiliche Gehirn der Bundesrepublik Deutschland und ein Arbeitsplatz für mehrere tausend Menschen.
Kriminaloberkommissar Dietmar Werth verließ ganz gegen seine Gewohnheit das Gelände, um essen zu gehen. Obwohl er nun schon mehr als zwei Jahre in der Antiterror-Abteilung des BKA arbeitete, mußte er sich beim Verlassen des Geländes jedesmal bei den Wachtposten ausweisen. Es war ihnen offenkundig nur möglich, sich das Aussehen der allerhöchsten Chefs einzuprägen, und Werth verabscheute es, mit einem Plastikkärtchen am Jackenaufschlag herumzulaufen, als gehörte er zu irgendeiner Putzkolonne oder zum Bodenpersonal eines Flugplatzes.
Eigentlich hatte er Hunger. Das einzige Restaurant in der Nähe war ein kleines italienisches Lokal, das wie eine umgebaute Garage aussah und es vermutlich auch war. Dietmar Werth kam zu dem Schluß, daß er einen Spaziergang nötiger hatte als etwas zu essen und daß der kühle Nieselregen ihm guttun würde. Denn in zwei Stunden lief er Gefahr, sich zu blamieren.
Punkt 14Uhr sollte er sich bei seinem Abteilungspräsidenten Klaus-Herbert Becker einfinden, dem Chef der Antiterror-Abteilung des BKA. Punkt 14Uhr mußte Dietmar Werth eine Empfehlung parat haben, und er war fast schon entschlossen, ein riskantes Unternehmen vorzuschlagen, nämlich daß der Herr Abteilungspräsident sich entschließen möge, die Angelegenheit vom BKA an die Konkurrenz in Köln abzugeben, an den Verfassungsschutz.
Mit einem solchen Vorschlag konnte er sich eigentlich nur unbeliebt machen. Bislang war es mit seiner Karriere schnell und direkt aufwärtsgegangen, bis zu diesem Punkt, an dem sie ein abruptes Ende finden konnte, sofern nämlich der Oberst so wütend wurde, wie im schlimmsten Fall zu befürchten war, wenn er den Vorschlag seines Untergebenen zu hören bekam.
Dietmar Werth ging ziellos zur Innenstadt hinunter, bog beim Stadttheater an der Wilhelmstraße ab und ging auf den Spazierwegen im Kurpark weiter. Das Wetter machte ihn zu einem einsamen Flaneur. Draußen im Teich schwammen zwei Stockenten, im übrigen schien die Gegend wie ausgestorben zu sein.
Von Anfang an war Werth der ganze Fahndungsansatz viel zu weit hergeholt erschienen. Irgendein übereifriger Drogenfahnder von der FD 6 (»Sonderermittlungen«) in Hamburg hatte sich eine Woche lang der wenig beneidenswerten Aufgabe gewidmet, sämtliche Gespräche aus zwei nebeneinanderliegenden Telefonzellen im Hurenviertel – einen Steinwurf von der Reeperbahn und der Herbertstraße entfernt – abzuhören und zu analysieren. Mein Gott, was mußte der arme Kerl für besoffenes Gequatsche und dummes Zeug mitangehört haben.
Aber dann hatte sich in dem Mann irgendwie der Eindruck verfestigt, daß eines der Telefonate als konspiratives Gespräch von zwei Terroristen gedeutet werden mußte, mochte es auf den ersten Blick auch so wirken, als unterhielten sich zwei jüngere Geschäftsleute in gepflegtem Deutsch über ein vor kurzem abgeschlossenes Geschäft, als planten sie einen weiteren Vorstoß auf die Märkte Belgiens oder Schwedens.
Das Gespräch hatte elf Minuten gedauert. Die automatische Aufzeichnung hatte es vermerkt: am Mittwoch, dem 16.November von 14.03Uhr bis 14.14Uhr. Die Abschrift umfaßte zwölf getippte Seiten in Dialogform, und das Gespräch selbst war der Form nach natürlich unschuldig und inhaltlich nichtssagend.
Nur notierte der Computer seit einiger Zeit auch die angerufene Telefonnummer. Und dieses zweite Telefon befand sich in dem italienischen Restaurant Cuneo, was deshalb auffallend war, da zwischen Restaurant und Telefonzelle kaum mehr als 200Meter lagen.
Wie kommt es, hatte sich der Kollege von der Drogenfahndung FD 6 gefragt, daß zwei Personen elf Minuten lang ein geschäftliches Telefongespräch führen, wenn sie kaum anderthalb Minuten Fußweg voneinander entfernt sind? Wollten sie es nicht riskieren, zusammen gesehen zu werden?
So war es zum Anfangsverdacht gekommen, und damit war das Ganze rein formal zum Fahndungsauftrag in einer Strafsache geworden. Aber statt der gewohnten Routine zu folgen, die Abschrift zu zerstören und das Gespräch im Computer zu löschen – denn diese sogenannte Überschuß-Information hatte offenkundig nichts mit strafbarem Drogenhandel zu tun, und die Abhörerlaubnis galt nur für Drogenstraftaten –, hatte sich der Drogenfahnder von der FD 6 mit der Abschrift hingesetzt und seiner Phantasie freien Lauf gelassen. Damit wurde die Angelegenheit zur Fahndungssache.
Ein einzelner Polizeibeamter hatte sich hingesetzt und Vermutungen angestellt. Seine erste Vermutung war, daß hier zwei Terroristen vom harten Kern der RAF erstens den Terroristenanschlag erwähnten, den sie soeben begangen hatten, das Bombenattentat in Hamburg, zweitens die Tatsache kommentierten, daß belgische Terroristen an der Aktion teilgenommen hatten, und drittens die Wahl zwischen neuen Terrorakten in Belgien oder Schweden erörterten, wobei die zweite Alternative viertens die Schwierigkeit aufwarf, daß man mit einem hinlänglich kompetenten schwedischen Terroristenkollegen Kontakt aufnehmen mußte.
Das Ganze schien zunächst weit hergeholt, um nicht zu sagen völlig aus der Luft gegriffen zu sein. Es war dem Drogenfahnder aber offenbar gelungen, seinen Einfall so mitreißend darzulegen, daß er seinen Chef von der FD 6, einen Kriminaldirektor Soundso, dazu gebracht hatte, die Angelegenheit formell der Terrorismus-Abteilung beim BKA in Wiesbaden zu übergeben, und so war sie drei Tage nach der Aufzeichnung des Telefonats und fünf Tage nach dem Bombenattentat in Hamburg auf Dietmar Werths Schreibtisch gelandet.
Dieser hatte die weitgehende Deutung des Telefongesprächs zunächst nicht einen Augenblick ernst genommen und es daher vorgezogen, diese Bagatellsache auf dem schnellsten Weg wieder loszuwerden. Die FD 6 hatte nämlich in erster Linie darum ersucht, das BKA möge prüfen, ob eine der Stimmen auf dem Tonband zu identifizieren sei.
Folglich hatte Werth Abschrift und Tonband an die technische Abteilung geschickt, um dort eine Analyse vornehmen zu lassen. In der Bundesrepublik sind bei der Polizei 700Personen als gesuchte Terroristen oder als Personen registriert, die im Verdacht stehen, Sympathisanten zu sein. Von rund 80 dieser Personen besitzt das BKA Tonbandaufzeichnungen, die in einem Tonarchiv gespeichert sind.
Die moderne Computertechnik hat Stimmen inzwischen zu einer fast ebenso sicheren Identifikationsquelle wie Fingerabdrücke gemacht. Die Ausrüstung des Wiesbadener BKA reicht aus, um eine gespeicherte Stimme mit fast hundertprozentiger Sicherheit wiederzuerkennen. Und damit begann die Sache ernst zu werden. Denn eine der Stimmen gehörte einem gewissen Horst Ludwig Hahn, 29Jahre alt, einen Meter fünfundsiebzig groß, besondere Kennzeichen: eine Narbe auf der Stirn. Er war in der unteren linken Ecke des Fahndungsplakats zu finden, das die Bilder der 22 meistgesuchten deutschen Terroristen zeigte. Auf jeden war ein Kopfgeld von 50000 DM ausgesetzt. Das rot-lila Plakat mit den schwarzweißen Bildern war in mehr als einer Million Exemplaren verteilt worden und hing in jedem Amt, in jeder Behörde der Bundesrepublik, auch an der Tür zu Dietmar Werths Dienstzimmer. Vorsicht, Schußwaffen! stand am unteren Rand des Plakats.
Die Identität des zweiten Gesprächspartners ließ sich nicht mit gleicher Sicherheit bestimmen. Seine Stimme war jedenfalls nicht archiviert, aber sein Dialekt sowie ein paar einfache Schlußfolgerungen hatten Dietmar Werth zu der Annahme gebracht, daß es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen gewissen Martin Beer handeln mußte: 25Jahre alt, einen Meter fünfundneunzig groß, kräftiger Körperbau und auf dem linken Oberarm eine sechs Zentimeter lange Narbe.
Auf Martin Beers Kopf waren ebenfalls 50000 DM ausgesetzt. Sein Bild fand sich rechts unten auf dem Plakat.
Also: Zwei Tage, nachdem sie in Hamburg einen Anschlag begangen hatten, hatten sich zwei der meistgesuchten Terroristen des Landes in dem Hurenviertel rund um die Reeperbahn aufgehalten. Sie hatten die Stadt nicht verlassen, so daß man davon ausgehen konnte, daß sie gegenwärtig von Hamburg aus operierten.
Die beiden hatten über eine Entfernung von rund 200Metern ein konspiratives Telefongespräch geführt, statt sich zu treffen. Der Schluß lag nahe, daß sie irgendwo auf St.Pauli konspirative Wohnungen besaßen. Übrigens gar nicht so dumm, sich gerade hier zu verstecken. Zwar sind die Kriminalbeamten von der Sitte ebenso wie die für die Bekämpfung von Gewaltverbrechen und Drogenvergehen zuständigen Polizisten auf St.Pauli ständig im Einsatz, einem Gebiet mit der höchsten Kriminalitätsdichte der Bundesrepublik. Dies bedeutet aber auch, daß die Aufmerksamkeit der Polizei auf andere Dinge gerichtet ist als auf terroristische Aktivitäten.
Daraus hätte das BKA normalerweise den Schluß ziehen müssen, in diesem Viertel verstärkt zu fahnden. Falls sich die Terroristen irgendwo auf St.Pauli versteckt hielten, bestanden recht gute Aussichten, einen oder mehrere von ihnen zu finden. Kurz: Man würde die Zahl der Gesichter auf den überall im Land hängenden rot-lila Plakaten verringern können, was die Steuerzahler auch billigerweise erwarten durften.
Man durfte aber auch auf keinen Fall den Öffentlichkeitserfolg – die Ergreifung von ein oder zwei Terroristen unter großem Getöse – mit einem effektiven Ergebnis verwechseln. Der innere Kreis der deutschen Terroristen, der sogenannte harte Kern, war nie sonderlich groß gewesen und hatte im Verlauf von bald 20Jahren immer wieder Verluste erlitten, ohne daß sich deswegen die Zahl der Terroristen verringert hätte. Es fiel ihnen leicht, Nachwuchs anzuwerben, und es schien ihre erklärte Taktik zu sein, nur Verluste zu ersetzen und den inneren Kreis nicht weiter zu vergrößern. Das war optimales Sicherheitsdenken; je mehr Eingeweihte, um so größer die Risiken.
Aus diesem Blickwinkel war es strategisch also nicht sonderlich sinnvoll, einen oder zwei Terroristen zu ergreifen, wenn man nicht gleichzeitig einen größeren Schlag gegen die Zentrale führen konnte, gegen den Kopf der Hydra.
Und hier ergab sich jetzt eine naheliegende und verführerische Möglichkeit, die die Lage angesichts der im BKA zu fassenden Beschlüsse komplizierte.
Die nachträgliche Lektüre der Abschrift des Gesprächs, als feststand, daß es sich um zwei identifizierte Angehörige des harten Kerns der RAF handelte, ließ den Inhalt des Gesprächs sonnenklar erscheinen.
Zunächst beglückwünschten sich die beiden Terroristen zu ihrem vor kurzem in Hamburg erfolgreich abgeschlossenen Geschäft (»Vorgestern« – was mit dem Zeitpunkt des Bombenanschlags übereinstimmte). Es folgte eine Anspielung auf die gelungene Zusammenarbeit mit den belgischen Kollegen. Da die RAF und die belgische Terrororganisation CCC (Cellules Communistes Combattantes) am Tag nach dem Attentat ein gemeinsames Kommuniqué in Umlauf brachten, in dem von ihrem »militärischen Angriff« auf den Hauptfeind NATO die Rede war, paßte auch das perfekt ins Bild.
Dann folgte eine interessante Komplikation mit dem Hinweis auf Schweden. Die Alternative zu einer Fortsetzung des belgisch-deutschen Geschäfts in Belgien sei offenbar »der wirklich große Schnitt in Schweden«. Aber, so hatte der mutmaßliche Martin Beer eingewandt, dazu fehle ein schwedischer Kollege mit den notwendigen Spezialkenntnissen, denn die seien »technisch hochkompliziert und erforderten einen neuen Maschinenpark, bei dem schon die Grundinvestitionskosten erheblich sein dürften«. Der schwedische Partner sei auch notwendig, um »die Marktlage in Schweden besser beurteilen zu können«.
Die Drogenfahnder der FD 6 waren zu der Schlußfolgerung gelangt, daß die Terroristen jemanden suchten, der nicht nur Schwede sein und sich in Schweden auskennen mußte. Er sollte überdies militärtechnisch ausgebildet und versiert sein, eine Eigenschaft, die den westdeutschen Terroristen fast ausnahmslos fehlte. Sie hatten mit der Zeit gelernt, Bomben herzustellen – und das sogar recht geschickt. Und mit einfacheren Handfeuerwaffen konnten die meisten von ihnen zumindest notdürftig umgehen. Aber hier suchten sie offensichtlich einen Mann, der über ein breites Repertoire militärischen Wissens verfügen sollte. Und zudem wollten sie wohl ihr Arsenal mit schwereren Waffen erneuern.
Dietmar Werth mußte sich widerwillig eingestehen, daß er selbst zu ungefähr den gleichen Schlüssen gekommen war. Was den schwedischen Teil des Telefongesprächs betraf, gab es keine andere Deutungsmöglichkeit, selbst wenn sich rein theoretisch denken ließ, daß es sich etwa um eine Investition in Lastwagen handelte, um irgendeinen spektakulären Transport von entführten Personen oder etwas Ähnliches zu arrangieren. Solche Aktionen paßten aber nicht zur modernen Strategie der Terroristen. Sie hatten die Entführungs-Strategie aufgegeben und wollten neuerdings »direkt« und mit »militärischen Aktionen« gegen den »Hauptfeind« zuschlagen.
Die FD 6 in Hamburg hatte drei Fragen gestellt und sollte auf dem Dienstweg Antwort erhalten. Aber bei der Formulierung der Antworten würde man unausweichlich gleichzeitig den entscheidenden Entschluß treffen müssen. Die drei Fragen der FD 6 lauteten:
1) Läßt sich die Identität einer oder beider Personen feststellen?
2) Sind besondere Fahndungsmaßnahmen zu ergreifen?
3) Sollte die Angelegenheit, vor allem was den Aspekt der Gewinnung von Erkenntnissen mit besonderen Methoden betrifft, dem Verfassungsschutz übergeben werden?
Was mit der letzten, etwas unbeholfen und euphemistisch formulierten Frage gemeint war, war vollkommen klar. Die besonderen Methoden, die in Frage kommen konnten, bestanden also darin, jemanden zu finden, der den Wünschen der Terroristen entsprach, ihn nach St.Pauli zu schicken und darauf zu hoffen, daß jemand anbiß.
Es war ungewöhnlich, daß die Terroristen diesmal außerhalb ihres Sympathisantenkreises, den sie gut kannten oder zumindest gut beurteilen konnten, einen Rekruten suchten. Ein unbekannter Schwede war etwas völlig anderes. Das eröffnete ganz andere Möglichkeiten, und das hatten sogar die Drogenfahnder begriffen.
Der Grund für die Übergabe der Angelegenheit an den Verfassungsschutz, die dazu führen würde, daß der Kriminalpolizei eine fette Beute entging, war in sowohl verwaltungstechnischer wie gesetzlicher Hinsicht offenkundig. Die reguläre deutsche Polizei hat weitgehende Freiheiten, wenn es beispielsweise darum geht, das organisierte Verbrechen zu unterwandern oder Scheingeschäfte mit Drogenhändlern abzuschließen, um zu Beweisen zu kommen. Diese Unterwanderungstechnik hat jedoch einen Haken: den Beamtenstatus der Ermittler. Ein Beamter darf sich nicht strafbar machen, jedenfalls nicht außerhalb eines bestimmten Rahmens von Gesetzesübertretungen. Und die Verbrechen, in die ein Beamter verwickelt werden kann, der mit Terroristen in Berührung kommt, sind weit schwerer als alles, was sich beispielsweise ein Drogenfahnder der FD 6 in Hamburg erlauben durfte.
Dem Verfassungsschutz war es auch nicht möglich, sein eigenes Personal in ein solches Abenteuer zu schicken. Ein Funktionsträger beim Verfassungsschutz ist ebenso Beamter mit entsprechender Verantwortung wie ein normaler Polizist. Der Verfassungsschutz hatte jedoch weit größere Möglichkeiten, sich außenstehender V-Männer zu bedienen. In diesem Fall ging es überdies ja noch darum, einen Ausländer zu engagieren. Für die reguläre Polizei wäre das sowohl technisch wie juristisch unmöglich. Der Verfassungsschutz konnte es unter Umständen möglich machen.
Folglich sollte die Sache an den Verfassungsschutz mit der Anfrage gehen, ob dieser interessiert sei, den Fall zu übernehmen. Weshalb es Dietmar Werth angesichts der bevorstehenden Empfehlung an seine Vorgesetzten im BKA nicht ganz wohl war, hatte nicht allzuviel mit Logik zu tun. Denn logisch stand zweifelsfrei fest, daß der Fall beim Verfassungsschutz am besten aufgehoben war. Die Konkurrenzsituation zwischen dem BKA und dem Verfassungsschutz lud jedoch nicht gerade dazu ein, derart interessante Fahndungsaufträge einfach aus der Hand zu geben. Beim BKA betrachtete man die Kollegen vom Verfassungsschutz als Schreibtisch-Polizisten und Bürokraten. Beim Verfassungsschutz hielt man die Kollegen vom BKA bestenfalls für primitive »Bullen« und im schlimmeren und normalerweise leider üblichen Fall für geistig minderbemittelte Paviane.
Dennoch hatte sich Dietmar Werth schon entschieden, als er die beiden einsamen Stockenten im Teich des Kurparks betrachtete, einen Erpel und ein Weibchen. Er wollte das Risiko auf sich nehmen, wollte der Logik vor der Angst, sich bei seinen Vorgesetzten zu blamieren, Vorrang geben. Er würde empfehlen, die Angelegenheit an den Hamburger Verfassungsschutz abzugeben, verbunden mit der Anfrage, ob man dort irgendwelche Möglichkeiten zu speziellen Operationen sehe, besonders im Hinblick auf den von den Terroristen offenbar gewünschten schwedischen Mitkämpfer.
Wahrscheinlich würde der Abteilungspräsident verrückt spielen, wahrscheinlich würde das Ganze dazu führen, daß man sowohl beim Hamburger wie beim Kölner Verfassungsschutz dankend ablehnte, und damit würde die Sache wieder beim BKA in Wiesbaden landen. Dort würde dann Dietmar Werth der Dumme sein und die Sache zum zweiten Mal auf den Schreibtisch bekommen. Das befürchtete er jedenfalls. Trotzdem wurde er das Gefühl nicht los, daß dies tatsächlich der richtige Weg war, daß er zu der Besprechung beim Abteilungspräsidenten genau mit diesem Vorschlag gehen mußte. Er zog den Mantel enger um sich, da der Nieselregen allmählich dichter wurde, und ging mit schnellen, zielbewußten Schritten den Abhang zur Thaerstraße hinauf.
Er hatte sich mit seinen pessimistischen Vermutungen geirrt. Der Abteilungspräsident lobte ihn für die schwierige, nach Lage der Dinge aber korrekte Beurteilung, die es geraten sein lasse, die Sache an den Verfassungsschutz abzugeben. Und dieser sollte nun wider alle Vernunft und gegen alle Hoffnung den perfekten Infiltranten finden.
3
Gemessen an seiner Funktion im Sicherheitsapparat der Bundesrepublik hatte Loge Hecht eine seltsame Angewohnheit. Er fuhr jeden Morgen mit der U-Bahn zum Hamburger Hauptbahnhof und ging dann zu Fuß, regelmäßig wie ein Uhrwerk, das kurze Stück zum Johanniswall 4. Seine Kollegen – zumindest die, die etwa den gleichen Dienstrang besaßen wie er – fuhren in einem dunkelblauen Mercedes 190 mit Chauffeur und dunklem, gepanzertem Glas zur Arbeit. Sie taten das zu unregelmäßigen Zeiten und benutzten nur selten den Haupteingang.
Hecht blieb kurz vor dem Portal mit den sechs runden Spiegelglasscheiben stehen und warf einen Blick in den Schnapsladen, wo Slogans wie Sonderangebot und Sensationelles Angebot verkündeten, daß der Beaujolais Nouveau des Jahres schon jetzt ausverkauft werde. Hecht zögerte, ob er zugreifen sollte, solange er das seiner Frau, einer geborenen Französin, gegebene Versprechen noch nicht vergessen hatte.
Loge Hecht war in mehr als nur einer Hinsicht ein konservativer Mann. Er bevorzugte deutsche Weine, zur stillen Verzweiflung seiner Frau sogar deutsche Rotweine. Er war Mitglied der CDU, saß aber trotz des sozialdemokratischen Senats in Hamburg fest im Sattel. Seine fachliche Kompetenz war einfach über alle parteipolitischen Bedenken erhaben; er galt allgemein als einer der fähigsten Männer beim deutschen Verfassungsschutz. Gerade deshalb mochten einige seiner Gewohnheiten exzentrisch erscheinen.
Jetzt verharrte er reglos vor dem Eingang zu seiner Dienststelle, einen Meter von dem diskreten, unauffällig braunen Schild mit den verrußten Goldbuchstaben entfernt, auf dem Behörde für Inneres steht. Das erweckt den Eindruck, als handle es sich hier um irgendeine Unterabteilung der Innenbehörde. (Das Telefonbuch gibt jedoch darüber Auskunft, daß der Hamburger Verfassungsschutz unter dieser Adresse zu erreichen ist.)
Daß er mit seiner schlichten, korrekten Kleidung, seinem untersetzten Körper und dem runden Kopf mit dem naßgekämmten Scheitel eher wie ein durchschnittlicher deutscher Wursthändler als wie ein Verfassungsschutz-Chef aussah, hatte keine Bedeutung und sollte auch keine Entschuldigung sein. Sein Bild war schon etliche Male in den Zeitungen erschienen, und er war sogar im Fernsehen aufgetreten. Er war ohne weiteres zu identifizieren. Jetzt stand er wie eine Zielscheibe vor dem Portal und überlegte, ob er die versprochene Menge französischen Wein, der seiner Ansicht nach nur etwas für Frauen war und nach Saft schmeckte, kaufen sollte oder nicht.
Er zuckte die Achseln, nickte einer der geschickt verborgenen Überwachungskameras oben im Eingangsgewölbe zu und ging entschlossen, also ohne den Beaujolais Nouveau zu kaufen, an dem Wachtposten in seinem Glaskäfig vorbei und betrat einen der weißen Paternoster. Als Kind hatte er es geliebt, in solchen Fahrstühlen über das rote Warnschild hinauszufahren, in der Dunkelheit über den Scheitelpunkt hinweg und dann hinunter in den Keller und wieder hinauf ins Licht.
Loge Hechts Selbstbewußtsein war nicht allzu knapp bemessen. Er war sich durchaus klar darüber, daß man ihn für einen der fähigsten Terroristenjäger der Bundesrepublik hielt. Andere Sicherheitsleute, die konventioneller dachten als er, neigten dazu, sich für erstrangige potentielle Terroristenopfer zu halten. Diese Kollegen würden nie mit der U-Bahn zur Arbeit fahren, niemals wie eine Zielscheibe mehrere Sekunden vor dem Eingang stillstehen, nie zu Fuß gehen, nie einem regelmäßigen Tagesschema folgen.
Aber Der Hecht, wie er auch im Ausland genannt wurde, hatte eine wohlbegründete Auffassung davon, was ihn auf einer hypothetischen Entführungs- oder Mordliste von Terroristen so weit unten placierte, daß er wohl kaum unter den 200 interessantesten Opfern landen würde. Für ihn war das Ganze einfach und logisch. Für die Terroristen war die NATO der »Hauptfeind«. Sie hatten begonnen, in militärischen Begriffen zu denken, wollten den »Hauptfeind« treffen, so oft sie konnten, und das machte mehr als 2000 denkbare menschliche Ziele und militärische Einrichtungen der NATO weit interessanter als einen anderen Bürger der Bundesrepublik, selbst wenn er beim Verfassungsschutz arbeitete.
Loge Hecht war vermutlich von den Bürgern der Bundesrepublik derjenige, der die reichhaltige Flora von Sympathisantenliteratur und Denkschriften des harten Kerns am ausgiebigsten und aufmerksamsten gelesen hatte; sicher auch genauer und vollständiger als jeder Terrorist. Aus dieser Lektüre hatte er eine sehr einfache Erfahrung gewonnen: Die Terroristen nahmen ernst, was sie schrieben. In der politischen Linken wurde mindestens genausoviel gelogen wie in der Politik überhaupt, aber davon durfte man bei Terroristen nicht ausgehen. Diese mußten sich immer erklären, vielleicht nicht mehr »den Massen«, wohl aber ihrem engeren Kreis von Sympathisanten. Daher meinten sie auch, was sie schrieben. Aus diesem Grund waren ihre Kommuniqués Loge Hechts wichtigste Erkenntnisquelle. Er war sich seiner Sache sicher und kannte den Feind.
Als er sein Büro im dritten Stock betrat, hatte sein engster Mitarbeiter, der auf die Minute genau wußte, wann Hecht erscheinen würde, gerade den Kaffee serviert. Siegfried Maack war Anfang dreißig, sah aber wegen seiner zunehmenden Kahlköpfigkeit und seiner randlosen Brille etwas älter aus.
Die beiden Männer nickten einander kurz zu und machten sich sofort an die gewohnte morgendliche Routine. Die gestrige Eilanfrage des BKA in Wiesbaden war das wichtigste Gesprächsthema. Das BKA hatte vorgeschlagen, der Verfassungsschutz solle einige Fahndungshinweise übernehmen, um daraus »eine Operation mit besonderen Methoden« zu entwickeln, wie die etwas verkorkste Umschreibung des BKA lautete. Das BKA verlangte jedoch einen raschen Bescheid des Verfassungsschutzes, da es »für den Fall einer dortigen negativen Entscheidung« (also für den Fall, daß Hecht ablehnen sollte) ohne weitere Verzögerung selbst eine konventionelle Fahndung aufziehen müsse. Das BKA wollte sich in diesem Fall darauf beschränken, möglichst bald einen oder am liebsten beide der identifizierten Terroristen zu ergreifen oder unschädlich zu machen. Natürlich lag dem BKA an einer schnellen Entscheidung, da der Verfassungsschutz selbst keine Festnahme vornehmen durfte.
Denn der westdeutsche Verfassungsschutz hat als wohl einziger Sicherheitsdienst der Welt nicht das Recht, Bürger festzunehmen. Sobald eine Festnahme oder eine Haussuchung angezeigt ist, weil Fahndungsergebnisse oder anderes Beweismaterial das erforderlich machen, muß er die normale uniformierte Polizei um Amtshilfe bitten.
Die Erklärung für diese deutsche Besonderheit ist einfacher, als man vielleicht glauben könnte. Vor weniger als einer Generation gab es hier einen Sicherheitsdienst, der noch heute eine der bekanntesten und verhaßtesten Abkürzungen der Welt verkörpert: Gestapo.
Bei der Gründung des Sicherheitsdienstes des neuen demokratischen Staates Bundesrepublik Deutschland wurde es daher zu einer selbstverständlichen Forderung, daß es den Sicherheitsorganen nie möglich sein dürfe, nachts in die Wohnung eines Bürgers einzudringen oder ihn auch nur abzuführen. Nie mehr durfte es dazu kommen, daß Männer des Sicherheitsdienstes nachts irgendwo die Treppe hinaufstiefelten und vor einer Tür standen.
Kollegen aus aller Welt waren immer wieder über diese anscheinend blödsinnig unpraktische Regelung erstaunt. Es fiel ihnen jedoch, meist ein wenig verlegen, leicht, die einfache historische Erklärung zu akzeptieren. Nur äußerst selten erlaubte sich ein ausländischer Kollege einmal den ironischen Hinweis darauf, daß der Sicherheitsdienst des zweiten deutschen Staates, der DDR, sich durch solche historischen Bedenken keineswegs gehemmt fühle.
Loge Hecht liebte es, im Gespräch mit ausländischen Kollegen gerade auf dieses Thema zu kommen. Da er in der EG-Kommission zur Bekämpfung des Terrorismus die Bundesrepublik vertrat, hatte er recht oft Gelegenheit dazu. Das System hatte seiner Ansicht nach einige entscheidende Vorteile.
Wenn man nämlich einen Verdächtigen nicht festnehmen darf, ist man dazu auch nicht verpflichtet. Ein normaler Polizeibeamter hat, um es brutal auszudrücken, die Pflicht, gegen jede Gesetzesübertretung vorzugehen, die er beobachtet oder die zu seiner Kenntnis gelangt. Dies ist möglicherweise der Grundsatz, den die Polizei in aller Welt am häufigsten verletzen muß.
Wenn man aber von der Verpflichtung entbunden ist, dem sogenannten Legalitätsprinzip zu folgen, erweitert das auch die Möglichkeiten, verbrecherische Zusammenschlüsse zu beobachten oder gar zu unterwandern, ohne daß man sich dabei ständig um die Grenzen der dienstlichen Rechte und Pflichten sorgen muß.
Loge Hecht empfand trotzdem einen starken Widerwillen gegen den vagen Vorschlag des BKA, die schwedische Kontaktmöglichkeit für eine Under-Cover-Operation zu nutzen. Auch für das Problem der Unterwanderung hatte Hecht wie für die meisten anderen Problemstellungen seines Dienstes eine fundierte Theorie parat, und in diesem Fall mußte seine Theorie das ihm nahegelegte Vorgehen in der Praxis verbieten.
Der Infiltrant mußte erstens ein Außenstehender sein. Ein Beamter des Verfassungsschutzes wäre zwar nicht verpflichtet, gegen irgendwelche verbrecherischen Aktivitäten einzuschreiten, aber als Beamter durfte er sich auch nicht an kriminellen Handlungen beteiligen. Es mußte irgendwo eine angemessene Grenze für das geben, was Hecht eher scherzhaft Verbrechen im Dienst nannte. Unter Terroristen lief man jedoch Gefahr, diese Grenze schon nach fünf Minuten zu überschreiten.
Möglicherweise würde es gelingen, Methoden zu finden, mit denen sich diese juristische Sackgasse auf halbwegs legalem Weg umgehen ließ. Aber danach würden sich gleichwohl praktische Hindernisse auftürmen, die fast unüberwindlich waren. So durfte der Infiltrant weder verheiratet sein noch Familie haben, und er mußte über eine echte »Legende« verfügen, durfte also keine erfundene Geschichte aus einer erfundenen Vergangenheit auftischen.
Und in diesem Fall sollte er überdies ein Schwede sein, dazu ein Schwede mit besonderer militärischer Kompetenz und eine Person, die von der Bundesrepublik irgendwie auf dem Dienstweg rekrutiert werden konnte – Freiwilligkeit war in diesem Zusammenhang ja kaum denkbar. Es konnte sich also nur um einen Schweden handeln, der beim Sicherheits- oder Nachrichtendienst arbeitete.
Als Hecht am gestrigen Nachmittag mit Siegfried Maack die Situation erstmals besprochen hatte, hatte er das ganze Projekt mit einem verächtlichen Schnauben abgetan.
»Zusammengefaßt«, hatte er seine Überlegungen beendet, »suchen wir also folgendes: einen schwedischen Sicherheitsbeamten im Alter zwischen 25 und 30Jahren, der in irgendeiner Form eine revolutionäre Vergangenheit hat. Schon daran dürfte die Sache aus naheliegenden Gründen scheitern. Selbst in Schweden dürften Linke beim Sicherheitsdienst ziemlich ungewöhnlich sein. Außerdem soll er noch militärische Sonderkenntnisse haben. So etwas gibt es auf dieser Welt nicht.«
Aber Auftrag ist Auftrag und muß erledigt werden. Die schnellste Methode, bis zum Ende dieser Sackgasse vorzudringen, bestand selbstverständlich darin, über die Verfassungsschutzzentrale in Köln anzufragen, ob dort oder mit Hilfe des Bundesnachrichtendienstes in Pullach jemand aufzutreiben sei, der dem Wunschbild auch nur nahekam. Nach dem selbstverständlich negativen Bescheid würde die Angelegenheit für Loge Hecht beendet sein und an das BKA in Wiesbaden zurückgehen.
Hecht arbeitete seit drei Jahren mit Siegfried Maack zusammen, und so hätte er eigentlich schon beim Betreten des Zimmers bemerken müssen, daß sich in dem heutigen Papierstapel etwas Besonderes befand. Er hätte es ihm anmerken müssen, noch vor dem Augenblick, in dem Maack, nachdem er wie gewöhnlich abgewartet hatte, bis sein Chef einen Schluck Kaffee getrunken hatte, ihm wortlos das Fernschreiben des BND über den Tisch schob. Hecht las mit wachsender Verblüffung:
Antwort auf Anfrage, Telex Abteilung III VS/Hamburg/ Hecht über VS/Z-Köln, 23.November. Nach der gegebenen Beschreibung kommt folgendes Objekt in Frage: Carl G. Hamilton, Marineleutnant, Alter 30. Beamter mit besonderen Aufgaben beim Sicherheitsdienst RPS/ Säk/Stockholm. Registriert wegen verfassungsfeindlicher (marxistisch-leninistischer) Verbindungen, Zugehörigkeit zur Studentenvereinigung Clarté sowie zu pro-palästinensischen Gruppen etc. Sonderausbildung als Marinetaucher sowie unbekannte weitere Ausbildung, vermutlich außerhalb Schwedens. Im vergangenen Jahr Einzeleinsatz gegen vier israelische Operateure (vgl. Archiv, Israel, unter dem Codewort »Stockholmer Fiasko«). Alle vier Israelis wurden bei der Konfrontation getötet. Bewaffnet; vermutlich umfangreiche waffentechnische Kenntnisse. Warnung: größte Vorsicht bei evtl. Konfrontation. Codename: Coq Rouge. Kein Foto. Ende der Mitteilung.
»Es fällt mir schwer, das zu glauben«, flüsterte Loge Hecht, nachdem er das lakonische Fernschreiben des BND langsam durchgelesen hatte. »Solche Tiere gibt’s doch nicht. Nicht mal bei Hagenbeck würden sie ihren Augen trauen.«
»Da hast du deine echte Legende, um mal damit anzufangen«, sagte Maack mit einem feinen Lächeln. Soweit er sich erinnern konnte, sah er seinen Chef zum ersten Mal verblüfft. »Was soll denn das übrigens heißen, marxistisch-leninistisch?« fuhr Maack sanft fort, um sich seinem Chef, der offensichtlich aus dem Gleichgewicht war, nicht allzu taktlos aufzudrängen.
Loge Hecht hatte sein Gleichgewicht aber schon selbst wiedergefunden und antwortete in seinem gewohnten, zusammenfassenden Stakkato-Tonfall.
»Studentische Linke, wütende Gegner des individuellen Terrors, wie es in ihrer Sprache heißt. Er ist theoretisch bestens gedrillt, beherrscht vermutlich die gesamte antiimperialistische Terminologie, also auch in dieser Hinsicht perfekte Voraussetzungen. Besser hätte es gar nicht kommen können.«
»Und in militärischer und technischer Hinsicht? Welches Stockholmer Fiasko der Israelis meinen sie, sollte es tatsächlich ein einziger Mann gewesen sein, der?« fragte Maack weiter, obwohl er die unangenehme Fortsetzung der Frage gleichsam aus Pietät in der Schwebe ließ. Jetzt war er sich seiner Sache noch sicherer als am Morgen, als er das Fernschreiben zum ersten Mal gesehen hatte. Hier ergaben sich offenbar erstaunliche Perspektiven.
»Das Stockholmer Fiasko mußt du doch kennen. Die Israelis hatten sich in den Kopf gesetzt, das Personal des Stockholmer PLO-Büros auszuschalten, warum, habe ich vergessen, jedenfalls ging die Sache furchtbar daneben. Soviel ich damals hörte – obwohl ich es für reinen Klatsch hielt –, war es ein einziger Mann des schwedischen Sicherheitsdienstes, der alle vier Israelis erledigte. Und hier haben wir ihn wieder. Wir haben es also mit einem qualifizierten Mörder zu tun, der dazu noch eine kommunistische Vergangenheit hat. Netter Bursche, was?«
»Bei dieser Vergangenheit besteht doch aber die Gefahr, daß er sympathisiert?«
»Nein, bei dieser Vergangenheit ist es so gut wie ausgeschlossen; wenn er einen derartigen marxistisch-leninistischen Hintergrund hat, ist er erheblich mehr gegen die Terroristen eingestellt als unsere grünen Umweltfreunde. Außerdem ist er Beamter.«
»Und wie wird er es bei uns?«
Loge Hecht stand auf und ging in dem länglichen Dienstzimmer auf und ab. Diese Frage ließ sich kaum leicht und schnell beantworten. Er blieb am Bücherregal neben der Tür stehen und zog nachdenklich eines seiner Lieblingsbücher heraus, die Memoiren des einzigen Spions, den er wirklich bewunderte, die Erinnerungen von Leopold Trepper, des Mannes, der während des Zweiten Weltkriegs Moskaus Spionageorganisation Rote Kapelle leitete. Hecht wog das Buch kurz in der Hand, dann stellte er es wieder ins Regal und kehrte zu seinem Schreibtisch mit dem brisanten Fernschreiben zurück.
»Laß uns zunächst eines klären«, begann er. »Wenn das stimmt, was hier steht, und im Augenblick gibt es keinen Grund, daran zu zweifeln, haben wir hier einen Mann mit geradezu perfekten operativen Voraussetzungen. Das ist eine goldene Gelegenheit, unbestreitbar. Der nächste Schritt muß jetzt so aussehen: Klärung der Frage, ob ein Mann des schwedischen Sicherheitsdienstes nach den Gesetzen der Bundesrepublik als Beamter oder ganz allgemein als Ausländer, also als Privatperson, anzusehen ist. Du siehst ein, warum?«
»Ja, natürlich. Wenn er rechtlich als Beamter anzusehen ist, platzt das Ganze, nicht wahr?«
»Richtig. Das solltest du mit der Rechtsabteilung in Köln klären. Wenn die grünes Licht geben, können wir den nächsten Schritt vorbereiten. Diese Rechtsfrage sollte aber als erstes geklärt werden.«
4
Sektionschef Henrik P. Näslund war beim Besuch der deutschen Kollegen vom ersten Augenblick an leicht unbehaglich zumute. Jetzt saß er da und hörte mit einem halben Ohr zu, während einer von ihnen mit deutscher Umständlichkeit bestimmte neue »objektive Voraussetzungen« in der Strategie der Bundesrepublik gegen die sogenannte vierte Terroristengeneration darlegte. Der Vortrag wäre ihm auch in schwedischer Sprache unerträglich langsam vorgekommen, aber jetzt trat durch die Übersetzung des Dolmetschers noch eine weitere Verzögerung ein. Die Deutschen sprachen kein Englisch, die Schweden kein Deutsch.
Näslund unterdrückte ein Gähnen und zog sich nachdenklich einen Kamm durchs Haar, ohne zu bemerken, daß seine Gäste erstarrten. Es war ein Montagmorgen um halb neun, draußen war es dunkel, und seine Sekretärin hatte in einem eigenhändig gebastelten Kerzenhalter mit kleinen Trollen und grauem Moos eine Stearinkerze angezündet. Sie hatte Kaffee mit vermutlich selbstgebackenen Safran-Krapfen serviert, da gerade erster Advent gewesen war. Näslund haßte dieses Vorverlegen der Vorweihnachtszeit von Jahr zu Jahr – Safran-Krapfen etwa sollte man nicht vor dem Lucia-Fest am 10.Dezember essen –, kam aber zu dem Schluß, daß ihm jetzt gerade die frühe Tageszeit am unappetitlichsten erschien.
Hinzu kam das Unbehagen, daß er sich nicht hatte darüber klar werden können, wo und wie die an und für sich wichtigen deutschen Kollegen placiert werden sollten. Wäre er selbst an seinem Schreibtisch sitzen geblieben, wären seine Besucher zu Untergebenen geworden, die mit übereinandergeschlagenen Beinen vor ihm gesessen hätten. Das wäre kein guter Einfall gewesen. Aber jetzt saßen sie alle fünf (er selbst, der Leiter der Terroristen-Abteilung des schwedischen Sicherheitsdienstes, der stellvertretende Polizeipräsident Christian Kallén, ein vereidigter Dolmetscher sowie die beiden hochrangigen deutschen Kollegen) an einem zu kleinen und zu niedrigen schwedischen Amtszimmertisch, der außer für einen Chef für höchstens zwei Besucher gedacht war, und folglich saßen alle beengt. In einem Konferenzzimmer des Sicherheitsdienstes hätten sie wiederum zu weit auseinander gesessen, was auch nicht gut gewesen wäre. Es war ein lächerliches, ihn aber gleichwohl irritierendes Problem.
Außerdem spürte Näslund, daß es ihm zunehmend schwerer fiel, seine Ungeduld zu zügeln. Die Deutschen hatten mit höchster Priorität um ein möglichst rasches Zusammentreffen und zudem um Amtshilfe gebeten. Jedenfalls hatte man ihr kurzgefaßtes Fernschreiben so ausgelegt.
Und statt gleich zur Sache zu kommen, begannen sie mit sogenannten Hintergrundinformationen, die in ein paar einfachen Worten hätten zusammengefaßt werden können.
In letzter Zeit gibt es nicht mehr allzu viele Terroristen, aber sie machen uns trotzdem zu schaffen, und es ist schwieriger geworden, sie zu fassen. Wenn es uns aber gelingt, die Übriggebliebenen zu fassen, haben wir die Möglichkeit, das Terroristenproblem endgültig zu lösen.
Das war in dürren Worten der Inhalt des Vortrags der ersten dreißig Minuten. Von der Mühe der Deutschen, zur Sache zu kommen, einmal abgesehen, hätte die Situation Näslund angenehm sein müssen. Normalerweise war die schwedisch-deutsche Zusammenarbeit eine Einbahnstraße wie die Kooperation Schwedens mit seinen sonstigen Verbündeten überhaupt: Die andere Seite leistete die Dienste, die Schweden gerieten in eine Dankesschuld.
Da haben wir’s, dachte Näslund. Das ist ja gerade das Unangenehme. Denn wenn sie jetzt ihre Schuld eintreiben wollen, brauchen sie mit ihren Forderungen nicht sonderlich zurückhaltend zu sein, und bis jetzt haben die Kerle nicht mal angedeutet, worum es geht.
Jetzt war der kleinere und rundere Deutsche an der Reihe, der wie ein kleiner Wursthändler aussah und bisher nicht viel gesagt hatte.
»Ich möchte gern mit der rein operativen Voraussetzung beginnen. Danach komme ich auf die rechtliche Problematik zu sprechen«, leitete Loge Hecht kurz seine Darlegungen ein und wühlte in seinen Papieren, während er die Übersetzung des Dolmetschers abwartete.
Teufel auch, jetzt geht es noch einmal von vorn los, dachte Näslund. Loge Hechts Darstellung unterschied sich jedoch deutlich von der seines Vorgesetzten aus Köln. Hecht brauchte nur eine Minute, um das Interesse der beiden schwedischen Kollegen zu wecken.
Also. Der Verfassungsschutz habe mit relativ großer Sicherheit feststellen können, daß der harte Kern der Rote Armee Fraktion sein Hauptquartier von Südwestdeutschland nach Hamburg verlegt habe. Man habe zwei Mitglieder der Gruppe bei einem Telefongespräch identifiziert, und hier seien die Unterlagen (Hecht referierte das mitgeschnittene Telefonat und schob die Abschrift über den Tisch).
Damit eröffneten sich zwei Arten des Vorgehens. Die eine sei natürlich, das hätten die geschätzten schwedischen Kollegen sicher schon selbst gesehen, durch verstärkte Fahndungstätigkeit in St.Pauli und Hamburg das Versteck der Gruppenmitglieder zu lokalisieren, das wahrscheinlich aus einer oder mehreren konspirativen Wohnungen bestand.
Da das mitgeschnittene Telefonat eine größere Operation der Terroristen in Schweden vermuten lasse, vielleicht auch ein Unternehmen in Zusammenarbeit mit schwedischen Terroristen, begründe schon das den Wunsch nach Zusammenarbeit mit den schwedischen Kollegen. Es dürfte im Interesse beider Parteien liegen, jede Terroraktion deutschen Ursprungs auf schwedischem Territorium zu verhindern. Vor allem deshalb, weil man es mit einer Gruppe zu tun habe, von der ein rücksichtsloses Vorgehen zu erwarten sei, wenn es nicht gelinge, rechtzeitig zu intervenieren.
Die wichtigste Voraussetzung dafür sei, daß die Terroristen jetzt einen schwedischen Mitarbeiter suchten, den sie soeben ausführlich beschrieben hätten.
Es liege in der Natur der Sache, daß solche seltenen Tiere der Polizei in der Bundesrepublik nicht zur Verfügung stünden.
»Voraussetzung für eine derartige Operation ist folglich«, fuhr Loge Hecht mit Nachdruck fort, »daß wir in Ihrer Organisation oder durch sie den Mann finden können, den wir für dieses Unternehmen brauchen.«
Darauf griff er nach einem neuen Papierstoß, während er auf die Übersetzung des Dolmetschers und die Wirkung seiner Worte wartete.
»Bevor ich aber zu unserem theoretischen operativen Modell komme, möchte ich Ihnen gern einige Aspekte der rein juristischen Problematik darlegen«, fuhr Hecht in den etwas gestelzten Worten des Dolmetschers fort.
Ein schwedischer Staatsbürger, ein Angestellter des schwedischen Sicherheitsdienstes ebenso wie ein gewöhnlicher Tourist, könne in dieser Situation mit viel größerer Handlungsfreiheit vorgehen als ein deutscher Beamter. Es gebe nämlich keinerlei juristische Möglichkeit, die Dienstpflichten und den Amtseid eines deutschen Beamten zu umgehen, sofern man davon ausgehe, daß der Betreffende in eine verbrecherische Aktivität hineingezogen werde, wie sie im Zusammenhang mit terroristischen Aktionen unzweifelhaft zu erwarten sei.
Es komme folglich darauf an, daß ein schwedischer Staatsbürger in einer möglichen Operation seinen Einsatz nicht wegen des Legalitätsprinzips würde abbrechen müssen, obwohl er mit den beteiligten deutschen Stellen natürlich sehr eng zusammenarbeiten sollte.
Hecht bemerkte, daß die zwei Schweden, die sehr gespannt zugehört hatten, neugieriger wirkten als erwartet, und so entschloß er sich zu einer kurzen Erläuterung.
Er wolle folglich sagen: Der Verfassungsschutz sei nicht verpflichtet, der Arbeit eines solchen Partners Einhalt zu gebieten, völlig unabhängig davon, was dieser unternehmen werde. Die Gesetzgebung der Bundesrepublik sei in dieser Hinsicht ziemlich eindeutig.
Das sei die eine Seite der Angelegenheit. Die andere bestehe in der denkbaren Komplikation, daß die deutsche Polizei vielleicht aus irgendwelchen Gründen gegen eventuelle Verbrechen des Operateurs vorgehen müsse. Aber auch da gebe es eine juristisch vertretbare Lösung: Sollte die Polizei gegen den Schweden vorgehen, gebe es an und für sich keine Möglichkeit, ein Strafverfahren von vornherein niederzuschlagen. Nach deutschem Recht müßten alle auf deutschem Boden begangenen Straftaten vor Gericht untersucht werden. Aber – und dies sei der entscheidende Punkt – ein solches Gerichtsverfahren werde mit Rücksicht auf die Sicherheitsinteressen des Staates wie auf das gute Verhältnis zu einer fremden Macht unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfinden. Und vor Gericht würde man den Vertrag zwischen Verfassungsschutz und dem schwedischen Operateur mühelos erläutern können, wofür der Verfassungsschutz jederzeit zur Verfügung stehe. Unter diesen Umständen werde das Gericht ohne weitere Verzögerung die Niederschlagung des Verfahrens beschließen.
Um noch einmal zusammenzufassen: Die Zusammenarbeit mit einem schwedischen Staatsbürger sei wünschenswert. Für eine solche Lösung gebe es sowohl juristische wie operative Gründe. Sollte der Unterwanderungsversuch mißlingen, was realistischerweise zu erwarten sei, wäre die Angelegenheit damit erledigt. Sollte die Operation aber gelingen, würde sie wahrscheinlich zu beiderseits höchst begrüßenswerten Ergebnissen führen. Die von der RAF geplante Aktion in Schweden, worum es sich dabei auch handeln möge, würde dadurch natürlich gestoppt werden. Überdies werde man endgültig die letzten funktionstauglichen Überreste der vierten Generation des harten Kerns der RAF dingfest machen, möglicherweise auch die Verbindungen zu ähnlichen Organisationen in Frankreich und Belgien offenlegen können.
Es stehe also eine Menge auf dem Spiel, und es müsse jetzt schnell gehandelt werden. Es sei eine außerordentlich günstige Gelegenheit für die schwedischen Stellen, sich für einige der früher von den Deutschen geleisteten Dienste zu revanchieren.
Der letzte Satz schien eher eine Drohung als ein einfacher Hinweis zu sein, was Hecht auch beabsichtigt hatte. Danach schwieg er, um die Reaktion seiner schwedischen Gesprächspartner abzuwarten.
Jetzt war offenkundig Näslund an der Reihe, etwas zu sagen. Er widerstand dem Impuls, sich mit dem Kamm durchs Haar zu fahren, da alle Anwesenden ihn gespannt beobachteten.
»Sie wünschen also, daß wir einen Beamten des schwedischen Sicherheitsdienstes mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung für eine Under-Cover-Operation in Hamburg zur Verfügung stellen? Und Sie meinen auch, für eventuelle Komplikationen auf deutschem Boden die volle juristische Verantwortung übernehmen zu können?« fragte Näslund, mehr um Zeit zu gewinnen.
Von Zeitgewinn konnte jedoch keine Rede sein.
»Jawohl, völlig richtig«, erwiderte der ältere der beiden Deutschen mit Nachdruck und einem langsamen Kopfnicken, während er mit einer Handbewegung den Dolmetscher unterbrach, der gerade begann, eine überflüssige Übersetzung nachzuliefern.
Zu Näslunds Karriere-Hintergrund gehörte zwar, daß er einmal im nördlichen Norrland als Staatsanwalt gearbeitet hatte; obwohl er ein Mann des Sicherheitsdienstes war, fiel es ihm folglich leicht, sich in juristische Probleme hineinzudenken, das heißt in die Technik der Umgehung solcher Probleme. Hinsichtlich des schwedischen Rechts aber sowie der Frage, ob das schwedische Recht für einen schwedischen Beamten unter westdeutscher Jurisdiktion und unter offiziellem westdeutschem Befehl überhaupt gelten konnte, war er mit seinen gedanklichen Mühen noch längst nicht fertig. Er versuchte erneut, Zeit zu gewinnen.
»Das scheint mir ein äußerst interessanter Ansatz zu sein«, begann er behutsam und legte dann einen völlig überflüssigen Satz nach, bevor ihm aufging, was er eigentlich hätte einwenden müssen: »Und es ist ja ganz offenkundig, daß es bei dieser Operation auch um genuine schwedische Interessen gehen könnte. Sie werden sicher verstehen, daß auch wir gewisse Schwierigkeiten haben, einen solchen weißen Raben zu finden, sonst würde ich keinen Augenblick zögern und mein Bestes tun, um Ihrem Verlangen zu entsprechen.«
Dieser letzte Satz war ein entscheidender Verhandlungsfehler. Wenn man sich auf praktische Schwierigkeiten beruft, müssen sie stichhaltig sein, sonst sitzt man in der Falle und hat eine Zusage gemacht. Und so wie sich Näslund später an die Besprechung erinnerte, glaubte er, im Gesicht des ranghöheren Deutschen gerade in diesem Moment ein schmales, hastiges Lächeln zu bemerken, das sofort wieder verschwand, etwa wie bei einem Filmvampir, der schnell die Eckzähne einzieht. Die Entscheidung folgte in Form eines Fernschreibens, das der Deutsche langsam über die gemaserte Tischplatte aus Birkenholz zu Näslund hinüberschob.
»Dies sind Angaben, die wir von unserem Nachrichtendienst erhalten haben. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was hier über diesen Coq Rouge gesagt wird, sieht es so aus, als hätten wir unseren Mann gefunden, nicht wahr, Herr Näslund.
Er brauchte nur einen kurzen Blick auf das Papier zu werfen, um einzusehen, daß die Deutschen recht hatten. Carl Gustaf Gilbert Hamilton war in Näslunds Augen zwar ein außerordentlich unsympathischer und unzuverlässiger Zeitgenosse, aber es ließ sich kaum leugnen, daß eben dieser Hamilton die Erwartungen der Deutschen in jeder Hinsicht erfüllte.
»Ja, das stimmt«, sagte Näslund resigniert, »dieser Mann besitzt einzigartige Qualifikationen, das muß ich zugeben. Gleichzeitig tauchen hier ein paar bürokratische Probleme auf, die sich wohl nur schwer werden lösen lassen.«
»Und die wären?« fragte der ranghöhere Deutsche kalt.
»Nun ja … diese Person befindet sich im Augenblick in einer bestimmten militärischen Ausbildung und ist von uns beurlaubt. Das heißt, wir müssen uns der Mitarbeit der Streitkräfte versichern.«
Näslund spürte, daß er plötzlich anfing, in Rätseln zu sprechen. Er hielt inne, um dem Dolmetscher zuzuhören, der seinen Einwand etwas präziser auszudrücken schien. Die beiden Deutschen schienen sein Argument aber dennoch als so gut wie bedeutungslos anzusehen. Wenn sowohl nationale Interessen als auch bewährte Formen der Zusammenarbeit zweier befreundeter Staaten berührt seien, könnten die schwedischen Streitkräfte wohl kaum Einwände erheben?
Nein, das mußte Näslund widerwillig eingestehen. Nein, die Streitkräfte würden wohl keine Einwände erheben. Fünf Minuten später hatte Näslund endgültig versprochen, sich nach Kräften dafür einzusetzen, daß der schwedische Geheimdienstmann in die Bundesrepublik kam, um persönlich zu dem Vorschlag Stellung zu nehmen. Weitere zehn Minuten später hielt er einen Umschlag mit den notwendigen Anweisungen für das erste Zusammentreffen in Bonn – wer, wann, wo – in der Hand, den er Hamilton persönlich übergeben sollte.
Die beiden Deutschen verabschiedeten sich, sichtlich zufrieden. Damit war Henrik P. Näslund allein mit dem Chef der Terrorismus-Abteilung. Er fuhr sich mit dem Kamm ein paarmal energisch über die Schläfen.
»Dieser Hamilton, von dem sie sprachen, ist das dieser bewußte …?« wollte Christian Kallen wissen, der die Telex-Kopie der Deutschen noch nicht gesehen hatte. Kallen war der Nachfolger von Axel Folkesson, der etwa vor einem Jahr ermordet worden war.
»Allerdings«, seufzte Näslund, »natürlich ist er das, wer denn sonst.«
»Wenn ich aber richtig informiert bin, hat er vier israelische Operateure ganz allein getötet, ich meine, dieses ganze Gewäsch von unserer neuen Sondereinheit und all der andere Scheiß, der in den Zeitungen stand, das war doch wohl nichts weiter als ein Nebelvorhang. Er hat es doch allein getan, oder?«
Christian Kalléns Unsicherheit rührte davon her, daß die ganze Angelegenheit mit dem grünen Stempel Streng geheim versehen worden war. Das hatte natürlich zu zahlreichen Gerüchten geführt, aber Gerüchte sind nun mal Gerüchte, und jetzt bekam Kallen plötzlich die Chance, Genaueres zu erfahren.
»Schon richtig«, seufzte Näslund erneut, »und wenn wir ihn damals nicht gestoppt hätten, fürchte ich, wäre alles nur noch schlimmer geworden. Ein verteufelt unangenehmer Typ, dieser Hamilton.«
»Das hört sich aber nicht so an, als würdest du seine Qualifikation anzweifeln?«
Näslund betrachtete seinen Untergebenen. Er war sich nicht sicher, ob er da eine ironische Untertreibung herausgehört hatte. Der neue Chef der Terrorismus-Abteilung hielt ihm jedoch ein vollkommen ausdrucksloses, fragendes Gesicht entgegen.
»Nein, ganz und gar nicht«, erwiderte Näslund, trat ans Fenster und blickte auf den düsteren Dezembermorgen hinaus. Draußen fiel schwerer, dicker Schnee.
Näslund zufolge war Hamilton nichts weiter als eine elende Erfindung der Militärs, ein beim schwedischen Sicherheitsdienst total überflüssiges Phänomen. Und der militärische Nachrichtendienst, auf dessen Rechnung Hamilton erschaffen worden war – oder wie immer man es nennen sollte –, wollte ihn ja offensichtlich auch nicht haben, aus welchem Grund auch immer, möglicherweise sogar wegen seiner politischen Vergangenheit. Waren die beim Verteidigungsstab wirklich so dämlich?
»Wenn er aber die Qualifikation besitzt«, fuhr Kallén fort, »brauchen wir ihn den Deutschen doch nur als Weihnachtsgeschenk zu geben. Denn es läßt sich doch wirklich nicht leugnen, daß diesmal sie es sind, die uns um etwas bitten.«
Die Bemerkung stand einen Moment im Raum. Kallén konnte das Unbehagen seines Chefs nicht verstehen. Kalléns Vorgänger war ermordet worden. Und offensichtlich war es dieser Hamilton gewesen, der die Mörder mehr oder weniger auf eigene Faust aufgespürt und sie danach bei einer bewaffneten Konfrontation getötet hatte.
»Es ist einfach nur so, daß ich den Kerl nicht mag«, knurrte Näslund, der noch immer am Fenster stand und in den Schneeregen hinausblickte. »Er ist eine Mordmaschine. Irgendwo in den USA ausgebildet, ich kenne nicht mal die Details. Das war so ein verfluchter Einfall des Alten.«
»Des Alten, welcher Alte?«
»Das ist der Mann, der früher die operative Seite des militärischen Nachrichtendienstes unter sich hatte. Er hatte vor, auf der militärischen Seite so etwas wie eine neue Garde von Agenten aufzubauen. Irgend etwas ging schief, warum weiß ich nicht, und dann hatten wir Hamilton plötzlich am Hals.«
»Offengestanden, ich verstehe nicht, was du meinst.«
Kallen zögerte, bevor er fortfuhr. Näslund war nicht gerade als toleranter Chef bekannt, der Einwendungen zu schätzen wußte. Kallen hatte sich aber von seiner Neugier überrumpeln lassen, und wer A sagt, muß auch B sagen. Er holte tief Luft, bevor er wieder ansetzte:
»Ich meine … wenn Hamilton nicht eingegriffen hätte … hätten wir dann überhaupt diese Israelis erwischt, die Folkesson erschossen haben?«
»Nein«, erwiderte Näslund ruhig, während er sich umdrehte und Kallen offen in die Augen blickte, »das hätten wir nicht geschafft, und wenn es uns wider Erwarten gelungen wäre, hätte das bei uns vermutlich zu weiteren Verlusten geführt. Das ist jedoch nicht das Problem. Es ist einfach nur so, daß solche Figuren bei den Militärs vielleicht ganz in Ordnung sind, aber nicht bei uns, denn hier machen sie nur Ärger. Ich will damit sagen, daß es nicht so ganz leicht sein wird, diesen Werwolf zu stoppen, wie unsere geschätzten deutschen Kollegen vielleicht glauben.«
Es wurde wieder still im Raum, und Näslund blickte wieder unentschlossen zum Fenster hinaus. Er erwartete keinen weiteren Kommentar seines obersten Terroristenbekämpfers. Allerdings konnte er die Besprechung auch nicht beenden, ohne zu irgendeinem konkreten Beschluß zu kommen. Zu welcher Entscheidung er in dieser Lage auch kam, sie würde garantiert unangenehme Folgen haben. Aber dann – zunächst glaubte er, sich verhört zu haben, doch als er herumwirbelte, stand der stellvertretende Polizeipräsident Christian Kallen tatsächlich mitten im Zimmer und lachte. Es war ein ersticktes Lachen, das aber gleichwohl klar und deutlich zu hören war.
»Was ist so verteufelt lustig daran?« fragte Näslund mit merklich verhaltener Kälte in der Stimme.
»Denk doch mal nach. Wir haben uns anderthalb Stunden lang eine gelinde gesagt komplizierte Darlegung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland angehört, dazu noch etwas über demokratische Garantien und komplizierte Gesetze und weiß der Himmel was sonst noch. Und dann? Nach einem Wust von Juristerei und Paragraphen, nachdem wir eine Woche in den Gesetzbüchern hin und her geblättert haben, endet das Ganze damit, daß ein Staat in gut demokratischer Manier einen Killer mietet. Du mußt zugeben, daß Don Corleone schneller zum Schuß kommen würde.«
»Don Corleone? Welcher Corleone, zum Teufel?«
»C-o-r-l-e-o-n-e. Du weißt doch, der Pate, Mafia. Wir drehen hier zwar ein paar juristische Pirouetten, aber es läuft auf das gleiche hinaus. We have put a contract an those guys, nicht wahr?«
Näslund war durchaus nicht amüsiert. Er verstand die Pointe nicht, wollte aber nicht um weitere Erklärungen bitten. Er verfluchte seine Situation. Es war unausweichlich, daß er jetzt diesen Hamilton um etwas bitten mußte, und das war eine Vorstellung, die ihm ganz und gar nicht behagte. Es blieb ihm aber keine Wahl. Die Deutschen hatten recht. Es stand tatsächlich viel auf dem Spiel.
Wenn die Deutschen ihre Zusammenarbeit nicht bekämen, würde der Informationsfluß aus Köln künftig wohl etwas dürftiger ausfallen. Immerhin war der Verfassungsschutz eine ihrer allerwichtigsten Informationsquellen.
Näslund ging plötzlich auf, was mit Corleone gemeint gewesen war. Sein Gesicht hellte sich ein wenig auf.
»Also gut«, sagte er, »they gave us an offer we couldn’t refuse. So ist es tatsächlich.«
Er drückte auf den Knopf der Gegensprechanlage und stellte fest, daß seine Sekretärin an ihrem Platz saß.
»Verbinde mich mal mit diesem Hamilton, du weißt doch, Carl Gustav Gilbert Hamilton, irgendwo in Gamla Stan.«
Es gab nur einen Mann, den Carl verabscheute. Und die Sekretärin dieses Mannes hatte jetzt drei dringende Mitteilungen auf seinen Anrufbeantworter gesprochen. Sie sagte, es gehe um eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit. Das hörte sich aus ihrem Mund unnatürlich an. Natürlich mußte es sich um etwas Dringendes handeln, aber wenn Näslund dahintersteckte, konnte die Angelegenheit nur unangenehm sein.
Carl lag mit einem Badelaken um die Hüften auf seinem Bett. Er hatte in seiner eigenhändig eingerichteten Mischung aus Fitness-Studio und Schießstand soeben eine Trainingsrunde hinter sich gebracht; der Trainingsraum lag auf der Hofseite der Wohnung hinter einer Stahltür. Er hatte in den letzten Monaten sehr hart trainiert, weil er den Eindruck gewonnen hatte, daß er allmählich zu altern und fett zu werden begann, und wohl auch, weil er ein Ventil für seine Aggressionen und seine Verzweiflung gebraucht hatte, falls Verzweiflung das richtige Wort dafür war. Kein Tag seines bisherigen Lebens, soweit er sich erinnern konnte, war mit dem Fiasko dieses 2.Dezember vergleichbar.
Am Morgen war die Post ungewöhnlich früh gekommen, noch bevor er zur Militärhochschule gegangen war, um die theoretische Schlußprüfung des Hauptmannskurses abzulegen. Zunächst sah es aus, als wären nur ein paar Rechnungen gekommen, aber dann entdeckte er die Ansichtskarte aus Kalifornien. Die Karte war von Tessie. Man hatte sie ihm von seiner alten Adresse nachgeschickt. Die sachliche Mitteilung war kristallklar, aber dennoch völlig unbegreiflich:
Lieber Charlie,
habe heute geheiratet. Rechne damit, glücklich zu werden. Wollte nur, daß Du es weißt.
Tessie
Das Motiv auf der Vorderseite der Karte war trivial: Surfbretter im Sonnenschein auf einer schön geschwungenen Woge. So war es aber gewesen. Das Foto hätte genausogut aus der Zeit stammen können, als sie noch zusammen waren, und das hatte sie natürlich auch gewußt, als sie die Karte aussuchte.
Warum wollte sie, daß er es erfuhr? Wollte sie ihm weh tun, oder wollte sie ihm zu verstehen geben, daß eigentlich sie ein Paar hätten werden sollen? Hatte sie je begriffen, warum er nie erzählen konnte, aus welchem Grund er in diesen zweieinhalb gemeinsamen Jahren so gut wie jede Woche einmal aus der Stadt verschwunden war?
Und warum hatte er ihr nichts erzählt? In dem Fall hätte ja alles anders kommen können. Nein, in der Kernfrage hätte auch das nichts geändert. Der zivile Teil seiner kalifornischen Ausbildung war nichts Besonderes, abgesehen vielleicht von den Computerkursen. Da sie Jura studierte, würde sie mit ihrer Ausbildung in Schweden nichts anfangen können. Und da seine Ausbildung hauptsächlich militärischer Natur war und geheim dazu, konnte er sich kaum in die USA absetzen; nein, es hätte wohl nie geklappt.
Am Ende waren sie im Unfrieden auseinandergegangen, weil er nicht erzählen konnte, warum er regelmäßig von der University of California in San Diego verschwand und mit dem Wagen nach Norden fuhr.
In den fünf Jahren in den USA war er zunächst ausgebildet worden und hatte dann auf der Californian Sunset Farm, wie jemand scherzhaft das Gegenstück der amerikanischen Navy und des FBI zur Farm der CIA in Maryland an der Ostküste getauft hatte, als Ausbilder-Assistent gearbeitet. Er hätte es ihr sagen können. Ein paar Sätze hätten genügt. Vielleicht wäre es dann aber so gekommen, daß er nach diesen Sätzen gezwungen gewesen wäre, deren Wahrheitsgehalt gegen ihre nicht ganz unverständlichen Zweifel zu verteidigen. Dann hätte er sich verheddert: Er hätte beschreiben müssen, mit welcher Technik er zu töten gelernt hatte, mit Messer, Pistole oder Sprengstoff, mit Granatwerfern oder RPG oder Funkwellen bis hin zu TNT und Sprengladungen im Auspuff eines Autos; vielleicht hätte er sich sogar dazu hinreißen lassen, ihr ein paar kleine Vorstellungen zu geben. Vielleicht hätte er ihre sämtlichen Schlösser mit einem der kleinen Instrumente geöffnet, die er in Gestalt eines harmlos aussehenden roten Schweizer Armee-Taschenmessers in der Hosentasche trug, eines Messers, bei dem Korkenzieher, Lupe und einige andere Kleinigkeiten gegen Instrumente ganz anderer Art ausgewechselt worden waren.
Nein, das wäre nicht gegangen. Es wäre unmöglich gewesen. Es war richtig gewesen, ihr nichts zu sagen. Und wenn er sich ihr offenbart hätte, hätte das ihre Beziehung ebenfalls beendet. In den letzten Jahren war es ihm beinahe gelungen, sich das einzureden; ihm kam es vor, als wäre die Wunde verheilt. Und jetzt hatte sie wieder zu bluten begonnen – das Ergebnis einer einzigen Ansichtskarte. Ihm war rätselhaft, warum Tessie sie geschrieben hatte. Sie hatte ihm mehr bedeutet als jeder andere Mensch, sagte er sich jetzt. Mehr als jeder andere, flüsterte er vor sich hin, um sich den Wahrheitsgehalt seiner Worte von der Stille im Raum bestätigen zu lassen.
Er stand mit einem Ruck auf und ging mit langen Schritten zur Rückseite der Wohnung und durch die Eichentür, hinter der sich die Stahltür mit dem Sicherheitsschloß befand. Er schloß auf, betrat seinen Übungsraum und ging zum Waffenschrank. Er entnahm ihm einen Revolver des Kalibers .22, für dessen Lärmpegel seine selbstgemachte Schallisolierung wohl genügte, denn bis jetzt hatte sich noch kein Nachbar beschwert.
Er schoß eine halbe Stunde lang. Das war seine Methode, jede Gedankentätigkeit abzuschalten; mit einer Waffe in der Hand versank er in absolute Konzentration, in welcher Gemütsverfassung auch immer er sich noch eine Minute zuvor als Unbewaffneter befunden haben mochte oder in dem Augenblick, bevor sich die rechte Hand in einem exakt kalkulierten, nicht zu harten Griff um den Kolben schloß. Zorn, Verzweiflung, Müdigkeit, Angst – solche Stimmungen beeinträchtigen die Präzision im rechten Zeigefinger. Die Bewegung muß entschlossen, zugleich aber sehr leicht sein, sonst landet der Treffer am unteren linken Rand der Zielscheibe.