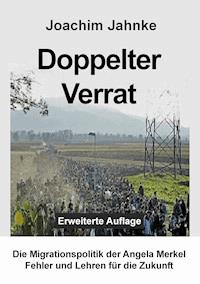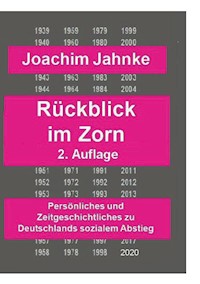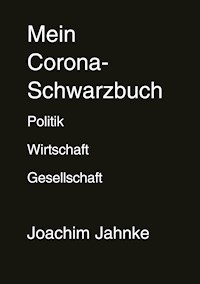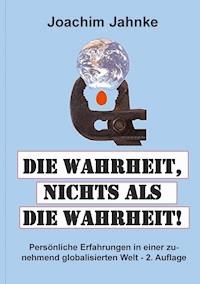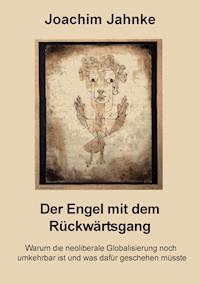
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autor beschäftigt sich seit 12 Jahren mit seiner Webseite Infoportal und einer Reihe von Büchern sehr kritisch mit den Auswuchsen einer ungehemmten, neoliberalen Globalisierung. Kaum eine wirtschafts-politische Entwicklung war in Deutschland so lange so märchenumwoben wie diese. Doch heute melden die davon erheblich Benachteiligten in Deutschland und anderen entwickelten Industrieländern massenhaft ihren Protest an. Damit stellt sich die Frage, ob dieser Prozess umkehrbar ist und was dafür geschehen müsste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung: Die Rolle rückwärts, eine Utopie?
Kapitel 1: Kräfte und Argumente auf dem Irrweg
Die deutsche Politik als treibende Kraft
Der „Oberglobalisierer” Schröder und seine Reformen
Das globale Aufreissen der Waren- und Arbeitsmärkte
China, Elefant im marktwirtschaftlichen Porzellanladen
Das globale Aufreissen der Finanzmärkte
Die Super-Globalisierungsbehörde: EU Kommission
Der Euro als Paradeprojekt neoliberaler Globalisierer
Lenkungsgremien der globalisierten Welt
Die grössten Wirtschaftsmächte unter sich
„Davos Man”
Fukuyama: „The End of History and the Last Man”
Kapitel 2: Die Bilanz
Das Gedankengerüst
Entwicklung von Einkommen und Vermögen
Die Renten und die Armut
Die anderen gesamtwirtschaftlichen Daten
Die ökonomische Bremsspur wachsender Ungleichheit
Die demographische Bremsspur
Immigration und innere Sicherheit
Die Umwelt zahlt für die Kosten, weit mehr als früher
Ein Blick über den deutschen Tellerrand
Einiges war besser in Deutschland, aber
Die Nostalgiefalle
Kapitel 3: Zu den Chancen für eine Umkehr
In der Wagenburg
Keine Umkehr der Eliten: CETA und so weiter
Die Schwäche der Proteste
Ein dummhaltendes Bildungssystem
Kapitel 4: Der Rückweg - Was geschehen müsste
Kapitel 5: „Retrotopia“ - Die Umkehr als Utopie?
Ein kurzes Nachwort
Anhang1: Immigration - Afrika
Anhang 2: Schwächen des deutschen Bildungssystems
Anhang 3: Sozialpolitik im Zeichen der Globalisierung (Auszug aus Schulfuchs.de)
Einleitung: Die Rolle rückwärts, eine Utopie?
Wer wie ich 1939 das Licht der Welt erblickte, wurde in den zweiten Weltkrieg hineingeboren, unter dem er dann in jungen Jahre meist selbst erheblich zu leiden hatte. Sehr viele Kinder haben ihre Väter verloren oder während langer Kriegsgefangenschaft vermissen müssen. Andererseits waren sie bei Kriegsende 1945 meist gerade so alt, dass sie die Dimensionen des deutschen Untergangs mindestens schemenhaft wahrnehmen konnten. Bis zum Ende der siebziger Jahre war dieser Jahrgang so etwa vierzig Jahre alt und in dem, was man damals noch die besten Mannesjahre nannte.
Verglichen mit 1945 war es eine total andere Welt. Es gab in den siebziger Jahren nur den einen und dann sehr kurzen Wirtschaftseinbruch von 1975. Entsprechend gross war bei den meisten Menschen der Optimismus. Eine globale Welt gab es natürlich schon, doch spürte man wenig davon, allenfalls während der Ölkrise von 1973. Kaum jemand musste sich Gedanken um die Sicherheit von Renten und die Gefahr von Altersarmut machen, fast paradiesisch im Blick von heute.
Mit dem Kniefall Brandts von Warschau und den von ihm geschlossenen Moskauer und Warschauer Verträgen, die die Oder-Neisse Grenze anerkannten, hatte Deutschland seine aussenpolitische Lage stabilisiert und war nun auch nach Osten ein respektierter und geschätzter Partner geworden. Deutschland holte 1974 die Welt zur Fussballweltmeisterschaft ins Land und war dabei sogar erfolgreich. Der Vietnamkrieg, der meine Studentengeneration protestierend auf die Strassen getrieben hatte, ging 1975 zu Ende. Während 1974 in USA die Watergate-Affäre Präsident Nixon zum Rücktritt zwang, war die deutsche Demokratie gefestigt und überstand auch relativ unbeschädigt den „Deutschen Herbst” von 1977, in dem sich die RAF auf ihre Mordserie machte.
Anders als heute waren die jungen Generationen politisch sehr aktiv. Zwar waren die Hochzeiten der Mitte der Sechziger entstandenen APO und der Studentenbewegung von 1968 vorbei. Doch kam es nun zu den „Neuen Sozialen Bewegungen” für Frauen, Schwule und Lesben, für Behinderte, den Frieden, die Ökologie, die Bürgerinitiativen, gegen die Atomkraft und für die Dritte Welt. Wir erlebten die Hippies, den Punk, die europäischen Ausläufer des indischen Bhagwan und die Jesus-People. In der Technik begann schnell erfolgreich die Ära der Personal Computer. In den siebziger Jahren (wie schon zuvor in den Sechzigern) fand der „Neue Deutsche Film” weltweite Anerkennung, was ihm seitdem in diesem Umfang nie wieder gelang. Im Zeichen der „Neuen Subjektivität” sprudelte die deutsche Literatur auf hohem Niveau mit Autoren wie Grass, Handtke, Walser und vielen anderen.
Von denen, die wie ich aus dem Jahrgang 1939 das Ende des Zweiten Weltkriegs schon halbwegs bewusst erlebten oder älteren Jahrgängen angehören, leben heute noch etwa sechs Millionen Menschen. Das sind die Letzten, die für diesen Neubeginn Deutschlands noch aus eigenem Bewusstsein zeugen können, nur noch ein kleiner Teil von jetzt weniger als acht Prozent der Bevölkerung unseres Landes. Alle anderen müssen nachlesen, was damals geschehen ist. Die meisten werden sich gar nicht mehr dafür interessieren. Meine Generation hat jedenfalls noch bis in die siebziger Jahre optimistisch nach vorn geblickt.
Seit beginnend in den späten siebziger Jahren und besonders unter der rot-grünen Koalition Gerhard Schröders ab 1998 die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland immer weiter abgebaut und dies mit den Notwendigkeiten aus der Globalisierung begründet wurde, beschleicht viele Menschen eine rückwärts gerichtete Wehmut, und das neuerdings zunehmend. Sie wird begleitet von einer Wut auf das, was die Neoliberalen brutal und rücksichtslos mit der neoliberalen Globalisierung über die letzten Jahrzehnte in Deutschland und anderswo angerichtet haben. Dazu kommt bei mir neuerdings eine klamm-heimliche Freude über jeden Stein, der von einer endlich wenigstens teilweise aufwachenden Menschheit auf dieses System geworfen wird. Man kann einen solchen Geisteszustand auch als „Hoffnung rückwärts” bezeichnen, während normalerweise Hoffnung immer nach vorn gerichtet wird. Es ist eine Hoffnung, dass das, was jetzt schon etwas rückwärts liegt, wieder nach vorne kommt.
Der Gedanke ist nicht neu. Paul Klee hat 1920 eine Zeichnung vom „Angelus Novus”, dem neuen Engel, geschaffen, die später durch Walter Benjamin bekannt wurde. Der hatte sie erworben und ständig bei sich geführt, als er über den Sinn der Geschichte nachdachte. Er schrieb dazu 1940, bevor er sich als aus Deutschland nach Frankreich geflüchteter Jude dort das Leben nahm:
„Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heisst. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füsse schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schliessen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.”
Benjamin ging es, so der Philosoph Stéphane Mosès, um eine radikale Kritik der historischen Vernunft, d.h. der Ideen der Kontinuität, der Kausalität und des Fortschritts, der optimistischen Geschichtsauffassung, die in der Geschichte einen stetigen Gang zur schliesslichen Vollendung der Menschheit sah. Diese abweichende Auffassung von geschichtlicher Zeit, die dem Glauben an eine auf das letztendliche Heil hinfortschreitende Geschichte gegenübersteht, übernimmt aus der jüdischen Theologie den Gedanken, dass die Geschichtszeit nicht irreversibel ist und das Hernach das Zuvor verändern kann. Es sei die Aufgabe des Eingedenkens, schreibt Benjamin, „zu retten, was gescheitert ist”.
Die Struktur einer wirklich sozialen Marktwirtschaft und eines damit verbundenen Heimatgefühls, wie sie vor dem Ansturm der neoliberalen Globalisierer in den siebziger Jahren und auch noch, wenngleich bereits erheblich beschädigt, vor der Jahrtausendwende in Deutschland bestanden hatte, wäre immer noch mit Benjamins Eingedenken zu retten. Man muss dafür den Weg, den man aus der Vergangenheit angeblich nach vorne gegangen ist, wieder ein Stück zurückgehen. Dabei hilft vielleicht die Vorstellungswelt der meisten Menschen, die von den Globalisierern bisher gar nicht mitgenommen, sondern in der Zeit davor zurückgelassen wurden und die daher oft fälschlich glauben, noch in einer sozialen Marktwirtschaft zu leben.
Um einen gangbaren Weg zurück zu suchen und eventuell zu finden, braucht es einige Vorbereitungen. Erstens muss man sich bewusst machen, von welchen Kräften mit welchen Argumenten in unseren demokratischen Gesellschaften die Situation von heute herbeigeführt wurde, wie man also auf diesen Weg gekommen ist. Zweitens gehört eine ehrliche und umfassend vergleichende Bilanz des Gemeinwohls von heute und dessen von gestern, in Deutschland also zu den Hochzeiten der sozialen Marktwirtschaft, dazu. Drittens müssen die hohen Hürden analysiert werden, die sich, zumal in einer vernetzten Welt, schon vor einer teilweisen Rück- oder Umkehr aufbauen. Erst dann zeichnet sich je nach Ergebnis ein Weg zurück ab, oder eben auch nicht.
In diesem kleinen Buch ist eine solche Arbeit nur ansatzweise möglich. Statt perfekte Lösungen zu finden, geht es um Denkanstösse. Selbst ein kleines Stückchen Weg zurück, wäre nur in einem längeren und schwierigen Prozess zu schaffen und besonders viel Optimismus in jedem Fall unberechtigt.
Der Weg zurück führt mitten hinein in den sich derzeit zuspitzenden Konflikt zwischen den „Nirgendwos”, die nirgendwo und damit überall zu Hause sind, und den sehr viel zahlreicheren „Irgendwos”, die noch irgendwo eine ursprüngliche lokale Fixierung haben, also den Globalisierungsaufsteigern und - absteigern. Der Soziologe Prof. Armin Nassehi hat von einem „Kulturkampf” gesprochen zwischen zwei Lagern in den Gesellschaften der fortgeschrittenen Industrieländern, nämlich zwischen einerseits einer sehr kosmopolitischen, moralisch allzu selbstbewussten und selbstgerechten, auch oft mit ökonomischer Potenz gedeckten Gruppe, die quasi mit links Begriffe wie Kultur, Volk, Nation dekonstruiere, aber auch veränderten Arbeitswelten offen gegenüber eingestellt sei, und andererseits den Verlierern, die nun erlebten, wie das, was noch vor einiger Zeit als Mittelschichtsnormalität galt, zumindest in Frage gestellt werden könne, nicht nur im Hinblick auf Migrationsfragen, sondern auch im Hinblick auf Familienformen, Geschlechterrollen, sexuelle Orientierungen, neue Arbeitsformen und professionelle Kompetenzen.
Die folgenden Ausführungen bauen teilweise auf meinen früheren beiden Büchern zur Sozialen Marktwirtschaft auf, werden aber erheblich ergänzt und auf jeden Fall umfangreich aktualisiert, um soweit möglich auf den Stand von 2016/17 und der heutigen Diskussion über Folgen und Rückzug aus der neoliberalen Globalisierung zu kommen.
Bangor, im Mai 2017
Kapitel 1: Kräfte und Argumente auf dem Irrweg
Man muss sich bewusst machen, von welchen Kräften mit welchen Argumenten in unseren demokratischen Gesellschaften die Situation von heute herbeigeführt wurde. Die neoliberale Form der Globalisierung ist ja nicht vom Himmel gefallen. Sie ist auch nicht unvermeidbar gewesen, wie uns Politiker aller Couleurs immer wieder weismachen wollten.
Gerade deutsche Politiker pflegten sich bei den harten sozialen Einschnitten hinter der Globalisierung, gegenüber der sie angeblich ohnmächtig waren, zu verstecken. Beispielsweise hatte Erhard Eppler davon gesprochen, dass sich die Gestaltungsmöglichkeiten für Politik durch die Globalisierung der Märkte dramatisch verringert hätten und Politiker gar nicht mehr das leisten könnten, was die Bürger von ihnen erwarten. Oder Gerhard Schröder: „Man darf ja nicht darüber hinwegsehen, dass die Globalisierung uns zu bestimmten Massnahmen zwingt.” Oder der frühere Bundespräsident Köhler: „Die Welt ist in einem tief greifenden Umbruch. Wer hier den Zug verpasst, bleibt auf dem Bahnsteig stehen.”
Die deutsche Politik als treibende Kraft
Tatsächlich aber waren gerade deutsche Politiker an dem Irrweg in die neoliberale Globalisierung massgeblich und in vorderster Linie beteiligt. Dafür sorgte schon der Druck der in Deutschland besonders gut aufgestellten Verbände von Handel und Industrie und insbesondere der deutschen Multis. Schon im September 1982 legte Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff sein „Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit” vor, mit dem die sozial-liberale Koalition aufgelöst wurde und die schwarze Wende zu Helmut Kohl kam. Sein eigentlicher Autor im Ministerium war der Leiter der Grundsatzabteilung Tietmeyer, der - obgleich CDU-Mann - unter Helmut Schmidt Karriere bis in politische Beamtenpositionen hinein machen konnte und dann unter Kohl Staatssekretär und später Chef der Bundesbank wurde und bis 2012 Vorsitzender des Kuratoriums der neoliberalen „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft” war.
Das Lambsdorff-Papier sah u.a. eine „Verteidigung und Stärkung des offenen, multilateralen Welthandelssystems und aktives Vorgehen gegen protektionistische Bestrebungen” vor. Damit wurde die neoliberale Globalisierung auch in Deutschland endgültig eingeläutet. Vieles aus diesem Papier wurde später unter Kohl und Schröder mit dessen Agendapolitik umgesetzt.
Lambsdorff war Mitglied der „Trilateral Commission”, einer der wichtigsten Motoren für eine globalisierte Welt. Sie war 1973 auf Initiative von David Rockefeller bei einer Bilderberg-Konferenz als private, politikberatende Denkfabrik gegründet worden und umfasst rund 400 höchst einflussreiche Mitgliedern aus den drei grossen internationalen Wirtschaftsblöcken Europa, Nordamerika und Japan sowie einige ausgesuchte Vertreter ausserhalb dieser Wirtschaftszonen. Auf diesem Weg verbindet die Trilaterale Kommission erfahrene politische Entscheidungsträger mit dem privaten Sektor.