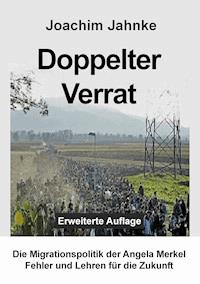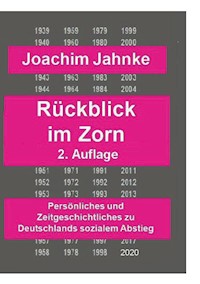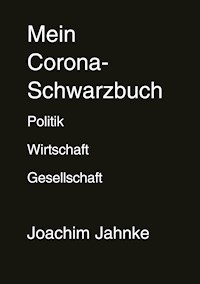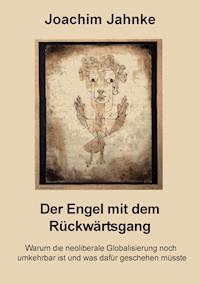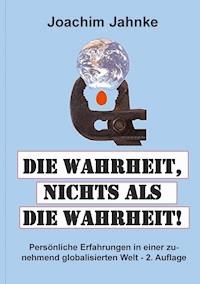
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autor beschäftigt sich seit 12 Jahren mit seiner Webseite Infoportal und einer Reihe von Büchern sehr kritisch mit den Auswüchsen einer ungehemmten, neoliberalen Globalisierung. Kaum eine wirtschafts-politische Entwicklung war in Deutschland so lange so märchenumwoben wie die der Globalisierung. Wir alle galten als absolute Profiteure, besonders wir Deutschen wegen unserer Exportüberschüsse, obwohl der negative Lohndruck der Niedriglohnkonkurrenz den sozialen Graben in Deutschland immer weiter aufgerissen hat und der Vorteil überwiegend von den Multis und ihren Kapitaleigner kassiert wurde. Es ist nicht einfach, hinter die ganze Wahrheit zu kommen. Der Autor konnte allerdings über die vergangenen 50 Jahre, meist als Insider dieser Entwicklung, immer wieder in deren finstere Abgründe blicken. Wir leben derzeit in einem schrecklichen Krisenmodus, zwischen Kriegen im Nahen Osten und ihren Flüchtlingswellen, Terroranschlägen, massiver Wirtschaftsmigration vor allem aus Afrika, Brexit und Trump sowie ähnlich drohende Bewegungen in Europa, der sozialen Krise wachsender Ungleichheit und ausgebremster Aufwärtsmobilität, Eurokrise, Umweltkrise, Finanz- und Bankenkrisen, sowie schweren weltwirtschaftlichen Ungleichgewichten, die durch Globalisierung angerichtet und noch verstärkt werden. Dieser Rückblick auf persönliche Erfahrungen geht von 1966 bis heute. Dies ist die leicht ergänzte und überarbeitete Auflage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
1965 -1968: Frühe Erfahrungen mit der Globalisierung in Köln und Paris
Gastarbeiter als Globalisierungsvorreiter
An der ENA
1969 – 1970: Bundeswirtschaftsministerium und die europäische Montanunion
Als „Hilfsreferent“ in Europa
1971: Die EU-Kommission von Innen
Globaler Krieg der Währungen
Osteuropa: Global nach Osten
Osthandel
Deutsch-sowjetische Wirtschaftskommission
Anfänge der neoliberalen Phase von Globalisierung
1983 – 1989: Luft- und Raumfahrt global
1989 - 1993: Die Dritte Welt und die Globalisierung
Globalisierung der Dritten Welt - Eine zweifelhafte Bilanz
Südafrika, Saudi-Arabien
Die Welthandelsorganisation als Motor der Globalisierung
Ein Kardinalfehler der Globalisierung: China und die WTO
1989 – 1993: Rüstungsexport
Globale Ausbreitung von Massenvernichtungstechnologie
Gesamtdeutsche Erfahrungen kurz vor Ende der DDR
Globalisierung nach Osten
1991 – 1993: EBWE und London als Mekka der Globalisierung, die ersten Jahre
Die „glitzernde Bank”
Eine total andere Kultur
Globale Spekulation
Steueroasen
Global enthemmte Banken
1993 – 2002 EBWE: Die letzten von 10 Jahren
Russlands schwere Krise
Horst Köhler kommt
Sorge um die Umwelt
Nukleare Sicherheit
Die Anfänge des globalen Protestes
2005 – heute: Mein Privatkrieg gegen die neoliberale Globalisierung
Mein Buchkrieg
Ein Buch für die Gewerkschaften
Seit 2005: Das Infoportal und die Rundbriefe
Themen und Streitpunkte
Globalisierung und China
Der Euro und seine Krisen
Bildung und Mobilität
Soziale Aufspaltung
Probleme mit der Migration
Eine sich zuspitzende Umweltkrise
Nachwort und Nachdenkliches
Anhang: Frühe Prägung
Anhang: Zwei Rundbriefe
Einleitung
So wie die Globalisierung ein globales Unternehmen ist, so findet auch die Propaganda für sie seit vielen Jahren mit ähnlichen Argumenten global statt. Ich habe mit meinen Büchern, Rundbriefen und der Webseite seit fast zwölf Jahren gegen die damit verbundene Verdummung angeschrieben. Den Menschen aus den Entwicklungsländern wird fälschlich eingeredet, sie würden nur so aus der Armut gehoben werden können, denen in den entwickelten Industrieländern, sie wären Gewinner der fortschreitenden Globalisierung, als gäbe es nicht ähnlich viele Verlierer. Die Propaganda kam und kommt aus allen Rohren und findet umso mehr auf fast denselben Wellenlängen um den Globus herum statt, als auch die hauptinteressierten Multis überall in den Stellungen sind und fast die gleiche Sprache sprechen oder durch ihre Regierungen sprechen lassen. Die Völker frassen es ihnen jahrzehntelang verdummt aus den Händen.
Kaum eine wirtschafts-politische Entwicklung war in Deutschland so lange so märchenumwoben wie die der Globalisierung. Wir alle galten als absolute Profiteure, besonders wir Deutschen wegen unserer Exportüberschüsse, obwohl von dem Ertrag durch faule Kredite und Währungsbewegungen viel wieder verloren gegangen ist und der negative Lohndruck der Niedriglohnkonkurrenz den sozialen Graben in Deutschland immer weiter aufgerissen hat. Die Gottväter der Wirtschaftswissenschaften, die Regierungen, die Medien und erst recht die eigentlichen Profiteure, nämlich die Wirtschafts- und Finanzunternehmen, hatten sich bei uns für die Richtigkeit solcher Sprüche verbürgt.
Ich selbst konnte allerdings über die vergangenen 50 Jahre, meist als Insider dieser Entwicklung, immer wieder in deren finstere Abgründe blicken. Dieser Rückblick auf persönliche Erfahrungen geht durch meine zehn in dieser Hinsicht unterscheidbaren Lebens- und Berufsphasen von 1965 bis heute. Meine soziale Einstellung ist in sehr jungen Jahren durch die eigene Lebenserfahrung geprägt worden; dazu mehr im Anhang.
Als ich die Schlusszeilen am Ende des Jahres 2016 schrieb, wurde mir sehr bewußt, in welchem Krisenmodus wir derzeit leben: Kriege im Nahen Osten und ihre Flüchtlingswellen, Terroranschläge, massive Wirtschaftsmigration sogar aus Afrika, die soziale Krise wachsender Ungleichheit und ausgebremster Aufwärtsmobilität, Eurokrise, Umweltkrise, Finanz- und Bankenkrisen, schwere weltwirtschaftliche Ungleichgewichte, die durch Globalisierung angerichtet und noch verstärkt werden, ein nuklear aufrüstendes Nordkorea und ein aggressiveres China, Erdogans Gegenterror, Brexit und Trump sowie ähnlichen Bewegungen in Europa. Vieles davon kommt aus meiner persönlichen Sicht in den folgenden Kapiteln vor.
Das Titelbild spiegelt das eines Buches wider, das ich vor 9 Jahren unter dem Titel „Globalisierung: Legende und Wahrheit: Eine Volkswirtschaftslehre für nicht ganz Dumme“ geschrieben habe. Wenig wäre daran heute zu korrigieren.
Bangor, im Februar 2017
1. 1965 -1968: Frühe Erfahrungen mit der Globalisierung in Köln und Paris
Die Berufslage für Juristen war 1965 nicht besonders gut. Trotz schöner Examensergebnisse gab es für mich zunächst viele berufliche Absagen. Ich füllte die Zeit, indem ich an der Universität in Köln an meiner Dissertation arbeitete. Es ging dabei um die Rolle der Versicherungen im Völkerrecht. Das war für sich eigentlich schon ein globales Thema. Da erklärte mir gegen Abschluss plötzlich mein Doktorvater, der schon ausgesuchte Co-Referent sei ein deutscher Professor des islamischen Rechts und würde sicher darauf bestehen, dass ich meine Arbeit auch unter dem Blickwinkel des islamischen Rechtes anlegte. Nun kann man sich fragen, warum das islamische Recht schon damals eine solche Rolle an der Kölner Universität spielte. Das hing wahrscheinlich mit der grossen Zahl an türkischen Gastarbeitern zusammen, die gerade dort an den Fliessbändern bei Ford und anderswo arbeiteten oder früher gearbeitet hatten und deren Familien nun dort leben und das möglichst nach islamischem Recht.
Gastarbeiter als Globalisierungsvorreiter
Diese Gastarbeiter wurden nach dem Anwerbevertrag mit der Türkei von 1961 über viele Jahre durch ein deutsches Anwerbebüro aus den Slums um Istanbul geholt, wohin sie sich arbeitslos aus dem rückständigsten Landesteil Anatolien geflüchtet hatten. Dementsprechend hatten sie eine abgeschlossene türkisch-traditionelle Sozialisation hinter sich und holten später Ehefrauen und andere Familienangehörige mit gleich niedrigem Bildungsstand aus der Ost-Türkei nach. Das Anwerbebüro liess die türkischen Gastarbeiter lediglich durch einen Arzt auf Geschlechtskrankheiten überprüfen. Intelligenz war für die Fliessbandarbeit in Deutschland nicht gefragt und eher nachteilig, weil dann mit gewerkschaftlicher Organisation und Streiks um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen hätte gerechnet werden müssen. Es war ein starker Akt früher Globalisierung des deutschen Arbeitsmarktes. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn die deutsche Industrie in der Türkei investiert und dort die Arbeitsplätze geschaffen hätte. Aber so war es für sie bequemer und ausserdem konnte sie mit den Gastarbeitern die deutschen Arbeiter unter Druck setzen und von Lohnerhöhungen abhalten.
Heute sind sehr viele von ihnen selbst in der zweiten und dritten Generation nicht in Deutschland integriert und leben zu sehr grossen Teilen in abgetrennten Parallelgesellschaften von Grossstadtvierteln. Dort haben sie begonnen, mit ihrer fremden Kultur das Strassenbild zu bestimmen, zumal sie meist strenggläubige Sunniten sind. Wie wenig sie integriert sind, zeigte schon 2010 der Besuch Erdogans in Köln, als er seinen Landsleuten erklärte, „Assimilation sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. Viele Bundesländer haben sogar in ihrer Verzweiflung zur Unterrichtung von türkischen Schülern türkische Lehrer angestellt, die türkische Beamte sind und von Erdogans AKP gesteuert werden. Bei der Massenimmigration von Muslimen im Jahr 2015 hat Bundeskanzlerin Merkel die Fehler bei der Integration der Gastarbeiter einräumen und das mit dem Versprechen verbinden müssen, aus diesen Fehlern gelernt zu haben. Leider jedoch werden dieselben Fehler wiederholt werden. Das zeichnet sich schon jetzt ab.
Denn derzeit schafften es im Jahr bis November 2016 nur 34.000 Einwanderer aus den acht wichtigsten nichteuropäischen Asylherkunftsländern, eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu finden, obwohl über 400.000 als arbeitssuchende Flüchtlinge registriert sind. Von den Erfolgreichen haben 22 % nur einen Job als Leiharbeiter; mehr als die Hälfte arbeiten in wirtschaftsnahen Dienstleistungsbereichen, vor allem im Gastgewerbe. Von den angeblich von der Bundesregierung zu schaffenden 100.000 1-Euro-Jobs sind bisher erst rund 5.000 entstanden. Generell liegt das Median-Arbeitseinkommen der Ausländer über die Flüchtlinge hinaus derzeit auch bei Vollzeitbeschäftigten um mehr als ein Fünftel niedriger als bei einheimischen Arbeitskräften. Im Jahr 2000 hatte der Unterschied noch wenig mehr als 8 % betragen. Selbst als Vollzeitbeschäftigte konnten Ausländer zwischen den Jahren 2000 und 2015 im Schnitt brutto pro Jahr nur wenig mehr als 1 % zulegen. 2015 erhielten schon 36 % der Ausländer nur einen Niedriglohn unter 2.000 Euro und ohne die Westeuropäer wären es noch viel mehr gewesen.
Eine wirklich erfolgreiche Integration sieht ganz anders aus. Was hier passiert, ist schlicht ein Niedriglohnwettbewerb zwischen Flüchtlingen und generell Ausländern auf der einen Seite und Einheimischen auf der anderen, bei dem niemand gewinnen kann, ausser natürlich die Arbeitgeber. Der Profit dieser Form von Globalisierung des Arbeitsmarktes landet also bei den Unternehmen, während die Kosten mangelnder Integration und der überproportionalen Inanspruchnahme der Sozialsysteme von der Allgemeinheit über sehr viele Jahrzehnte zu tragen sind. Es war und ist ein Fall sogenannter Externalisation von Unternehmenskosten, wie er sonst vor allem im Umweltbereich zu beobachten ist.
Da auch die Gastarbeiter von Köln also ein früher Akt von Globalisierung des deutschen Arbeitsmarktes waren, habe ich bei meiner Dissertation und dem mir abverlangten islamischen Recht eine erste Erfahrung mit Globalisierung gemacht.
An der ENA
Die folgenden Jahre 1967 und 1968 waren für mich echte Jahre der Erfahrung mit der europäischen Integration, die ja ihrerseits ebenfalls ein globalisierendes Unternehmen für globale Märkte und Kulturen war und ist. Plötzlich fand ich 1967 zwar keinen Job, dafür aber eine Annonce des deutschfranzösischen Jugendwerkes für ein einjähriges Anschlussstudium an der französischen Verwaltungshochschule ENA in Paris. Die ENA sollte dafür sorgen, dass die höchsten französischen Staatsdiener bis zu den Staatspräsidenten in der gleichen elitären Wolle gefärbt waren und sich zugleich dafür eigneten, französische Interessen in internationalen Organisationen, vor allem in der Europäischen Union, kraftvoll durchzusetzen. Die deutsche Bundesverwaltung sah mit Neid auf die elitären französischen Produkte und dachte unter Kanzler Kiesinger zeitweise darüber nach, ein gleiches System in Deutschland einzuführen. Dazu kam es dann nicht, zumal es nicht zum deutschen Föderalismus gepasst hätte. Immerhin aber stellten die Bonner Ministerien sehr gern Nachwuchs ein, der an der ENA gewesen war, was auch mir später zum Berufseinstieg beim Bundeswirtschaftsministerium verhalf.
Also machte ich mich von Berlin aus nach Bonn auf die Reise, um dort erfolgreich die Aufnahmeprüfung des Deutschen Akademischen Austauchdienstes für die ENA zu durchlaufen. Im Herbst 1967 in Paris angekommen, gehörte ich zu einer etwa ein Dutzend Männer (keine Frauen!) starken deutschen Gruppe an der ENA. Sie setzte sich überwiegend aus Beamten zusammen, die direkt aus deutschen Ministerien kamen. Wir waren wenig in den französischen Betrieb integriert, zumal unsere französischen Kollegen ständig benotet und nach Rangfolge geordnet wurden und deshalb wenig Zeit für uns hatten. Für Zeitvertreib sorgte dagegen der Mai 1968 mit dem gewaltigen Studentenaufstand. Alles streikte, auch die ENA unter einer frisch über dem Dach aufgezogenen roten Fahne. Viele deutsche Kollegen waren als Beamte unsicher, ob sie sich überhaupt an einem Streik beteiligen durften. Da aber auch der öffentliche Verkehr eingestellt war, erledigte sich das Problem auf diese Weise.
An der ENA begriff ich auch, wie wenig die französische Wirtschaftsphilosophie mit der deutschen übereinstimmte. Eine höhere Inflationsrate galt als geeignet, um leichter private und vor allem staatliche Investitionen zu finanzieren, weil sich dann das Kreditvolumen real über die Inflationsrate verkürzt. Dagegen verband sich Inflation in Deutschland mit einer schon hysterischen Erinnerung an die Hyperinflation zwischen den Weltkriegen. Als ich später noch vor Einführung des Euro bei einer Konferenz in Deutschland Hans Tietmeyer, damals Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und einer der Väter des Euro, die wirtschaftspolitische Annäherung beider Länder preisen hörte, stellten sich bei mir sofort Zweifel ein. Waren das die Illusionen, die zum Euro führen würden?
Was hatte nun die ENA mit der Globalisierung zu tun? Sie zeigte uns, wie stark sich Frankreich zugleich auf seine Rolle in den globalen Organisationen vorbereitete und dass dies nicht im europäischen sondern allein im französischen Interesse erfolgte. So wurde ich damals schlagartig aus meinen eigenen internationalistisch-europäischen Träumen gerissen. Europa war für unsere deutsche ENA-Gruppe aus dem geteilten Lande noch die erträumte neue Heimat gewesen. Doch hier war zu erleben, wie fest der Nationalismus in Frankreich weiterhin verankert war. Immer wieder musste ich später in verschiedenen Ländern die gleiche Erfahrung machen: Die deutschen Träume von Europa wurden und werden bei unseren Nachbarn nicht geteilt. Wenn man damals die EU schätzte, dann wohl mehr als wirtschaftliches Bollwerk gegen den Kommunismus der Sowjetunion. Als sich später der grüne Aussenminister Fischer für ein föderales Europa aussprach, erntete er im Resteuropa nur ungläubige Verwunderung und fast ausschliesslich Ablehnung. Am Ende freute ich mich in meinem neu erwachenden Schmalspur-Nationalismus über jede schicke Mercedes-Karosse, die ich auf Pariser Strassen sehen konnte.