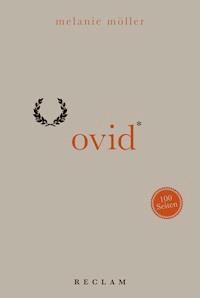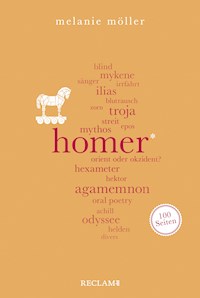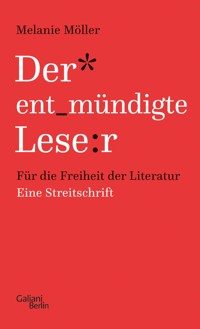
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Literatur muss frei sein, wild, darf böse sein und muss auch weh tun können, sonst verliert sie ihren Reiz, sagt Melanie Möller. Sie muss ein Freiraum bleiben für ungeschützte Gedanken und scharfe Worte. Dafür liefert die Autorin einen wilden Ritt durch mehrere Jahrhunderte Literaturgeschichte im Kampf für die Freiheit des Worts. Bibelverbot für Schulen in Utah, Verbannung von Klassikern aus Lehrplänen und Schulbüchern, glättende Übersetzungen, zensierte Klassiker, politisch korrekte Vorgaben für Literatur, Sensitivity-Reading, Triggerwarnungen, Verbot ›schwieriger‹ Vokabeln: Ein Verhängnis!, sagt Melanie Möller und warnt davor, den Leser zu unterschätzen. In Sachen Kunst darf es keine Abstriche geben. Wer verwässert, entmündigt den Leser – und der ist schlauer, als man denkt. »Was fehlt, ist ein leidenschaftlicher Kampf für die Autonomie der Literatur, der diese schützt wie eine bedrohte Minderheit – und zwar kompromisslos«, so die Autorin. Melanie Möller führt ihn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Melanie Möller
Der entmündigte Leser
Für die Freiheit der Literatur. Eine Streitschrift
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Melanie Möller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Melanie Möller
Melanie Möller ist Professorin für Latinistik an der Freien Universität Berlin und schreibt regelmäßig für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2016 erschien ihr Buch Ovid. 100 Seiten, 2017 organisierte sie die Veranstaltungsreihe Bimillennium 2017: Ovid und Europa.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Literatur muss frei sein, wild, darf böse sein und muss auch weh tun können, sonst verliert sie ihren Reiz, sagt Melanie Möller. Sie muss ein Freiraum bleiben für ungeschützte Gedanken und scharfe Worte. Dafür liefert die Autorin einen wilden Ritt durch mehrere Jahrhunderte Literaturgeschichte im Kampf für die Freiheit des Worts.
Bibelverbot für Schulen in Utah, Verbannung von Klassikern aus Lehrplänen und Schulbüchern, glättende Übersetzungen, zensierte Klassiker, politisch korrekte Vorgaben für Literatur, Sensitivity-Reading, Triggerwarnungen, Verbot ›schwieriger‹ Vokabeln: Ein Verhängnis!, sagt Melanie Möller und warnt davor, den Leser zu unterschätzen. In Sachen Kunst darf es keine Abstriche geben. Wer verwässert, entmündigt den Leser – und der ist schlauer, als man denkt.
»Was fehlt, ist ein leidenschaftlicher Kampf für die Autonomie der Literatur, der diese schützt wie eine bedrohte Minderheit – und zwar kompromisslos«, so die Autorin. Melanie Möller führt ihn.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Lisa Neuhalfen
Covermotiv: Umschlagillustration: © Lisa Neuhalfen
Lektorat: Florian Ringwald und Wolfgang Hörner
ISBN978-3-462-31298-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Zur Einführung
1. Homer und die Bibel
2. Ovid und Joseph Brodsky
3. Catull und Casanova
4. Properz und Herr von Goethe
5. Vergil und Heinrich von Kleist
6. Euripides und Annie Ernaux
7. Aristophanes und Shakespeare
8. Petron und Céline
9. Sappho und Astrid Lindgren
10. Zum Schluss
Zitierte Literatur
Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Damit es uns glücklich macht, wie Du schreibst? Mein Gott, glücklich wären wir eben auch, wenn wir keine Bücher hätten, und solche Bücher, die uns glücklich machen, könnten wir zur Not selber schreiben. Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wälder vorstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord, ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.
Franz Kafka an Oskar Pollak, 27. Januar 1904
Zur Einführung
Von der schwer erträglichen Leichtigkeit des Cancelns
Liebe LYX.audio-Hörer:innen, Bis zum hellsten Morgen enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung. […] Die Inhalte sind: Bodyshaming, Mobbing, Gewalt, Rassismus, Untreue, Depressionen, Essstörungen, Panikattacken, Anxiety und Alkoholismus. Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass in diesem Buch folgende Themen behandelt werden: Adoption, Erbrechen. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Euer LYX-Verlag (auf der homepage des Bastei-Lübbe-Verlags am 2. August 2023)
Es geht ein Gespenst um im Literatur- und Kulturbetrieb. Wie es Gespenster so an sich haben, kann es ein gewisses Alter vorweisen: Es hat Jahre, Jahrhunderte, sogar Jahrtausende auf dem krummen Buckel. Das Gespenst ist unter verschiedenen Namen bekannt, die von Kultur zu Kultur, aber auch innerhalb ein und desselben Sprach- und Denkraumes wechseln: Dazu gehören »Cancel culture«, »wokeness« »political correctness« oder »sensitivity reading«. Früher einmal hörte es auf den schlichten Namen Zensur. Das Gespenst hat eine sehr weite weiße Kutte, unter der sich allerlei Verbotenes und Verfemtes, Verdächtiges oder Unliebsames versteckt; wie und warum es dahingeraten ist, kann sich das Gespenst selbst nicht so recht erklären. Nachdem es sich erst interessiert an die Erforschung der aktuellen Zusammenhänge gemacht hatte in der Hoffnung, es könne diesmal mehr als bloß wieder sein ewiger Konkurrent, der Zeitgeist, dahinterstecken, hat es enttäuscht die kleinen weißen (oder schwarzen?) Hände sinken lassen: Doch wieder das altvertraute Schema; die Leute, die es mit Stoff versorgen, wechseln zwar mit der Zeit, aber eigentlich sind sie austauschbar, denn sie machen im Prinzip alle das Gleiche: Sie vergehen sich an Kunst und Literatur, und sie wollen (Literatur)Geschichte umschreiben, indem sie sie moralisch bereinigen, mögen die Gründe für ihr Vorgehen auch mit der Zeit wechseln. Das war schon vor 2000 Jahren so, als die ersten Schriftzeugnisse, derer wir habhaft werden können, das Licht der Welt erblickten (und auch für die Zeit, in der Literatur vorwiegend oder ausschließlich mündlich präsentiert wurde, lässt sich das annehmen). Das Gespenst beschließt, wie stets, für eine gewisse Zeit mitzuspielen, liebäugelt aber schon mit dem Plan, alsbald die Kutte zu lüften und alles wieder an die Oberfläche zu lassen, wo es hingehört.
Wenn man die Bezeichnung »Gespenst« oder »Geist« hört, könnte man schnell meinen, dahinter verberge sich nichts als ein Hirngespinst. Etwas, das nur im Kopf ängstlicher, gereizter Leute existiert, in Wahrheit aber gar nicht dingfest zu machen ist. Liest man die jüngsten Abhandlungen zum Thema, kann man tatsächlich den Eindruck gewinnen, eine gewisse Mehrheit sei dieser Auffassung. Immer wenn es einen besorgten Aufschrei gibt, sind begütigende Stimmen nicht weit, die, sich betont ruhig und sachlich gebend, behaupten, das sei alles übertrieben. Alles sei weiterhin erlaubt, zumal in der sog. westlichen Zivilisation. Niemand werde zu Einschränkungen der Meinungsfreiheit, und sei es nur mit Blick auf Zitate, gezwungen. Wer das beobachte, sei panisch oder pathetisch, schlimmstenfalls der hexerischen Einwirkungskraft »rechter Diskurse« erlegen. Und wenn es hier und da vielleicht doch ein Problemchen gebe, dann sei dies leicht aus der Welt zu schaffen. Überdies werde sich die Aufregung mit der Zeit schon legen, wenn die Leute wieder Wichtigeres zu tun hätten, als sich über ein paar Triggerwarnungen oder sprachliche Anpassungen in der Literatur zu empören.
Bemerkenswert ist, dass diese Haltung trotz der ostentativen Nüchternheit häufig recht polemisch eingekleidet ist. So auch der Eindruck nach der Lektüre eines um Vermittlung und Meinungsaustausch bemühten Bandes, den kürzlich der Hanser Verlag auf den Markt gebracht hat: Unter dem augenfälligen Label »Canceln« haben sich diverse Autoren und Kritiker zu einem heterogenen Meinungsaustausch versammelt (A. Domainko et al., Canceln. Ein notwendiger Streit, München: Hanser, 2023). Ziel war es, die verschiedenen Positionen wertneutral nebeneinanderzustellen, um in der Diskussion zu bleiben (Zitat aus dem Vorwort: »[Dieser Band] sucht den produktiven Streit, der dazu zwingt, die eigene Haltung zu hinterfragen und die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, auch eine andere Sicht könne gerechtfertigt sein«). Tatsächlich scheint der Band die Lage eher zu ver- als zu entschärfen; zwar kommen durchaus verschiedene Stimmen zusammen, aber am Ende überwiegt die Tendenz zum behutsamen Umgang mit Leserbefindlichkeiten. Der ketzerische Beitrag von Johannes Schneider am Ende, der von einer Cancel-Lüge spricht und die Zensur-Kritiker für hysterische Verschwörungstheoretiker hält, lässt einen aber doch in einigermaßen verdrießlicher Stimmung zurück, schon wegen seiner Polemik gegenüber Leuten, die sich in Sachen Kunst und Literatur etwas weniger gleichgültig geben als er:
»Liebe weiße akademische Mittelschichtsmitbürgerinnen, bevorzugt westdeutscher Herkunft, … liebe Menschen in Vororten und auf Resthöfen, liebe Pfarrerinnen und Physiotherapeuten, die diese Debatten immer genau auf diese Art halb mitbekommen, die anfällig macht für die Behauptung einer Krise, wo keine ist, ich verrate Ihnen und Euch jetzt mal was: Nichts ist gecancelt, alles ist möglich« (S. 211).
Schneider meint, man dürfe »so viel«, nur eben nicht »widerspruchsfrei« (ebd.). Er spricht allgemein von einem »Deppenverständnis von Werk- und Versionengeschichte, die den Lebenden jeglichen Zugriff auf das Buch einer Toten versagt«, und stänkert in so beliebter wie einfacher Manier gegen die ewig Gestrigen, die sich gegen jede Veränderung verwahrten:
Wollen Menschen an Traditionen festhalten, die unter ›Verletzungsverdacht‹ geraten sind, sehen sie sich, so Schneider ironisch, mit unliebsamem Widerspruch konfrontiert, und
»dieser Golem des Widerspruchs […] wird stets zur Unzeit und stets undifferenziert über Kirchen und Missbrauch, über Royals und Kolonialismus und über den Rassismus sprechen, der sich auch im unschuldigen Spiel von Kindern verbergen kann. Und er wird damit nicht einfach aufhören, weil Hubert sich weiter mit Lederfransen verkleiden will, seine Frau einen Adelsfimmel hat und seine Enkel fröhlich von geilen Puffmüttern grölen wollen, derweil sie sich gegenseitig versichern, dass das ›null sexistisch‹ gemeint sei« (S. 218).
Der Beitrag ist bei Weitem nicht der einzige, der seine Sperrig- und Dornigkeit – bzw. die des jeweiligen Verfassers – in einer befremdlich-narzisstischen Weise feiert und die eigene Aufgeklärtheit schwarz/weiß gegen die einfältigen Konservativen stellt. Im gesamten ›kritischen Diskurs‹ um Eingriffe in Texte missfällt der Missbrauch von psychoanalytischem Vokabular auf Seiten der Änderwütigen: Allenthalben ist von möglichen Traumata zu lesen, die Wörter oder Themen bei diesem oder jenem auslösen könnten[1], und man könnte meinen, man sei fast ausschließlich von Narzissten umgeben, die alles und jeden persönlich nehmen.
Doch auch die Verteidiger der Kunstfreiheit, die sich vor den radikalen Zuspitzungen der jüngsten Zeit gruseln, weichen, scheint’s, allzu schnell in den Modus der Verteidigung aus. Kunst müsse frei bleiben, gewiss, man müsse sie eben in ihrem historischen Kontext verorten, ggf. mit kleinen erläuternden Hinweisen versehen oder aber für sich selbst sprechen lassen: So werde sie sich und ihre Verfasser – auch wohl ihre unkritischen Leser – schon selbst entlarven, und das funktioniere allemal besser, wenn man sie nicht nachträglich manipuliere. So oder ähnlich kann man es häufig lesen. Aber steckt dahinter nicht die gleiche problematische Haltung wie bei den Cancellern? Wird nicht auch hier, nur eben im Namen der Freiheit, von einem hohen moralischen Ross herab gesprochen, ganz so, als ob die (jeweilige) Gegenwart »besser« wäre? Wird nicht auch hier der Leser (der Gegenwart) vorsorglich »entmündigt«, derjenige der Vergangenheit an den Pranger (der Unaufgeklärtheit) gestellt? Das schiene mir fatal.
Nehmen wir zwei Beispiele aus der aktuellen Diskussion, um die Komplexität des Problems zu veranschaulichen:
Im Anfangskapitel eines Romans, an dem der Schweizer Autor Alain Claude Sulzer arbeitet, macht er Gebrauch von dem Wort »Zigeuner«, wobei auch handelsübliche Klischees in den Kontext der Erzählung verwoben sind. Das hat Besorgnis erregt bei einem Literaturgremium, bei dem er das Kapitel zur Förderung einreichte und das beim Autor Klärungsbedarf anmeldete. Sulzer zog den Antrag unter Protest zurück, klärte aber dahingehend auf, dass die Handlung des Buches schließlich in den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts angesiedelt und dies der damals übliche Sprach- und Vorurteilsgebrauch gewesen sei, den er darstelle und den zu verfälschen nur um den Preis der Aufgabe von Realitätsnähe möglich sei, welche jedoch ein wichtiges Kriterium bedeute. Sulzers Protest gegen die erzwungene Apologie hat hohe Wellen geschlagen; er hat auch reichlich Unterstützung gegen diese Zensur-Versuche erfahren. In diese Unterstützung hat sich aber doch wieder zu viel apologetische Taktik des Verweisens auf historische Kontexte hineingemengt und gleichsam verselbstständigt; immerhin hat Sulzer ja keine historische Einführung geschrieben, sondern einen Roman, der, generisch gesehen, längst nicht mehr unter dem Namen Historie firmiert und auch nie eine war im Sinne um Objektivität bemühter Geschichtsschreibung. Dass sich der Romanautor um die Evokation authentischer, zeitgemäßer Eindrücke bemüht, ist nachvollziehbar. Aber es ist nicht zwingend notwendig, wenn er sich in einem Phantasiestück, einer fiktionalen Erzählung, solcher Wörter befleißigt, die aktuell von einer bildungspolitischen Minderheit inkriminiert werden. Ein literarischer Text »darf« das in jedem Genre, ob faktual oder fiktional.
Das zweite Beispiel grenzt unfreiwillig an eine Parodie auf die Korrektheit: Ausgelöst hat diese die Journalistin Sieglinde Geisel, als sie dem Thema »Böse Wörter« mit sensiblem Gespür auf den Grund gehen wollte (DLF Kultur vom 26. Mai 2023). Da in ihrem Radio-Beitrag ein Übersetzer vorkam, der erläuterte, welchen Unterschied es mache, ob der von ihm übersetzte Autor das Wort »Neger« oder das Wort »Nigger« verwendet, und wie er die Stellen übersetze, nicht zuletzt, um die historischen Differenzen im Sprachgebrauch zu veranschaulichen, entschied der Radio-Sender kurz vor Ausstrahlung, das Vokabular sei ihm doch zu heikel, und unterlegte die entscheidenden Momente mit einem »Klanggeräusch«, das an einen gebuzzerten Beep in einer schlechten Quizshow gemahnte, natürlich dem gleichen für beide Ausdrücke, wodurch die betreffende Stelle schlicht sinnlos und unverständlich wurde. So kann man die Sache – und die Menschen hinter den Dingen! – auch ad absurdum führen!
Die in der Radiosendung zitierten Texte berühren unter anderem das sensible Thema Literaturübersetzung, welches das Fass künstlicher Befindlichkeiten immer wieder zum Überlaufen bringt. Das ließ sich, bis zur Groteske verfremdet, am Beispiel der Inaugurations-Lyrik der US-Amerikanerin Amanda Gorman studieren. Es wurden Übersetzerinnen gesucht, die nicht nur sprachlich qualifiziert waren, sondern auch bestimmte »kulturelle Voraussetzungen« erfüllten (möglichst Frau, schwarz, ähnliche Hintergründe etc.). Die freilich waren schwer zu finden; bereits erteilte Aufträge wurden aufgrund von Protesten zurückgenommen, es wurde immer kurioser. Am Ende hätte Frau Gorman sich wohl nur selbst übersetzen dürfen, um jegliche Anmutung von kultureller Aneignung zu vermeiden. Da verlangte man angesichts des internationalen Erfolgs ihrer Gedichte eine unmenschliche Vielsprachigkeit von ihr, ganz abgesehen davon, dass man auch als Übersetzer eigener Texte vor sich – etwaigen Fehlgriffen, und sei es mangelnde Sensibilität – keineswegs sicher ist.
Übertragungen von Originaltexten in andere Sprachen sind ein eigenes Problemfeld, keine Frage. Eine Übersetzung stellt immer einen kreativen Vorgang dar, egal, wie eng sich der Übersetzer an den originalen Wortlaut halten möchte – stets trifft er eine Auswahl aus mehreren Möglichkeiten. Hier könnten nun die Anhänger sensibler Lektüren einwenden, dass Übersetzungen doch immer schon dem Zeitgeist angepasst wurden; warum sollten dann aktuelle Versionen nicht Rücksicht auf sprachliche Befindlichkeiten nehmen dürfen? Doch das Problem ist weitaus komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Das heißt: Wörter, die in ihrer Zeit wertneutral verwendet wurden, sollten sowohl der historischen Gerechtigkeit als auch, vor allem, des ästhetischen Anspruchs wegen auch so transportiert werden. Aus denselben Gründen sollten Wörter, die – positive wie negative – Wertungen enthielten, in dieser ihrer Wertungsabsicht weiter- und wiedergegeben werden – da mögen sie noch so verletzend sein. Das bereits erwähnte und in jüngerer Zeit besonders häufig inkriminierte Wort »negro«, »Neger«, ist ein gutes Beispiel für diese Vielfalt, denn es ist im Laufe der Zeit faktisch sehr unterschiedlich eingesetzt worden – neutral, deskriptiv, kritisch, herablassend, aber auch dezidiert selbstbewusst (von nichtweißen Schriftstellern oder Politikern etwa, die, wie Martin Luther King, eine politische Botschaft in die explizite Verwendung implementierten). Warum also die Texte und ihre Verfasser nachträglich belehren? Übersetzungen sollten versuchen, eine historische Entsprechung des Begriffs zu finden und diese in den Text zu setzen – etwaige erläuternde Fußnoten sollten nicht in warnenden Vorbemerkungen entschuldigt werden. Für allgemeine Erklärungen zum procedere der eigenen Übersetzung wäre aber sicher in einem Nachwort Platz – ggf. auch in entsprechenden Kommentaren. Das gilt überhaupt für die Dimension des Politischen in der Literatur, zumal wo sie ein didaktisches Gepräge aufweist: Auch sie lässt sich in Kommentaren breit auffächern. Wenn wir aber an der Autonomie der Kunst festhalten wollen, dürfen wir eben nicht zulassen, dass sie zum Knallbonbon des wissenschaftlich assoziierten Aktivismus wird. Wir müssen die Furchtsamen gelegentlich daran erinnern, dass die thematischen, ästhetischen, sprachlichen Herausforderungen, vor die uns die Literatur stellt, auch zur Schärfung unserer eigenen intellektuellen Instrumentarien beitragen (und damit sind eben nicht nur besorgte Akademiker gemeint, sondern alle Leser oder Kunstinteressierten). Wie arm wäre doch ein Lesen oder Hören (ein Leben sogar) ohne solche Reibungen, wie verstörend oder ›verletzend‹ sie individuell auch aufgenommen werden mögen.
Und mag manch ein Wort-Gebrauch auch die Grenzen des guten Geschmacks forcieren – seine Bereinigung macht es eher noch schlimmer als die Wiedergabe, weil diese dem Leser ein Urteil erlaubt oder sogar abnötigt, jene nur verschweigt und verweigert. Schweigen hat die Sache aber nie besser gemacht, sondern das Problem »in den Untergrund« verschoben und nicht selten verschärft. Nebenbei bemerkt ist, um noch kurz beim »negro«-Beispiel zu verbleiben, diese Fixierung auf die Hautfarbe ganz unsäglich; als ob es auch hier nur schwarz oder weiß gäbe – dabei ist die Farbenvielfalt auch der menschlichen Haut unermesslich, und warum sollte die Sprache nicht genutzt werden, um diese Vielfalt positiv differenzierend zu beschreiben –, das Wort Diskriminierung ist leider (wie z.B. das Wort »Populismus«) einseitig negativ in Gebrauch und Schlagzeilen geraten, dabei gehört es ursprünglich auch zu den Begriffen, die Vielfalt überhaupt erst ermöglichen.
Jeder so, wie er mag – diese Parole hört man dieser Tage nur noch selten, und wenn man sie hört, fungiert sie offenbar nurmehr als Alibi. Denn am Ende sollen – eher denn wollen – doch wohl alle in einen Topf der Ununterscheidbarkeit hineingepfercht werden? Ähnliches lässt sich, über die Übersetzungsproblematik hinaus und mit Blick auf den eingangs zitierten Verlags-trigger, für viele Wörter sagen, die »Zigeuner« und »Indianer«, die »Dicken« und die »Adoptierten«, aber auch ein harmlos anmutendes »Weib(lein)«. Jeder und jede kann hier etwas Kränkendes für sich finden. Mich z.B. hat als Teenager die Darstellung von Frauen in der Literatur mitunter irritiert, vor allem habe ich, bis heute eigentlich, Anstoß an dem Wort »Weib« genommen, welches im Lauf der Jahrhunderte alle Spektren von sachlicher Beschreibung bis hin zu hässlicher Herablassung durchlaufen hat. Soll ich jetzt rufen: »Alle ›Weiber‹ aus den Texten entfernen«? Oder zum W-Wort verkürzen und mit einer erläuternden Klausel versehen? Überhaupt, der Kampf der Geschlechter: Wenn Frauen in der Literatur als »Nutten« oder Männer als »Schweine« bezeichnet werden – wo ist das Problem? Sollte ein Herausgeber, ein Verlag, eine Übersetzung die Entscheidung treffen, die Beleidigung aus Rücksicht auf einzelne abzumildern, die das persönlich nehmen könnten, aus welchen Gründen auch immer?
Nein, eben das sollte weder er noch sie. Und zwar aus- und nachdrücklich nicht. Denn Leidenschaft scheint mir das Gebot der Stunde zu sein – es resultiert aus der Diagnose ihres Mangels, der unter dem Deckmantel der Sachlichkeit und des großzügigen Verständnisses daherkommt, in Wahrheit aber doch Zurückhaltung an der falschen Stelle bedeutet. In den Worten Ijoma Mangolds: »Die beste Art, einen Kulturkampf zu beenden, ist Gleichgültigkeit. Die allerdings muss von Herzen kommen«[2]. Was fehlt, ist ein leidenschaftlicher Kampf für die Autonomie der Literatur, der diese schützt wie eine bedrohte Minderheit – und zwar kompromisslos. Denn wo kämen wir da hin, wenn jeder seine mehr oder weniger berechtigte Befindlichkeit erwartungsvoll an sie herantrüge? Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Kultur, Haltung, Äußeres wie Inneres, sonst etwas betreffend? Und wenn jeder nur noch in eigener Sache sprechen könnte (als ob das überhaupt möglich wäre)? Darf demnächst nur noch jeder sich selbst übersetzen, spielen, interpretieren – keine Weiße eine Schwarze, kein Dicker einen Dünnen, kein Bebrillter einen Vollsichtigen, kein Tauber einen Stummen, keine Blonde eine Brünette? Was ist hier los? Wohin soll das führen? Durch neue, andere Anreden und Umschreibungen fühlen sich überdies womöglich wieder andere in ihren Befindlichkeiten »verletzt« (z.B. Frauen, die nicht mehr als Frauen, sondern als »Sehr geehrte/r Maria Müller« angesprochen werden). Es ist tatsächlich (ich zitiere eine in diesem Zusammenhang gerne und inflationär genutzte Formulierung) »schwer verdaulich«, wenn man die von Alice Schwarzer und anderen (Vor)Kämpferinnen des Feminismus erwirkten Errungenschaften auf ein paar Gendersternchen zusammenschrumpft. Bezeichnend indes für die ideologische Blindheit des grassierenden Aktivismus, dass ausgerechnet Alice mittlerweile als »transphob« gilt (und auch sonst wegen unbequemer politischer Meinungen stigmatisiert und mitunter ausgeladen wird) – wobei wohl kaum jemand sagen kann, was er/sie/es eigentlich unter diesem Attribut versteht? Und mit Blick auf das Gesterne: Was ich aus – hier primär sprachlich-grammatikalischer – Überzeugung ablehne, dem verweigere ich mich auch konsequent. Es wäre erfreulich, wenn andere das auch täten; doch leider verbleibt die Kritik an der political correctness und den »identitären Diskursen« weitgehend im Dickicht des Geraunes. Im schlimmsten Fall werden die kritisierten Diskurse zugleich aktiv bedient, weil sie wie ein gemütliches weiches Kissen wirken, auf dem es sich ruhiger – und mit Blick auf öffentliche Fördergelder zum Beispiel – sicherer übernachten lässt als unter dem Damoklesschwert des Risikos, gerügt zu werden oder aus den gestifteten Gemeinschaften herauszufallen. In meinem Buch gibt es jedenfalls keine Auslassungsstriche und keine Sterne, sondern nur männliche oder weibliche Formen, wo grammatisch und sachlich geboten – den Rest überlasse ich den mündigen Lesern.
Unter »mündig« verstehe ich dabei nicht unbedingt »aufgeklärt«, jedenfalls nicht »aufgeklärt« in dem Ton, den die neuesten, p.c.-kritischen Studien anschlagen, etwa die des ehemaligen Kulturstaatsministers Julian Nida-Rümelin (»Cancel Culture« – Ende der Aufklärung? Ein Plädoyer für eigenständiges Denken, München: Piper, 2023) oder der Philosophin Susan Neiman (Links ist nicht woke, Hanser Berlin 2023). Beide sehen in der Cancel Culture eine demokratieversehrende Praxis, der es mit aufklärerischem Geiste entgegenzuwirken gelte. Während Nida-Rümelin dabei auch die altbewährten Tugenden des sogenannten Humanismus in den Fokus rückt, setzt Neiman vor allem auf die vernunftbasierten Erkenntnisse der historischen Phase der ›Aufklärung‹, die sie gegen die aktuellen Rassismus- und Kolonialismus-Anwürfe verteidigt und gegen Heidegger, Carl Schmitt (geschenkt) und die Postmoderne, allen voran Michel Foucault und seine Adepten, ins Feld führt. In Foucault sieht sie einen amoralischen Antiaufklärer und »rechten Ideologen« , weil er die Möglichkeit moralischen Fortschritts ebenso radikal in Zweifel zog wie die Berufbarkeit auf Vernunft oder Universalismus. Dabei konnte man Foucault für diese Einschätzung selten lauteren Beifall zollen als eben jetzt, wo moralische Aufklärung einmal mehr zu einem Machtinstrument mutiert ist, wenn sie sich dieser Bezeichnung auch immer wieder zu entziehen versucht.
Die Ausfälle gegen »die Theorie« haben in den letzten Jahrzehnten an Beliebtheit zugenommen; besonders in der »Arbitrarität« der Postmoderne vermutet man die Ursache für allerlei Übles, vor allem dafür, dass klare Erkenntnisse und begrifflich-konzeptuelle Unterscheidungen hinfällig wurden, mit denen sich die Welt ohne Zweifel leichter gestalten ließe. Aber die Welt ist komplex, und dazu gehört auch ihre Begrifflichkeit, ihre Theorie, die Sprache, mit der sie sich – in und außerhalb der Literatur – beschreiben lässt. Gerade in der »Jargonlastigkeit« sieht aber Neiman einen Beweis dafür, dass die woken Linken ihrer ›eigentlichen‹, also: ›wahren [linken] Werte‹ verlustig gegangen seien. Mit ihrem Buch möchte die Philosophin selbst aufklären, und zwar in einer verständlichen Sprache, für die kein Doktorstudium nötig ist, auf dass alle es kapieren können: »Dieses Buch habe ich in der Hoffnung geschrieben, dass die Philosophie die Verwirrungen auflösen kann, die von der Theorie gestiftet wurden.«
Was die Studien von Neimann und Nida-Rümelin eint, ist die erfolgreiche Suche nach Schuldigen an der Misere; das sind aber leider die üblichen Verdächtigen: Konservative, Rechte sowie Linke, die ihre guten alten Werte vergessen und sich der ›falschen‹ Theorie verschrieben hätten. Doch das sind mehr oder weniger Bauernopfer, denn so einfach ist das nicht. Um damit aufzuräumen, bedarf es vorab einer Loslösung von den althergebrachten schwarz/weiß- bzw. links/rechts-Kategorien, auch wohl von einer allzu lauten Selbstfeier der Aufgeklärten (und) Humanisten. Denn das sind womöglich die wahren Schuldigen, wenn man denn solche ausmachen will. Lieber möchte man den in dieser Weise Engagierten dazu raten, noch mal ihren alten Nietzsche in die Hand zu nehmen und neben – oder sogar auf – den Habermas-Bücherstapel auf dem Nachtschrank zu legen – Friedrich Nietzsche, der ja auch um den Preis der totalen eigenen Isolation gegen die altererbte Tradition der Gutgläubigen und Wohlmeinenden angetreten ist. In dem den Unzeitgemäßen Betrachtungen entstammenden Beitrag »Wir Philologen« (wohlgemerkt: nicht »Wir Philosophen«) stemmt er sich gegen die Vermengung des historisch gewordenen Menschlichen mit der Idee des »Humanen«, sprich: des Humanismus; das Menschliche eben gelte es gerade »in einer Unmaskiertheit und Inhumanität« zu zeigen, so »dass es zur Belehrung nicht zu entbehren ist«.
Es gab erfreulicherweise in jüngster Zeit mehrere Versuche, sich dem Phänomen der (Über)Empfindlichkeit unter Berufung auf die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem »Bösen« kritisch zu nähern; dabei stehen provozierende Studien wie die Generation beleidigt der feministischen Publizistin Caroline Fourest (2020) oder die gegen allgemeine ›Schmerzangst‹ gerichtete Abrechnung mit der Palliativgesellschaft des Philosophen Byung-Chul Han (2021) neben der differenzierten und um gegenseitige Annäherung bemühten Abhandlung Sensibel der Philosophin Svenja Flaßpöhler (2021). Diese primär philosophisch und politisch motivierten Einsichten sollen hier um eine genuin philologisch-literaturwissenschaftliche erweitert werden: Ein weiterer, vielleicht der Schlüssel zur Lösung könnte tatsächlich in sprachlicher Reflexion und Präzision liegen, denn Sprache kann nach wie vor wesentliche Macht entfalten.
Die Behauptung, das Gerangel um korrekten Sprachgebrauch sei bloß ein Nebenschauplatz, wird auch durch häufige Wiederholung nicht richtiger. Ein fatales Paradox liegt in der Gängelung durch die Sprachsäuberer auf der einen, die Kritiker des »theoretischen Jargons« auf der anderen Seite: Im Grunde begehen sie alle den gleichen Fehler, indem sie der Sprache Gewalt antun, sie also zugunsten ihrer politischen Interessen manipulieren und gegen den Strich bürsten oder aber als deskriptives Instrument komplexer Texte und Theorien nicht ernstnehmen. Die eilfertigen Korrigierer legen eine herablassende Haltung gegenüber der Literatur und ihrer Geschichte an den Tag und blasen alle in dasselbe Horn: Sie produzieren die eintönige Melodie des ›Anfangsverdachts‹ gegen die Sprache, die recht eigentlich auf Respektlosigkeit ihr gegenüber gründet. Und auf Misstrauen gegenüber diesem schwer zu bezähmenden Phänomen in all seinen vielfältigen Facetten.
Also bitte gar keine Kompromisse, keine Änderungen an den Texten, schon gar nicht bei toten Autoren, die sich nicht wehren können. Wer etwas nicht lesen möchte, darf es gerne lassen oder entsprechend kommentieren. Autonomie ist Autonomie, und, frei nach Rapper Danger Dan: Das ist alles durch die Kunstfreiheit gedeckt, es ist gefährlich, es verletzt und provoziert, Kafkas Axt spaltet – das war schon immer so und ist auch ganz in Ordnung; leider aber hat es schon immer Entmündiger von Lesern und Hörern gegeben, sie sind sogar älter als Sokrates. Offenbar haben wir nichts dazugelernt.
Werfen wir an dieser Stelle einen Blick zurück in die Antike, bei deren Texten derzeit auch gerne das Messer angesetzt wird. Einer der Ersten, der sich derlei korrektive Kritik, Rückschlüsse von der Kunst aufs Leben – und umgekehrt – ausdrücklich verbeten hat, ohne die Komplexität der Gemengelage zu verkennen, ist der Veroneser Dichter Gaius Valerius Catullus (1. Jh.v.Chr.). In dem 16. Gedicht seiner kleinen, hochexplosiven Sammlung formuliert er die Dichotomie von Leben und Kunst folgendermaßen:
nam castum esse decet pium poetam / ipsum, versiculos nihil necesse est
»enn für den frommen Dichter selbst gehört es sich, moralisch aufrecht zu sein, / für seine Verslein ist das mitnichten notwendig«.[3]
Diese Verse müssen – unbeschadet ihrer kunstimmanenten Stellung – als Kontrafaktur der gängigen Auffassung gelesen werden, Kunst und Lebenswirklichkeit sollten direkt aufeinander bezogen werden. Die Analogie zwischen den Versen und der vita des Dichters wird als sachgemäßes Evaluationskriterium zurückgewiesen, die zwei Welten werden betont separiert. Darüber hinaus werden im weiteren Verlauf des Gedichts die Leser allein für das verantwortlich gemacht, was sie, auf der Grundlage eben dieser fatalen Vermischung der Ebenen, aus den Texten herauslesen oder auf sich selbst beziehen, in diesem Falle die als lendenlahm, aber aufgegeilt attackierten alten weißen Römer.
Mit Nachdruck wird die Autonomie der Kunst eingefordert und, gut avantgardistisch, zum Leben umgedeutet. Dies ist nur ein Beispiel für viele antike (und spätere) Versuche, der Kunst ihr eigenes Recht zu verschaffen; anders als etwa Jonas Grethlein suggeriert, ist Autonomieästhetik auch »in ihrer Radikalität« nicht erst ein Phänomen der Moderne (F.A.Z. vom 3. Januar 2024). Catull entwirft das Modell einer genuin dichterischen Existenz. Immerhin knüpft sich an die Catull’sche Verweigerung eine apologetische Tradition, die seine Verse zur lex Catulli adelt[4]. Gleichwohl hat sich der längst nicht nur von Catull artikulierte Widerstand gegen die lebensweltliche Vereinnahmung der Kunst trotz der Ernsthaftigkeit, mit der er sich zuweilen geltend macht, nicht durchgesetzt, bis heute nicht, obwohl es verstörend-geniale Varianten davon zu bestaunen gibt wie die der Berliner Hip-Hopper von K.I.Z. in ihrem Song »FBI und Interpool«: »Bitte trennt das Werk vom Künstler / Denn privat sind wir sehr viel schlimmer«.
Zum guten, bösen Schluss sei noch auf die obszöne Einkleidung schon der Verse Catulls verwiesen, die mehrere der im Cancel-Kontext aufscheinenden Probleme gleichzeitig berührt: pedicabo ego vos et irrumabo / Aureli, pathice, et cinaede Furi!, was in etwa so viel bedeutet wie: »Anal und oral werd ich euch’s besorgen, Aurelius, du Schwuchtel, und Furius, du Päderast!«. Catull möchte den beiden Kritikern, die stellvertretend angegriffen werden für alle diejenigen, die Kunst und Leben gerade nicht zu unterscheiden vermögen und an der Kunst aus moralisch motivierten, lebensweltlichen Gründen herumkritteln, obszöne Gewalt antun und beschimpft sie darob »homophob«. Mit der Übersetzung haben sich Generationen von Philologen schwergetan. Unter ihnen ragt vielleicht das peinlich-verharmlosende »Den Bürzel werd ich Euch versohlen« heraus: So weit entfernt von der obszönen Sprengkraft des Wortlauts war eine Übersetzung selten. Noch einfacher haben es in der Überlieferung die Mönche gehalten, indem sie das verletzend-pervers anmutende pedicare einfach zu dedicare (»weihen«) umschrieben – die Beweggründe mögen hier und da voneinander abweichen, doch in der Sache gibt es keinen Unterschied bei den Versuchen, der Kunst ihr, im Sinne von Kafkas Eingangszitat, verstörendes Potenzial zu rauben. Dem kann man höchstens noch mit einer ausgeschlafenen Ironie begegnen wie Harald Schmidt, der die vom WDR verhängten »Warnhinweise« auf einigen Folgen seiner anarchischen Kultsendung »Schmidteinander« mit dem Ausruf »Weltklasse!« kommentiert hat.
Zum Aufbau des Buches
Wie aus der gespenstischen Einleitung hervorgeht, sind die Beispiele für Übergriffe auf die Literatur so zahl- wie zeitlos. Es ist also unmöglich, einen halbwegs erschöpfenden Überblick bieten zu wollen. Da aber, wie ebenfalls bereits skizziert, die Beweggründe und Vorgehensweisen dafür einander stark ähneln, habe ich mich für eine repräsentative Auswahl entschieden. »Repräsentativ« ist sie freilich nur sehr bedingt, und schon der Anspruch eröffnet ein Minenfeld: Natürlich sind nicht alle Minderheiten dieser Welt vertreten. Auf geschlechtliche und sonstige Paritätsaspekte wurde bei der Zusammenstellung dieser Texte nur sehr beiläufig, eher intuitiv, geachtet, weil mir das der Sache weitaus zuträglicher scheint. Dafür sind diverse Klassiker der Weltliteratur versammelt, noch gar westliche. Das liegt daran, dass die Verfasserin dieses Buches eben diesem Kulturkreis angehört. Gleichwohl sieht sie sich dazu in der Lage, über die Tellerränder dessen, was klassischerweise unter ›Literatur‹ verstanden wird, hinauszuschauen und verschiedene Wirkungszusammenhänge mit in den Blick zu nehmen. Die Auswahl der Texte ist dennoch heuristisch; es konnte auch nur eine Auswahl von Gattungen sowie ›Nationalliteraturen‹ (ohnehin ein verpönter Begriff) berücksichtigt werden.
Die Studie bemüht sich lediglich um einen weiträumigeren Gang durch die Zeiten, um der Geschichte der Gewalt gegen die (in diesem Fall primär literarische) Kunst historische Tiefe und Breite zu verleihen. Auch hier gibt es natur- bzw. fachgemäße Fokussierungen; die unliebsame Antike mit ihren als frauen- und fremdenfeindlich stigmatisierten Sklavenhaltergesellschaften ist vielleicht in mancherlei Betrachters Auge etwas überrepräsentiert – das hat jedoch einen guten Grund, da diese antiken Texte viel prägendere Spuren nicht nur in der westlichen Nachwelt hinterlassen haben (durchaus auch bei den meistens eher fremd- als selbsterklärten Minderheiten), als ihre Kritiker hinnehmen wollen. Denn die Antike und ihre fachlichen Hüter, die Klassischen Philologen, sind zweifelhafte Profiteure der neuen Aufmerksamkeit auf tradierte Texte, die die akademisch institutionalisierten oder frei flottierenden Aktivisten generieren, indem sie sich auf der Arche postkolonialer Kritik durch die Welt bewegen, um sie »diverser« und dadurch wohl »gerechter« zu machen. Sie, die ›Hüter‹ des antiken Erbes, bewahren Kunstwerke, Texte, Bilder, Wissen aus einer fernen Vergangenheit vor dem Vergessen – einen historischen Schatz, der der neumodischen Moral eine breite Angriffsfläche bietet. Die Diskursfelder, die sich die ›Aufklärungsbewegung‹ vornimmt, sind vielfältig; besonders plakativ geraten die Vorwürfe aus den Sparten »Sexismus« und »Rassismus«. Diesen vor allem wollen wir in den ausgesuchten Beispielen nachgehen.
Daneben stehen weitere Klassiker verschiedener Epochen – wobei ja auch der Epochenbegriff, wie nahezu alle Orientierungskategorien, man denke etwa an Gattungen, ein fragiles, labiles, provozierendes Konstrukt ist, wie sollte es anders sein? Gleichwohl wird bei der Verwendung einschlägiger Begrifflichkeiten auch in diesem Band lose an solchen Konstrukten festgehalten – zur besseren Orientierung, aber auch, um die geschichtliche Fixierung auf derlei künstlich gezogene Abgrenzungskriterien widerzuspiegeln.
Fragilität und Konstruiertheit literaturgeschichtlicher ›repräsentativer Überblicke‹ werden durch den synkritischen Ansatz gespiegelt – und verstärkt. Es werden nämlich Paarungen unterschiedlicher Epochen gebildet. Bald liegen sie (scheinbar) näher beieinander liegen wie Homers Epen und die Bibel, die großen alten Texte, in denen Ungleichbehandlung der Geschlechter (um es mal euphemistisch auszudrücken), Gewalt, Rassismus, ›Überfremdung‹, all die populären Themen unserer Zeit, einen breiten Raum einnehmen; teilweise driften sie sehr weit auseinander, wie Vergil, der römische Epiker, und Heinrich von Kleist, der deutsche Dramatiker, die sich in einer bestimmten Art von Isoliertheit treffen, oder Euripides und Annie Ernaux, die, jeder auf seine Weise, Frauen in einem besonderen, von Selbstbestimmtheit erhellten Licht erscheinen lassen. Auch thematisch ist die Nähe mitunter sehr groß (Catull und Casanova, Aristophanes und Shakespeare), mal weniger augenfällig wie bei Ovid und Brodsky oder Petron und Céline, die alle Grenzen überschreiten, wenn auch in je eigener Art und Gattung. Die Flucht in die Welt der römischen Elegie verbindet Properz und Goethe, wobei beide bestimmte Klischees über Frauen und Liebe zu bedienen scheinen. Sappho und Astrid Lindgren schließlich müssen schon deshalb zusammenkommen, weil sie weibliche Ikonen sind oder geschaffen haben, die gängige Normen spreng(t)en.
Alle hier versammelten Texte widmen sich leidenschaftlich der künstlerischen Adaption des Spiels der Geschlechter um Liebe und Gewalt, Macht und Unterdrückung. Bisweilen sind es nur einzelne Kommentierungen aus der trigger world, die die beiden Autoren und ihre Texte für diese Sammlung assoziiert haben. Manches ist auch noch gar nicht getriggert worden, bietet aber reichlich provozierendes Material für Zartbesaitete. So kommt es, dass die beiden Teile der Kapitel nicht immer exakt die gleiche Länge aufweisen; auch literaturgeschichtliche Kontextualisierungen und Überblicke sowie Rekurse auf die Fachforschung sind unterschiedlich gewichtet.
Die Intensität der jeweiligen Affiliation möge aus den einzelnen Kapiteln erhellen; auch bei größerer Ferne gibt es einige Fäden, die sich parallel ziehen lassen. In die finale Bestandsaufnahme schließlich soll auch Popkulturelles einbezogen werden, etwa die Diskussion um den Stones-Klassiker Brown Sugar oder den herrlich gemeinen Ärzte-Song Die fette Elke.
1. Homer und die Bibel
Von epischer Gewalt und anderen Ungeheuerlichkeiten
Befragen wir in Sachen Sensibilität zunächst drei der ältesten und einflussreichsten Texte überhaupt: die Epen Homers, Ilias und Odyssee, sowie die Bibel.
Diese drei stellen für die heutige Lesewelt eine besonders große Herausforderung dar, nicht nur, weil sie aus so fernen zeitlichen Dimensionen stammen, sondern weil sie erst recht kulturell »fremd« wirken – zumal die überlieferten Texte mehrere einander überlagernde historische Schichten repräsentieren. Außerdem gestaltet sich die Frage von Autoridentität und Autorität als besonders komplex: Die Identität Homers bietet seit jeher eine hübsche Projektionsfläche für vielfältige Phantasien. Gab es den Herrn überhaupt? War es einer, waren es mehrere? Um wen geht es hier eigentlich? Eine beachtliche Plausibilität hat jedenfalls die Vermutung, hinter Ilias und Odyssee stehe ein Kollektiv aus Autoren verschiedener Generationen. Von den Autoren der Bibel lässt sich bekanntlich noch weniger sagen – und wenn wir das Werk für Gottes Wort hielten, so würde diese Annahme die Autorfrage nicht eben vereinfachen.