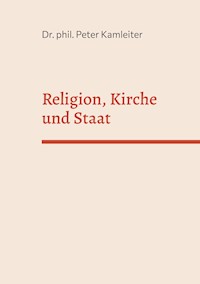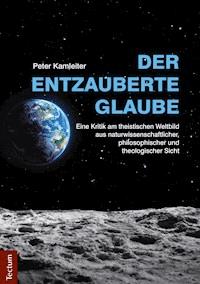
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Während schon vor fast 50 Jahren Menschen zum Mond geflogen sind, sind im 21. Jahrhundert noch mehr als zwei Milliarden Menschen Anhänger eines christlichen Gottes- und Menschenbildes, das in seinen Ursprüngen bis weit in die Antike zurückreicht. Wie plausibel kann aber das christliche Weltbild noch sein, angesichts der Erkenntnisse der modernen Natur- und auch Geisteswissenschaften? Wirkt ein transzendenter Schöpfergott nicht wie ein Fremdkörper in einer Welt, deren Geheimnissen man immer mehr auf die Spur kommt? Ohne eine radikal-atheistische Position zu vertreten, versammelt Peter Kamleiter die Erkenntnisse von Kosmologie, Evolutionsbiologie, Hirnforschung, der Philosophie, ja sogar einer mittlerweile auch selbstkritischen Theologie, um die Unvereinbarkeit althergebrachter Mythen und Vorstellungen mit moderner Wissenschaft zu belegen. Und Kamleiter fragt: Welche Existenzberechtigung und welcher gesellschaftliche Einfluss darf Kirche und Religion in Schulen, Medien und Politik beispielsweise in Fragen der Moral überhaupt noch zugestanden werden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Peter Kamleiter
Der entzauberte Glaube
Peter Kamleiter
Der entzauberte Glaube
Eine Kritik am theistischen Weltbild aus naturwissenschaftlicher, philosophischer und theologischer Sicht
Tectum Verlag
Peter Kamleiter
Der entzauberte Glaube. Eine Kritik am theistischen Weltbild aus naturwissenschaftlicher, philosophischer und theologischer Sicht
© Tectum Verlag Marburg, 2016
ISBN: 978-3-8288-6356-9
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3654-9 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: Fotolia.com © Romolo Tavani
Umschlaggestaltung: Norman Rinkenberger | Tectum Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
INHALT
Vorwort
TEIL I
Vom Mythos zum Logos oder Vom Kampf progressiv-aufklärerischer und repressiv-metaphysischer Kräfte
Einleitung
1.Die griechische Antike
2.Das Mittelalter
3.Die Neuzeit
4.Das 17. Jahrhundert
4.1Der Rationalismus
4.2Der Empirismus
5.Das Zeitalter der Aufklärung
6.Das 19. Jahrhundert
7.Die Philosophie des 20. Jahrhunderts
TEIL II
Theistischer Transzendenzglaube versus Evolutionärer Naturalismus oder Von der Unvereinbarkeit des theistischen Weltbildes mit dem modernen naturwissenschaftlichen Kenntnisstand
Einleitung
1.Kosmologie
1.1Der Urknall. Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Erklärung und religiöser Deutung
1.2Die Quantenphysik
1.3Die Relativitätstheorie
1.4Weltanschauliche Konsequenzen aus den kosmologischen Erkenntnissen für den Theismus
2.Die Evolutionsbiologie
2.1Die atmosphärischen Voraussetzungen für die Entstehung des Lebens
2.2Die Entstehung und Evolution des Lebens
2.3Die weltanschaulichen Konsequenzen aus der Evolutionsbiologie für den Theismus und die Anwendung des evolutiven Prinzips auf religiöse Systeme
3.Das Leib-Seele-Problem
3.1Das Leib-Seele-Problem im historischen Kontext
3.2Das Leib-Seele-Problem aus neurologischer Sicht
3.3Philosophische Lösungsansätze zum Leib-Seele-Problem
3.4Weltanschauliche Konsequenzen aus der naturphilosophischen Betrachtungsweise des Leib-Seele-Problems
4.Schlussbetrachtung
TEIL III
Die Infragestellung des (christlichen) Theismus durch die Theologie selbst oder Die intellektuelle Selbstauflösung des Theismus durch eine selbstkritisch gewordene Theologie
Einleitung
1.Philosophische Kritik am Theismus
1.1Das Theodizee-Problem
1.2Ludwig Feuerbach oder der historisch bedeutsame Umschwung von der Glaubensgewissheit zur großen Ungewissheit
1.3Reaktion und Apologetik bedeutender Theologen des 20. Jahrhunderts auf die Entzauberung des Glaubens durch Aufklärung und Vernunft
2.Die theologisch begründete Kritik am Theismus
2.1Die kritisch gewordene Theologie und ihre Selbstaufhebung
2.2Das Alte Testament und sein entzauberter Gott
2.3Die Glaubwürdigkeit der Kirchen
2.4Göttlicher Anspruch und historische Wahrheit
2.5Die Probe aufs Exempel oder die historisch-moralische Selbstwiderlegung des christlichen Theismus
2.5.1Glaubenskriege
2.5.2Ketzerei
2.5.3Simonie, Nepotismus, Ablass und andere geheiligte Tricks
3.Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
VORWORT
Mit dem vorliegenden Werk sollen Glaubwürdigkeit und Geltungsansprüche des theistischen Welt- und Gottesbildes – paradigmatisch in seiner christlichen Variante – unter Berücksichtigung natur- und geisteswissenschaftlicher Aspekte hinterfragt werden. Dabei steht die Kompatibilität jener für sich monopolistisch alleinseligmachende Wahrheiten reklamierenden Glaubensideologie mit den Erkenntnissen aus den modernen Natur- und Geisteswissenschaften auf dem Spiel. Es geht hier also um nichts weniger als die grundsätzliche Glaubwürdigkeit und Plausibilität des auf Offenbarungsschriften sich berufenden (christlichen) Theismus, also um dessen Gottes- und Weltbild und den damit verbundenen mehr oder weniger latenten Anspruch aller theistischen Offenbarungsreligionen, nämlich, die einzig wahre und göttlich legitimierte Sicht der Dinge zu besitzen. Eine Hybris, die in der Geschichte der monotheistischen Religionen zu unzähligen Kriegen und bestialischen Genoziden mit millionenfachen Opfern geführt hat. Dabei ist es nicht unsere Absicht, die Möglichkeit der Existenz eines allgemein gehaltenen göttlichen Prinzips philosophisch zu widerlegen, was aus prinzipiellen Gründen ohnehin nicht möglich sein dürfte und von unserer agnostischen Grundposition aus auch gar nicht intendiert ist. Der Theismus jedoch geht von ganz konkreten, nach seinem Selbstverständnis göttlich offenbarten und dogmatisierten Glaubenswahrheiten aus, ohne die er in der Tat auch seine Identität verlieren würde. Eine wissenschaftlich und plausibel begründete Infragestellung oder gar Widerlegung zentraler Glaubensaussagen würde die theistischen Religionen deshalb existentiell treffen, zumindest wenn sie den Anspruch der Rationalität aufrechterhalten und sich nicht komplett außer oder über jegliche Rationalität hinweg in die Welt des Unerforschlichen oder Irrationalen flüchten wollen, in der quasi a priori jegliche Logik und Empirie außer Kraft gesetzt ist.
Der erste Teil des Buches („Vom Mythos zum Logos“) stellt den diachronen Teil dar, in dem das Spannungsverhältnis zwischen Mythos und Logos von den Vorsokratikern bis in die Gegenwart thematisiert wird. Dieser philosophiegeschichtliche Teil schildert die kulturelle Entwicklung der abendländischen Erkenntnis- und Wissenschaftsgeschichte unter dem Gesichtspunkt der Auseinandersetzung religiös motivierter reaktionärer wie restriktiver Kräfte mit den progressiven Strömungen innerhalb der Gesellschaften, zum Beispiel den Intellektuellen und Wissenschaftlern. Dabei wird ersichtlich, dass aufgrund sowohl der Explikationskraft der Wissenschaften als auch der auftretenden Widersprüche mit ihnen der Anspruch der Religionen, sakrosankt und unangreifbar über jeglicher wissenschaftlichen Kritik zu schweben, nicht berechtigt ist. Kulturgeschichtlich lässt sich nicht leugnen, dass auch Kulturen und die zu ihnen gehörenden und sie prägenden Religionen dem natürlichen evolutiven Prozess des Entstehens und Vergehens unterliegen.
Teil II („Theistischer Transzendenzglaube versus Evolutionärer Naturalismus?“) thematisiert einige der wichtigsten Spannungsfelder zwischen dem Theismus und der modernen naturwissenschaftlichen Sichtweise. Die drei dargelegten Hauptbereiche sind die Kosmologie (Quantenphysik, Relativitätstheorie und die kosmologischen Modelle), die Evolutionsbiologie (die natürlich erklärbaren Voraussetzungen für die Entstehung und Entwicklung des Lebens) und das Leib-Seele-Problem. Im Gegensatz zu den spekulativen Glaubenssystemen – wie Religion, Mystik oder Esoterik – muss bei den von den einzelwissenschaftlichen Erkenntnissen sich abhebenden wissenschaftlich-metaphysischen Modellen die Rückgebundenheit mit den naturwissenschaftlichen Fakten und Erkenntnissen gewährleistet sein, um nicht ins Beliebige zu verfallen und damit ebenfalls zu einem pseudoreligiösen, rein spekulativen System zu degenerieren. Eine wichtige Aufgabe der Naturphilosophie besteht somit darin, die in unterschiedlichen einzelwissenschaftlichen Bereichen auftretenden Erkenntnisse zu einem konsistenten, einheitlichen und wissenschaftskompatiblen Weltbild zusammenzufügen, wobei sie immer aber auch eine kritische, erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch begründete Distanz zu diesen zu wahren hat.
Entgegen allen, hauptsächlich von theologischer Seite versuchten Kompatibilitätsbestrebungen zwischen Wissen und Glauben kommen wir zu der Überzeugung, dass die Dynamik des wissenschaftlichen Erkenntniszuwachses und die damit verbundenen philosophischen Implikationen sich immer mehr von den religiös-theistischen Anschauungen wegbewegen. Somit wird von uns ein naturalistischer Standpunkt vertreten, der von natürlich erklärbaren Ereignissen in der Natur (sowohl bei der Entstehung der Welt als auch in ihrer weiteren Entwicklung bis hin zum Leben und zu menschlichem Bewusstsein) ausgeht, bei der das entwicklungsgeschichtliche (evolutionäre) Welterklärungsprinzip eine absolute Schlüsselrolle darstellt. Mit dem Evolutionsgedanken ist es gelungen, die mit einer statischen Sichtweise verbundene, obsolet gewordene biblisch-kreationistische Weltanschauung erstmals naturwissenschaftlich und überzeugend zu widerlegen. Die Nicht-Existenz eines im Sinne des Theismus personal gedachten Gottes ist freilich aus einer naturphilosophischen Begründungsebene heraus nicht beweisbar. Jedoch handelt es sich unseres Erachtens aufgrund der erdrückenden Indizienlage beim Theismus um eine archaische, nicht mehr plausible und heute verzichtbar gewordene Zusatzhypothese. Außerdem sehen wir die „Beweislast“ für die Existenz metaphysischer Wesen nicht bei denjenigen, die sie aufgrund ihrer Unerkennbarkeit negieren, sondern bei denen, die sie trotzdem für existent erklären.
Im dritten Teil schließlich („Die philosophische und die theologische Kritik am (christlichen) Theismus“) kommen die Geisteswissenschaften zum Zug. Um die in den bisherigen Teilen geschilderten Diskrepanzen zwischen Glaube und Wissen in der Gegenwart unter ganzheitlichen Gesichtspunkten zu komplettieren, ist es notwendig, die historische Retrospektive auf das faktisch Geschehene der Religions- und Kirchengeschichte mit einzubeziehen. Zunächst aber werden einige philosophische Kritikpunkte am Theismus angeführt. Gegenstand der Erörterung sind unter anderem das Theodizee-Problem, Ludwig Feuerbachs Religionsphilosophie, die Darlegung der theologischen Auffassungen bedeutender Theologen des 20. Jahrhunderts und ihre Infragestellung durch eine weniger dogmengebundene „philosophische Theologie.“ Es wird deutlich gemacht, dass der gewichtigste Gegner aller Theologie die Theologie selbst ist, nämlich die in ihrer kritisch-historischen Ausprägung. Die „suizidäre“ Kritik der Kritischen Theologie ist dabei wesentlich direkter und somit wirkungsvoller als die philosophische und naturwissenschaftlich begründete, weil sie ohne Umwege philosophischer oder naturwissenschaftlicher Argumentationen an der Heiligen Schrift selbst ansetzt und hierzu ihre theologisch begründeten Zweifel äußert. Diese sind dabei so massiv geworden, dass damit, würde nur ein Bruchteil ihrer exegetischen Kritik berechtigt sein, das ganze Glaubensgebäude in sich zusammenstürzen müsste. Zusätzlich führen wir noch eine historische Kritik an, indem die Infragestellung der Kirche als göttliche Institution eines allmächtigen und allliebenden Gottes aufgrund ihrer eigenen Geschichte, also der so blutig verlaufenden Religions- und Kirchengeschichte, erfolgt. Neben dem Theodizee-Problem liefert die blutgetränkte historische Faktizität der Offenbarungsreligionen ungewollt selbst die besten Argumente für eine religionsnegierende atheistische Position. Durch die Einbeziehung der immanenten und selbstreferentiellen theologischen Kritik ergibt sich ein auch die Geisteswissenschaften, explizit die Theologie selbst berücksichtigendes abgerundetes Bild, welches dadurch dem möglichen Vorwurf eines einseitigen Naturalismus entgegentritt.
Grundsätzlich halten wir die Prämisse aufrecht, dass jeder nach seiner Fasson unter grundgesetzlichen Voraussetzungen glücklich werden solle. Der nach wie vor erhobene Anspruch der Kirchen auf Meinungsführerschaft und die staatlicherseits gebilligten Sonderrechte entsprechen aber schon lange nicht mehr ihrer tatsächlichen Bedeutung innerhalb der Gesellschaft. Die Diskrepanz zwischen beanspruchter ethisch-moralischer Leitfunktion und einer zunehmenden Säkularisierung, verbunden mit einer stark schwindenden Mitgliedschaft von bekennenden Christen mag dabei an selbst verschuldeten Skandalen, sicher aber auch an einer nachlassenden Nachvollziehbarkeit der für aufgeklärte Geister und Gesellschaften nicht mehr plausiblen archaischen Glaubensansprüche liegen. Die Verhältnisse haben sich noch mehr in Richtung Säkularisation verschoben, der gesellschaftliche Führungsanspruch der Kirchen aber bleibt, unterstützt von Politik und Medien, die in Unkenntnis oder trotz der Kenntnis der Kirchengeschichte, der Geschichte des Christentums und der Ergebnisse der Kritischen Theologie nach wie vor die christliche Glaubensideologie gegenüber agnostischen, atheistischen oder rein humanistischen Strömungen z. B. in den Kindergärten, Schulen und Medien bevorzugen. Und das, obwohl im Namen der letztgenannten Geisteshaltungen im Gegensatz zu den Offenbarungsreligionen keine andersdenkenden Menschen umgebracht oder Kriege im Namen der Rechtgläubigkeit geführt wurden. Der Atheismus ist unter intellektuellen und ethisch-moralischen Aspekten wesentlich besser als sein von kirchlicher und staatlicher Seite gepflegter schlechter Ruf. Für den Theismus dagegen trifft nach näherer und differenzierter Betrachtung genau das Gegenteil zu, wenn man in der Lage und willens ist, sich von den Fesseln der Tradition zu befreien und zur objektiven Prüfung und zu radikalen Hinterfragungen einen neutralen Standpunkt einzunehmen.
Üblicherweise erzeugen religionskritische Abhandlungen eher emotionale denn rationale Reaktionen. Eingedenk der damit verbundenen möglichen Flut an Protesten und Pamphleten, welche durch dieses Buch hervorgerufen werden könnten, berufen wir uns auf die Legitimität der Philosophie als rationale freie Kritik. Diese Kritik ist von uns philosophisch, naturwissenschaftlich und theologisch begründet. Sie drängt sich durch die dargelegten offenkundig fraglich gewordenen theistischen Geltungsansprüche und die dagegen noch immer beanspruchte gesellschaftliche Rolle des institutionalisierten christlichen Theismus als führende moralische und weltanschauliche Instanz geradezu auf. Noch extremer steht die islamfundamentalistische Glaubensideologie der aufgeklärten und wissenschaftlich begründeten Sicht gegenüber. Aus Gründen der Deeskalation ist es vernünftig, wenn Politiker sich hinstellen und behaupten, der islamistische Terror hätte nichts mit dem Islam zu tun. Faktisch jedoch ist dies falsch. Die Fundamentalisten werden zur Rechtfertigung ihres Terrors im Koran fündig, genau so wie Christen über Jahrhunderte, zum Beispiel bei den Kreuzzügen, sich auf das Alte Testament berufen hatten. Der islamistische Terror hat ebenso mit dem Islam zu tun wie die Kreuzzüge mit dem Christentum. Je unaufgeklärter und wortgläubiger die Anhänger einer wörtlichen und selektiven Auslegung von vermeintlich heiligen Büchern sind, desto stärker ist dabei ihr hasserfüllter Fanatismus. Dieser entlädt sich, wie wir an zahlreichen Anschlägen nun auch in Europa, insbesondere im Jahre 2015 in Paris, ersehen können, immer mehr in brutaler Gewalt. Diese Gewalt aber, wie sie in der langen Geschichte der monotheistischen Offenbarungsreligionen immer wieder propagiert und praktiziert wurde, ist das denkbar schlechteste und primitivste Argument, das man sich für welchen Glauben auch immer vorstellen kann. Auch dies unterscheidet weltlichen Humanismus und freie Philosophie von der Geschichte der monotheistischen Buchreligionen. Der Theismus im Allgemeinen und die christlichen Kirchen im Besonderen hatten ihre weltgeschichtliche Chance auf die Verwirklichung einer besseren und humaneren Welt und auf einen damit verbundenen moralischen Führungsanspruch. Sie haben beides – unter einem ganzheitlichen Blickwinkel gesehen – unumkehrbar selbst verspielt. Dies deutlich zu machen und ein klein wenig beizutragen, die nontheistischen Strömungen zu emanzipieren, zu rechtfertigen und durch Aufklärung vor reaktionären und restriktiven Einflüssen zu schützen, ist ein weiteres Agens dieses Buches. Die von manchen womöglich empfundene Einseitigkeit, mit der wir zugunsten des Logos und gegen die Ansprüche des Mythos – also die theistischen Glaubensansprüche – argumentieren, wollen wir damit entschuldigen, dass wir erstens aufgrund der alleinigen Rechenschaft vor unserem intellektuellen Gewissen zu keinem anderen Ergebnis gelangen konnten und es zweitens eine Unmenge auch an theophiler Literatur gibt, welche hinsichtlich dieses potentiellen Vorwurfes uns in nichts nachsteht. Mit dem Unterschied, dass wir uns nicht auf Glauben und Tradition, sondern auf unsere Ratio und zu einem großen Teil auf empirische, also wissenschaftliche Erkenntnisse stützen, eingedenk dessen, dass auch einzelwissenschaftliche Erkenntnisse nur approximativ und zeitlich begrenzte Gültigkeit besitzen könnten. Uns geht es aber auch gar nicht um letzte Beweise, sondern um Plausibilitäten. Diese aber sind für uns auf der Seite des Theismus so wenig auffindbar, wie sie uns vice versa auf der Seite der Religions- und Kirchenkritik regelrecht ins Gesicht springen. Dabei wäre es für den theistisch gedachten allmächtigen und allliebenden Gott doch so einfach, sich eindeutig und unmissverständlich so zu offenbaren, dass es weder ungläubige Atheisten noch unterschiedliche Religionen und somit falschgläubige Theisten geben müsste. Das Zulassen des Zustandes, dass weltweit ganz unterschiedliche, sich ausschließende Glaubens- und Nichtglaubensrichtungen existieren, die sich bekämpfen und sich in ihren Heiligen Schriften gegenseitig als jeweils Ungläubige die ewige Verdammnis androhen – alleine dieses Faktum ist schon ein unauflösbarer innerer Widerspruch des Monotheismus, wenn er von der Existenz eines gütigen und allmächtigen Gottes ausgeht. Das ist aber nur einer von zahlreichen anderen, in diesem Buch noch anzuführenden endogenen Widersprüchen der theistischen Glaubensideologie.
Nicht alle Menschen streben nach Erlösung von eingeredeten Sünden, einige streben auch nach Erkenntnis und Fortschritt. Was dem Homo religiosus sein anerzogenes Gewissen vor Gott ist, das ist dem selbständig denkenden Freidenker sein intellektuelles Gewissen. Den Befürwortern einer aufgeklärten und dynamisch fortschreitenden Weltanschauung ohne personifizierte Götter, Dämonen, Engel, Teufel, Wunder usw. sei deshalb mit diesem Buch ein Konglomerat an begründet kritischen naturwissenschaftlichen, philosophischen und theologischen Einwänden gegen restriktive Kräfte und ihr retrospektiv auf archaische Vorstellungen gegründetes Welt- und Gottesbild gegeben. Der Anhänger des (christlichen) Theismus wiederum mag vielleicht mit den in diesem Buch dargelegten Argumenten wenigstens erahnen können, weshalb es kritisch-rationalen und sich ihrem intellektuellen Gewissen verpflichteten Menschen nicht möglich ist, seine Glaubensüberzeugungen annehmen zu können. Man könnte die Sache darauf beruhen lassen, indem jeder doch das glauben und danach leben solle, was er für richtig hält, jedoch war und ist noch immer der Einfluss monotheistischer Religionen auf Gesellschaften und den Weltfrieden immens und keineswegs nur positiv – im Gegenteil. Zudem wird seitens der Vertreter jener Religionen unter Berufung auf ihre Heiligen Bücher (explizit auch auf das Neue Testament) den Ungläubigen die ewige Verdammnis angekündigt, was wir als unverhältnismäßig und als zutiefst inhuman erachten. Sei’s drum: Jener hasserfüllte und zutiefst inhumane Wunsch der ewigen Verdammnis und der größten Höllenqualen gegenüber Andersdenkenden wird den Agnostiker und Atheisten wohl kaum ernsthaft beunruhigen können, setzt er doch eben jenen von diesem ungeglaubten Glauben und Gott voraus, der aus seiner Sicht abstruse, widersprüchliche und – was insbesondere den Gott des Alten Testaments angeht – durchaus pathologische Züge trägt. Aus der geschilderten wissenschaftlichen und freidenkerischen Sicht wollen wir somit deutlich machen, dass auch der theistisch gedachte Gott der Buchreligionen letztlich nur ein von Menschen gemachter, demnach menschlich allzumenschlicher Gott ist. Darüber hinaus: Ob es überhaupt eine göttliche Entität in welcher Form auch immer gibt, darüber vermögen wir von unserem agnostischen Standpunkt aus nichts zu sagen.
Rothenburg ob der Tauber, 2015
Peter Kamleiter
TEIL I
VOM MYTHOS ZUM LOGOS ODER VOM KAMPF PROGRESSIV-AUFKLÄRERISCHER UND REPRESSIV-METAPHYSISCHER KRÄFTE
Einleitung
Im ersten Teil dieses Buches soll ein philosophiegeschichtlicher Überblick gegeben werden über die weit zurück reichenden Spannungen eines eher metaphysisch-repressiven Denkens auf der Grundlage religiöser Vorzeichen und eines progressiv-aufklärerischen Denkens, das dessen damit verbundene Ansprüche auf den monopolistischen Besitz absoluter Glaubenswahrheiten negiert. Die dabei aus der Philosophie erwachsenen, zunächst noch naturphilosophischen, später dann naturwissenschaftlichen Einzeldisziplinen mit ihren Erkenntnissen wirken dabei wie ein Katalysator dieses Prozesses. Die in der Überschrift vorangestellte Kurzformel „vom Mythos zum Logos“ soll diesen bis heute anhaltenden Prozess auf den Punkt bringen. Für beispielsweise sehr bibelgläubige Menschen mag ein Blick in die Bibel genügen, um alle Antworten auf unsere Fragen, z. B. jene der Entstehung der Welt, des Lebens und des Menschen, zu finden. Gemäß den Vorstellungen ihrer Verfasser herrscht hier kein evolutives, sondern ein kreationistisches Weltbild vor, dem zufolge die Welt nicht vor ca. 15 Milliarden Jahren, sondern – so die biblische Zeitrechnung – durch einen sieben Tage dauernden Schöpfungsakt vor knapp 6000 Jahren entstanden sei. Da aber aufgrund heutiger, z. B. anthropologischer und paläontologischer, Erkenntnisse Kulturen ebenso wie die damit zusammenhängenden Religionen selbst als ein erst relativ spätes Produkt der Menschheitsgeschichte angesehen werden müssen, muss, um das Menschsein (seine Herkunft, seine intellektuellen und affektiven Möglichkeiten bzw. Dispositionen) möglichst umfassend begreifen zu können, besonders auch von den heutigen Erkenntnissen, insbesondere den Evolutionstheorien, Gebrauch gemacht werden. Für ein solches, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierendes universelles Weltbild müssen wir aber weit über den Horizont religiöser Anschauungen (z. B. in zeitlicher Hinsicht) hinausgehen. Denn diese sind keineswegs als absolute und offenbarten Wahrheiten vom Himmel gefallen, sondern (ver-)bergen ihre mythologischen und vorgeschichtlichen, soziologischen, evolutionsbiologischen und kulturellen Voraussetzungen ebenso in sich selbst wie es auch andere kulturelle Hervorbringungen der Menschheit tun. Kurz: Das Menschsein beginnt nicht erst in der Zeit der Entstehung der großen Weltreligionen vor nur wenigen Jahrtausenden, sondern bereits vor vielen Jahrmillionen in Afrika. Bevor die theologisierenden oder philosophierenden Menschen sich den Kopf über Sein, Sosein und An-sich-Sein zerbrechen konnten, waren zunächst einmal Jahrmilliarden einer heute selbst unter den meisten Theologen unstrittig gewordenen Kosmos, Leben und Bewusstsein umspannenden allgemeinen Evolution nötig. Wir wissen dies und noch viel mehr, weil sich die progressiv-aufklärerischen Kräfte, wenn auch nicht gänzlich, aber doch in intellektuellen Kreisen sehr beachtlich bis heute gegen die restriktiven und verdunkelnden Mächte in der westlichen Geistesgeschichte durchsetzen konnten. Die mit diesem Prozess verbundenen Spannungen der okzidentalen Geistes- bzw. Philosophiegeschichte soll im folgenden Teil um des besseren Verständnisses der Hauptteile wegen vorangestellt werden, ohne dass damit aber auch nur annähernd ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden könnte. Zudem soll durch die diachrone Betrachtungsweise der sich antagonistisch gegenüberstehenden konservativen und progressiven Ideen auch ein gewisses historisches Verständnis für die heute vorhandenen Diskrepanzen von auf völlig unterschiedlichen Voraussetzungen ruhenden religiös und nichtreligiös begründeten Weltanschauungssysteme hergestellt werden.
1.Die griechische Antike
Für unser heutiges wissenschaftliches Denken ist es charakteristisch, mit Theorien zu operieren, die sich im Rahmen natürlicher Erklärungen bewegen, ohne also einen problematischen Bruch an einer gewissen Stelle der natürlichen Erklärungskette vollziehen zu müssen, um dann auf übernatürliche Erklärungen zurückzugreifen. Diese Entwicklung vom Mythos hin zum Logos beginnt im Wesentlichen um 600 v.u.Z. mit den Vorsokratikern bzw. den ionischen Naturphilosophen in den griechischen Kolonialstädten Kleinasiens. Sie gilt es hier als die ersten großen Aufklärer und Geburtshelfer unserer abendländischen Kultur zu würdigen. Auf Samos sowie in Milet und Ephesos entfaltete sich erstmals die große Idee, dass sich die Welt durchaus auch ohne Mythen und Götter begreifen lässt und dass es stattdessen Prinzipien, Kräfte und Naturgesetze gibt, mit denen sich die Welt ganz natürlich und unmythologisch begreifen lässt. Bis in die Neuzeit hinein waren von nun an Philosophie und die aus ihr entstandenen Einzelwissenschaften auf das Engste miteinander verbunden. Die Voraussetzungen für die Geburt des philosophischen Denkens, welches die abendländische Kultur entscheidend prägen sollte, waren sehr gut, denn auf dem kleinasiatische Terrain bildeten sich im Westen viele kleine und wohlhabende Stadt- oder Inselstaaten, die freien Gedanken gegenüber äußerst tolerant und offen eingestellt waren. Unter den Handelsstädten herrschte nicht nur ein reger Austausch an Waren, sondern auch an Gedanken und Wissen. Astronomie, Kalender, Münzen und Gewichte, vielleicht auch die Schrift übernahm man aus dem Osten. Dazu kam noch der Umstand, dass das Gemeinwesen nicht unter dem Joch einer organisierten und gestrengen Priesterschaft stand. Eine erbliche und privilegierte Priesterklasse wie in Babylonien oder Ägypten, die immer in Sorge war, mit neuen Ideen sei auch ein gefährlicher Wechsel des Weltbildes verbunden, der auch sie ihre Privilegien oder gar ihre berufliche Existenz kosten könnte, gab es nicht. Der günstige Umstand, dass das Gemeinwesen der Ionier unter keinem religiös-weltanschaulichem Joch und keinem „eifersüchtigen“ Gottes stand (wie bei den Israeliten), zeigt, zu welchen Erkenntnissen der Mensch fähig ist, wenn er frei leben, forschen und denken darf. Somit konnte damals das bis zu den Vorsokratikern vorherrschende mythische, heute eher grotesk anmutende Weltbild eines Hesiod oder Homer, in dem Naturerscheinungen mit Göttern identifiziert wurden, leichter überwunden werden. Mit einem Male traten Leute auf, die glaubten, dass alles aus Atomen bestehe, dass Krankheiten nicht von Dämonen oder Göttern verursacht würden, dass die Erde ein die Sonne umkreisender Planet sei, dass die Sterne keine Götter darstellen und sich als Himmelskörper in sehr weiter Ferne befinden – Betrachtungen also, die uns heute selbstverständlich erscheinen und die aus einer erstmals erwachten nüchternen, naturalistisch inspirierten Denkweise resultieren. Wie eng die Mythologie eines Volkes mit seiner realen Lebenswelt zusammenhängt und von dieser geprägt wird, können wir neben z. B. der chinesischen, aztekischen und zahlreichen anderen besonders gut auch an der babylonischen und ägyptischen Kultur studieren. So stellt sich der Kosmos nach alter ägyptischer Anschauung als enge Röhre dar, was deutlichen Bezug zur geographischen Gegebenheit des fruchtbaren Nildeltas aufzeigt, das durch Wüste und Gebirge – das Himmelsdach – begrenzt ist. Während aber die ägyptische Astronomie noch als phänomenale zu bezeichnen ist, da sie nur auf qualitative Beobachtung rekurriert und kaum rechnet bzw. nicht auf geometrische Modelle zurückgreift, arbeitete die babylonische Astronomie bereits mit Tabellen und machte in die Zukunft gerichtete Prognosen. Aber erst die Naturphilosophen der griechischen Kolonialstädte in Kleinasien brachten bei ihren kosmologischen Betrachtungen geometrische Modelle und physikalische Theorien mit ein und begannen die althergebrachten Naturmythen zu hinterfragen, was einigen, wie Anaxagoras, prompt den Atheismusvorwurf einbrachte. Anaxagoras, der die ionische Aufklärung nach Athen brachte, wurde wegen Gottlosigkeit aus dieser Stadt verbannt.
Die Vorstellung Anaximandros (um 610–547) war es, dass die Erde, die er sich als frei im Raum schwebend vorgestellt hatte, die Lebewesen durch allmähliche Austrocknung selbst hervorgebracht hatte, wobei diese zunächst im Wasser lebten und später auf das Land überwechselten. Damit hatte Anaximandros nicht nur die moderne Entwicklungslehre ansatzweise vorgedacht, sondern auch die heute innerhalb der Evolutionstheorie vertretene Theorie, dass das Leben abiotisch (also allmählich nach vielen Zwischenstufen aus letztlich toter Materie) und ohne Eingreifen übernatürlicher Mächte entstanden sei. Aus der Hilflosigkeit neugeborener Landtiere sowie der menschlichen Säuglinge zog Anaximandros den Schluss, dass dies nicht die früheste Form des Lebens sein könne. Fische kümmern sich nämlich nicht weiter um ihre Nachkommen, also müsse das Leben generell ursprünglich aus dem Wasser hervorgegangen sein. Seine Entwicklungstheorie wurde vom großen Platon verspottet. Sein abstrakt idealistisches Denken war dem naturalistischen, aus der Erfahrung schöpfenden Denken der Naturphilosophen diametral entgegengesetzt. Ohne die durchaus auch großartigen Gedanken Platons schmälern zu wollen, liegt hier aber das Übel begründet, welches in unserer europäischen Geistesgeschichte viele Jahrhunderte lang jegliches empirisches Denken zugunsten einer einseitig idealistischen, sich auf Platon4 stützenden christlich-dogmatischen Philosophie bis in die Neuzeit gar nicht erst aufkommen ließ. Freies Forschen, technische Entwicklung, geistiger Fortschritt durch freies Denken und Philosophieren und eine damit ermöglichte adäquate Erkenntnis der Natur wurden Jahrhunderte lang wegen ideologischer und dogmatischer Restriktionen verhindert. Anaximandros hatte auch die Idee einer unendlichen Anzahl bewohnter, dem Kreislauf von Werden und Vergehen unterworfener Welten entwickelt. Ein Gedanke, den außer in den östlichen Religionen viel später auch Nietzsche und einige Kosmologen mit dem Modell des oszillierenden bzw. des pulsierenden Weltalls ins Kalkül gezogen haben, wenn nämlich die Gravitationskräfte irgendwann die Expansionskräfte des Universums übersteigen und es somit zu einer Implosion kommt, an deren Ende der sogenannte „big crunch“ steht, aus dem dann wiederum ein neues expandierendes Universum hervorgeht, in infinitum.5 Noch ein weiterer ionischer Naturphilosoph, Empedokles (um 495–435), dachte mit dem Entwicklungsgedanken die Evolutionstheorien voraus, denn nach seiner Vorstellung entstanden zunächst die niederen und danach die höhere Organismen (Pflanze → Tier → Mensch). Auch die sich im Volksbewusstsein lange Zeit haltende Vorstellung von den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft gehen auf ihn zurück. Anaxagoras (um 500– 428) wiederum war der erste überlieferte Naturalist, der den Mondschein als reflektiertes Licht identifizierte. Ihm wurde ebenfalls der Prozess wegen Gottlosigkeit gemacht, weil er den Mond aus gewöhnlicher Materie bestehend und die Sonne als einen rotglühenden Stein am Himmel betrachtete, sie also somit nicht für Gottheiten hielt.
Xenophanes (um 570–470) wandte sich, wie später Feuerbach auf das Christentum bezogen, gegen die Vermenschlichung der Götter und war somit ebenfalls einer derer, die gegen die althergebrachte Religion und gegen jede Art von Aberglauben ankämpften. Dies war eine weitere Voraussetzung dafür, einer naturalistischen Sichtweise den Weg zu ebnen, z. B. wenn nunmehr Krankheiten und Seuchen des Apolls oder die Blitze des Zeus auf natürliche Ursachen zurückführt wurden. Gleichwohl ist Xenophanes nicht unbedingt als Atheist zu bezeichnen, sondern – und das hat er mit vielen großen naturwissenschaftlichen und philosophischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts gemeinsam – sein Standpunkt ist der des Agnostizismus, wie das folgende Fragment Nr. 34 belegt: „Nimmer noch gab es den Mann und nimmer wird es ihn geben, der die Wahrheit erkannt von den Göttern und allem auf Erden. Denn auch, wenn er einmal das Rechte vollkommen getroffen, wüsste er selbst es doch nicht. Denn Wähnen nur ist uns beschieden.“ Von ihm stammt auch das bekannte Zitat: „Wenn Kühe, Pferde oder Löwen Hände hätten und damit malen und Werke wie die Menschen schaffen könnten, dann würden die Pferde pferde-, die Kühe kuhähnliche Götterbilder malen und solche Gestalten schaffen wie sie selber haben.“6
Für Heraklit (um 520–460) vollzieht sich alle Entstehung in einem polaren Zusammenspiel gegensätzlicher, aber natürlicher Kräfte. Übertragen auf den gesellschaftlichen Bereich würde dies bedeuten, dass die Hoffnung auf einen allumgreifenden Weltfrieden, wie er beispielsweise heute von Friedensbewegungen ersehnt wird, reine Illusion ist, weil er einem Naturprinzip, dem des Kampfes, widerspricht. Heraklits Urprinzip, das er in einer Art Urfeuer oder Urenergie sah, deckt sich sehr gut mit dem heutigen Forschungsstand der Kosmologie, die mehr als nur plausible Hinweise für einen Urknall aufweisen kann. So betont auch Werner Heisenberg, dass Heraklits Lehre vom Urfeuer, wenn man sie heute zeitgemäß als Energie deutet, der modernen Physik zumindest prinzipiell „außerordentlich nahe kommt“.7
Nach Demokrit (um 460 bis frühes 4. Jahrhundert), dem Begründer der genialen und heute immer noch aktuellen Atomlehre, entstehen und vergehen ebenfalls von Ewigkeit her zahllose Welten. Dies jedoch erfordert auch für ihn keineswegs einen planenden oder lenkenden Geist, sondern alles geschieht mit einer dem Sein immanenten Gesetzmäßigkeit. Interessant an den Atomisten, zu denen neben Demokrit noch Leukippos und Epikur zu zählen sind, ist aber besonders die Tatsache, dass ihr Atomismus heute – zwar stark modifiziert, aber zumindest prinzipiell – bestätigt ist. Für die antiken Atomisten waren die Atome unsichtbar klein, hinsichtlich ihrer stofflichen Beschaffenheit gleich, in Form und Größe unterschiedlich, dabei ständig in Bewegung, was wiederum einen leeren Raum voraussetzte. Diesen aber leugnete Parmenides und versuchte deshalb dieses „Nichts“ (also den leeren Raum) und alle Bewegung als bloßen Schein abzutun. Interessant ist, dass über die Atomtheorie hinaus bereits Epikur das stochastische Element entdeckte und in die atomistische Ontologie ein spontanes, akausales Abweichen der Atome von ihrer atomistischen Bahn im Raum einführte.8 Trotz aller bewundernswerter prinzipieller antizipativer Gedanken der griechischen Vorsokratiker darf man die Analogien und prinzipiellen Übereinstimmungen mit den heutigen physikalischen Erkenntnissen natürlich auch nicht zu weit treiben. So betont Heisenberg einen großen Unterschied zwischen der modernen Naturwissenschaft und der griechischen Philosophie, den er in der empiristischen Haltung sieht, die bei den Griechen einfach noch nicht ausgebildet war und erst seit Galilei und Newton ihren entscheidenden Durchbruch hatte.
Dass die Vorsokratiker im Gegensatz zu den später auftretenden klassischen griechischen Philosophen heute kaum bekannt sind, hat seine Ursache nicht in deren Minderwertigkeit, sondern in der Tatsache, dass von diesen nur spärliche Überlieferungen und Fragmente vorhanden sind. Vielleicht wäre die Menschheit zumindest in ihrer technologischen Entwicklung und in ihren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen heute um zwei Jahrtausende weiter – nämlich um die Zeit von den Vorsokratikern bis zur Renaissance, als das naturwissenschaftliche Denken langsam wieder zu seiner Freiheit und Unabhängigkeit gelangte –, wenn nicht die Unterbrechung dieses naturwissenschaftlichen Forscherdranges durch das religiös-ideologisch9 dominierte christliche Mittelalter gewesen wäre. Auch wenn wir hierüber zwangsläufig nur spekulieren können, so hat dieser Gedanke bei näherer Betrachtung durchaus etwas Plausibles an sich. Man stelle sich vor, die gegenwärtige Menschheit könnte sich – was den technischen Fortschritt anbelangt – bereits heute auf dem Niveau etwa des Jahres 4015 n.u.Z. befinden.10 Ob dies ein letztlich begrüßenswerter Umstand für die heutige Menschheit wäre ist freilich fraglich.
Mit dem Auftreten der ersten Sophisten (450–380) begann sich der Blick von einer unbefangenen Erklärung der Welt wegzuwenden, hin zu an sich durchaus legitimen Überlegungen über die Zuverlässigkeit der sinnlichen Wahrnehmung bis hin zu einem allgemeinen Zweifel an der Erkenntnisfähigkeit des Menschen überhaupt und der Leugnung objektiver Maßstäbe für Wahrheit. Der Mensch und nicht mehr die Welt stand von nun an im Mittelpunkt philosophischer Betrachtungen. Entsprechend dem späteren Höhlengleichnis Platons ist nun der wirkliche Philosoph der, der als Gefangener aus der Höhle des Scheins in das Licht der Wahrheit entflohen ist. Nur er besitzt wahres Wissen, indem er sich an die ewigen und unveränderlichen, bereits präexistent geschauten Ideen wieder erinnert (Anamnesis-Lehre). Durch diese unmittelbare Möglichkeit des Schauens der Wahrheit – d. h. im Platonismus der abstrakten, aber im Reich der Ideen für real existierend gehaltenen Ideen oder später im christlichen Sinne mit der Idee eines transzendenten, dreieinigen und personalen Gottes – entsteht eine ideelle Wirklichkeit, die nun ansetzt, sich über die Wirklichkeit der Welt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, zu erheben. Die unmittelbare Verbindung zu Gott vollzieht sich nun in der menschlichen Seele, nicht in der äußeren Welt. Gerade diese subjektivierte Problemstellung hat das menschliche Denken mehr als irgendein anderes in den zweitausend Jahren nach Platon beschäftigt.
Eine Ausnahme und einen ganz besonderer Fall, der zeigt, dass sogar Mystiker einmal zu wissenschaftlichen Ehren gelangt sind, bildet der Fall Pythagoras (um 575–500) und seiner Schule. Die Schule des Pythagoras ist ebenfalls eine ganz entscheidende Voraussetzung für Platons Philosophie gewesen, die so gewaltigen Einfluss auch auf das christliche Abendland haben sollte. Ausgehend von einer Zahlenmystik, d. h. dem Gedanken, dass alles Sein auf Zahlen und Proportionen aufgebaut ist, entwickelte diese Schule eine bis dato noch nicht da gewesene mathematische Fertigkeit, verbunden allerdings mit skurrilen Absonderlichkeiten, die die Pythagoreer mit dieser formalwissenschaftlichen Arbeitsweise verbanden. Die mystischen Folgerungen aus den dagegen zu würdigenden mathematischen Leistungen sind aber innerhalb der Philosophiegeschichte weitgehend unberücksichtigt geblieben.11 Das größte Verdienst der Pythagoreer war sicher die Einführung der Zahl in die Philosophie als immaterielles, aber relationales Prinzip der Welterklärung. Der Philosoph Bertrand Russell hält Pythagoras gar für einen der einflussreichsten Denker überhaupt. Für ihn erweist sich sogar der Platonismus „bei entsprechender Analyse im Wesentlichen als Pythagoreismus.“12 Dies trifft für beide Seiten des Denkens zu, sowohl für die mathematisch-deduktive (als deren Begründer nach Russell Pythagoras zu betrachten ist) als auch für die dunkle mystische Seite. Pythagoras selbst hielt sich für einen Halbgott, der die sinnliche Welt unter die Welt der mathematischen Ideen stellt, die Seele für unsterblich und in anderen lebenden Wesen ständig neu inkarniert sieht. Der Körper ist nur das Grab der Seele, so seine wahrscheinlich von östlichen Lehren beeinflusste Philosophie. Von hier aus wird also ersichtlich, wie der Seelenglaube später über Platon, die Gnostiker und den Neuplatonismus auch auf das Christentum, wenn auch modifiziert, wirkte.13
Wenn sich die Sinnenwelt der Mathematik nicht fügte, so war dies eher ein Beweis dafür, wie trügerisch Erstere doch letztlich sein muss. Umso unglücklicher für Pythagoras‘ System („alle Dinge sind Zahlen“) war es, dass sein Theorem zur Entdeckung inkommensurabler Größen führte, die seine gesamte Philosophie infrage stellte. So ging die Geometrie der Griechen von Axiomen aus, die vielleicht als evident bezeichnet werden können, aber in ihren deduktiven Schlüssen zu Theoremen verarbeitet werden, die diesen Status kaum mehr aufrechterhalten können. Dabei scheinen die mit rationalistischer Einstellung verbundenen mystischen Assoziationen auch ein gewisses Hemmnis für empirische Erkenntnis gewesen zu sein. So betrachtete man bei den Pythagoreern und Platon bis ins ausgehende Mittelalter den Kreis als geometrisch vollkommene Figur. Dies behinderte den Fortschritt in der Kosmologie insofern, als man sich nicht vorstellen konnte, Gott könnte die Planeten in elliptischen Bahnen, die als unvollkommener als Kreise angesehen wurden, verlaufen lassen. Kopernikus, der nach antiken Vorgängern als Erster wieder ein heliozentrisches Weltbild vertrat, konnte mit seiner Theorie die Beobachtungen an den Bewegungen der Planeten nicht vollständig erklären, weil er an den idealistischen Vorstellungen seiner Vorgänger und damit ebenfalls an den Kreisbewegungen festhielt. Erst Kepler entdeckte 1609 die Ellipsenformen.14 So können also rein idealistische bzw. ideologische Vorgaben durchaus an den Fakten der Natur bzw. an deren Beobachtung scheitern und zu falschen dogmatischen Auffassungen führen.
Für Russell ist diese Hochhaltung der Mathematik auch die „Hauptquelle des Glaubens an eine ewige und exakte Welt“, wie sie besonders in Platons Ideenlehre zum Ausdruck kommt. Platons zentraler philosophischer Gedanke ist der, dass es das „Gerechte an sich“, das „Schöne, Gute, Große… an sich“, den „Kreis an sich“, den „Menschen an sich“ usw. nicht bloß in der Vorstellung des menschlichen Geistes, sondern in seiner Urform realiter und objektiv in einer Art „Ideenhimmel“ gibt. Die Seelen der Verstorbenen schauen diese Ideen bzw. Wahrheiten, vergessen sie aber wieder bei ihrer Wiedergeburt. Alle irdischen Phänomene sind nur unvollkommene Abbilder jener Urbilder, welche im Gegensatz zur Sinnenwelt die eigentliche Wirklichkeit darstellen. Diesen Ideen kommt auch Vollkommenheit und Unveränderlichkeit zu. Sie sind die Voraussetzung für die Existenz aller Sinnesobjekte. Im Gegensatz dazu vertritt sein Schüler Aristoteles die Auffassung, dass vielmehr die Einzeldinge die eigentliche Wirklichkeit ausmachen und die Allgemeinbegriffe lediglich das intellektuelle Bedürfnis ausdrücken, die Phänomene in Ordnungskategorien zu klassifizieren. Somit hatte bereits Aristoteles die möglichen Schwächen dieses idealistischen Systems aufgezeigt. Für Aristoteles zielt alles logische und mathematische Denken auf lediglich ideale Objekte des Geistes ab, deren reale Existenz in einem „Ideenhimmel“ keineswegs zwingend ist. Die an sich begrüßenswerte intelligible Perfektionierung abstrakter Theorien (wie der Mathematik) führte mit Platon aber auch zu einer Vernachlässigung der empirischen Welt. Nun werden sogar mystische Lehren durch reine Mathematik erhärtet, da Zahlen real, ewig und nicht zeitgebunden sind. Lag also mit dem vorpythagoreischen Orphismus eine den asiatischen Mysterienreligionen ähnelnde Lehre vor, so tritt nun mit Pythagoras über Platon, Thomas von Aquin, Descartes, Spinoza, Leibniz… die Verschmelzung zweier Gegensätze – Religiosität und Vernunft (mehr oder weniger mathematisch bzw. geometrisch ausgerichtet) – ein, was teilweise groteske Züge annahm. Auch die unterschiedlichen und widersprüchlichen Ergebnisse, zu denen man dabei gelangte, zeigen, dass diese einseitig rationalistische Methode nicht ihren eigenen Ansprüchen, nämlich exakte Beweise auch für metaphysische „Wahrheiten“ liefern zu können, gerecht werden konnte.
Der große Gegenspieler Platons war sein Schüler Aristoteles (384–322). Die Gegensätze beider Denker hat der Maler Raffael in seiner „Schule von Athen“ um 1510 sehr treffend dargestellt, indem er Platon mit dem Finger nach oben, also in Richtung des überirdischen „Ideenhimmels“ als Ort reinster Erkenntnis und absoluter Wahrheiten, zeigen lässt, während der ihm im Gespräch zugewandte Aristoteles mit der Hand nach unten, also eher zur Erde hin deutet und somit die empirische, weniger spekulative und weniger metaphysische Position vertritt. In der Tat verkörpern beide Philosophen den Gegensatz des Idealismus und des Empirismus. Erkenntnis ist für Aristoteles, den Begründer der systematischen Logik, nicht ein Wiedererinnern an die in einem behaupteten „Ideenhimmel“ einst geschauten Ideen bzw. Wahrheiten, sondern fängt ganz profan und induktiv von unten an. Aus Wahrnehmung (die allen Lebewesen zukommt) wird Erinnerung (wozu einige Lebewesen fähig sind), wiederholte Wahrnehmung verdichtet sich zu Erfahrung (höhere Tiere und der Mensch) und aus dieser wiederum folgt das Wissen (Eigenschaft nur des Menschen), indem Allgemeinbegriffe, Prinzipien und Definitionen gebildet werden. Während also für Platon die Einzeldinge nur in Abhängigkeit von den intelligiblen Ideen existieren und letztere deshalb eine höhere Seinsebene erhalten, geht Aristoteles den umgekehrten Weg von unten (Einzeldinge) nach oben (Allgemeinbegriffe) und kritisiert Platons Position darin, dass dieser die Ideen von der Sinnenwelt abgrenzt, dabei aber auch die Ideen als Einzeldinge gekennzeichnet werden, was aber ihrem eigenen Definitionsanspruch der Allgemeinheit widerspricht. Aber auch Aristoteles gelangt mit seiner empirisch ausgelegten Philosophie zu einer Art Gottheit, die er als den ersten, selbst unbewegten Beweger bezeichnet. Aristoteles ging noch davon aus, dass die Zeit selbst und die Veränderungen unveränderlich sind. Eine Position, die in Einsteins Relativitätstheorie widerlegt wird. Die einzige Veränderung, die für Aristoteles ewig existieren kann, ist dabei die auch für Platon ideale Kreisbewegung. Die vermeintliche Kreisbewegung der Fixsterne muss daher ebenso eine ewige und immaterielle Substanz haben, die er als von einem ersten Beweger verursacht betrachtet. Es ist aber keineswegs ein persönlich gedachter Gott, sondern dieser erste Beweger ist „nous“, also immaterielle Vernunft, die sich quasi selbst denkt. Da aber nur Lebendiges denken kann, ist Aristoteles’ Gott zumindest belebt und bewegt die ganze Natur. Die Lebewesen existieren in gewisser Weise als Art und durch die Fortpflanzung ebenfalls ewig. Ebenso wie der physikalische oder kosmologische Ausgangspunkt, nämlich der einer ewigen und unvergänglichen Zeit, aus heutiger Erkenntnislage heraus bezweifelt werden kann, so gilt dies auch für diese biologische Annahme, die ebenfalls für Aristoteles ein Indiz für einen göttlichen Beweger ist. Wir wissen heute, dass die rezenten Lebensformen einst abiotisch und erst in vielen Zwischenstufen evolutiv entstanden sind, dass umgekehrt aber auch Arten aussterben und dass spätestens mit dem Erlöschen der Sonne auch auf unserem Planeten kein Leben mehr möglich sein wird. Damit fällt ein wesentlicher Baustein der Argumentation des Aristoteles für einen göttlichen Beweger weg. Zumal das Problem letztlich auch nur verschoben wäre, weil nicht geklärt ist, wer den ersten unbewegten Beweger bewegt hat. Die Annahme eines ersten unbewegten Bewegers gleicht ein wenig dem Problemlösungsversuch des durchgeschlagenen gordischen Knotens. Wenn man einen ersten unbewegten Beweger postuliert, dann ist die Frage berechtigt, warum man nicht auch für einen unbewegten, ewig existierenden Kosmos plädieren sollte, ohne einen vorgeschalteten göttlichen Beweger. Es wäre zumindest eine sparsamere These, die auch nicht einen überflüssigen Hiatus von natürlichen Erklärungen hin zu übernatürlichen aufweist. Andere bekannte Irrtümer Aristoteles‘ waren seine Annahmen, dass schwere Körper im freien Fall schneller fallen, je schwerer sie sind; oder seine These vom horror vacui (Abneigung der Natur gegen das Leere bzw. Nicht-Seiende) und der damit verbundenen Äthertheorie; oder die Behauptung, das Gehirn sei eine Art Kühlorgan und das Denken vollziehe sich in der Herzgegend. Dennoch war er auf vielen Gebieten ein überragender Denker, der sowohl in theoretischer Hinsicht mit der Herausbildung einer bis weit in die Neuzeit hinein kaum verbesserten Logik als auch in praktischer Hinsicht, was viele seiner biologischen Untersuchungen angeht, Herausragendes geleistet hat. Wie vor ihm Platon, so hat auch Aristoteles das christliche Mittelalter sehr stark beeinflusst und wurde von den christlichen Gelehrten sozusagen als intellektuelle Krücke für ein ansonsten eher mythisches und aus rein objektiver Sicht gesehen auch irrationales Glaubensgebäude aus Wundern, Dämonen, Engeln, Teufeln, Heiligem Geist, Jungfrauengeburt, Wiederauferstehung, Himmelfahrt… gerne adaptiert. Dennoch gab es auch zwischen der Theologie des christlichen Mittelalters und der Weltsicht des Aristoteles einige unüberbrückbare Diskrepanzen. So konnte man von theologischer Seite seine Thesen von der Ewigkeit der Welt und der absoluten Gültigkeit der Naturgesetze nicht akzeptieren. Interessanterweise stieß aber gerade seine Rechtfertigung der Sklaverei bei einigen Scholastikern auf Interesse und sogar auf grundsätzliche Zustimmung. Auch Aristoteles‘ Standpunkt einer sterblichen Seele passte nicht so recht in das Himmelskonzept und die Versprechungen eines ewigen Lebens.
Ein weiteres und letztes Beispiel, wie sehr das freie und rationale griechische Denken dem mythologischen Denken zeitgleicher anderer Kulturen überlegen geworden ist, sind die Erkenntnisse des Naturphilosophen und Astronomen Aristarchos von Samos (310–230). Nicht nur dass er im Gegensatz zu den alttestamentarischen Autoren ein heliozentrisches Weltbild vertrat, mit Mathematik und den einfachsten empirischen Mitteln kam er zu dem Ergebnis, dass die Erde 2,85 mal so groß wie der Mond ist. Der tatsächliche Faktor beträgt 3,67. Und auch wenn er die Entfernung der Erde zur Sonne noch nicht exakt bestimmen konnte, so besteht sein Verdienst darin, dass er tendenziell richtig lag und zumindest einen Eindruck von den wirklichen Dimensionen unseres Planetensystems gewonnen hatte. Da die Sonne statt 400 mal nach Aristarchos nur 19 mal so weit entfernt ist von der Erde wie der Mond, schloss er daraus, dass erstens – da Sonne und Mond am Himmel etwa gleich groß erscheinen – auch der Größenunterschied das 19fache betragen müsse; und dass zweitens ein so großes Himmelsgestirn wie die Sonne auch das Zentrum des Universums sein müsse. Nach Kleanthes vertrat Aristarchos zudem die Auffassung, dass nicht der Himmel sich um die Erde, sondern diese sich um die eigene Achse drehe. Auch Aristarchos Arbeiten blieben im Gegensatz zu den Schriften des Aristoteles und Platon lange unbeachtet, weil sie dem biblischen Weltbild und somit den Auffassungen des christlichen Mittelalters widersprachen. Erst durch Nikolaus Kopernikus wurden sie neu entdeckt und wieder aufgegriffen.
Insgesamt lässt sich also mit dieser kurzen Zusammenfassung festhalten, dass antike Philosophen wenig geeignet sind, um sich auf diese als Kronzeugen für ein theistisches Welt- und Gottesbild berufen zu können.
2.Das Mittelalter
In der mittelalterlichen Geistesgeschichte15, die vorrangig Theologie war, spielt die Antike eine noch immer dominierende, wenngleich auch eine unter die Knute der christlichen Ideologie geratene Rolle. Der intellektuell eher anspruchslose urchristliche Glaube bedurfte der philosophischen Absicherung, indem man beispielsweise mit Platons Ideenlehre religiöse Glaubenspositionen nun auch intellektuell, d. h. philosophisch, festigen und formen konnte, und später mit Hilfe Aristoteles sogar zu „beweisen“ vermeinte. Das Mittelalter holte sich aus der antiken Philosophie wie aus einem Steinbruch die Steine zur Untermauerung seiner theologischen Konstruktionen. Man anerkannte die heidnischen Vorstellungen eines höchsten Gutes (Platon), welches der christlichen Vorstellung sehr nahe kam, aber bemitleidete gleichermaßen die großen antiken Denker, weil sie aufgrund ihrer frühen Geburt ohne den „rechten“ Glauben – womit freilich immer nur der christliche Glaube gemeint war – dennoch der Verdammnis ausgeliefert waren. Nach Dantes Göttlicher Komödie „genießen“ Vergil, Homer, Horaz, Ovid… als Ungetaufte aber immerhin einen bevorzugten Platz in der Hölle.
Die Märtyrer und Heiligen des Mittelalters selbst waren aber wohl mehr Glaubens- als Liebeshelden, da der Glaubenseifer jenen Eifer an guten Werken bei weitem überwog. Und wenn Barmherzigkeit praktiziert wurde, dann auch nicht aus humanistischen oder altruistischen Gründen, sondern um Christi willen, da man sich davon – nicht ganz ohne Eigennutz – einen gewissen Lohn, nämlich das ewige Leben, erhoffte. So wurde Christi Mitleid, wenn es sich nicht um Andersgläubige handelte, zwar nachgeahmt, die Armut als solche aber nie beseitigt. Daran bestand auch herzlich wenig Interesse. Im Gegenteil, die Kurie profitierte von der Ausbeutung und, was dazu notwendig war, von der geistigen Unterdrückung und Manipulation der damals höchst naiv strukturierten und so auch bewusst gehaltenen Menschen. Selbstverständlich wurden die Ordnung der Gesellschaft in Stände sowie die Zugehörigkeit des Individuums zu seinem Stand demnach auch als gottgewollt und unveränderlich propagiert.
Die im römischen Reich wenigstens einigermaßen vorhandene Toleranz in Religionsangelegenheiten wurde mit dem Christentum immer mehr abgelöst von einem religiösen Fanatismus und einer zunehmenden Gewaltbereitschaft bei der Bekehrung oder Ausrottung der Heiden. Die christliche Liebe war zu diesem Zeitpunkt wahrlich keine von Herzen kommende Liebe, sondern stand immer im Bann der religiösen Ideologie und wurde dieser in praxi untergeordnet. Selbst der barmherzige Franz von Assisi ordnete an, dass man Brüder seines Ordens, die als „nicht katholisch“ betrachtet werden können, ruhig ins Gefängnis werfen könne.16
Besonders charakteristisch für das Lebensgefühl und das Weltbild der mittelalterlichen Menschen war das von der kurialen Obrigkeit auch zum Zwecke der Gefügigmachung der Plebs bewusst einverleibte Bewusstsein, dass das Jenseits wichtiger sei als das Diesseits. Dementsprechend war auch das irdische Leben der Menschen ausgerichtet und gesteuert. So gut wie alle Annehmlichkeiten des Lebens wurden verteufelt, während die hohe Kirchlichkeit sich bereits im Diesseits den Himmel mit Völlerei, Hurerei und zahlreichen anderen Annehmlichkeiten auf Kosten der gutgläubigen und ausgebeuteten Masse gönnte. Um an die begehrten kirchlichen Ämter zu kommen, schreckte man auch nicht vor Intrigen, Betrug (Konstantinische Schenkung), ja nicht einmal vor Mord zurück. Die Geschichte der Päpste ist nachgewiesenermaßen auch eine Geschichte voller Grausamkeiten, Ausschweifungen, Skandale, moralischer Verkommenheit, Kriege und Schreckensherrschaft.
Auch der gemeine mittelalterliche Mensch war durchdrungen von einem manipulierten Bewusstsein über die Schlechtigkeit der Welt. Diese wurde durch eine Frau mit einem wunderschönen Antlitz symbolisiert, die aber, wenn sie von der anderen Seite betrachtet wird, von Würmern, Schlangen und Geschwüren verunstaltet ist. Dass es aber nicht die Schlechtigkeit der Welt ist die den Menschen betrügt, sondern dass die Menschen auch mit Hilfe der Religion selbst für diese Lage verantwortlich sind, kam den Theologen und Denkern gar nicht erst in den Sinn. Zu sehr war man von einem schicksalhaften und allein in Gottes Hand liegenden Leben überzeugt, welches jegliches Gefühl der Eigenverantwortlichkeit erst gar nicht aufkommen ließ. Eine Revolution von unten nach oben zur Abschaffung dieses Übels war aufgrund dieser bewusst gepflegten Geisteshaltung und einer mit Blut aufrechterhaltenen Hierarchie nicht zu erwarten.
Das Mittelalter war auch die Zeit von Aberglauben, Hexenwahn, Scheiterhaufen, Satansglaube, Endzeiterwartung und Intoleranz gegenüber Andersdenkenden (es gab nur zwei Alternativen: katholischer Glaube oder Verfolgung und Tod), die durchaus von oben, also vom Klerus, inauguriert und gefördert wurden, sei es aus echter Überzeugung von der Wahrheit dieses Aberglaubens, sei es aus purem Machtinteresse. Eine durch Dämonen- und Teufelsglauben in Angst und Schrecken lebende unaufgeklärte Bevölkerung ist leicht zu beherrschen und zu manipulieren.
Geprägt war diese dunkle unaufgeklärte Zeit zudem von der Überzeugung, Weltgeschichte sei Heilsgeschichte und die Erlösung durch Christus und das Reich Gottes stehen unmittelbar bevor. So sind alle mittelalterlichen Gliederungen der Weltgeschichte direkt auch auf das Seelenheil des Menschen bezogen, geprägt durch den Glauben, sich im letzten Weltalter zu befinden mit dem Ende der Zeiten in naher Zukunft. Joachim da Fiore (um 1135–1202) teilte die Weltgeschichte entsprechend der Trinität in drei Abschnitte ein. Auf das Reich des Vaters (die Zeit des Alten Testamentes) folgte das des Sohnes (die Zeit des Neuen Testamentes). Das dritte glückliche Zeitalter des Heiligen Geistes sollte seiner Vorhersage nach 1260 anbrechen und alle Freuden des Himmlischen Jerusalem (Offenbarung 21) bieten.
Es herrschte aber nicht nur die geistige Niederhaltung des gemeinen Mannes. Bauern, die über 90 % der Bevölkerung ausmachten, standen auch in klösterlichen Frondiensten, lieferten Naturalien, Zinsen und darüber den Kirchenzehnt ab. Es gab so gut wie nichts, was nicht dem Einfluss der Kirche und des Glaubens unterworfen gewesen wäre. Im Gegensatz zur Gegenwart herrschte gewiss auch kein Priestermangel, man schätzt heute, dass im 13. Jh. in Deutschland jeder neunte die geistlichen Weihen besaß. Das öffentliche und private Leben bis in die letzten Winkel der Psyche (des Gewissens) hinein war infiltriert von kirchlichen Bevormundungen und Suggestionen.
Zu welcher antihumanistischen Entartung religiöser Fanatismus fähig ist, sieht man auch an den Regeln der frühen Benediktiner. Unbedingter Gehorsam, Aufgabe der eigenen Meinung und des eigenen Willens, keine Scherze und kein Lachen. Der Mönch soll außerdem „das ewige Leben mit aller Begierde des Geistes ersehnen“, „den drohenden Tod vor Augen haben“, „die Gelüste des Fleisches nicht befriedigen“ und „vor der Hölle zittern“. Auch bei den Franziskanern ist diese Weltfremdheit und vor allem auch Weltfeindlichkeit vorhanden. Tanzen z. B. war eine gefährliche Angelegenheit zur Sünde, wie die Frauen insgesamt aufgrund einer alle Sinnlichkeit ablehnenden Einstellung mit einer offenen Feindseligkeit betrachtet wurden. So schrieb schon Hieronymus: „Die Frau ist die Pforte des Teufels, der Weg der Bosheit, der Stachel des Skorpions, mit einem Wort, ein gefährlich Ding.“17 Der Abstand zwischen den einstigen Idealen des Stifters des Christentums und der Wirklichkeit, also mit unermesslichem Luxus, Genusssucht auf der einen und Armut, geistiger Unterdrückung, körperlicher Grausamkeit und schreiendem Unrecht auf der anderen Seite, war exorbitant. Noch heute besteht diese schwer nachvollziehbare Kluft zwischen kurialem Reichtum und einer unsäglichen Armut unter dem weitaus größten Teil der Erdbevölkerung.
Verglichen mit dem Geschichtsabschnitt der heidnischen Griechen und Römer scheint das christlich geprägte und dominierende Mittelalter alles in allem ein, aus zumindest humanistischer und geisteswissenschaftlicher Sicht gesehener, Rückschritt gewesen zu sein. Zumindest wurde das Wort „media aetas“ („Mittelalter“) von italienischen Humanisten im 15. Jh. geprägt, um damit anzuzeigen, dass zwischen Altertum und der daran wieder anknüpfenden Neuzeit eine Zeit von Unwissenheit und Barbarei gelegen hat.18
Besonders der psychologisch erfolgreiche Kunstgriff der Androhung einer ewigen Verdammung und des Fürchtenmachens durch das Phantasieprodukt des Teufels spielt in der mittelalterlichen Denkweise eine zentrale und gesellschaftlich exorbitante Rolle. Da der christliche Glaube zu dieser Zeit nicht mehr wie in urchristlichen Zeiten als Religion von unten angesehen werden kann, sondern als gewissermaßen alternativlose und gottgegebene bzw. gottgewollte universalistische Religion der Mächtigen von oben diktiert wurde, ist der Vorwurf an die Kirche durchaus nicht unberechtigt, durch Religion, vornehmlich mit der Androhung ewiger Höllenstrafen, sich die breite Masse gefügig gemacht zu haben. Die sinnlich sehr konkret geschilderten Höllenängste des an den leibhaftigen Teufel glaubenden mittelalterlichen Menschen peinigten diesen in einer heute kaum mehr nachvollziehbaren Art und Weise. Religion war, daran kann heute kein Zweifel mehr sein, zu einem großen Teil auch psychologisches Machtmittel zur Unterdrückung einfacher Menschen und zum materiellen Wohle einer klerikalen Minderheit. Die Riege der Glücklichen, welche es schaffen, in das Paradies zu kommen, wird dabei bewusst gering gehalten, um die Abhängigkeit zu erhöhen. Gemäß dem Prediger Berthold von Regensburg taugen nur fünf von hundert für das ewige Leben, was er aus der Bibel heraus zu beweisen vermeinte. Um die Heiden zu bekämpfen, bedurfte es somit des Phantasieproduktes des Teufels, denn dieser steckt in diesen. Da es galt, den Teufel auszurotten, der in allen der Kirche missliebigen Menschen steckt, so war jeder Krieg, besonders die Kreuzzüge, aber auch jede Grausamkeit gegen Andersdenkende leicht zu rechtfertigen. Besonders im 13. Jahrhundert nahmen die Ketzerverfolgungen ein perverses Ausmaß an.
Im Zusammenhang mit dem Teufelsaberglauben ist auch der Aberglaube an die Hexen zu sehen, welche mit diesem paktierten und welche man für jegliches Übel wie Hagel, Blitz, Krankheiten usw. verantwortlich machte. Damit wiederum stehen die sogenannten „Gottesurteile“ im Zusammenhang. Da man ganz im Sinne des Theismus glaubte, Gott würde direkt in das Weltgeschehen eingreifen, wurden Verdächtige in einen vorher geweihten Fluss geworfen, mit gebundenen Händen und den Körper mit einem schweren Stein versehen. Ihre Unschuld konnte nun dadurch bewiesen werden, indem sie eben nicht untergingen. So war dieses Procedere bis ins frühe 13. Jahrhundert sowohl ein untrügliches Zeichen für die Allmacht Gottes als auch für die Schuldigkeit des Verdächtigen.
Auch die Voraussetzung für ein freies Forschen oder Philosophieren waren zu dieser Zeit der Vorherrschaft von Kirche und Theologie noch nicht gegeben. Die Philosophie war zur „ancilla theologiae“ degradiert worden. Nur in durch Glaube und Dogmen vorgegebenen Grenzen und unter Berufung auf sanktionierte Autoritäten konnte die Philosophie lediglich als eine Art Steigbügelhalter für den Glauben agieren. So war für Bonaventura (13. Jh.) philosophisches und wissenschaftliches Wissen nur dann von großem Nutzen, wenn es in den umfassenden Horizont des Glaubenswissens integrierbar ist und wenn es die Vereinigung mit Gott, d. h. natürlich nur mit der christlich-theistischen Auffassung, die man von ihm hatte, zum Ziel hat. Wissenschaft und Philosophie hatten sich der Theologie und der Schrift, die als einzige Quelle allen Wissens galt, unterzuordnen. Mittelalterliche Philosophie war somit lange Zeit christliche Philosophie, deren Vertreter fast allesamt Kleriker waren. Dementsprechend waren auch die Grenzen für Wissen vorgegeben, denn immer musste es glaubenskonform sein und zum Heil führen. Dies sind im Wesentlichen immer noch die Leitlinien der Katholischen Kirche.19 Das Monopol auf die absolute Wahrheit zu besitzen, dies beanspruchten für sich ganz allein die Theologen, was sich aus ihren „Gottesbeweisen“ und Dogmen herauslesen lässt. Was aber sind Dogmen als lediglich der Ausdruck des Willens zur Gewissheit? Dabei wird ab einer bestimmten Stelle der Hinterfragung einfach abgebrochen und dogmatisch ein vermeintlich zureichender theologischer Grund postuliert. Die auf übernatürliche Weise offenbarte Wahrheit, die dann von der Kirche verkündet wird, muss von den Gläubigen vorbehaltlos angenommen werden. Versehen mit dem Anschein des Göttlichen und Unfehlbaren werden Dogmen gegen Verbesserungsvorschläge bzw. gegen sich weiter entwickelnde Erkenntnisse immunisiert. Gegen diese Konservierung bestehender Zustände steht der damit unvereinbare Wille zur Aufklärung, dem zufolge prüfbare Theorien zu entwickeln sind, die als Provisorien permanent zu kritisieren sind, um sich der postulierten Wahrheit anzunähern.
Ein wesentliches Agens des Glaubens und die unabdingbare Voraussetzung zur Erlangung des Heils war auch die Zusage zur Vergebung der Sünden. Dies kann und will die Philosophie im Gegensatz zur Theologie nicht aufbieten, schon allein weil sie nicht zwangsläufig von Prämissen wie der von Paulus erfundenen Erbsünde ausgeht und somit auch kein Sündenbewusstsein und eine damit verbundene Erlösungstheorie erzeugt, was ja erst die notwendige Voraussetzung dafür ist, Sünden großzügig und salbungsvoll wieder vergeben zu können. Die Befriedigung dieses Bedürfnisses nach Sündenvergebung konnte also nur durch den rechten Glauben erlangt werden, von dem es allerdings nicht ganz uneigennützig auch seinen Ausgang nahm.
Was das Verhältnis zwischen Philosophie und Theologie angeht, so lässt sich dies auch im Verhältnis von Vernunft und Glaube beschreiben. Nach Wilhelm von Auxerre (gest. 1231) verhält es sich bei Aristoteles so, dass der Beweis (argumentum) die Begründung einer zweifelhaften Sache ist, die den Glauben erzeugt; bei einem Christen hingegen sei der Beweis der Glaube, der die Vernunfteinsicht hervorbringt. Mit dieser nicht unproblematischen Auffassung von „Beweis“ kann allerdings jede Art von Glauben als Ausgangspunkt für eine vermeintliche Wahrheit postuliert werden, und folglich gibt es so viele vermeintliche Wahrheiten wie es Religionen gibt, denn jeder religiöser Glaube ist von seiner Richtigkeit überzeugt. Damit lässt sich alles und das Gegenteil begründen, wenn nur der Glaube, an was auch immer, fest und tief genug ist.
Für Albertus Magnus (1193?–1280) besteht der Hauptunterschied beider Wissenschaften darin, dass die philosophische Gottesschau und der Gottesbegriff das Resultat der menschlichen natürlichen Erkenntnis sind, wohingegen die theologische Schau durch ein gnadenhaft eingegossenes Licht ermöglicht und erst im Jenseits vollendet wird. Hierbei wird allerdings die Existenz Gottes (freilich handelt es sich bei den mittelalterlichen Theologen immer nur um den christlichen Gott) als selbstverständliche Voraussetzung postuliert. Das, was also als evident bewiesen werden soll, wird bereits in der Prämisse vorausgesetzt. Albertus schreibt in seiner Metaphysica XI: „Was zur Theologie gehört, stimmt in den Prinzipien nicht mit dem überein, was zur Philosophie gehört“ (Theologica autem non conveniunt cum philosophicis in principiis), weil es sich auf Offenbarung und Inspiration und nicht auf Vernunft gründet, und deshalb kann ich es im Rahmen der Philosophie nicht erörtern. In diesem Sinne handelt die Theologie „von den höchsten Gegenständen und auf die höchste Weise“, während die Philosophie, die in der Form der Metaphysik auch Weisheit ist, zwar auch die höchsten Gegenstände thematisiert, aber nicht „auf die höchste“, sondern in der durch die menschliche Vernunft bedingten Weise. Theologisches Denken wird somit im Mittelalter in anmaßender und dogmatischer Weise als Geschenk Gottes zu einem göttlichen Denken verklärt, das somit außerhalb der Vernunft und jeglicher Kritik steht und deshalb auch nicht von dieser belangt werden kann.
Auch Thomas von Aquin (1225–1274), der Hauptvertreter des aristotelisch bestimmten Denkens im Spätmittelalter, schließt sich der Auffassung über das Verhältnis von Glaube und Vernunft weitgehend seinem Lehrer Albertus an. Die Philosophie als Metaphysik betrachtet die höchsten Ursachen des Seienden, sofern sie aufgrund des geschaffenen Seins erkennbar sind, die Theologie aber ist durch göttliche Inspiration dazu in den Stand versetzt, diese Ursachen „nach Art der Ursache selbst“ (i. e. göttlich) zu betrachten. Die fragliche Existenz eines (christlichen) Gottes, die es zu beweisen gilt, wird also auch bei ihm nolens volens vorausgesetzt. Die conclusio (der zu folgernde Schluss) wird, wie eben bei Albert dargelegt, somit auch bei ihm bereits in den Prämissen latent vorausgesetzt.20
Der Beginn des sich langsam in die mittelalterliche Geistesgeschichte hineindrängenden und später ab der Renaissance bis heute so erfolgreichen naturphilosophischen Denkens wird durch den Aristotelismus eingeleitet. Mit ihm trat insofern eine Wende mittelalterlicher Philosophie ein, als von nun an mit der experimentellen Methode („scientia experimentalis“) die naturalistische jetzt auch empirische Naturwissenschaft erstmals wieder seit den ionischen Naturphilosophen Berücksichtigung fand. So ist für Albertus beispielsweise der natürliche, bewegte Körper Gegenstand der Naturwissenschaft, und zwar in einem so weit gefassten Sinne, dass auch Wetter-, Gesteins-, Pflanzen- und Tierkunde sowie Abhandlungen über Jugend und Greisenalter, Schlafen und Wachen, Sinn und Sinneswahrnehmung, Gedächtnis und Erinnerung, Vernunft und Erkenntnisinhalt und einiges mehr darunter fielen. Den Aufstieg des empirischen Denkens erkennt man daran, dass bereits in Albertus naturphilosophischem Aristotelismus ein Schluss (conclusio), der zur Sinneswahrnehmung (sensus) in Widerspruch steht, unannehmbar geworden ist. Dies war für das vorausgegangene platonisch dominierte Mittelalter alles andere als eine Selbstverständlichkeit, da hier die Vernunft und die überzeitlichen Ideen die Majorität über die stets als minderwertig betrachtete Sinnenwelt besaßen.
Mit Wilhelm von Ockham (ca. 1300–1350) kommen wir nun zu einem wissenschaftshistorisch äußerst bedeutsamen Mann, mit dem die Wende von der mittelalterlichen hin zu der neuzeitlichen Philosophie und Naturauffassung massiv beschleunigt wurde, brachte er doch das zumindest oberflächlich so erscheinende Konstrukt der Harmonie von Glaube und Wissen bzw. von Theologie und Philosophie zum Einsturz.
Der wesentliche Streitpunkt der mittelalterlichen Theologie und Philosophie war der sogenannte Universalienstreit. Es geht dabei um das bereits seit der klassischen Philosophie vorhandene problematische Verhältnis von Begriff und Wirklichkeit. Sicher will alles Denken Wirklichkeit erfassen, doch da man in Begriffen denkt, ist die Beziehung von Begriff und Wirklichkeit entscheidend. Aristoteles lehnte den platonischen „Ideenhimmel“ ab. Für ihn existieren Gesamtheiten, Klassen, Typen und somit die platonischen „Ideen“ nur in unserem Denken. Dennoch vertritt auch Aristoteles den Standpunkt, es gäbe Prinzipien, die nicht der Erfahrung entstammen. Allerdings bringt er die Empirie zu ihrem Recht, wenn er ähnlich wie später Kant betont, dass zur Überprüfung die Erfahrung als gegebenenfalls widerlegende Instanz herangezogen werden könne. Für das platonisch geprägte frühe Mittelalter hingegen kam den Ideen Platons allein Wirklichkeit zu. Alles Individuelle stellte diesen zufolge ein unvollkommeneres Abbild bzw. eine Individuation der an sich vollkommenen und einzig realen Ideen dar. Das Individuelle und Besondere wird von diesem Allgemeinen gewissermaßen erzeugt und partizipiert an diesem gemäß dem platonischen Teilhabegedanke.
Das Charakteristische jener Zeit war dabei, dass man bestrebt war, den Platonismus mit dem Christentum zu verschmelzen, indem man die Ideen in Gottes Geist versetzte. So stritt man sich beispielsweise darum, ob denn dem Allgemeinen (den universalia), das auch Abälard nur als Begriff gelten lässt, nun in den Dingen selbst Realität zukommt oder ob sie nur in Gottes Geist vorkommen. Für Abälards Konzeptualismus sind Ideen insofern ante res, als sie in Gottes Geist vor ihrer Erschaffung existieren. Für den menschlichen Verstand wiederum sind sie post res, da dieser den Begriffen nur durch Abstraktion habhaft werden kann.